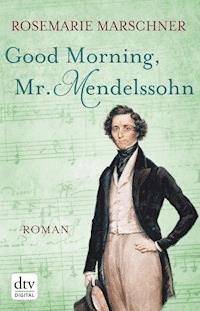6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das private Leben in Zeiten, wo alle Privatheit von außen bedroht ist. Linz im Jahre 1939. Antonia hat ihrem Mann, dem Rechtsanwalt, zum zweiten Mal eine Tochter geschenkt, Elisabeth soll sie heißen. Die Taufe soll eine freudige Familienfeier werden, doch dann gibt Antonias Vater einen Entschluss bekannt, der ihm nicht leicht gefallen sein dürfte. Als Hochschullehrer in Wien fühlt er sich von den neuen Machthabern bedroht. Er will sich mit seiner Frau nach Italien zurückziehen. Antonia ist entsetzt. Die Zukunft wird sie allein meistern müssen, mit zwei Kindern und einem Mann, der als Rechtsanwalt den Nazis kaum ausweichen kann. Wie sich die Frauen durch das Festhalten an der Familie gegen die Vereinnahmung durch die Nazis gewehrt haben, ist nicht immer heroisch, aber allemal spannend zu lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Rosemarie Marschner
Das Jagdhaus
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
ERSTES BUCH
DIE TAUFE
1
Wenn Antonia Bellago in späteren Jahren auf ihr Leben zurückblickte, kam es ihr vor, als habe es, ohne daß sie es damals bemerkt hätte, in ihrem neunundzwanzigsten Lebensjahr eine Zäsur gegeben. Die Schatten von draußen rückten näher und verdunkelten allmählich die Tage, die bisher so licht und sorglos gewesen waren.
»Dieses Kind ist so alt wie der Krieg«, hatte der Pfarrer bei der Taufe gesagt, aus deren Anlaß sich Antonias Familie versammelt hatte. Gerade so viele waren sie, daß jeder von ihnen am Rande des sechseckigen Marmorbeckens Platz fand, in das der Mesner kurz vorher erwärmtes Taufwasser gegossen hatte. Antonia, die junge Mutter, stand neben dem Pfarrer. Sie hielt das Taufkind in den Armen, das in wenigen Augenblicken den Namen Elisabeth erhalten sollte, seit seiner Geburt aber bereits von allen Lilli genannt wurde.
Zur allgemeinen Erleichterung schlummerte Lilli sanft. Nur von Zeit zu Zeit öffnete sie kurz die Augen, seufzte leise und schlief dann sofort wieder ein. Ein Teil der Anwesenden erinnerte sich bei ihrem friedlichen Anblick daran, daß die Taufe von Lillis älterer Schwester sieben Jahre zuvor wesentlich turbulenter verlaufen war. Die kleine Enrica, die damals das gleiche spitzenbesetzte Taufkleid trug wie heute Lilli, hatte während der ganzen Zeremonie ohne Unterbrechung durchdringend gebrüllt. Erst als alles vorbei war, verstummte sie und war von da an den ganzen Tag der liebenswürdigste Säugling, den man sich nur vorstellen konnte. Ihr lautstarker Auftritt diente seither in Pfarrkreisen dazu, besorgte Eltern zu beruhigen, wenn sie fürchteten, ihr Kind könnte durch sein Geschrei das Taufritual stören. »Da gab es einmal eine Enrica«, erklärte man ihnen dann mit einer Stimme, als spräche man von der mittelalterlichen Pest. »Die hätten Sie hören sollen!« Heute allerdings stand Enrica im weißen Kleidchen zwischen ihren Eltern, seltsam gerührt, als wäre sie selbst eine kleine Mutter. Alle Anwesenden hatten gehört, was sie mit leuchtenden Augen geflüstert hatte, als der weißgewandete Geistliche im Gegenlicht die Kirche betrat: »Da kommt ja der liebe Gott!«
Auch der Pfarrer hatte es vernommen und daraufhin selbstgefällig gelächelt. Sein Familienname war »Herrn«, und jedesmal, wenn die Gläubigen das Lied ›Lobet den Herrn‹ anstimmten, lächelte er so wie eben, als würde ihm eine Ehrenbezeigung erbracht, auf die er ein Anrecht hatte. Die Gemeinde schmunzelte darüber, wenn auch zunehmend verdrossen, da es kaum noch eine Messe des Pfarrers gab, bei der er das Lied nicht singen ließ.
Neben Antonia stand ihr Mann Ferdinand Bellago, mit dem sie seit acht Jahren verheiratet war. Daß das zweite Kind wieder ein Mädchen war, spielte weder für Ferdinand noch für die übrige Familie eine Rolle, obwohl die gegenwärtige öffentliche Meinung Söhne eindeutig favorisierte. Auf diesbezügliche Bemerkungen antwortete Ferdinand: »Hauptsache gesund!«, was zwar die meisten Väter in einem solchen Fall sinngemäß zu sagen pflegten, doch Ferdinand Bellago verspürte tatsächlich keinerlei Bedauern. Während er nun am Taufbecken stand und den Arm um die Schultern seiner Frau legte, dachte er daran, daß sie elf Jahre jünger war als er, doch beide hatten den Altersunterschied nie wirklich wahrgenommen. Und auch in ihrem Bekanntenkreis bildete er kein Thema. Ferdinand und Antonia Bellago galten einfach nur als schönes, angenehmes Paar, das man gern bei sich zu Hause empfing – besonders Antonia, denn sie war lebhaft und nahm regen Anteil an den Tischgesprächen.
Als der Pfarrer nun mit einem Kopfnicken ans Taufbecken trat, übergab Antonia den Täufling an den Paten Thomas Harlander – Juniorpartner in Ferdinand Bellagos Anwaltsbüro. Die Bellagos hatten ihm die Patenschaft angetragen, um ihn noch enger an die Familie und die Kanzlei zu binden. Er nahm es mit Humor und bemerkte nur ganz nebenbei, daß er sich für eine derartige Würde eigentlich noch nicht gesetzt genug fühle.
Fünf weitere Personen nahmen an der Taufe teil: Ferdinands und Antonias Eltern sowie Antonias jüngerer Bruder Peter, der noch aufs Gymnasium ging. Ihre nächsten Angehörigen standen hier vereint beieinander, dachte Antonia, während ihr Blick von einem zum anderen wanderte. Eigentlich hatten die beiden Familien nicht viel miteinander gemein, doch in den zwei kleinen Mädchen verband sich ihr unterschiedliches Erbe.
»Dieses Kind ist so alt wie der Krieg«, wiederholte der Pfarrer, und wie beim ersten Mal zuckte Antonia zusammen. Es hätte ein so schönes Fest werden können, dachte sie, wenn der Pfarrer es nicht mit diesem einen Satz zunichte gemacht hätte, der daran erinnerte, daß es außerhalb dieser Familie noch eine andere Welt gab, die ihr Glücksgefühl über die Ankunft eines neuen kleinen Menschenwesens nicht teilen konnte. Panzer, die ein schwaches Land überrollten. Flugzeuge, die ihre tödliche Fracht abwarfen. Gewehrkolben, die Türen einschlugen. Gewalt gegenüber hilflosen Menschen, kaum vorstellbar für jene, die noch im Frieden lebten und sich wünschten, daß es ewig so bliebe.
Dieses Kind ist so alt wie der Krieg … Meine arme kleine Lilli, dachte Antonia: Elisabeth Bellago, gerade sechzehn Tage alt, so zart noch, so verletzlich, daß man beim Baden Angst hatte, dem winzigen Körper ein Leid anzutun. Ein ganz junges Leben, ohne jede Schuld. Niemand hatte das Recht, es mit dem Krieg in Verbindung zu bringen, diesem Urverbrechen der Menschheit, das alle anderen Schandtaten weit übertraf.
Wie es in der Familie Bellago üblich war, hatte Lillis Geburt zu Hause stattgefunden, da man das Risiko nicht eingehen wollte, daß in der Klinik die Gebärende den Kreißsaal mit anderen Frauen zu teilen hätte – eine Nähe, der man sie nicht aussetzen wollte. Die Bellagos waren im allgemeinen auf Distanz bedacht, auch wenn sie mindestens einmal die Woche Gäste hatten und noch häufiger selbst eingeladen waren. Trotzdem wagte niemand, Franz Josef Bellago seinen Freund zu nennen, und ebensowenig konnte sich eine der Damen der Gesellschaft damit brüsten, daß die alte Frau Doktor ihr jemals ein Geheimnis anvertraut, sie um Rat gebeten oder sich auch nur einen Scherz über die eigene Familie erlaubt hätte. Trocken seien sie, die älteren Bellagos, hieß es, staubtrocken, und bevor seine Heirat ihn offener gemacht hatte, habe es so ausgesehen, als ob auch der Sohn auf dem besten Weg wäre, ihrem Beispiel zu folgen.
Im Gegensatz zu ihren Schwiegereltern galt Antonia Bellago als heiter und aufgeschlossen, so daß sie nicht in die provinzielle Enge der kleinen Stadt zu passen schien, in die ihre Heirat sie verschlagen hatte. Sie war stets freundlich, und wenn man sie nach ihrer persönlichen Meinung fragte, antwortete sie offen und mit Gefühl. Sie war ein Gewinn für diese Familie, dessen war man sich sicher. Eine Rose zwischen lauter Dornen, hatte ein heimlicher Verehrer sie einmal genannt, und wer sich der Bellago-Villa mit ihren hohen Zaunspitzen und der einschüchternden Hausfront näherte, atmete auf, wenn ihm die junge Frau lächelnd entgegenkam und ihn willkommen hieß.
Die Geburt war ohne Komplikationen verlaufen. Antonia erholte sich schnell. Ihre Schwiegermutter achtete darauf, daß der Schlaf der jungen Mutter durch das Neugeborene nicht gestört wurde. Lillis Kinderzimmer lag mehrere Türen vom Schlafgemach ihrer Eltern entfernt. Es war das Reich der Kinderfrau Fanni, die schon Enrica aufgezogen hatte und der alle blind vertrauten, wie die vermögenden Stadtleute schon seit Generationen ihre Kinder in die Obhut der jungen Bauerntöchter aus dem Umland gaben. Bereits sieben Jahre lebte Fanni im Haus, fast so lang wie Antonia, und sie hatte sich noch nie von irgend jemandem hier einschüchtern lassen.
»Geh’n S’, Herr Doktor!« pflegte sie zu antworten, wenn Franz Josef Bellago sie zurechtwies oder sie auf halb spöttische, halb streitbare Art aus der Reserve zu locken suchte. »Geh’n S’, Herr Doktor!« – Manchmal kampfbereit mit finster gerunzelten Brauen, manchmal tadelnd, wie niemand sonst es gewagt hätte, doch zuweilen auch wieder verschämt lächelnd, als wäre der alte Herr noch ein junger Mann, der ihr gerade ein Kompliment gemacht hatte. »Geh’n S’, Herr Doktor!« Dann drehte er sich scheinbar verärgert um und ließ sie stehen, ohne daß ein Schmunzeln sein heimliches Wohlbehagen verraten hätte.
Ja, staubtrocken waren sie, die alten Bellagos, aber es ließ sich mit ihnen auskommen. Das fand Fanni und das fand auch Antonia. Von Anfang an hatte sie sich in der Familie ihres Mannes wohl gefühlt, die so ganz anders war als ihre eigene. »Geh’n S’, Herr Doktor!« tadelte auch sie manchmal ihren Schwiegervater und imitierte Fannis Lächeln und ihre kokette Schulterdrehung. Dann kam es vor, daß er doch ein wenig schmunzelte und sich insgeheim eingestand, daß sein Sohn – dieser lahme Knochen, der so lange gebraucht hatte, bis er endlich die Richtige fand! – eine akzeptable Wahl getroffen hatte.
Eine angenehme Zeit hatte man bisher miteinander verbracht. Das kleine Mädchen im Taufkleid aus Brüsseler Spitze wurde in eine Familie hineingeboren, die Zuneigung und Fürsorge versprach. Gute Wünsche, liebevolle, sollten ihm bei der Taufe mitgegeben werden – nicht der Hinweis darauf, daß dieses verletzliche junge Leben gerade so alt war wie ein jenseits der Grenzen ausgebrochener Krieg.
2
Der weitere Verlauf des Tages wurde vom Naturell Franz Josef Bellagos diktiert, der Völlerei haßte und es verabscheute, seinen asketischen Körper nach einem üppigen Mittagsmahl schon am Nachmittag wieder mit Kaffee und Torte zu traktieren, womit man seiner Auffassung nach dem Gehirn Sauerstoff entzog und die inneren Organe folterte. Ganz zu schweigen von der Verfettung, die sich bei mehrmaliger Wiederholung der kulinarischen Ausschweifung unweigerlich einstellen würde und die der alte Herr verachtete. »Adel hält auf Taille; nur der Pöbel frißt sich satt«, pflegte er sogar in Gesellschaft zu verkünden, was dazu führte, daß seinen Tischgenossen der Appetit verging und die Gastgeberinnen ihn im stillen verfluchten. Seine Frau war die einzige, die ihm einmal widersprach – dies jedoch auch nur in der Abgeschiedenheit des ehelichen Schlafzimmers, wo niemand Zeuge ihrer Auflehnung werden konnte. »Von sattfressen kann keine Rede sein«, wandte sie ein. »Die du meinst, sind schon froh, wenn sie und ihre Familien nicht verhungern müssen!« Dabei wandte sie das Gesicht ab, um ihrem Protest die Schärfe zu nehmen. Trotzdem folgte ihren Worten eine unerwartete Stille. »Von diesen Menschen spreche ich nicht, wenn ich Pöbel sage«, antwortete ihr Mann schließlich ungewohnt leise, obwohl er es sonst ablehnte, eigene Behauptungen zu rechtfertigen. »Der Pöbel, den ich meine, frißt sich sehr wohl satt – in jeder Hinsicht und immer ungenierter. Ich frage mich, ob er je den Hals vollbekommen wird.« Da atmete sie erleichtert auf und schlief unverzüglich ein.
In Gesellschaft gab er solche Erklärungen niemals ab, und nur seine unangefochtene Position im Leben der Stadt verhinderte, daß man aufhörte, ihn einzuladen. Manchem schien es dabei, als wollte Franz Josef Bellago mit seinen Bemerkungen austesten, ob man noch immer Angst vor ihm hatte wie schon in seinen besten Jahren, und das, obwohl er nie ein öffentliches Amt bekleidet hatte.
»Angeborene Autorität« nannte er seine Fähigkeit, andere zu überrennen. Schon als sein Sohn Ferdinand sechs Jahre alt war, verwirrte er ihn an seinem ersten Schultag mit der Empfehlung, er solle sich nicht so sehr um Beliebtheit bemühen, ein gewisses Maß an Einschüchterung sei viel effizienter. »Sie müssen ja nicht gleich Angst vor dir haben«, riet er seinem feinfühligen kleinen Sohn, der bereits anfing, an sich selbst zu zweifeln. »Aber zumindest auf Respekt mußt du bestehen, sonst tanzen sie dir bald auf der Nase herum.«
Er erfuhr nie, welchen inneren Kampf er damit bei seinem Sohn auslöste, der im Turnunterricht Schwierigkeiten hatte, das Seil hochzuklettern oder auf dem Reck einen schwungvollen Felgaufschwung zustande zu bringen. Nur seine erstklassigen Noten retteten ihn vor der Verachtung seiner Mitschüler, die ihm seine Position als Klassenprimus nur deshalb nicht neideten, weil sie ihn auf dem höher geachteten sportlichen Feld übertrumpften. So lernte das nachdenkliche Kind frühzeitig und erschreckend bewußt eines der versteckten Gesetze erfolgreichen Wettbewerbs: andere ruhig ihr Gesicht wahren zu lassen und dafür auf dem eigenen Gebiet zu siegen, ohne durch Neid behindert zu werden.
Vielleicht hätte seinem Vater als geborenem Anwalt diese machiavellistische Schlußfolgerung sogar gefallen. Doch er ahnte nichts vom Zwiespalt seines Sohnes. Über die schlechte Zensur im Fach »Leibesübungen« ging er mit einem Achselzucken hinweg. »Hauptsache Köpfchen!« pflegte er jedesmal zu sagen, wenn ihm Ferdinand errötend das Zeugnis vorlegte. Er ahnte nicht, daß der Junge – Schlauheit hin oder her – jede Eins in Latein oder Mathematik freudestrahlend hergegeben hätte, wenn er dafür ein einziges Mal beim Völkerballspiel als erster gewählt worden wäre.
So ging man also anstelle des Nachmittagskaffees spazieren – zu sechst. Die Kinder blieben zu Hause, und der Pate hatte sich bereits auf den Weg nach Wien gemacht, wo er – wie Antonia wußte – eine kleine Freundin hatte, die er niemandem vorstellte, obwohl man sich erzählte, sie sei eine tüchtige Studentin und außerordentlich hübsch. »Eine heimliche Liebschaft«, sagte Antonia lächelnd und ein wenig herausfordernd, als er sich verabschiedete. »Wie romantisch!« Da lächelte er ebenfalls, äußerte aber – wie immer – dazu kein Wort.
Es war ein angenehmer Spätsommertag. Die Blätter der Kastanien fingen an, sich zu verfärben. Manchmal segelte eines langsam zu Boden und trieb im sanften Wind über den Gehsteig. Für Antonia war es das erste Mal seit der Geburt, daß sie wieder spazierenging. Die ungewohnte frische Luft und die Wärme der Sonnenstrahlen berauschten sie fast und erfüllten sie mit einem Glücksempfinden, das durch Sonne und Wind in ihr gleichsam aufgerührt wurde. Sie hatte das Gefühl, einen einzigartigen, vollkommenen Moment zu erleben, den sie in ihrer Erinnerung für immer festhalten wollte: Sie hatte ein Kind geboren. Es war gesund, und sie war es ebenfalls. Ihr Mann ging an ihrer Seite und legte den Arm um ihre Schultern, wie um sie zu beschützen. Er liebte sie, dessen war sie sicher, und sie liebte ihn desgleichen, obwohl er ganz anders war als sie – oder vielleicht sogar deswegen. Ihre Eltern waren da und auch die seinen. Sie redeten miteinander, lachten manchmal, blieben stehen und gingen dann wieder weiter. Und das alles im hellen Sonnenlicht, das durch die Blätter der Kastanien hindurchdrang und den Gehsteig mit leuchtenden, beweglichen Kringeln betupfte! Welch ein Friede, dachte Antonia. Welch ein Friede.
3
Als sie von ihrem Spaziergang zurückkehrten, kam es Antonia jedoch auf einmal so vor, als würden ihre Eltern immer unruhiger. Sie tauschten fragende Blicke, schüttelten dann wieder den Kopf und flüsterten miteinander, als gelte es, eine unangenehme Verpflichtung endlich hinter sich zu bringen.
Sogar Franz Josef Bellago fiel die gespannte Stimmung auf, in der sich seine Gäste befanden. »Habt ihr etwas?« fragte er, direkt wie immer. Er traute den Bethanys nicht über den Weg. Für seinen Geschmack waren sie zu unkonventionell. Aber so mußte ein Hochschullehrer aus dem roten Wien vielleicht sein, in dessen Haus sogar ein Doktor Freud zu Gast gewesen war, der bekanntlich das menschliche Streben auf gewisse intime Regungen zurückführte, über die Franz Josef Bellago nicht zu diskutieren pflegte.
Wieder schauten sich die Bethanys fragend an. Diesmal aber nickten sie. »Allerdings«, räumte Johann Bethany ein. »Wir müssen mit euch reden.«
Franz Josef Bellago starrte ihn mißtrauisch an. »Das verspricht ja nichts Gutes«, murmelte er und wies mit einer einladenden Geste den Weg in den Salon.
»Darf ich dabeisein?« fragte Peter, Antonias Bruder, der, Enrica im Schlepptau, herbeigelaufen war, kaum hatten die Älteren das Haus betreten.
Seine Mutter schüttelte den Kopf. »Lieber nicht«, wimmelte sie ihn ab. »Wir rufen dich später.«
Peters Gesicht war blaß. Antonia spürte seine Anspannung. »Aber es geht doch auch um mich!« rief er. Seine innere Not stand ihm im Gesicht geschrieben. Doch seine Eltern blieben hart. »Spiel mit Enrica!« sagte sein Vater, wobei er seinen Sohn nicht anschaute, vielleicht um den ängstlichen Gesichtsausdruck nicht wahrnehmen zu müssen, mit dem der Junge zu ihm aufblickte.
Die Tür zum Salon wurde geschlossen. Man setzte sich um den schweren Holztisch, der Antonia bei ihrem ersten Besuch an die Tafel einer Ritterburg erinnert hatte. Obwohl sich alle bemühten, gleichmütig zu erscheinen, übertrug sich die Unruhe der Bethanys auch auf die anderen.
»Komm am besten gleich zur Sache!« forderte Franz Josef Bellago seinen Gegenschwieger auf.
Dieser nickte gehorsam. »In Ordnung, ich mache es kurz«, antwortete er. »Ich komme mit dem neuen Regime nicht zurecht und habe deshalb Schwierigkeiten an der Universität. Und außerdem leide ich an Asthma.«
Franz Josef Bellago starrte ihn fragend an. »Und?« fragte er. »Mir gefallen die neuen Herren auch nicht, und manchmal rumpelt mein Herz.«
Johann Bethany atmete tief ein. Das Ausatmen bereitete ihm einige Schwierigkeiten. »Es geht nicht um gefallen oder nicht gefallen«, entgegnete er. »Ich fürchte, wir sind in Gefahr. Mit einem Wort: Wir müssen fort!«
»Fort wohin?«
Nun mischte sich auch Antonias Mutter in das Gespräch ein. »In meine Heimat«, erklärte sie in fast flehendem Ton. »Nach Italien. Dort soll mein Mann erst einmal seine Krankheit auskurieren. Danach hat sich hier vielleicht schon vieles normalisiert, so daß wir wieder zurückkönnen.«
Antonia schien es, als würde es plötzlich dunkel im Zimmer. »Das könnt ihr doch nicht tun!« rief sie erschrocken. Gerade war sie noch so glücklich gewesen und hatte geglaubt, ihr Leben und das ihrer beiden Familien wäre vollkommen. Und nun saß ihr Vater vor ihr, wollte fort und rang nach Atem, aus Angst, zu ersticken.
Laura Bethany legte besänftigend eine Hand auf die ihres Mannes, die nun zitterte, als er merkte, auf wie wenig Verständnis seine Ankündigung bei den Bellagos stieß. »Langsam, Gianni, langsam«, murmelte Laura Bethany, wobei sie wie immer, wenn sie Angst hatte, das A seines Kosenamens nach Art ihrer Muttersprache in die Länge zog. »Erkläre doch erst alles.«
Johann Bethany wartete darauf, daß jemand ihn ermunterte. Doch alle schwiegen. Sie starrten ihn an, daß er meinte, nur noch Augen zu sehen wie so oft in letzter Zeit, wenn er in seinen Vorlesungen wagte, eine Meinung zu vertreten, die sich von der staatlich relevanten unterschied. Und staatlich relevant war auf einmal fast alles, zumindest kam es ihm so vor: was an öffentlichen Plätzen gesagt wurde und was im kleinen Kreis; wie die Kinder spielten, was sie sangen und wofür sie sich begeisterten; wie man seine Freizeit verbrachte und was man las; welche Musik man bevorzugte und wie man sich kleidete; was man aß und trank und mit wem man befreundet war. Fehlte nur noch, daß die Schnüffler der Partei sogar in die Schlafzimmer schlichen, um sicherzustellen, daß auch hier das ungeschriebene Gesetz der Partei beachtet wurde: Alles für ihn, den Führer. Einer für alle, alle für einen. Keiner mehr für sich selbst. Individualismus war gefährlich für den gesunden Volkskörper. Es war nicht nötig und nicht erwünscht, sich eigene Gedanken zu machen. Sich zu fragen, ob das alles wirklich so vollkommen war und so moralisch, wie man behauptete. War man tatsächlich ein Volk ohne Raum? War es wirklich unumgänglich, in andere Länder einzudringen, um den eigenen Machtbereich zu erweitern? War es wirklich Recht und Pflicht des Starken, den Schwächeren zu unterwerfen? Und wer entschied, wer der Starke war, der Bessere, der Herrenmensch, dem die Knute gebührte, unter die sich die anderen zu ducken hatten?
»Wie ihr wißt, bin ich Historiker«, sagte Johann Bethany leise. »Alte Geschichte – die Geschichte auch der Demokratie, die ich immer bewundert habe. Ein Ideal vielleicht nur, aber wert, daß man ihm nachstrebt. Soll ich meinen Studenten auf einmal das Gegenteil erzählen? Soll ich meine Meinung verleugnen, nur weil in der letzten Reihe einer sitzt, der alles mitschreibt, was ich sage, und der den Saal noch vor Ende der Vorlesung verläßt?«
»Ein bißchen Klugheit und Vorsicht können nie schaden«, meinte Franz Josef Bellago in dem herablassenden Tonfall, den er sonst für uneinsichtige Prozeßgegner reservierte. »Wir können alle nicht einfach herausplaudern, was uns gerade in den Sinn kommt.«
Johann Bethany atmete tief ein, um sich zu beruhigen. Seine Frau beobachtete ihn besorgt. »Dein Asthma, Gianni!« mahnte sie leise. Doch er schüttelte den Kopf.
»Es geht um Redlichkeit, alter Freund!« Er drehte sich um, ging zum Fenster und schaute hinaus. »Ich kann meine Seele nicht verkaufen.« Er wandte sich wieder um. »Das sind Verbrecher, Franz Josef!« sagte er eindringlich. »Glaubt nicht, daß ihr sie in den Griff bekommen werdet. Glaubt nicht, daß die Macht sie besänftigen wird. Das sind Landsknechte, die Blut gerochen haben. Sie werden niemals aufhören, nach vorne zu stürmen, nicht einmal, wenn sie sich schon den ganzen Erdball untertan gemacht hätten.« Er setzte sich neben seine Frau und ließ zu, daß sie seine Hand mit ihren beiden umschloß. »Unsere Zeit ist krank, darum sind auch die Menschen krank«, murmelte er. »Seit dem Weltkrieg haben sie sich nicht mehr erholt. Auch was sie tun, ist krank. Sie suchen erneut den Krieg. Den Tod. Aber ich kann dem nicht zustimmen. Ich kann nicht zusehen, wie sie in ihr Unglück rennen, und dazu auch noch schweigen – auch nicht aus Klugheit oder Vorsicht!«
Dann berichtete er, wie sich sein Leben in den beiden letzten Jahren verändert hatte. »Alles wird enger und immer enger!« murmelte er. »Haß und Feindschaft, wo früher Arbeitsfreude und Ehrgeiz regierten, Humor und ein wenig Leichtsinn.« Er entzog seiner Frau die Hand und wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. »Erst ging es nur gegen die Juden«, sagte er leise. »Dann gegen die, die sie verteidigten, und jetzt gegen alle, die eine andere Meinung haben als die Herrschaften in Berlin. Man darf nicht mehr äußern, was man denkt, und wenn man es doch tut, kostet es gestern die Freunde, heute die Karriere und morgen das Leben.« Er wandte sein Gesicht Franz Josef Bellago zu, der älter war als er und so viel lebenstüchtiger. »Versteh mich bitte, alter Freund«, bat er. »Ich muß fort. Wenn ich bleibe, gefährde ich nicht nur mich selbst, sondern auch meine Frau und unseren Sohn. Mit jeder Vorlesung, die ich halte, ziehen sich unsere Freunde weiter von uns zurück, schleichen unsere Feinde näher. Erst hat man mich verspottet, dann verachtet, und jetzt bin ich nur noch ein Ärgernis, das man loswerden möchte. Wenn ich nicht gehe, wird man mich irgendwann als Gefahr betrachten und schließlich als Feind. Ich möchte nicht in Dachau enden, Franz Josef, auch wenn ich dort einer Menge guter Bekannter begegnen würde, die vor ein paar Jahren noch als Elite gefeiert wurden und jetzt nur noch als Abschaum gelten, der weggesperrt werden muß oder gar ausgemerzt.«
Johann Bethany hielt verstört inne. Er wartete auf Zuspruch. Doch alle schwiegen. Als die Stille unerträglich wurde, stand Antonia auf und öffnete ein Fenster. Ein warmer, frischer Luftzug wehte ins Zimmer und bewegte die Gardinen.
»Mein Mann ist nicht mehr so gesund wie früher«, mischte sich Laura Bethany wieder ins Gespräch. »Seine Differenzen mit den Kollegen und den Studenten haben ihm mehr zugesetzt, als man ihm ansieht. Und wie gesagt: er hat Asthma.«
Johann Bethany hob beschwichtigend die Hand, um seine Frau am Weiterreden zu hindern. Doch sie fing die Hand ab und legte sie ihm in den Schoß. Es war eine Bewegung, die Antonia vertraut war. Immer wieder berührten ihre Eltern einander. Kaum eine Bemerkung, die nicht auch körperlichen Ausdruck fand – ganz anders als bei den Bellagos, die stets voneinander Abstand hielten. Nie streichelte einer die Hand oder Wange des anderen. Nie schienen sie sich zu umarmen. Kaum, daß sie einander zulächelten. Sie redeten über Dinge, die zu tun waren, über Verabredungen, Erledigungen und Bekannte. Manchmal tadelten sie einander, doch auch das, ohne sich zu nahe zu treten. Als Ehepaar bildeten sie nach außen hin eine Einheit, doch innerhalb dieser Einheit hielten sie Distanz.
»Asthma«, wiederholte Laura Bethany. »Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr er manchmal leidet.« Dann erklärte sie, daß sie schon vor Monaten den Plan gefaßt hatten, das Land zu verlassen und nach Italien zu ziehen, Lauras Heimat, wo sie am Strand von Viareggio noch das Haus ihrer Großeltern besaß. »Wir haben alles genau geregelt«, berichtete sie. »Johann hat um vorzeitige Pensionierung ersucht, aus gesundheitlichen Gründen, was man ihm umgehend zugestanden hat. Unsere Fahrt nach Italien gilt offiziell als Kuraufenthalt. Man wird verstehen, daß gegen sein Leiden nur das warme Klima hilft. Er hat mit mehreren Kollegen darüber gesprochen. Sie haben nicht daran gezweifelt, daß er zurückkommen will, sobald es ihm besser geht. Das ist wichtig für uns, damit es keine Schwierigkeiten bei der Auszahlung der Pension gibt. Sogar unsere Wohnung werden wir behalten. Die Miete ist ohnedies sehr niedrig. Mieterschutz und so. Ihr wißt ja, wie das in Wien gehandhabt wird.« Sie wandte sich Antonia zu. »Ich möchte dich deshalb bitten, bambina, alle paar Wochen nach der Wohnung zu sehen. Vielleicht habt ihr ja auch Spaß daran, sie hin und wieder als Quartier in der Hauptstadt zu nutzen.« Sie lächelte.
Franz Josef Bellago lehnte sich zurück und faltete die Hände im Schoß. »Dann ist das ja wohl bereits beschlossene Sache«, stellte er fest. »Ich wünschte, ihr hättet früher mit mir darüber gesprochen. Vielleicht hätten wir eine andere Lösung gefunden.« Er machte eine Pause. »Eine bessere Lösung«, fügte er hinzu.
Antonia merkte, daß ihre Hände zitterten. »Wann kommt ihr wieder?« fragte sie bedrückt. Am liebsten hätte sie geweint.
»Wenn dieser sogenannte Blitzkrieg zu Ende ist und wirklich nur ein Blitzkrieg bleibt«, antwortete ihr Vater. »Womöglich aber auch nie mehr.«
»Aber warum das alles so plötzlich?« erkundigte sich Hella Bellago gereizt. »Es eilt doch nicht. Das Haus in Italien läuft euch nicht davon.«
Laura Bethany zuckte die Achseln. »Das Haus nicht«, murmelte sie bitter. »Doch ab nächstem Mittwoch soll die Benutzung privater Kraftfahrzeuge verboten werden. Wir möchten unseren Wagen jedoch auf jeden Fall mitnehmen.«
Franz Josef Bellago schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Eine Verordnung aus Berlin!« schnaubte er verächtlich. »Bis die bei uns gegriffen hat, hat das noch lange Zeit. Wir kennen das doch. Außerdem gibt es für alles eine Ausnahmegenehmigung.«
»Nicht für mich.« Johann Bethany war blaß und müde. Noch nie hatte ihn Antonia so erschöpft gesehen. Auch ihre Mutter schien von Sorge beherrscht. Es kam Antonia so vor, als wären ihre Eltern, die ihr bisher so sorglos und lebenslustig erschienen waren, urplötzlich alt geworden.
In diesem Augenblick ließ ein heftiger Luftzug von der Tür her die Gardinen emporflattern wie unstete Vögel und drückte sie dann an die Fensterscheiben.
Alle drehten sich um. Peter stand in der Tür, weiß wie die Wand. Er hatte es wohl nicht mehr ertragen, mit seiner kleinen Kusine »Mensch ärgere dich nicht« zu spielen, während im Salon die Erwachsenen über sein Schicksal entschieden.
»Habt ihr schon über mich gesprochen?« fragte er besorgt.
Antonia sah ihn plötzlich mit ganz anderen Augen als bisher. Das hier war nicht mehr der ungezwungene blonde Junge, der mit seinem Charme alle Menschen für sich einnahm. Einer, dem alles leichtfiel, dem alles zuflog. Einer, der sich nicht bemühen mußte, sondern nur zuzugreifen brauchte. Ein Glückskind von Geburt an. »Fortunatus« hatte ihn sein Vater manchmal im Spaß genannt. Der Glückliche. Diesmal aber war das Glück nicht auf Peters Seite, dachte Antonia und blickte hinüber zu ihrer Mutter, als trüge diese die heimliche Schuld daran.
Peter stand noch immer in der Tür und wartete auf eine Antwort. Peter Bethany, zwölf Jahre alt, ein Nachzügler in der Familie, zu spät zur Welt gekommen, um die Hoffnung seiner Mutter auf eine Stube voller Kinder noch zu nähren. Fast wie Hohn war es ihr erschienen, als sie merkte, daß sie mit vierzig Jahren noch einmal schwanger geworden war. »Ein zweites Einzelkind«, murrte sie, bekreuzigte sich aber gleich danach, weil es Sünde war, mit dem Schicksal zu hadern. Ein Kind war ein Geschenk des Himmels und mußte zu jeder Zeit freudig begrüßt werden. Nichts konnte wichtiger sein. Noch nach Jahren wurde Laura Bethany manchmal vom schlechten Gewissen gepackt – vor allem in den frühen Morgenstunden, mitten im Aufwachen, wenn die gedachten und die gelebten Sünden ihr wahres Gesicht zeigen. Dann hätte sie ihren Sohn am liebsten auf der Stelle um Verzeihung gebeten dafür, daß sie ihn vor seiner Geburt ein paar Augenblicke lang nicht willkommen geheißen hatte, und sie schwor sich, daß sie diese Sünde tausendfach gutmachen würde, indem sie ihm alle Liebe schenkte, die ein Kind von seiner Mutter nur erwarten konnte.
»Er will nicht mit«, erklärte Laura Bethany mit leiser Stimme. »Er will nicht in einem anderen Land mit einer anderen Sprache leben und zur Schule gehen. Dabei habe ich mich immer bemüht, ihm die italienische Sprache nahezubringen. Bei Antonia hatte ich Erfolg, aber Peter hat sich nie dafür interessiert. Hier in Österreich will er leben, hier fühlt er sich wohl. Bei keinem seiner Besuche in Viareggio konnte er sich mit seinen Cousins und Cousinen wirklich anfreunden. Er sagt, er finde die Mädchen unberechenbar und die Jungen angeberisch. Die Zuwendung der Verwandtschaft beenge ihn, und die Sommer seien ihm viel zu heiß.« Mit einer resignierten Gebärde hob Laura Bethany die Arme. »Dabei ist er doch zur Hälfte Italiener!«
Franz Josef Bellagos Gesicht hatte sich verdüstert. Die Stirn in tausend Falten, starrte er vor sich hin. »Und was bedeutet das?« fragte er mit harter Stimme.
Johann Bethany errötete. »Ich möchte euch bitten, meinen Sohn bei euch aufzunehmen«, sagte er beklommen. »Zumindest vorläufig.« Alle sahen, wie er um Atem rang. Er wußte, daß er eine Bombe zum Platzen gebracht hatte.
Niemand sagte etwas. So still war es im Raum, daß man das Ticken der Uhr auf dem Kamin hörte und einmal sogar das leise Knacken des Parketts.
Franz Josef Bellago wandte sich zu Peter um. Die ganze Zeit, während er sprach, schaute er den Jungen an. Der einsamste und zugleich der tapferste kleine Mensch, den sie je gesehen hatte, dachte Antonia.
»Wenn ihr tot wärt«, sagte Franz Josef Bellago, »wäre es eine Selbstverständlichkeit, daß wir uns um den Jungen kümmern. Aber so? Wo bleibt eure elterliche Verantwortung? Und habt ihr auch an uns gedacht? Es ist nicht ungefährlich, sich in diesen Zeiten ein Kind ins Haus zu holen, das die Verhältnisse in der Familie nicht kennt. Die neuen Herren in Berlin wissen genau, wie man in Familien eindringt und sich Informationen verschafft.« Er wies mit dem Kinn auf Peter wie ein unerbittlicher Lehrer. »Wie war das bisher bei euch, mein Junge: in der Schule und beim Jungvolk? Hat man euch gefragt, wie es zu Hause abläuft? Was die Eltern über die Regierung sagen? Ob sie zufrieden sind oder ob sie sich beschweren?«
Peter hielt seinem Blick stand. »Natürlich haben sie gefragt, Onkel«, antwortete er mit heiserer Stimme. »Aber vergiß bitte nicht, daß ich einen Vater habe, der ihnen nicht genehm ist. Ich weiß, was man sagen darf und was nicht.«
Doktor Bellago starrte ihn forschend an mit diesem für ihn typischen Raubtierblick, der vor Gericht so manchen erstarren ließ. »Gut!« brummte er dann. »Es scheint, du hast verstanden, worum es geht.«
Laura Bethany fing an zu weinen. »Kann er bleiben?« fragte sie flehentlich. Erst jetzt sah man ihr ihre Verzweiflung an.
Franz Josef Bellago musterte sie wie eine Fremde. »Glaubt nicht, daß ich billige, was ihr tut«, antwortete er. »Aber der Junge soll nicht für eure Feigheit büßen.« Er erhob sich und ging zur Tür. Vor Peter hielt er inne. Mit einer kurzen, fast widerwilligen Bewegung tätschelte er ihn am Arm. »Du kannst hierbleiben, wenn es denn sein muß.« Damit verließ er den Raum.
Peter stand noch immer wie erstarrt an der Tür. Antonia lief zu ihm hin und umarmte ihn. »Wir waren alle ein wenig überrumpelt«, gestand sie. »Aber ich freue mich, daß wir wieder unter einem Dach leben werden.« Sie versuchte ein tröstendes Lächeln. »Wir werden eine gute Zeit miteinander haben, und vielleicht überlegen es sich Mama und Papa und kommen ja bald wieder zurück. Immerhin haben sie die Wohnung in Wien nicht gekündigt.«
Peter gab keine Antwort, aber er ließ sich von ihr auf die Wange küssen. Als ihn seine Eltern ebenfalls umarmen wollten, wandte er sich ab.
4
Es war Nacht. Eine milde Septembernacht in einer rauhen Zeit. Ein Krieg in der Ferne, in Polen, so weit weg, daß man seine Auswirkungen noch kaum zu spüren bekam, auch wenn schon das Gerücht die Runde machte, in den nächsten Tagen werde die Regierung Lebensmittel und Seife rationieren. Man werde Bezugsscheine verteilen, die der Normalverbraucher beim Einkauf einlösen könne. Eine vorübergehende Regelung, vier Wochen nur, hieß es beschwichtigend. Die vorherrschende Meinung dazu lautete, das werde man wohl überstehen, wenn nur danach wieder Ruhe einkehre.
Trotzdem schien alles nun anders als bisher. Des Nachts wurden die Städte verdunkelt. Die Fensterläden mußten geschlossen werden, Jalousien heruntergelassen. Wo sie fehlten, bemalte man die Glasscheiben mit schwarzer Farbe. In jedem Haus hatte mindestens eine Handfeuerspritze bereitzustehen, ein Reißhaken, Wassereimer, eine Sandkiste, Schaufeln und eine Axt. Kleine Veränderungen nur, doch sie mehrten sich. Wer fremde Sender abhörte, dem drohte Zuchthaus oder gar die Todesstrafe, weil jedes dort gesendete Wort erstunken und erlogen sei und nur dazu bestimmt, dem deutschen Volk einen weiteren Dolch in den Rücken zu stoßen.
Eine milde Septembernacht, und auch in der Villa Bellago waren wie überall in der Stadt die Fenster fest geschlossen. Antonia hatte das Gefühl, sie müsse ersticken. Sie dachte an ihren Vater und sein Leiden. Vielleicht war es wirklich besser, in ein Land zu ziehen, wo man nachts die Fenster öffnen durfte, damit man tief durchatmen konnte und der Mond ins Zimmer schien.
Antonia dachte daran, daß heute zum ersten Mal seit langer Zeit ihre ganze Familie wieder unter demselben Dach schlief. Alle vereint und in Sicherheit – ein Zustand, von dem Antonia manchmal träumte, weil sie sich häufig um ihre Angehörigen sorgte. Trotzdem fand sie in dieser Nacht keine Ruhe. Nichts schien auf einmal mehr sicher. Die Familie driftete auseinander. Die gemeinsame Zukunft war in Frage gestellt, die Sicherheit aller. Die Gewißheit, daß man einander regelmäßig treffen würde und einander beistehen konnte, wenn Hilfe nötig war.
Antonia horchte auf den Atem ihres Mannes. In der Finsternis konnte sie nicht einmal seinen Umriß erkennen, aber seinem leisen Schnarchen nach zu schließen, mußte Ferdinand auf dem Rücken liegen, den Kopf von ihr abgewandt. Sie flüsterte seinen Namen, doch Ferdinand bewegte sich nicht, so tief war sein Schlaf. Da stand sie auf und schlich auf Zehenspitzen zur Tür. In der ungewohnten Dunkelheit stieß sie an die Kommode und mußte ein paarmal tasten, bis sie die Klinke fand.
Auf der Empore machte sie Licht. Erst jetzt atmete sie auf. Sie huschte zum Kinderzimmer, in dem Fanni mit Enrica und dem Baby schlief. Enrica hatte darauf bestanden, daß das Kindermädchen mit Lilli zu ihr ins Zimmer zog. Der Raum – eigentlich zwei große, in L-Form aneinandergereihte Zimmer – bot Platz genug für alle drei. Franz Josef Bellago mißbilligte diese Regelung. Das Haus sei so weitläufig, daß jeder ein eigenes Zimmer bewohnen könne, erklärte er. Außerdem dürfe man Kinder nicht verweichlichen. Auch Mädchen nicht. Mit sieben Jahren sei Enrica alt genug, allein zu schlafen. Doch Antonia wollte nicht, daß sich Enrica nach der Geburt der kleinen Schwester zurückgesetzt fühlte, und auch Fanni war damit einverstanden, ihr Schlafzimmer – zumindest vorläufig – mit beiden Kindern zu teilen.
Antonia ließ die Tür halb offenstehen. Sie trat an den Stubenwagen, wo unter einem Himmel aus dichten weißen Spitzen das Baby lag: auf der Seite und zugedeckt mit einem leichten Kissen, das am Wagen festgebunden war, damit das Kind es nicht wegstrampeln konnte oder darunter erstickte. »Lilli«, flüsterte Antonia. Das Baby grunzte leise und seufzte. Antonia streichelte seine Wangen. Alle Sorgen fielen auf einmal von ihr ab. Sie dachte nicht mehr an die Zukunft, sondern nur noch daran, daß wahrhaftig all ihre Lieben in ihrer Nähe waren und es ihnen gerade gutging. Jetzt. Zu dieser Stunde. Warum an morgen denken?
Antonia sah, daß Fanni wach geworden war, aber dann – als sie die Besucherin erkannte – beruhigt weiterschlief. Welch ein Friede, dachte Antonia zum zweiten Mal an diesem Tag. Sie ging zu Enricas Bett und zog die Decke zurecht. Halb im Schlaf rückte Enrica zur Seite und machte ihrer Mutter Platz, wie sie es oft tat, wenn draußen ein Gewitter tobte oder Antonia einfach den Wunsch hatte, sich zu vergewissern, daß mit ihrem Kind alles in Ordnung war.
Für ein paar Minuten legte sich Antonia neben ihre ältere Tochter. Dann stand sie wieder auf. Ohne die Augen zu öffnen, murmelte Enrica: »Mama«, und schlief erneut ein. Antonia streichelte ihr übers Haar und verließ den Raum.
Auf dem Weg zurück ins Schlafzimmer kam sie an dem Raum vorbei, in dem Peter übernachtete. Sie dachte, daß auch er immer noch ein Kind war, das jemanden brauchte, der seinen Schlaf behütete. Da strich sie mit der flachen Hand sanft über die Tür und wünschte ihm im stillen, daß er in seinem Leben nicht unglücklich werden möge, zumindest nicht mehr, als zu ertragen er stark genug war.
PETER
1
Peter Bethany mußte einsehen, daß er sich verkalkuliert hatte. Für einen Jungen von zwölf Jahren hatte er zu hoch gepokert und verloren. Schon seit Monaten sprachen seine Eltern davon, daß sie nicht mehr in Wien leben wollten. Jeden Morgen, wenn sich sein Vater nach dem Frühstück die Krawatte umband und seine Aktentasche holte, um zu Fuß zur Universität zu gehen, spürten Peter und seine Mutter die Anspannung, die von ihm Besitz ergriff und die er stets mit einer scherzhaften Bemerkung zu überspielen suchte. »Auf in die Höhle des Löwen!« sagte er dann vielleicht oder »Heil Hitler, ihr Lieben! Der Führer wartet schon auf mich.« Dabei lächelte er mit zusammengepreßten Lippen und wurde erst rot und dann leichenblaß.
Manchmal kam es vor, daß sich dabei sein Atem beschleunigte und er seine Krawatte noch einmal lockern mußte. Dann stützte er sich mit beiden Händen auf den Eßzimmertisch und rang nach Fassung. Seine Frau brachte ihm ein Stück Würfelzucker, auf das sie zwanzig Tropfen träufelte. Mit zitternden Händen nahm er ihr den Zucker aus der Hand und ließ ihn langsam im Mund zergehen. Dazu setzte er sich wieder hin, wie um den gefürchteten Aufbruch hinauszuzögern. Erst nach einer Weile, während der ihn Peter und seine Mutter besorgt beobachteten, sprang er wieder auf, als wäre alles vergessen, machte sich fertig und ging zur Tür. Er küßte seine Frau auf die Wange und zwinkerte Peter zu. »Alles bestens«, sagte er beruhigend. »Diese tausend Jahre werden wir auch noch überstehen.«
Peter war alt genug zu begreifen, daß sein Vater Angst hatte. Dabei war noch vor etwas mehr als einem Jahr alles ganz anders gewesen. Damals erschien ihm sein Vater unverwundbar und souverän; einer, der über den Dingen stand, der die Handlungen der Menschen und ihre Beweggründe durchschaute; einer, den man achtete, wenn er vor vollen Sälen sprach oder in kleiner Runde sein Urteil abgab; einer, dessen Mitgliedschaft man im Golfclub zu schätzen wußte; an dessen Tisch man während Bällen sitzen wollte und den man gerne zu sich nach Hause einlud – nicht nur als gesellschaftliche Pflicht, sondern auch weil er amüsant war, klug und aufmerksam, galant mit Frauen umging und umgänglich mit Männern, selbst wenn sie anderer Auffassung waren als er. Ein geschätzter Wissenschaftler und ein angenehmer Mensch; ein Weltbürger vom Scheitel bis zur Sohle. Daß er sich seine Frau aus dem Ausland geholt hatte, schien diesen Charakterzug nur noch zu unterstreichen.
Die Veränderung war langsam gekommen. Schleichend, so wie sich das Klima im Land, in der Stadt und an der Universität gewandelt hatte. »Zukunft braucht Herkunft«, hatte Johann Bethany eines Abends zu Peter gesagt, den Arm um seine Schultern gelegt, während sie auf dem großen Platz vor dem Stephansdom standen, die Seelenheimat aller, die hier geboren waren. »Was du hier siehst, das existiert nicht für diese Leute aus Berlin. Jahrhunderte tiefer Erfahrungen, die sich in unser gemeinsames Gedächtnis eingenistet haben. Dieser Dom ist ein Teil von dir und von mir, von uns allen, die wir Tag für Tag an ihm vorbeigehen. Unsere Vorfahren haben ihn gebaut. Ihr Blut ist unser Blut, und wie sie fühlten, so fühlen auch wir. Du, Peter, bist der Junge, der hilflos zusah, wie der Kaiser der Franzosen in Schönbrunn einzog, als gehörte es ihm. Der mit seinen Eltern in der Loge saß und voller Entzücken und Traurigkeit den Melodien des göttlichen Mozart lauschte. Du bist der Junge, der in den Mauern der Stadt fast verhungerte, belagert von fremden Horden. Der mit gesenktem Haupt den Mönchen diente. Der sich wochenlang im Wald vor den römischen Legionären versteckte und dem eines Tages ein Reisender von einer neuen Religion erzählte und von einem Menschen, den man dafür ans Kreuz genagelt hatte. Du bist der Junge aus den Wäldern, aus den Höhlen. Der Jäger in Fellschuhen, der mit Pfeil und Bogen auf die Berge stieg, um Nahrung zu erbeuten für sich und die Seinen. Das ist deine Herkunft, mein Kind. Das ist die Herkunft von uns allen hier. Nicht die gewaltige Sagenwelt des hohen Nordens ist die Heimat deiner Seele. Nicht das tosende Meer voller Eis, über dem die Nebel hängen. Der Junge, der du immer warst, ist geprägt von einer lieblichen Natur, von der Farbe und dem Duft der Blumen. Schwerer Wein, Musik und Tanz und das Streben nach Vollkommenheit, vielleicht sogar nach dem süßen Frieden des Todes. Niemals in all den Jahrhunderten warst du der gute Mensch an sich, aber du wärst es immer gern gewesen und hast das Böse in dir erkannt und beklagt, wenn auch nicht besiegt … Zukunft braucht Herkunft, mein Kind. Eigene Herkunft. Es wird uns vernichten, wenn wir uns den Göttern anderer ausliefern. Tote, grausame Götter, die – wiedererweckt – nach Heldenblut gieren und unbegrenztem Recht des Stärkeren. Begreifst du, was ich meine?«
Er hatte es begriffen, wenn auch mehr mit dem Gefühl als mit dem Verstand, und als er mit seinem Vater nach Hause ging, vorbei an den wartenden Fiakern und den vielen Männern in Uniform und Stiefeln, wurde ihm bewußt, in welcher Gefahr sein Vater schwebte. Er dachte an seine Lehrer im Gymnasium, die ganz anders redeten. Nicht alle, aber viele, doch auf genau die hörte man. Er dachte an seinen Banknachbarn, ein Junge wie er, so war es ihm zumindest immer erschienen. Erst gestern hatte der Turnlehrer diesen Jungen einen Bastard genannt. Alle wußten warum und schwiegen, weil sie Unannehmlichkeiten befürchteten und weil sie jeden Samstag mit ebendiesem Lehrer auf Wanderung gingen, auf die sie sich freuten, weil in der weiten Natur und beim Gesang am Lagerfeuer ihre jugendliche Sehnsucht nach Abenteuer, Gemeinschaft und Romantik gestillt wurde.
»Deine Frau Großmama kam aus dem Schtetl, nicht wahr, du kleiner galizischer Bastard?«
Auch Peter hatte weggehört, obwohl einen Augenblick lang das Bild seines Vaters vor ihm auftauchte, der nicht geschwiegen hätte und auch nicht schwieg, wenn an seiner Universität Unrecht geschah. Nicht daß er laut wurde. Keine dramatischen Auseinandersetzungen. Die entsprachen nicht seiner Natur. Aber er sagte seine Meinung, und das reichte schon aus, um in Gefahr zu sein. Er wußte es selbst. Wenn er am späten Nachmittag nach Hause kam und die Aktentasche wegstellte, rang er nach Luft, als hätte er es gerade noch bis hierher geschafft, sich zu beherrschen. Manchmal reichten die Tropfen, die seine Frau schon bereithielt, aus, ihn zu beruhigen. Oft aber schien es, als müsse er sterben, weil der Atem seine Brust nicht mehr verlassen konnte und ihn von innen her fast erdrückte.
Zukunft braucht Herkunft, dachte Peter dann und fragte sich voller Angst, ob sein Vater noch eine Zukunft zu erwarten hatte, da es verboten war zu denken wie er und einer gewachsenen Welt eine neue übergestülpt werden sollte, die eigentlich schon uralt war und längst untergegangen; die nach Tod roch und nach Verwesung; die jubelnd den Krieg besang und die Unbarmherzigkeit und die dennoch so viele verlockte, weil sie meinten, hinter aller Mühsal und allen Opfern das Licht einer vollkommenen Welt zu erahnen, in der alle schön und stark waren, treu und gehorsam. Alles würde gigantisch und erhaben werden in dieser Welt, schnörkellos und klar. Keine banalen Parteizwiste mehr, keine Arbeitslosigkeit und keine Angst vor einer ungewissen Zukunft. Wer sich unterordnete, gehörte dazu und brauchte sich keine Gedanken mehr zu machen.
Du kleiner galizischer Bastard … Was sein Vater wohl geantwortet hätte, um den Lehrer in die Schranken zu weisen? Einen Augenblick lang dachte Peter, es hätte ihm gutgetan, sich vor den Mitschüler zu stellen, der nie ein enger Freund gewesen war, an den er aber trotzdem immer öfter denken mußte. Gutgetan, aber auch geschadet. Wer war schon so unangreifbar, daß er aus der Menge hervortreten konnte, um zu widersprechen? War Peters Mutter nicht auch eine Ausländerin? Italienerin: nichts Schlimmes also, da der Führer und Mussolini miteinander befreundet waren. Andererseits hieß es aber, Mussolini habe noch vor wenigen Jahren der damaligen österreichischen Regierung versprochen, sie gegen den Führer zu verteidigen, sollte dieser es wagen, seine Hand nach dem Nachbarland auszustrecken. Einst Rivalen, nun Verbündete. Es war verwirrend, dachte Peter. Verwirrend wie alles um ihn herum, wenn die Politiker von »unseren italienischen Freunden« sprachen, aber die kleinen Leute auf der Straße von den »Katzlmachern«.
Zukunft braucht Herkunft. Peter fragte sich, ob es irgend jemandem irgendwann einmal einfallen würde, auch ihn einen Bastard zu nennen. Man lebe in einer Zeit der Erneuerung, wurde täglich verkündet. Die Zeit der Kirchen und Dynastien sei vorbei. Angebrochen sei nun die Epoche der Völker und Rassen. Ein Volk zu sein, war die Religion der neuen Zeit, dieser berauschenden Zeit des Wandels. Was aber, dachte Peter, wenn sich dieser Wandel einmal gegen ihn und seine Familie richtete? War überhaupt noch etwas sicher auf dieser Welt?
2
Ja, er hatte sich verkalkuliert, das wußte er jetzt, als er in dem weitläufigen Haus seiner Schwester und deren neuer Familie in dem großen Raum mit den hohen Wänden lag und die Ohren spitzte, weil draußen jemand über den Flur schlich und nun verstohlen die Tür zu einem anderen Zimmer öffnete. Licht drang durch die Ritze unter der Tür in sein Zimmer, und er hoffte, daß das umherirrende Gespenst auch zu ihm hereinkäme, damit er sich nicht mehr so einsam fühlte und erzählen konnte, wie es gekommen war, daß er plötzlich nirgends mehr dazugehörte und daß ihn schon am nächsten Morgen sogar die eigenen Eltern verlassen würden.
Er hatte sich verkalkuliert, als er sich weigerte, die Eltern nach Italien zu begleiten. Bis zuletzt hatte er geglaubt, wenn er nur genügend Widerstand leistete, würden sie schon nachgeben und auf ihre Auswanderungspläne verzichten. Er war ihr Kind. Zählte das nicht viel mehr als ein paar Kontroversen im Hörsaal? Warum konnte sich sein Vater nicht beugen, warum sich nicht geschmeidig anpassen wie so viele andere auch?
Trotz seines jugendlichen Alters hatte Peter in den vergangenen Monaten gelernt, zu beobachten und Schlüsse zu ziehen. Mit immer schwererem Herzen erkannte er die Gegensätzlichkeiten, die plötzlich dort offenbar wurden, wo ihm bisher alles friedlich und harmonisch erschienen war. Kurze Wortgefechte, die bei Tisch plötzlich unter den Gästen aufflammten, weil der eine die Welt ganz anders beurteilte als der andere und weil jeder sich im Recht wähnte. Abfällige Bemerkungen über Religion und Kirche, die er bisher für unangreifbar gehalten hatte. Das Verschwinden von Menschen, die er fest in seiner Welt verankert glaubte.
Vorsichtig war er geworden wie ein im Dienst gealterter Diplomat. Abwägend und schweigsam, wenn er in der Klasse nach seiner Meinung gefragt wurde. Er, der bisher immer gern Aufsätze geschrieben hatte, wagte kaum noch, sich zu äußern, weil er genau wußte, was man von ihm hören wollte, und vor Scham errötete er bei dem Gedanken, sein Vater würde nach seinen Heften fragen und dort die verlangten Lobeshymnen auf die neue Zeit vorfinden, mit der er selbst sich nicht abfinden konnte. Immer kürzer wurden Peters Aufsätze, enttäuschend für die Lehrer, die ihn bisher für intelligent gehalten hatten.
Seine einzige Rettung war der Sportunterricht, auf den höchsten Wert gelegt wurde. Dort konnte er immer noch glänzen. Dort verausgabte er sich für seine Mannschaft, weil es ein Spiel war. Er war schnell, geschickt und mutig. Ein gutaussehender Junge mit dunkelblondem Haar. Das Idealbild dessen, was erwünscht war. »Ein Intellektueller wie sein Vater ist er glücklicherweise nicht geworden«, urteilte der Sportlehrer zufrieden. »Aber dafür eine richtige kleine Kampfratte. Wenn es soweit ist, wird ein erstklassiger Soldat aus ihm, und darauf kommt es schließlich an.«
Es war eine zerrissene Welt, in der Peter Bethany seither lebte, geprägt von der Sorge um seinen Vater. Trotzdem hoffte er immer noch, die Menschen um ihn herum könnten zu ihrem früheren Gleichmut zurückfinden. Das Wort Toleranz war ihm noch nie untergekommen, aber genau danach sehnte er sich.
3
Einen einzigen Menschen gab es, in dessen Gegenwart er sich noch wohl fühlte. Es war kein Mitschüler oder gleichaltriger Freund, sondern ein junger Bursche aus ganz anderen Lebensverhältnissen, die mit denen der Bethanys nur dadurch verknüpft waren, daß dem Vater des jungen Mannes das Haus gehörte, in dem Peters Eltern die Wohnung gemietet hatten. Der Vater war ein Hotelbesitzer aus der Innenstadt, dem auch ein elegantes Restaurant gehörte und einige – so erzählte man sich, ohne daß es je einer beweisen konnte – nicht ganz so vornehme Etablissements, die allerdings das Geld einbrachten, mit dem ihr Besitzer das Trauma seiner unglücklichen Kindheit als Sohn eines arbeitslosen Bürogehilfen zu bewältigen suchte.
Ein Haus nach dem anderen kaufte er, wobei der Mietertrag unerheblich war, gab es doch für ihn kein befriedigenderes Gefühl als an Montagen, wenn das Restaurant geschlossen hatte, mit einem Fiaker von einem seiner Häuser zum nächsten zu fahren und durch die herrschaftlichen Portale zu treten in dem Bewußtsein, daß dies alles ihm gehörte und er jederzeit mit seiner Familie hier einziehen könnte. Langsam und genußvoll stieg er dann die Treppen hinauf und wieder hinunter und spielte dabei mit dem schweren Schlüsselbund in seiner Tasche.
Im Haus, in dem die Bethanys wohnten, lebte er jedoch selbst. Nicht im ersten Stock, der Beletage, wo man den Hausbesitzer vermutet hätte, sondern im zweiten, weil er weiter von der Straße entfernt lag und damit auch von unerwünschten Besuchern. Zwei Zugangsmöglichkeiten gab es zu dieser Wohnung: die breite Steintreppe und den klappernden Aufzug mit den Türen aus Schmiedeeisen. Beim Einzug hatte sein Architekt vorgeschlagen, auf die Treppe einen roten Teppich zu legen, um damit zu demonstrieren, daß hier nicht irgendein Mieter wohnte, sondern der Mann, dem das ganze Haus gehörte. Der Teppich wurde auch aufgezogen, doch schon nach einer Woche wieder entfernt, weil er den Schall der Tritte verschluckte, und der Hotelier Wert darauf legte, in seiner Wohnung zu hören, wenn jemand zu ihm heraufkam.
Der Sohn dieses Mannes hieß Johnny, zumindest nannte er sich so. Peter kannte ihn jedenfalls nur unter diesem Namen. Er wußte, daß Johnny noch zur Schule ging – eine private Handelsschule, wo er lernen sollte, mit all dem Geld umzugehen, das sein Vater in so geschickter Weise angehäuft hatte. Johnny war hochgewachsen und sehr schlank, immer rastlos und nervös, was sich darin ausdrückte, daß er trotz seiner Jugend fast ununterbrochen rauchte und seine Mundwinkel zu zucken begannen, wenn er gezwungen war, über längere Zeit an einem Platz auszuharren. Für Peter war er ein Freund, der ihm zuzuhören schien, wenn der Junge sein Leid klagte. Antworten allerdings gab er keine, sondern er nickte nur, ohne jemals zu widersprechen, und spielte dann dem Kind seine neuesten Schallplatten vor, die er, beständig mit den Fingern schnipsend, mit einer Art Tanz begleitete. Einen »Schlurf« nannten ihn die Nachbarn, die ihm wegen seiner brillantineglänzenden, welligen Haare und seiner gewollt eleganten Kleidung alles Schlechte zutrauten.
Peters Eltern wußten nicht, daß ihr Sohn fast jeden Nachmittag die Treppe zum nächsten Stockwerk hinaufeilte, um Johnny zu besuchen. Für ihn war Johnny kein Schlurf, und auch Johnny selbst lehnte diese Bezeichnung ab. Schlurfs gab es in der Vorstadt unter den Proleten, sagte er, doch er war der Sohn eines reichen Mannes, und auch seine Freunde und Freundinnen hatten vermögende Eltern. Sie trafen sich reihum, immer auffallend angezogen, die Mädchen stark geschminkt. Die Nachbarn in ihren von Johnnys Vater gemieteten Wohnungen empörten sich, wenn durch die geschlossenen Türen hindurch die Musik das Stiegenhaus erfüllte, daß die Fensterscheiben zitterten. Der stampfende Rhythmus der Musik drängte sich auf wie Baulärm, daß die Herzen derer, die sie haßten, gefährlich zu klopfen begannen.
Swing: Johnny und seine Freunde waren ihm ergeben wie einer Sucht, auch wenn er bei den unfreiwilligen Zuhörern als »Negermusik« verschrien war. Nach diesem Swing aus dem fernen Amerika, dem Land ihrer heimlichen Sehnsucht, benannten sich Johnny und seinesgleichen. Sie waren »Swing-Kids«, denen nichts wichtiger war, als sich von den braven Kindern des Nationalsozialismus abzugrenzen. »Swing Heil!« riefen sie, wenn sie einer Gruppe Hitlerjungen begegneten. Immer wieder kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, die oft genug in blutigen Schlägereien endeten. Die Hitlerjungen nannten die Mädchen der Swing-Kids »Swingerhuren«, und die Swing-Kids bemühten sich, die zackigen Fahrtenlieder der HJ mit ihren eigenen Songs zu übertönen.
»Eigentlich wollten wir uns ja die ›Scheichs‹ nennen nach dem Sheik of Araby«, erklärte Johnny, während ebendieser Song durchs Zimmer schallte. »Aber die Mädchen waren dagegen. Sie seien keine Scheichs, sagten sie und für Haremsdamen seien sie zu selbstbewußt. Nun ja, vielleicht fällt uns noch ein anderer Name ein.« Und er legte seine neueste Platte auf: ›Puttin’ on the Ritz‹, nach dem sich so wunderbar steppen ließ, daß man meinte, gerade in diesem Augenblick selbst im glitzernden New York zu sein und mit den anderen verwöhnten Müßiggängern über die Park Avenue zu flanieren.
Dressed up like a million dollar trooper.
Trying hard to look like Gary Cooper. Super duper.
Peter liebte Johnny. Er bewunderte ihn und wäre gerne so gewesen wie er, vor allem auch wegen Johnnys Freundin Lola, die Peter so wunderschön erschien wie noch nie zuvor ein Mädchen. Lola mit den trägen Bewegungen einer Katze; eine helle, immer ein wenig schmollend klingende Stimme; ein blasses Gesicht mit schwarz umrandeten Augen und einem dunkelroten Kußmund. Ein schwarzer Bubikopf und Röcke, die immer eine Idee kürzer waren als die der anderen Mädchen, was durch die hochhackigen Schuhe, in denen sie daherstolzierte, noch unterstrichen wurde. Sie sei ein tüchtiges kleines Ding, erklärte Johnny, der vom Vater gelernt hatte, daß man sich zwar des Lebens freuen solle, Arbeit aber nötig sei, um das erforderliche Kleingeld dazu zu erwirtschaften.
»Ihr Vater hat ein Bestattungsunternehmen«, erzählte Johnny weiter. »Da arbeitet sie am Vormittag im Büro – ganz brave kleine Tippse und dazu noch ungeschminkt und immer im schwarzen Kleid und mit schwarzen Strümpfen, weil die Kundschaft meint, da sie selbst in Trauer ist, wäre es die ganze übrige Welt auch. Vor allem natürlich der Bestatter ihres Vertrauens und somit auch Lola.«
Johnny war stolz auf Lola, und sie war stolz auf ihn. In ihrer Clique bildeten sie das Königspaar. Was sie bestimmten, geschah, und niemals waren sie unterschiedlicher Meinung. Peter hätte gerne gewußt, was sie taten, wenn sie allein waren, doch er wagte nicht, Johnny danach zu fragen. So war er auf Beobachtungen angewiesen, die ihm aber ebensowenig Aufschluß darüber gaben. Manchmal setzte sich Lola vor aller Augen auf Johnnys Knie und barg ihr Gesicht an seiner Schulter, während er scheinbar gleichmütig ihren Rücken streichelte und weiterredete. Manchmal küßten sie sich auch, ohne sich durch die Gegenwart der Freunde stören zu lassen. Alles Anzeichen, dachte Peter, daß die Nachbarn recht hatten, wenn sie ihnen unterstellten, sie nähmen auf bürgerlichen Anstand und die allgemein geforderte voreheliche Enthaltsamkeit keine Rücksicht. Trotzdem berührte ihn die Behutsamkeit, mit der sie einander behandelten, und er wünschte sich sehnlichst, an Johnnys Stelle zu sein.
In manchen Nächten konnte er nicht aufhören, an Lola zu denken. Dann überlegte er sich, ob es irgendeinen Augenblick gegeben hatte, in dem ihm das Mädchen besondere Beachtung schenkte. Doch die einzige Gelegenheit, die ihm einfiel, war ihre kurze Gratulation zu seinem zwölften Geburtstag. Er hatte ihn erwähnt, weil er hoffte, damit Lolas und Johnnys Aufmerksamkeit zu erregen. Dreimal versuchte er, sich Gehör zu verschaffen, bis er im Stimmengewirr von Johnnys Freunden endlich durchdrang. Erst dann horchte Johnny auf, klopfte ihm auf die Schulter und forderte ihn auf, sich als Geschenk zwei seiner Platten auszusuchen.
Überwältigt und voller Schüchternheit fragte Peter, ob es denn auch die beiden neuesten sein dürften. »Der ›Scheich‹ und das ›Puttin’ on the Ritz‹!«
Trotz der kühnen Forderung verzog Johnny keine Miene. »Aber sicher, Kleiner«, antwortete er. »Schön, daß du den gleichen Geschmack hast wie ich.«
»Und es macht dir wirklich nichts aus?«
»Aber nein. Ich kann sie mir doch wieder besorgen. Als Gastronom hat man so seine Quellen.« Damit reichte er Peter die beiden Platten – ein Geschenk auf Zukunft, denn Peter besaß kein eigenes Gerät, sie abzuspielen, und der Gedanke, das erlauchte Grammophon seiner Eltern für diesen Swing zu mißbrauchen, erschien ihm gewagt, fast undenkbar.
Doch dies war noch nicht der Höhepunkt seines Glücks. Noch während ihm das Klopfen seines Herzens bewußt wurde, spürte er, wie ihn jemand sanft am Arm faßte, und dann sah er wie in einem paradiesischen Traum Lolas Gesicht vor sich. »Gratuliere dir«, sagte sie mit ihrer gedehnten, schmollenden Kinderstimme, die in seinen Ohren bezaubernder klang als alles andere auf der Welt. Damit zog sie ihn einen Atemzug lang an sich und küßte ihn auf die Wange – so nah an seinem Mund, daß ein Teil ihrer Lippen die seinen berührten.
Zu Stein erstarrt stand er da. »Danke!« stieß er hervor, drückte seine Platten an sich und stürmte aus der Wohnung, die Treppe hinunter und in sein Zimmer, wo er sich aufs Bett warf und wie in verzweifeltem Zorn minutenlang auf das Kissen einprügelte.
Lola. So vollkommen und dabei so zierlich, daß er bald größer sein würde als sie. Sie war es, an die er als erstes dachte, als ihm seine Eltern eröffneten, sie wollten das Land verlassen. Lola und Johnny, Johnny und Lola. Wie sollte er weiterleben, ohne die beiden zu sehen, selbst wenn jedes ihrer Treffen allein von ihm ausging und sie ihn nie zu vermissen schienen, wenn er sich nicht meldete?
4
Als der Sommer kam und damit auch die Ferien an der Universität und an Peters Schule, begann eine Zeit der Irreführung und Manipulation. Alle Welt redete davon, daß ein Krieg bevorstand und nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei nun Polen an der Reihe sein würde, weil die Polen, wie Hitlers Presse berichtete, die deutsche Minderheit in unerträglicher Weise drangsalierten, was der Führer nicht länger mit ansehen konnte. Wie ein Vater, so priesen ihn seine Anhänger, sorge er für sein Volk und für dessen Sicherheit, indem er seine eigene, ganz persönliche Abneigung gegen den Bolschewismus unterdrücke und mit seinem russischen Erzfeind Stalin einen Nichtangriffspakt geschlossen habe, was bedeutete, daß im Kriegsfall keiner der beiden den Gegner des anderen unterstützen würde. Sogar von einem geheimen Zusatzprotokoll wurde gemunkelt, in dem die beiden Feinde – und nun doch Verbündeten – das gesamte Osteuropa schon im voraus unter sich aufteilten. »Wir sind ausgetrickst worden!« sagte der französische Botschafter in Berlin resigniert. »Der letzte Faden, an dem der Friede noch hing, ist gerissen.« Ihm war klar, daß sein Land und Großbritannien im Falle eines deutschen Angriffs auf Polen Deutschland den Krieg erklären mußten, wie sie sich vertraglich gegenüber Polen verpflichtet hatten.
Verzweifelt bemühten sich die Diplomaten der europäischen Länder und der Vereinigten Staaten, die Kriegsgefahr abzuwenden. Pius XII. in Rom mahnte zum Frieden in dieser Welt, in der es brodelte und zischte. Frankreich feierte das hundertfünfzigste Jubiläum seiner großen Revolution, während die Geisterschiffe der geflüchteten deutschen Juden über die Meere irrten auf der Suche nach einem Hafen, der sie endlich aufnahm; während sich zugleich in Palästina der latente Bürgerkrieg zwischen Arabern und Juden verschärfte; während in Ravensbrück das erste Konzentrationslager nur für Frauen errichtet wurde; während Japan halb China eroberte und das nationalistische Spanien den Sieg im Bürgerkrieg feierte. In New York erregte die Weltausstellung Aufsehen, und Italien überfiel das Königreich Albanien. Die Irisch-Republikanische Armee zündete todbringende Bomben in London und anderen englischen Städten, und im Deutschen Reich ehrte man die Frauen, die mindestens acht »deutschblütige« Kinder geboren hatten mit dem Mutterkreuz in Gold, während zu gleicher Zeit der Führer die Arbeiten am Westwall inspizierte, der das »gigantischste Befestigungswerk aller Zeiten« werden sollte, »eine unüberwindliche Mauer aus Stahl und Beton« zum Schutz gegen den Erbfeind Frankreich.
Wie sollte man verstehen, daß man in Wien verzweifelte, weil der Fußballclub Admira Wien mit 9:0 gegen den deutschenFC Schalke 04 verloren hatte? Wie sollte man verstehen, daß die Tischgespräche hauptsächlich um die Hochzeit des Schauspielers Heinz Rühmann kreisten, während kaum jemand erfuhr, daß der große Joseph Roth in einem Pariser Hospital elendiglich verreckt war?
Eine Zeit der Täuschung, um die eigene finanzielle Existenz zu sichern. Niemand durfte erfahren, daß die Italienfahrt des Professors Johann Bethany mehr war als eine Spätsommerreise der Gesundheit zuliebe und daß der bedauernswerte Asthmatiker, der mit seinen defätistischen Ansichten ohnedies nichts mehr auf der Hochschule zu suchen hatte, fortan fern seiner Heimat leben wollte – für längere Zeit oder vielleicht sogar für immer.