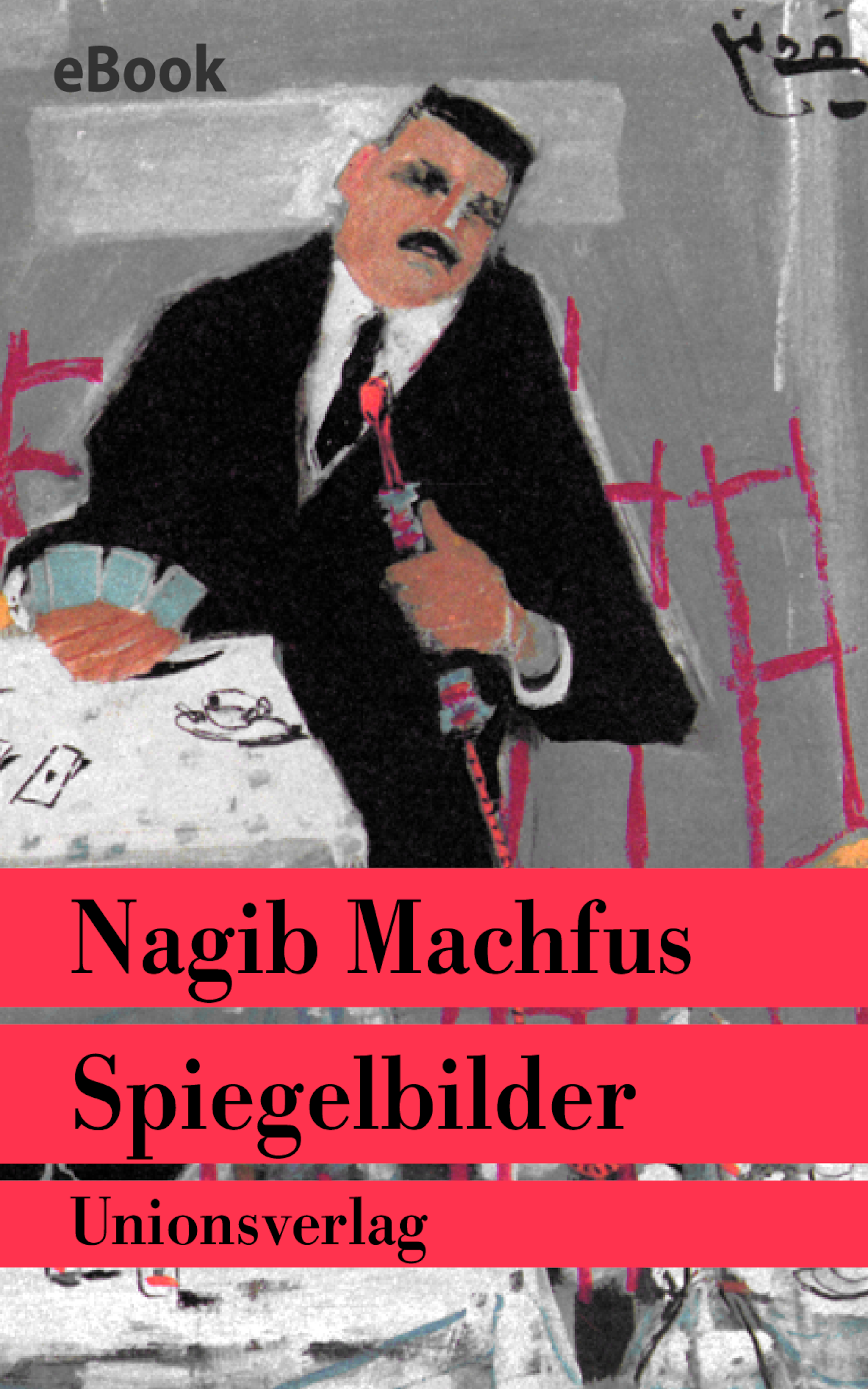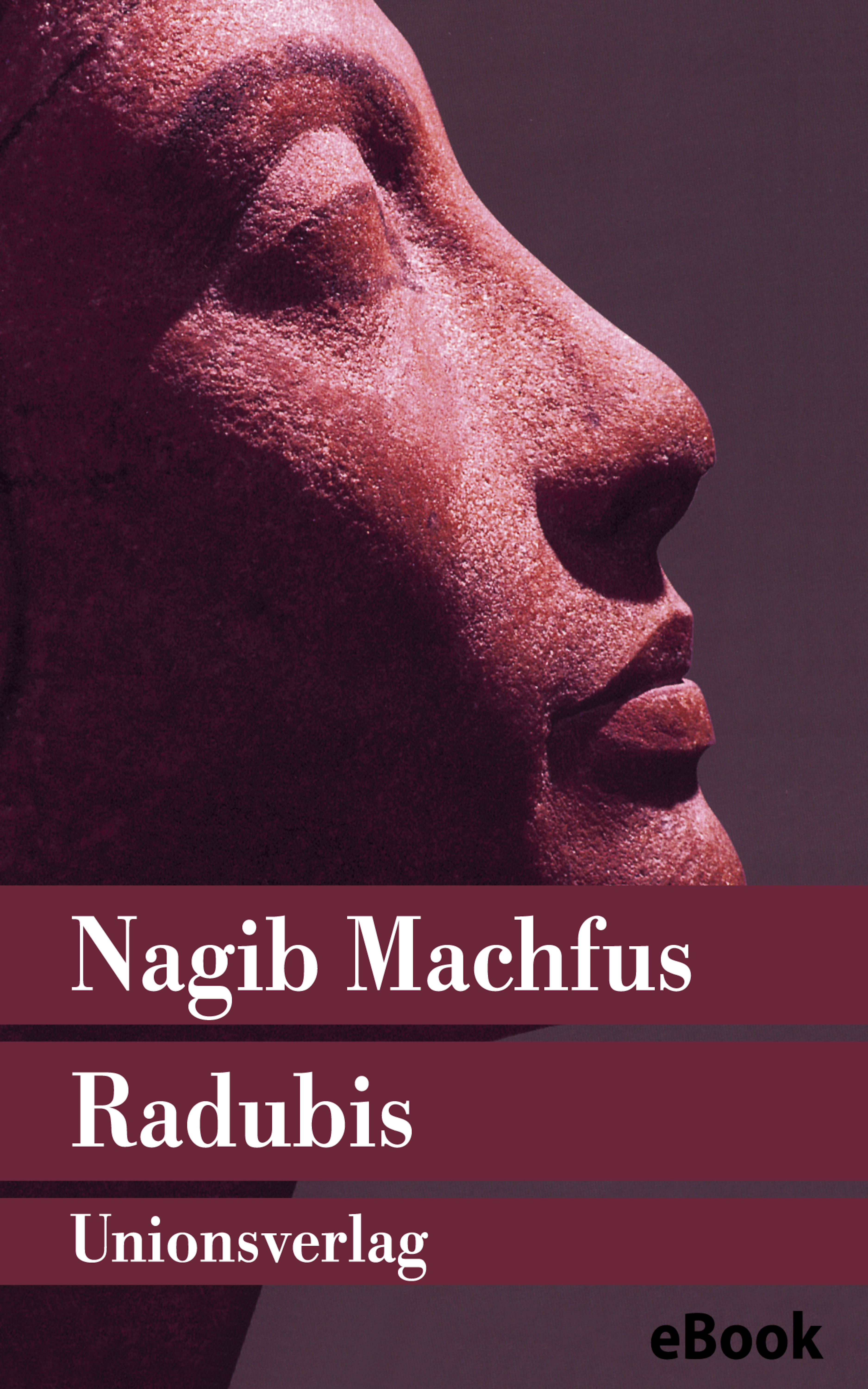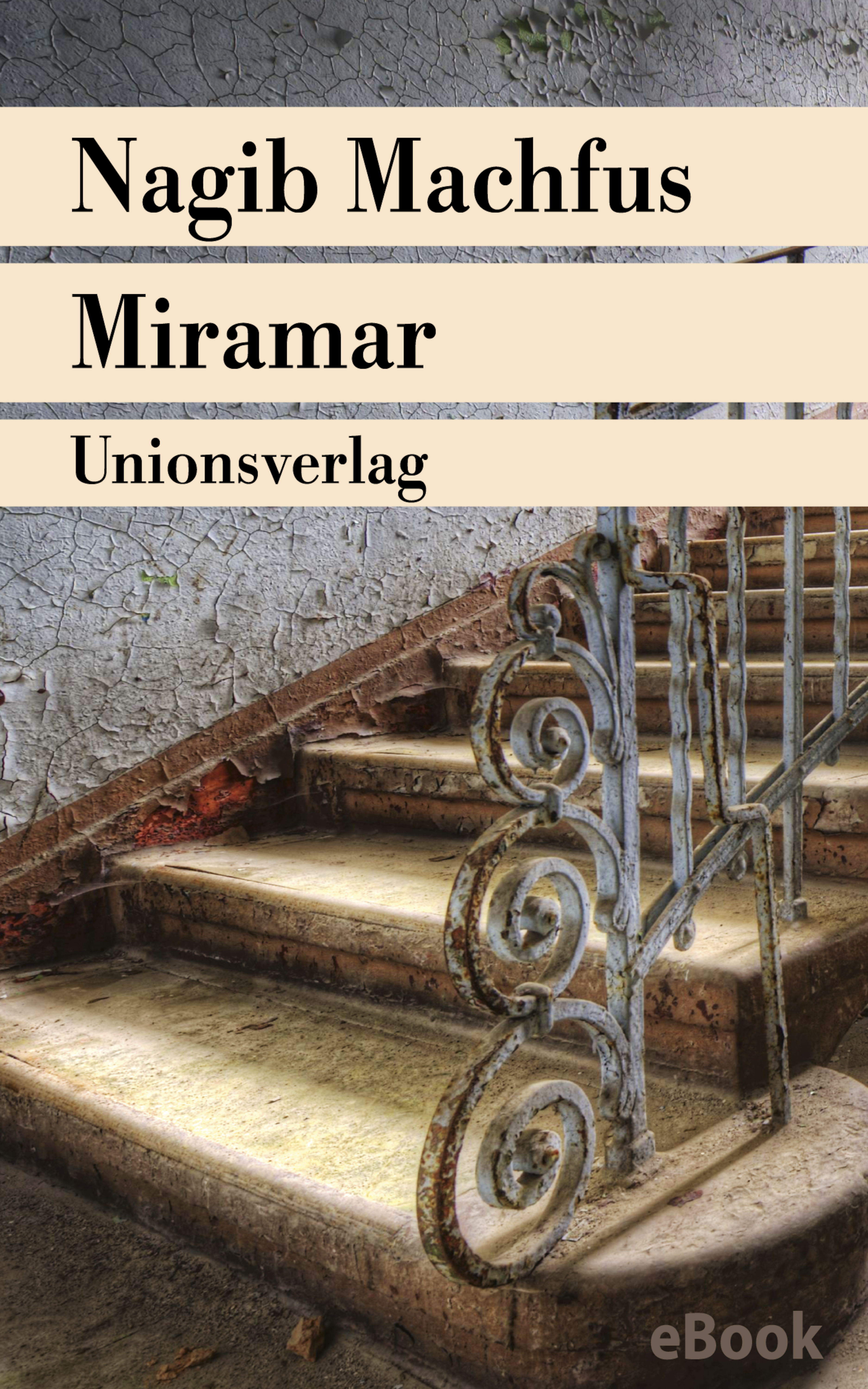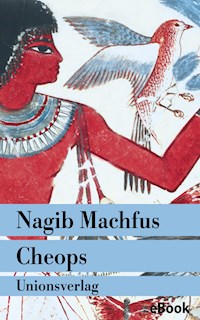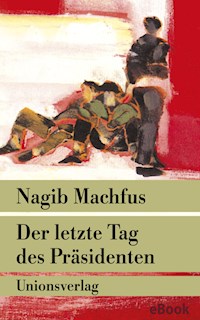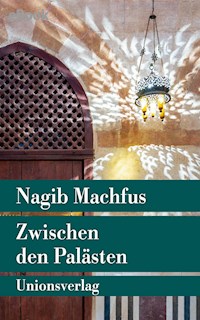11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kairo, gestern wie heute ein Ort gewaltiger Ungleichheiten und großer Umbrüche. Als der ambitionierte Student Machgub erkennt, dass es ohne die richtigen Beziehungen keine Jobs gibt, sieht er sich gezwungen, einem trügerischen Abkommen zuzustimmen: Er soll eine Frau, die ihre Unschuld verloren hat, zur Rettung ihrer Ehre heiraten – ohne seine Braut vorher gesehen zu haben. Darüber hinaus fordert der Verführer dieses Mädchens, ein hochrangiger Beamter, weiterhin regelmäßiges Besuchsrecht bei seiner Geliebten. Im Gegenzug erhält Machgub eine Position in einem Ministerium. Was für ihn zunächst als bloße Überlebensstrategie beginnt, entpuppt sich bald als faustischer Pakt mit unabsehbaren Folgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Der ambitionierte Student Machgub lässt sich auf einen faustischen Pakt mit unabsehbaren Folgen ein: Er heiratet eine Frau, die ihre Unschuld verloren hat, zur Rettung ihrer Ehre – ohne seine Braut vorher gesehen zu haben. Im Gegenzug erhält Machgub eine Position in einem Ministerium. Doch er hat die Rechnung ohne den Geliebten gemacht …
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Nagib Machfus (1911–2006) gehört zu den bedeutendsten Autoren der Gegenwart und gilt als der eigentliche »Vater des ägyptischen Romans«. Sein Lebenswerk umfasst mehr als vierzig Romane, Kurzgeschichten und Novellen. 1988 erhielt er als bisher einziger arabischer Autor den Nobelpreis für Literatur.
Zur Webseite von Nagib Machfus.
Hartmut Fähndrich (*1944) ist seit 1978 Lehrbeauftragter für Arabisch und Islamwissenschaften an der ETH Zürich. Neben seiner Übersetzertätigkeit arbeitet er auch als Herausgeber und Publizist.
Zur Webseite von Hartmut Fähndrich.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Nagib Machfus
Das junge Kairo
Roman
Aus dem Arabischen von Hartmut Fähndrich
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 6 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 1945 unter dem Titel al-Qâhira al-gădîda.
Die Übersetzung wurde mit Mitteln der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V.
Originaltitel: al-Qahira al-gadida
© 1945 by Nagib Machfus
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Andrew Neilan
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30570-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 07:45h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DAS JUNGE KAIRO
1 – Die Sonne hatte gerade den Zenit überschritten …2 – An der ersten Kreuzung entlang der Allee bogen …3 – Das Studentenwohnheim am Ende der Raschad-Pascha-Straße war eine …4 – Ali Taha blieb in seinem Zimmer, bis die …5 – Auch Machgub Abdaldaim wartete in seinem Zimmer …6 – Er riss den Umschlag auf und las7 – Nur wenige Minuten später stand er vor einem …8 – Am nächsten Morgen erschien der Arzt, untersuchte den …9 – Die Sonne löste sich im blutigen See des …10 – Die drei Freunde waren in Mamun Radwans Zimmer …11 – Während der noch verbleibenden Januartage kümmerte er sich …12 – Am folgenden Morgen erwachte er zerschlagen und mit …13 – Machgub verließ sein Zimmer. Er war fest entschlossen …14 – Auf der Fustatstraße schlug ihm ein kalter ruppiger …15 – Am folgenden Morgen wachte er ruhiger auf …16 – Er erkundigte sich nach dem Büro von Herrn …17 – Am folgenden Freitag begab er sich, ein wenig …18 – Danach folgte eine relativ stabile Zeit19 – Er hielt es für geraten, al-Ichschidi zu Hause …20 – Fünfzig Groschen. Eine wahrhaft lächerliche Summe. Aber wie …21 – Er traf seine Vorbereitungen. Er badete, bügelte Anzug …22 – Am nächsten Vormittag ging Machgub in seinem winzigen …23 – Salim al-Ichschidi seufzte erleichtert auf24 – Nachdem er sich sorgfältig gekleidet und alles unternommen …25 – Ichsan Schahata leibhaftig, jedoch nicht mehr das unschuldige …26 – Machgubs und Ichsans Blicke begegneten sich, wortlos …27 – Das Experiment konnte beginnen, seine Philosophie wartete begierig …28 – Er stand früh auf, ging ins Ministerium und …29 – Am selben Tag begleitete al-Ichschidi Machgub Abdaldaim wie …30 – Er wollte reden, wusste aber nicht, was er …31 – Als er am frühen Morgen die Augen öffnete …32 – Machgub hielt an seinem unverfrorenen Vorhaben fest …33 – Einen Toten schmerzt keine Wunde34 – Am nächsten Morgen erwachte er spät. Zerschlagen und …35 – Nach dem Mittagessen legte er sich ins Bett …36 – Ein solches Gespräch führte er kein weiteres Mal …37 – Der August kam und mit ihm Machgubs erstes …38 – Er teilte seiner Frau die Neuigkeit mit …39 – Nur wenige Tage später quartierte sich der neue …40 – Herr Machgub Abdaldaim oder genauer: Machgub Bey Abdaldaim …41 – Vier Tage lang konnte Machgub seine bedeutsame Stelle …42 – Sie drängelten sich zu den Tischen und nahmen …43 – Bei ihrer Rückkehr waren sie erschöpft und heiser …44 – Als er am nächsten Vormittag, einem Freitag …45 – Sein Herz pochte heftig, und seine Glieder durchlief …46 – Die drei Freunde, Ali Taha, Achmad Badir und …Anmerkungen
Mehr über dieses Buch
Über Nagib Machfus
Nagib Machfus: Das Leben als höchstes Gut
Nagib Machfus: Rede zur Verleihung des Nobelpreises 1988
Tahar Ben Jelloun: Der Nobelpreis hat Nagib Machfus nicht verändert
Erdmute Heller: Nagib Machfus: Vater des ägyptischen Romans
Gamal al-Ghitani: Hommage für Nagib Machfus
Hartmut Fähndrich: Die Beunruhigung des Nobelpreisträgers
Über Hartmut Fähndrich
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Nagib Machfus
Zum Thema Ägypten
Zum Thema Arabien
Zum Thema Großstadt
1
Die Sonne hatte gerade den Zenit überschritten. Sie stand über der gewaltigen Kuppel der Universität, als quelle sie daraus hervor oder wolle ihren Rundgang dort beenden. Sie überflutete die Wipfel der Bäume, die grasüberzogene Erde, die silbergrauen Wände der Gebäude und die Allee, die sich durch den Orman-Park zog, mit freundlichen Strahlen, denen die Januarkälte die sengende Kraft nahm, sie gnädig und mild stimmte. Die Kuppel präsidierte zwei Reihen hoher Bäume, die sich die Straße entlangzogen. Sie sah einem Gott ähnlich, der von knienden Priestern angebetet wird, jetzt am Nachmittag, da am klaren Himmel nur einige ferne Wolkenfetzen zu sehen waren und ein kühler Wind die Bäume durchzog, deren Blätter seufzten und klagten.
Am Himmel kreisten ein paar Milane, und unten spazierten Gruppen von Studenten. In allerlei Gespräche vertieft, gingen sie vom Platz der Universität auf die Allee hinaus. Auch ein Grüppchen von Studentinnen tauchte auf, nicht mehr als fünf, die im Gehen miteinander tuschelten. Frauen an der Universität waren noch immer etwas Besonderes, etwas, das Aufmerksamkeit und Neugier weckte, vor allem bei den Erstsemestern. Diese zwinkerten sich zu und flüsterten miteinander, vielleicht etwas laut, für ihre Kommilitonen kaum zu überhören.
»Ist unter denen denn gar kein erfreuliches Gesicht?«, fragte einer, worauf ein anderer leicht spöttisch erwiderte: »Das hier sind Botschafterinnen der Wissen-, nicht der Leidenschaft.«
Wozu ein Dritter – mit einem Blick auf die näher kommenden schmächtigen jungen Damen – voll kritischem Eifer bemerkte: »Aber Gott schuf sie als Botschafterinnen der Leidenschaft.«
Der Erste lachte laut und bemerkte, leicht aufgeplustert: »Vergiss nicht, dass wir uns hier an der Universität befinden, einem Ort, wo weder Platz für Gott noch für Leidenschaft ist.«
»Dass hier kein Platz für Gott ist, leuchtet ein. Aber was die Leidenschaft angeht …«
»Die Universität ist wohl ein Feind Gottes, nicht aber der Natur«, deklamierte einer in professoralem Ton.
»Wohl gesprochen! Doch lasst euch von der Hässlichkeit dieser jungen Damen nicht entmutigen. Sie sind nur eine erste Ladung des schönen Geschlechts. Weitere werden folgen. Die Universität kommt in Mode, und das wird sich noch ausbreiten. Besser heute schon an morgen denken.«
»Glaubst du etwa, die Mädchen hier stürzen sich auf die Uni wie aufs Kino?«
»Noch stürmischer! Du wirst hier noch ganz andere Frauen sehen als diese armseligen Exemplare.«
»Gnadenlos werden sie sich unter die Männer drängen.«
»Gnade wäre hier fehl am Platz.«
»Sie werden sich wohl kaum um gute Manieren bemühen, das hat der Stärkere gar nicht nötig.«
»Vielleicht entflammt ja ein Feuer zwischen den Geschlechtern.«
»Das wäre doch wunderschön.«
»Schau doch nur die Bäume und die Büsche! Da entsteht die Liebe so spontan wie die Maden im Frischkäse.«
»Mein Gott, werden wir solche glückseligen Zeiten noch erleben?«
»Du musst nur lange genug warten können.«
»Wir stehen erst ganz am Anfang, und die Zukunft lockt in allen Farben.«
Sie stellten ihre allgemeinen Betrachtungen ein und musterten die Kommilitoninnen, eine nach der anderen, mit bitterem Sarkasmus und beißendem Spott.
Vier junge Männer schlenderten langsam dahin. Auch sie unterhielten sich und lauschten wohl zugleich auf das Geplapper der Jüngeren. Sie waren im letzten Studienjahr und schon vierundzwanzig. Reife und Wissen standen ihnen ins Gesicht geschrieben, und ihrer Bedeutung waren sie sich durchaus bewusst, nur zu bewusst.
»Diese Jungen haben nichts anderes als Mädchen im Kopf«, bemerkte Mamun Radwan süffisant.
»Was spricht dagegen?«, wollte Ali Taha wissen. »Männer und Frauen sind zwei Hälften, die einander suchen. Das war schon immer so.«
»Sieh es ihnen nach, Mamun«, schaltete sich Machgub Abdaldaim ein. »Heute ist Donnerstag, und Donnerstag ist ›Frauentag‹.«
Achmad Badir, Student und Journalist, lächelte mild und verkündete feierlich:
»Meine lieben Freunde, hiermit möchte ich euch bitten, in wenigen Worten eure Ansichten über die Frau preiszugeben. Was meinst du zum Thema, Mamun Radwan.«
Der Angesprochene war verwirrt, dann lächelte er und erwiderte: »Ich soll mich zu dem Thema äußern, für das ich andere kritisiere?«
»Versuch nicht, dich zu drücken. Los! Nur ein paar Worte. Ich bin Journalist, und als solcher ist mir kein Thema zu heiß.«
Mamun Radwan wusste, dass man Achmad Badir nicht so leicht entkam, also fügte er sich. »Gut, wenn du mich fragst, ich stimme mit den Worten unseres Herrn überein: Die Frau ist ein Trost in dieser Welt und ein gangbarer Pfad zum Trost in der nächsten.«
Mit einer Kopfbewegung wandte sich Achmad Badir nun an Ali Taha und forderte ihn auf, sich zu äußern.
»Die Frau ist, wie man so sagt, die Gefährtin des Mannes in seinem Leben«, erklärte dieser, »doch diese Gemeinschaft sollte, meiner Meinung nach, auf völliger Gleichheit von Rechten und Pflichten beruhen.«
»Und wie lautet die Meinung unseres geschätzten Satans?«, fragte Achmad Badir lachend, an Machgub Abdaldaim gewandt.
»Die Frau«, hob der Angesprochene mit theatralischer Geste an, »ist ein Überdruckventil am Dampfkessel.«
Wie immer, wenn sie seine Meinungen hörten, gab es Gelächter. Schließlich wollte man auch noch Achmad Badirs Ansicht hören, doch dieser entzog sich mit den Worten, ein Journalist müsse zuhören, nicht selbst reden, besonders in der heutigen Zeit.
2
An der ersten Kreuzung entlang der Allee bogen sie ab und gingen Richtung Gouverneurssitz. Mamun Radwan war der Größte von ihnen, Machgub Abdaldaim nur unwesentlich kleiner, Ali Taha dagegen war mittelgroß und untersetzt. Achmad Badir schließlich war klein, hatte aber einen sehr großen Kopf. Mamun Radwan, der die studentische Arbeitswoche möglichst angenehm abschließen wollte, um danach den Feiertag zu begehen, wies mit seiner wohlklingenden, leidenschaftlichen Stimme darauf hin, die Diskussion über Frauen habe sie ihr eigentliches Thema ganz vergessen lassen. »Was haltet ihr von der Vorlesung, die wir gerade gehört haben?«, wollte er wissen.
Bei dieser Debatte war es um die Frage gegangen, ob Prinzipien für den Menschen notwendig seien oder ob man sich von ihnen befreien sollte.
»Wir sind uns doch einig«, sagte Ali Taha, an Mamun Radwan gewandt, »dass Prinzipien für den Menschen notwendig sind. Sie sind der Kompass, der dem Schiff auf hoher See die Richtung weist.«
»Quatsch«, kommentierte Machgub Abdaldaim kurz und bündig, doch Ali Taha beachtete ihn nicht und sprach weiter zu Mamun: »Wir sind uns aber nicht einig, wie die Prinzipien im Einzelnen auszusehen haben.«
»Wie üblich«, sagte Achmad Badir schulterzuckend.
»Uns genügen«, erklärte Mamun mit einem Flackern in den Augen, wie immer, wenn er in Fahrt geriet, »die Prinzipien, die Gott der Allmächtige eingesetzt hat.«
»Es will mir nicht in den Kopf, dass einer wie du an solche Märchen glaubt«, erklärte Machgub Abdaldaim.
»Ich glaube an die Gesellschaft, die lebendige menschliche Zelle«, nahm Ali Taha die Debatte wieder auf. »An ihren Prinzipien sollten wir uns also orientieren, uns aber davor hüten, sie heiligzusprechen, denn sie müssen von Generation zu Generation erneuert werden, durch die Gelehrten und die Erzieher.«
»Welche Prinzipien braucht denn unsere Generation?«, wollte Achmad Badir wissen.
»Den Glauben an die Wissenschaft, nicht an die Transzendenz, an die Gesellschaft, nicht ans Paradies, an den Sozialismus, nicht an die Rivalität«, antwortete Ali enthusiastisch.
Doch Machgub hatte für all das nur ein dreifaches »Quatsch« übrig, weshalb ihn Achmad Badir fragte: »Nun, Machgub, was hältst du von der Debatte?«
»Quatsch«, erwiderte der Gefragte ruhig.
»Sind Prinzipien notwendig?«
»Quatsch.«
»Also unnötig?«
»Quatsch.«
»Religion oder Wissenschaft?«
»Quatsch.«
»Also welches von beiden?«
»Quatsch.«
»Hast du keine Meinung?«
»Quatsch.«
»Ist dieses ›Quatsch‹ eine Meinung?«
»Es ist das höchste Ideal«, erklärte Machgub in seiner vorgetäuschten Ruhe.
Mamun Radwan wandte sich an Ali Taha. Ihm lag mehr daran, seine eigene Meinung zu äußern, als andere zu überzeugen.
»Gott ist im Himmel«, sagte er, »und der Islam ist auf Erden. Das sind meine Prinzipien.«
Ali Taha lächelte, und wie zuvor Machgub Abdaldaim erklärte nun er: »Es will mir nicht in den Kopf, dass einer wie du an solche Märchen glaubt.«
Machgub lachte auf und kommentierte: »Quatsch.«
Er warf den anderen einen raschen Blick zu. »Erstaunlich«, meinte er, »dass wir alle unter ein Dach passen: ein Hitzkopf wie ich; Mamun, der in den alten Märchen gefangen ist wie der Geist in der Flasche; und Ali Taha mit seinem Bauchladen voll neuer Mythen.«
Die beiden Erwähnten beachteten ihn nicht. Wie so oft hatten sie Mühe, bei ihm zwischen Scherz und Ernst zu unterscheiden, was Diskussionen mühsam machte, weil er sich nicht festnageln ließ, sondern immer in die Clownerie auswich.
Als am Ende der Raschad-Pascha-Straße das Studentenwohnheim auftauchte, verabschiedete sich Achmad Badir und ging zur Zeitungsredaktion, wo er immer abends arbeitete. Die anderen drei kehrten zurück zum Wohnheim, um sich auf den Donnerstagabend einzustimmen.
3
Das Studentenwohnheim am Ende der Raschad-Pascha-Straße war eine gewaltige Festung. Das dreistöckige Gebäude umschloss einen weiten, runden Innenhof. Jedes Stockwerk bestand aus kreisförmig angeordneten Zimmern mit je einem engen Vorraum, von dem aus man auf den Innenhof blickte. Die drei Freunde wohnten nebeneinander im zweiten Stock.
Mamun Radwan ging in sein Zimmerchen und zog sich um. Das Mobiliar bestand aus einem schmalen Bett, einem Schrank und dazwischen, vor einem kleinen Fenster, einem mittelgroßen Schreibtisch mit Büchern und Nachschlagewerken. Der junge Mann war ein leidenschaftlicher Leser, und als sein Blick auf Lalandes Lexikon fiel, trat auf seine Lippen ein feines Lächeln, das seine Liebe und seine Leidenschaft verriet. Doch nun verlor er keine Zeit. Er vollzog die Waschung und verrichtete das Nachmittagsgebet. Dann zog er seine besten Kleider an, verließ sein Zimmer und ging auf die Straße hinunter. Beim Gehen hielt er seinen geschmeidigen Körper fast soldatisch aufrecht. Er war schlank, ohne mager zu sein, und besaß eine rötlich durchsetzte weiße Gesichtshaut. Besonders attraktiv an ihm waren die leuchtenden, großen schwarzen Augen, die Schönheit und Intelligenz ausstrahlten.
Energisch zog er los, den Blick durch nichts abgelenkt. Sein Ziel war die Wohnung seiner Verlobten in Heliopolis. Mamun betrieb seine Herzensangelegenheiten mit derselben Rechtschaffenheit und Geradlinigkeit wie alles in seinem Leben. Auf den Rat seines Vaters hatte er um die Hand eines Mädchens angehalten, die Tochter eines Verwandten, eines hohen Armeeoffiziers, und man war übereingekommen, dass die Hochzeit stattfinden sollte, sobald Mamun sein Studium abgeschlossen hätte. Seitdem besuchte er jeden Donnerstag ihre Familie und verbrachte dort ein paar Stunden in angenehmer Gesellschaft. Nie wäre es ihm eingefallen, das Mädchen ins Kino einzuladen oder etwas auszuhecken, um mit ihr allein zu sein. Er hielt nichts von diesen »modernen Unsitten«, wie er es nannte, ja, er verabscheute sie. Und sein Verhalten wurde von der Familie des Mädchens, einer Familie, die unbeirrbar an den alten Sitten festhielt, gewürdigt und geschätzt. Trotzdem schlug sein Herz kräftig, als er sich auf den gewohnten Weg machte, nach ein paar Minuten die Gisehstraße erreichte und dort in die Straßenbahn stieg.
Wie er so dasaß, schön und würdevoll, mit klarem Blick und in aufrechter Haltung, hätte man ihn ohne Weiteres für eine berühmte Persönlichkeit wie Omar Ibn Abi Rabia1 halten können. Doch er war ein tugendhafter, anständiger und sauberer junger Mann, wie selten einer. Er besaß ein reines Gewissen, eine untadelige Gesinnung und ein aufrichtiges Herz, das an der wahren Religion, einem tief verwurzelten Glauben und einer aufrechten Moral festhielt.
Mamun war in Tanta geboren. Sein Vater, ein frommer und sittenstrenger Mann, arbeitete als Lehrer an einer theologischen Einrichtung. Er wuchs also in einer Umgebung auf, die in ihrer Einfachheit, ihrer Religiosität, ihrer Moral und ihrer Kraft fast schon beduinisch war. Als Kind hinderte ihn eine schwere Krankheit am Schulbesuch, was tiefe Spuren in ihm hinterließ. Bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr erfuhr er also die Bitterkeit und den Schmerz des Alleinseins und so manchen Schicksalsschlag. Doch unter der Leitung seines Vaters konnte er religiöse Studien betreiben und wurde dadurch schon in sehr jungen Jahren Experte in religiösen Fragen. Als Grundschüler besaß er ein großes Herz, einen wendigen Geist und einen lebhaften Intellekt. Doch konnte er auch fanatisch und heftig werden, und bisweilen überkam ihn eine irrsinnige Brutalität. Dann geriet er aus dem Gleichgewicht, und er ging los wie eine Feuerzunge, die nach allem schnappt, dessen sie habhaft werden kann, und alles verschlingt, was sich ihr in den Weg stellt: Er verdoppelte seinen Eifer bei der Arbeit, seine Hingabe beim Gebet, seine Schärfe bei der Debatte, und wenn er allein war, versank er noch tiefer in Niedergeschlagenheit und Depression. In seinem entbehrungsreichen Leben fand der Junge keinen anderen Weg zur Selbstverwirklichung als die Arbeit. Er stellte alle seine Kameraden in den Schatten und war imstande, sich stundenlang Gott zu widmen und ständig den Namen des Höchsten zu sprechen. Während der letzten Tage des Schuljahrs konnte er zwanzig Stunden am Tag lernen, und so schloss er das Abitur als Bester ab. Dasselbe erwartete man auch für den Studienabschluss. Bester zu sein, wurde zu einem seiner Hauptziele, ebenso wie der Islam, der Arabismus und die Tugend. Niemandem gestattete er, sich seinen Leistungen auch nur anzunähern. Doch dank seiner außerordentlichen Kraft, seinem großen Selbstvertrauen und seinem festen Glauben an Gott hinterließ dieser Ehrgeiz keinen üblen Nachgeschmack. Er entfaltete seine Menschlichkeit zu voller Blüte, weil Glauben für ihn nicht fruchtlose Askese oder Selbstaufgabe bedeutete. Glauben heiße, sagte er gern, sich mit himmlischer Kraft zu füllen, um die höchsten Ideale Gottes auf Erden zu verwirklichen.
Mamun war ein wirklich außergewöhnlicher junger Mann, auch wenn er nicht von allen geschätzt wurde. Seine Überlegenheit rief auch Neider auf den Plan, und ungewollt stellte er durch sein Verhalten andere in schlechtes Licht. Außerdem behielt er seinen Hang zur Einsamkeit bei, die ihm während seiner langen Krankheit zur Natur geworden war. Ruppige gesellschaftliche Umgangsformen und ein mangelnder Sinn für Humor, gepaart mit gnadenloser Offenheit, ließen seine Bemerkungen häufig nach Peitschhieben klingen. Wer ihn nicht mochte, nannte ihn mal »den universitären Tölpel«, mal den »unerwarteten Messias«. »Mamun Radwan ist der Imam des Islams in unserer Zeit«, äußerte einmal ein Student: »In der guten alten Zeit führte Amr Ibn al-Ass2 den Islam in Ägypten durch seine Klugheit ein, und in Bälde wird Mamun Radwan ihn dort durch seine Plumpheit zum Verschwinden bringen.« Der junge Mann behielt seine Überlegenheit bei, auch wenn er sie bisweilen fürchtete und verabscheute. Jawohl, er fürchtete diesen unkontrollierbaren Drang, erhaben und abgehoben zu sein, und bat Gott um Hilfe dagegen. Aus demselben Grund war es ihm unmöglich, große Persönlichkeiten zu bewundern. Am Tag, als der König die Universität eröffnete, zögerte Mamun nicht, sich abschätzig über die bei der Feierlichkeit anwesenden Regierungsvertreter zu äußern. Und ebenso zuckte er verächtlich mit den Schultern, wenn er sah, wie Studenten sich begeistert über Männer zeigten, die sie Führer nannten. Von Parteien wollte er gar nichts wissen, und mit der ägyptischen Frage nichts zu tun haben. Es gebe nur eine einzige Frage, pflegte er sich zu ereifern, diejenige des Islams im Allgemeinen und des Arabertums im Besonderen.
Der unter den Studenten grassierende modische Atheismus ließ ihn seltsamerweise völlig unberührt. Das hatte seinen Grund wohl darin, dass er zu Studienbeginn schon dreiundzwanzig Jahre alt war und seinen Glauben an drei Dinge gefestigt hatte, von denen er sein ganzes Leben lang nicht mehr ließ: Gott, die Tugend und der Islam. Auch der neue Einfluss an der Universität brachte ihn davon nicht ab. Am unverrückbaren Felsen seines Glaubens brachen sich die Wogen der Psychologie, der Soziologie und der Metaphysik. Er trotzte aller Wissenschaft und aller Philosophie, zog aber beide zur Begründung und zur Stützung seines Glaubens heran, und groß war seine Freude, als er so herausragende Philosophen wie Platon, Descartes, Pascal und Bergson im Schatten Gottes fand. Außerdem bejubelte er innerlich die Versöhnung zwischen Wissenschaft, Religion und Philosophie, die das zwanzigste Jahrhundert verkündete. Heutzutage wird Materie als elektrische Ladung verstanden, der Seele gar nicht so unähnlich. So gewann die Spiritualität den Thron zurück, von dem sie gestoßen worden war. Die Gelehrten beschäftigten sich mit religiösem Denken, und die Männer der Religion orientierten sich an der Wissenschaft und der Philosophie. Ein Bravo also dem jungen gläubigen Philosophen!
Der junge Mann in Giseh unterschied sich von dem kranken Jungen in Tanta, der er damals war. Er war gelassener und offener geworden. Er konnte lächelnd den Frivolitäten Machgub Abdaldaims zuhören, konnte mit Ali Taha über den Wert der Religion und des Atheismus diskutieren und geduldig die Pfeile der Kritiker und der Spötter abfangen, außer wenn ihn der Zorn übermannte, seine Augen entflammten und ihn dieser schreckliche Blick überkam. Dann verließ ihn sein klares Denken, und seine Sicht trübte sich.
Unter seinen Kommilitonen fand der junge Mann jedoch auch aufrichtige Gläubige, und er fühlte sich mit seinen Überzeugungen nicht allein, obwohl es ihm nie gelang, jemanden für den Islam und das Arabertum zu gewinnen. Die Gemüter zu jener Zeit waren mit anderen Dingen beschäftigt: mit der ägyptischen Frage beispielsweise und der Verfassung von 1923, oder dem Boykott ausländischer Waren. Doch der junge Mann verzweifelte nicht in seiner Einsamkeit. Wie hätte ein Herz wie seines auch verzweifeln können?
Er hatte große Erwartungen, doch war sein Herz auch imstande, froh zu sein und das jetzige Leben in vollen Zügen zu genießen. Nun schaute er fast etwas ungeduldig aus dem Fenster und wünschte, die Straßenbahn könnte nach Heliopolis fliegen.
4
Ali Taha blieb in seinem Zimmer, bis die Sonne sich ihrem Untergang zuneigte. Er saß am Fenster, den Blick auf den Balkon eines kleinen, alten Hauses gerichtet, an dessen Eingang sich ein Zigarettenladen befand. Das Haus lag direkt gegenüber dem Studentenwohnheim an der Ecke der Asbastraße, der Verlängerung der Raschad-Pascha-Straße Richtung Dokki.
Bis auf den Tarbusch war er vollständig bekleidet, schick wie üblich. Wer seine kräftigen Schultern sah, hätte ihn für sportlich halten können. Ali Taha war ein gutaussehender junger Mann mit grünen Augen und beinahe goldblondem Haar, was auf eine gute Abstammung deutete. Er schaute erwartungsvoll und etwas unsicher hinüber, doch als schließlich ein junges Mädchen auf den gegenüberliegenden Balkon trat, wurde sein Blick lebendig und wach. Er stand auf und winkte mit beiden Händen, worauf sie zu ihm herüberlächelte und Richtung Straße wies. Daraufhin setzte er seinen Tarbusch auf und verließ zuerst das Zimmer, dann das Haus. Er trat auf die Raschad-Pascha-Straße hinaus und ging gemächlich die Hauptstraße entlang. Diese war beidseits gesäumt von hohen Bäumen, hinter denen sich Villen und Paläste erhoben. Von Zeit zu Zeit warf er einen Blick zurück, bis er im sanften Licht des Sonnenuntergangs die junge Dame vom Balkon erblickte, die ihm mit wiegendem Schritt folgte. Mit freudig pochendem Herzen machte er kehrt und ging ihr errötend entgegen, bis sich ihre Hände begegneten – die Rechte der Linken, und die Linke der Rechten – und der junge Mann einen Willkommensgruß murmelte, den die junge Frau mit strahlendem Lächeln und leuchtenden Augen erwiderte.
Freundlich zog sie ihre Hände zurück und hängte sich bei ihm ein, und gemeinsam schlenderten sie gemütlich Richtung Gisehstraße. Achtzehn Jahre war das Mädchen alt. Es hatte eine helle, elfenbeinfarbene Haut und schwarze Augen, die unter den Wimpern einen besonderen Zauber verströmten. Der Kontrast ihres pechschwarzen Haares zur hellen Haut war auffallend. Ihr grauer Mantel umschloss einen geschmeidigen, reifen Körper, der Zauber und Glanz ausstrahlte. Sie schlenderten dahin, ein Anblick voller Jugend und Leben. Ali Taha tastete vorsichtig mit dem Blick die Straße nach allen Seiten ab, als fürchtete er eine unangenehme Überraschung. Die junge Frau betrachtete ihn verstohlen in sehnsuchtsvoller und freudiger Erwartung. Als der junge Mann sich schließlich überzeugt hatte, dass niemand sie beobachtete, legte er seine Finger unter ihr Kinn, zog ihr Gesicht zu sich und drückte seine Lippen zu einem warmen Kuss auf die ihren. Als er sein Gesicht wieder hob, seufzte er tief auf, und schweigend setzten sie ihren Weg fort. Sie sah, wie er sie musterte, und da fiel ihr, trotz der Faszination des Augenblicks, der elende Zustand ihres Mantels ein, was ihre Freude sofort trübte.
»Dir gefällt es wohl nicht, dass ich immer denselben schäbigen Mantel trage?«, fragte sie, ohne es eigentlich zu wollen.
Über das Gesicht des Mannes legte sich ein Schatten des Missfallens. »Wie kannst du nur an so etwas Triviales denken?«, sagte er tadelnd. »In diesem Mantel steckt ein Schatz, dem ich all mein Glück verdanke.«
Für sie war der Mantel keine Trivialität. Schon oft hatte sie bedauernd zu sich selbst gesagt, zu einem glücklichen Leben gehöre es, jung zu sein und etwas Hübsches zum Anziehen zu haben. Sie bemerkte seinen schicken wollenen Anzug und hatte Lust, es ihm heimzuzahlen. »Schöne Argumente sind mir das!«, protestierte sie. »Du bezeichnest Kleider als Trivialitäten und kommst selber so schick und schmuck daher.«
Nun wurde er schamrot. Er sah aus wie ein verunsichertes Kind und versuchte es mit einer Entschuldigung. »Der Anzug ist neu. Man kann sich ja keinen alten Anzug kaufen. Trotzdem sind Kleider Trivialitäten, Äußerlichkeiten, oder etwa nicht, Liebling?«
Doch sie ging Diskussionen dieser Art mit ihm aus dem Weg, Diskussionen, die er nur allzu gern nutzte, um sich ihr gegenüber als Lehrer aufzuspielen, was sie ganz und gar nicht mochte. Auch war er selbst keineswegs frei von Widersprüchen. Immer wieder äußerte er sich verächtlich über Garderobe, Speisen oder Klassenunterschiede, und dann besaß er die schicksten Anzüge, aß gut und reichlich und gab ziemlich viel Geld aus. Außerdem hatte sie, Ichsan Schahata, ihm etwas zu sagen, und sie wusste, er brannte darauf, es zu hören.
»Ich bin beinahe fertig mit dem Buch, das du mir geliehen hast«, erzählte sie in ihrer weichen, schalkhaften Stimme.
Auf seinem Gesicht zeigte sich Interesse. Er wollte ihren Intellekt ebenso lieben wie ihre Persönlichkeit.
»Und was hältst du davon?«, wollte er wissen.
»Ich habe nicht viel davon verstanden«, gab sie zu. »Und mit dem wenigen konnte ich nichts anfangen.«
»Warum denn das?«, fragte er enttäuscht.
Sie lächelte ihn an, um ihre Worte zu mildern. »Das Buch, das du eine Geschichte nennst, besteht hauptsächlich aus Gedanken und Ansichten«, erklärte sie. »Ich suche in einem Buch nach Leben und Gefühl.«
»Aber das Leben besteht aus Denken und Fühlen.«
Nun nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und wehrte sich. »Versuch nicht, mich mit deiner Logik einzuschnüren. Möglicherweise kann ich sie nicht widerlegen, doch das ändert nichts an meinem Geschmack. Für mich ist die Musik das Kriterium der wahren Kunst, und was in einem Buch mit dieser nichts zu tun hat, sollte gar nicht Kunst heißen.«
Ihre Ansicht entsetzte ihn. Er versuchte ein müdes Lächeln und sagte bedauernd: »Damit verzichtest du auf die schmackhaftesten Früchte der wahren Kunst.«
Sie lachte. »Magdulin3, Die Leiden des jungen Werther und Raphaels Schmerzfiguren – das sind Kunstwerke, wie ich sie liebe.«
Sie sagte das, als wollte sie den berühmten Koranvers »Ihr habt eure Religion, ich die meine« zitieren. Und so schwieg der junge Mann und fragte sich nur, ob er wirklich die Hoffnung aufgeben müsse, ihre Ansichten zu ändern. Er wünschte aufrichtig, dass ihre Liebe in Herz und Verstand Eingang fand, dass ihre Beziehung umfassend und harmonisch und sie für ihn Geliebte, Gefährtin und eine geachtete Kollegin würde. Sein Herz und seine Seele waren von Liebe zu ihr beherrscht, doch er hoffte auch, aus ihr eine Ehefrau zu machen, wie man sie in orientalischen Haushalten nicht kannte.
An der Gisehstraße bogen sie links ab. Der junge Mann seufzte erleichtert auf. Die Straße war menschenleer und das Wetter eher trüb. Er hob ihre Hand zu seinem Mund und küsste sie leidenschaftlich. Dann neigte er sich zu ihr hinab und holte sich von ihren vollen, frischen Lippen einen süßen Kuss. Als er sah, dass sie ihre Augen geschlossen hielt, erschauerte sein kräftiger Körper, und Funken der Freude durchschossen ihn. Stockend brachte er hervor: »Wie lieb du bist, und wie schön.«
Zauberhafte Augenblicke wohltuender Stille gingen vorüber, dann seufzte er wie bedauernd. »Bis zu meinem Abschlussexamen sind es nur noch ein paar Monate. Und bei dir?«
»Mein Abitur ist im Juni. Wo, denkst du, sollte ich studieren?«
»An meiner Fakultät«, antwortete er sofort.
Obwohl sie ihre Ausbildung abschließen musste, hätte sie es gern gehört, wenn er ihr vorgeschlagen hätte, aufzuhören, um ihr gemeinsames Nest einrichten zu können. Darum fragte sie etwas reserviert, warum er denn seine Fakultät vorschlage.
»Damit wir im Geist, in der Kunst und im Beruf vereint sind.«
»Im Beruf?«
»Natürlich, Liebling«, rief er, noch immer begeistert. »Die Aufgabe einer Frau besteht doch aus mehr als darin, eine Hausmagd zu sein. Ich kann der Gesellschaft unmöglich ein so schönes und nützliches Mitglied vorenthalten, wie du es bist. Das wäre ein Verrat an meinen Prinzipien.«
Im Grunde genommen teilte sie seine Ansicht, denn schon aus finanziellen Gründen würde sie eines Tages einer beruflichen Tätigkeit nachgehen müssen. Doch irgendwie, sie wusste selbst nicht, wie, verstimmte sie diese Begeisterung für seinen eigenen Vorschlag. Ihr wäre es lieber gewesen, ihn – gegen sein Zweifeln und Zögern – selbst davon überzeugen zu müssen.
Sie schlenderten die menschenleere Straße entlang und unterbrachen das lebhafte Gespräch über ihre Träume hin und wieder mit einem Kuss.
Ichsan Schahata hatte ein besonderes Gespür für zwei Dinge: für ihre Schönheit und ihre Armut. Ihre Schönheit war in der Tat außergewöhnlich. Das gesamte Studentenwohnheim war ihr verfallen, die Bewohner aller Zimmer sandten das Feuer ihrer Seelen herab auf den Balkon des kleinen, schäbigen Hauses und warfen sich der stolzen Schönheit zu Füßen. Doch in ihrem Heim befand sich kein Spiegel, der jene strahlende Schönheit wahrhaftig zeigte, denn auch die Armut war eine nur allzu sichtbare Wahrheit, die ihre sieben Brüder, alle jünger als sie, ihr unablässig in Erinnerung riefen. Ebenso die Tatsache, dass sie alle von einem Zigarettenkiosk von gerade einmal einem Quadratmeter Grundfläche lebten, dessen Kundschaft fast ausschließlich aus Studenten bestand. Oft schon hatte sie gefürchtet, dass die Folgen der Armut, schlechte Ernährung beispielsweise, ihre Schönheit beeinträchtigen könnten. Und ohne die Rezepturen ihrer Mutter, die vor ihrer Heirat mit Meister Schahata Turki Sängerin in der Muhammad-Ali-Straße gewesen war, wäre sie abgemagert, und ihre Hinterbacken, die doch ein Poet an der Medizinischen Fakultät in einem wohlklingenden Gedicht gepriesen hatte, wären gewelkt.
Als sie Ali Taha kennenlernte, gab ihr Herz ihm vor allen Studenten des Heims den Vorzug. Seine Jugend, sein gutes Aussehen, seine Familie und seine beruflichen Perspektiven nahmen ihn für sie ein. Doch vom ersten Augenblick an lagen zwei gewichtige Faktoren miteinander im Streit: ihr Gefühlsleben und ihr Familienleben, anders ausgedrückt: Ali Taha und ihre sieben Brüder. Vor Ali Taha war sie von einem betuchten Jurastudenten umworben worden. Aus dessen Verhalten hatte sie jedoch geschlossen, dass er bei ihr nur Sinnesfreude und jugendlichen Zeitvertreib suchte, und war deshalb auf der Hut vor ihm. Vor ihren Eltern hatte sie keine Geheimnisse, aber das Drängen ihrer Mutter und die Gier ihres Vaters nach dem Geld des jungen Mannes hatten sie wirklich beunruhigt und früh mit den bitteren Fakten und traurigen Geheimnissen des Lebens bekannt gemacht.
Ihre Eltern, das war unbestreitbar, hegten in moralischen Fragen keinerlei Skrupel. Ihre eigene Verbindung war als Leidenschaft entstanden, die in eine Ehe mündete. Ihr Vater hatte sich seinen Lebensunterhalt mit Charme und Unverfrorenheit auf dem Markt des guten Aussehens verdient, bis ihre Mutter ihn heiratete und ihm für seine Geschäfte ihr ganzes Erspartes überließ. Doch er verschleuderte das Geld mit Drogen und Glücksspiel, und schließlich blieb ihm nur der kleine Zigarettenladen. Er hielt sein eigenes Leben für vergeudet, tröstete sich aber immer damit, dass doch auf Ichsan der Segen ruhe. Ichsan ihrerseits sah ihre Eltern als willige Handlanger des Satans, die auf ihren Fall hinwirkten. Sie jedoch hatte keine Eile zu fallen. Sie hatte bemerkt, was sie nicht hätte bemerken sollen: eine Demütigung. Ihr Stolz begehrte auf, und das rettete sie.
Eines Tages fand sie ihren Freund mit ihrem Vater im Laden zusammensitzen und hörte, wie die beiden über den Preis für ihre Tugend feilschten. Sie fühlte sich entwürdigt und entehrt und wurde fuchsteufelswild. Sie brach rigoros mit dem jungen Mann und beraubte ihn jeder Hoffnung. Aus diesem Erlebnis ging sie siegreich hervor, doch erst, nachdem sie sich klar geworden war, dass sie an einem Abgrund lebte. Danach spürte sie plötzlich in ihrem tiefsten Innern, dass sie sich aus der Kontrolle und den Fesseln gelöst hatte, dass sie frei war zu tun, was sie wollte, ohne jemandem Rechenschaft schuldig zu sein. Dieses Gefühl absoluter Freiheit führte zu einer Revolte, die zunächst ohne rechtes Ziel, aber auch ohne Hindernis blieb. Wilde Gefühle erwachten in ihr, regten sich und brachen sich Bahn, auch wenn Scham und Zurückhaltung sie eindämmten. Die Atmosphäre war drückend, aber atmen konnte sie. Die Umstände deuteten auf einen unausweichlichen Ablauf hin. Ihr schamloser Vater, der dem wohlhabenden jungen Mann nachtrauerte, machte ihr klar, dass sie die Verantwortung für sie alle, besonders für ihre sieben Brüder trage. Gott im Himmel, wie konnte sie angesichts solcher Argumente an ihren Wünschen festhalten? Konnten sie sich denn nicht etwas gedulden, bis sie ihre Ausbildung am Lehrerseminar abgeschlossen und eine anständige Stelle gefunden hatte, die sie alle ernährte?
Willensschwach hatte sie sich in ihr Schicksal ergeben, ohne Überzeugung und ohne Glauben. Doch dann kam Ali Taha. Bei ihm fand sie echte Zuneigung, tiefe Aufrichtigkeit und ein hehres Ziel. Er stärkte ihren erschütterten Willen, barg sie aus den Fluten der Unsicherheit und der Angst und gab ihr das Gefühl von Achtung und Stolz zurück. Sie liebte ihn und knüpfte ihre Hoffnungen an ihn. Meister Schahata Turki jedoch betrachtete den neuen jungen Mann mit Missfallen. Er sei ein armer Schlucker, nörgelte er; nicht einmal Zigaretten rauche er. Und zu seiner Tochter bemerkte er einmal beißend: »Glückwunsch zu dem schmucken Jüngling, den Gott geschickt hat, um uns auszuhungern.« Doch sie ließ sich nichts anhaben. Sie setzte ihre Hoffnung auf die Zukunft, die einen anständigen Beruf für sie bereithielt und die Verwirklichung der Träume ihres Herzens erlaubte.
Ali Taha war ein junger Mann mit vielen guten Eigenschaften, ein hervorragendes Beispiel für ein hoch entwickeltes gesellschaftliches Bewusstsein. Schon in der Oberschule war er ein führendes Mitglied der Spezialabteilung, der Schulausflugskommission und der Diskussions- und Zeitungsgruppe gewesen. Er konnte ausgezeichnet reden, debattieren, kochen und singen; außerdem besaß er eine lobenswerte Vorliebe für Unterweisung und Kultur und eine aufrichtige Bindung an die Tugend. Mit seinem Eintritt in die Universität verengte sich der Bereich seiner Aktivitäten zwar, vertiefte und erhöhte sich aber gleichzeitig. »Herr Ali« wurde Präsident der Debattiervereinigung und zeichnete sich vor seinen Kommilitonen durch seine rhetorischen Fähigkeiten, seine Allgemeinbildung und Schlagfertigkeit aus. Er interessierte sich für hohe Ideale und sprach enthusiastisch und voller Begeisterung vom Musterstaat. Wer ihn kannte, glaubte ihm, doch manch kritische Geister verbreiteten allerhand Behauptungen über ihn. Er sei ein ganz schlauer Fuchs und dränge sich unter dem Mantel der Tugend in jeglichen Zirkel, um im Namen von Wissenschaft und Anstand hinter den schönen Mädchen her zu sein; er rede von der Moral wie eine Heiratsvermittlerin über eine Braut, die sie noch nie zu Gesicht bekommen habe. Aber das waren Übertreibungen und Lügen. Denn tatsächlich war der junge Mann offen und ehrlich, und wenn er die Schönheit liebte, so tat er es mit Anstand und Aufrichtigkeit. Doch auch sein Leben kannte schmerzhafte Krisen. Der Eintritt in die Universität hatte ihn in seinen Glaubensfesten erschüttert, und er sah sich quälenden Veränderungen ausgesetzt. Doch er war mutig und ehrlich und trat dem neuen Leben mit energischem Willen und wahrheitsdurstigem Verstand entgegen. Er war kein schamloser Spötter und hielt nicht mit seiner Bewunderung für Mamun Radwans Ehrlichkeit und Mut hinterm Berg, obwohl er sich gleichzeitig der materialistischen Philosophie in die Arme warf: Hegel, Ostwald und Mach. Er glaubte an die materialistische Interpretation des Lebens und stimmte vollkommen überein mit der These, Existenz sei Materie, Leben und Geist seien komplexe materielle Prozesse, und die Empfindung sei ein zwangsläufiges, aber spurenloses Charakteristikum, wie das Geräusch eines Rades beim Drehen, das ja auch keine Wirkung habe. Immer wieder hatte Mamun Radwan ihm erklärt, die materialistische Philosophie sei simpel, löse aber gleichzeitig kein einziges Problem zufriedenstellend. Doch Ali Taha war ein sozial orientierter junger Mann und viel zu ungeduldig für lange Reflexionen. Er brauchte eine Woche, um das zu lernen, was Mamun Radwan sich in zwei Tagen einverleibte. Denn neben der Zeit, die er für das Lesen vorsah, brauchte er Zeit für den Sport, das Debattieren, das Reisen, die Liebe und so weiter. Für sein Leben genügten ihm diese allgemeinen philosophischen Erklärungen. Es gab da jedoch ein Problem, das zum gefährlichen Abgrund zu werden drohte: die Moral. Früher baute er seine Moral fest auf der Religion auf. Worauf sollte er sie jetzt aufbauen? Was konnte, nach Gott, den Wert der Tugenden ersetzen? Oder sollte er sie aufgeben wie sein früheres Credo und sich dann kopfüber, gedanken- und bedenkenlos, in den Lebensstrom stürzen? Die Logik war klar und der Weg unabänderlich, doch er zögerte, hielt sich zurück und schützte sich mit der Kraft der Trägheit. War es denn unmöglich, zu leben wie Abu-l-Ala al-Maarri4?, fragte er sich. Aber dieser war blind, pockennarbig und melancholisch, er dagegen war ein strammer, gut aussehender, geselliger junger Mann. Wie sollte er da für ein asketisches Einsiedlerleben infrage kommen? Er war ähnlich ratlos wie Ichsan Schahata, nachdem sie sich vom Schatten ihrer Eltern befreit hatte. Schließlich fand er seinen Retter in Auguste Comte, so wie sie ihren in ihm fand. Er begegnete dem Gesellschaftsphilosophen, der ihm einen neuen Gott, die Gesellschaft, und eine neue Religion, die Wissenschaft, verkündete. Er glaubte an die menschliche Gesellschaft und an die menschliche Wissenschaft, und er war überzeugt davon, dass der Atheist ebenso wie der gläubige Monotheist Prinzipien und Ideale erkennt, wenn er den festen Willen dazu hat; außerdem davon, dass das Gute tiefer in der menschlichen Natur verwurzelt sei als die Religion, da der Mensch in alter Zeit die Religion geschaffen habe, nicht die Religion den Menschen, wie er, Ali Taha, einst geglaubt hatte. »Früher war ich tugendhaft durch Religion ohne Verstand«, begann er sich einzureden, »jetzt bin ich tugendhaft durch den Verstand ohne irgendwelchen Aberglauben.«
Überzeugt und getrost und voller Eifer und Kraft kehrte er zu seinen hohen Idealen zurück. Leidenschaftlich vertrat er Sozialreformen und träumte vom Paradies auf Erden. Er studierte gesellschaftswissenschaftliche Theorien, und schließlich nannte er sich gern einen Sozialisten. So endete sein geistiger Rundgang, der in Mekka begonnen hatte, in Moskau. Irgendwann wollte er sogar seine nächsten Freunde zum Sozialismus bekehren, doch hatte er damit kein Glück. Achmad Badir entschuldigte sich, er sei wafdistischer Journalist, und der Wafd sei eine kapitalistische Partei. Mamun Radwan erklärte mit der für ihn typischen Überzeugung, der Islam kenne seinen eigenen Sozialismus: die Almosenabgabe, die, genau befolgt, Gerechtigkeit garantiere, ohne die natürlichen Instinkte zu unterdrücken, die den Menschen in seinem Kampf unterstützten. Wenn er also nach einer Weltenordnung suche, die wahre Brüderlichkeit, Glückseligkeit und Gerechtigkeit schaffe, so müsse das der Islam sein. Machgub Abdaldaim zuckte nur verächtlich mit den Schultern und sagte kurz und bündig: »Quatsch.«
Wie dem auch sei, Ali Taha hatte für sein Leben ein Ziel gefunden, das ihn vor der Unsicherheit, dem Chaos und dem Verderben bewahrte. Und so konnte er freudig von sich sagen: »Hier meine Kennkarte, die keinerlei Erläuterungen bedarf: armer atheistischer Sozialist und ehrbarer platonischer Liebhaber.«
5
Auch Machgub Abdaldaim wartete in seinem Zimmer, zog sich aber nicht um. Er besaß nämlich, im Gegensatz zu seinen beiden Freunden, keinen speziellen Donnerstagabendanzug. Von seinem Fenster aus betrachtete er die Straße und sah Mamun Radwan forschen Schritts das Haus verlassen. Er bemerkte auch den Liebeswink auf dem Balkon des kleinen alten Hauses und sah kurz darauf die beiden Liebenden sich nacheinander auf der Raschad-Pascha-Straße einfinden. Beiden ließ er ein spott- und grollschweres »Quatsch« folgen. Auch er wartete auf sein Rendezvous, doch zog er die Dunkelheit vor und schätzte den Schutz der Nacht. Das Heim war praktisch leer, bis auf ihn.
Machgub Abdaldaim war, wie Mamun Radwan, groß und schlank, hatte jedoch blasse Haut und krauses Haar. In seinem Gesicht stachen die honigfarbenen Augen und die nach oben gewandten Brauen hervor. Dazu kam ein ängstlicher, gehetzter Blick, aus dem Spott und Widerstandsgeist blitzten. Er sah zwar, im Gegensatz zu seinen beiden Freunden, nicht gut aus, doch waren seine Gesichtszüge auch nicht besonders hässlich. Wer ihn ansah, bemerkte sofort sein trotziges Äußeres und lebte in ständiger Furcht vor einem Witz, einem Scherz oder einer beißenden Bemerkung aus seinem Mund.
Machgub Abdaldaim sah sich einem Leben voller Schwierigkeiten gegenüber, an deren oberster Stelle sein sexuelles Problem rangierte, das er als ebenso schwer lösbar einschätzte wie die ägyptische Frage. An Ichsan Schahata, die schon lange den Vulkan seiner Leidenschaft entfacht hatte, sah er das Gleiche wie an allen Frauen: eine Brust, einen Hintern und zwei Schenkel. Schon eine dieser Sehenswürdigkeiten genügte, um in seiner Brust ein elektrisches Funkengestöber auszulösen. Doch das Mädchen traf eine weise Wahl, indem sie dem blonden Jüngling mit den grünen Augen den Vorzug gab. Und so blieb Machgubs Leben trist und einsam, sein Herz in Finsternis und sein Geist in ständigem Aufruhr.