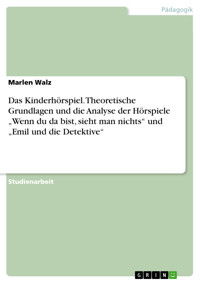
Das Kinderhörspiel. Theoretische Grundlagen und die Analyse der Hörspiele „Wenn du da bist, sieht man nichts“ und „Emil und die Detektive“ E-Book
Marlen Walz
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1,3, , Sprache: Deutsch, Abstract: Viele Kinder im Grundschulalter hören gerne Geschichten. Sie lauschen aufmerksam ihren Großeltern beim Geschichten erzählen oder wünschen sich abends vor dem Schlafen gehen noch eine Gute-Nacht-Geschichte. Auch Kinderhörspiele sind daher für die Jungen und Mädchen ein sehr attraktives Medium. Bei dem Zuhören der Erzählungen regen die Kinder nicht nur ihre Phantasie an, sondern erweitern auch ihre Sprachkompetenz und lernen das genaue Hinhören. Aus diesem Grund ist das Medium für den Deutschunterricht in der Grundschule sehr interessant. Doch in der Praxis kommt dieses leider häufig zu kurz, da andere Medien wie beispielsweise das Video im Vordergrund stehen. Dabei eignet sich das Hörspiel aufgrund der weniger kostspieligen Anschaffung besonders gut für den Unterricht in der Schule. Außerdem ist es weiniger komplex als andere Medien und vielseitig einsetzbar. Vor dem Einsatz im pädagogischen Bereich sollten Hörspiele analysiert werden, um ihr Potential für den Unterricht beurteilen zu können und eine geeignete, kindgerechte Auswahl treffen zu können. Im Folgenden möchte die Verfasserin nun zwei Kinderhöspiele unter Zuhilfenahme verschiedener Kriterien nach Böckelmann analysieren und den pädagogischen Nutzen der Medien aufzeigen. Im ersten Teil der Hausarbeit werden zunächst kurz die theoretischen Grundlagen zusammengefasst, die dieser Analyse zugrunde liegen. Im Anschluss daran folgt die Analyse der Hörspiele „Wenn du da bist sieht man nichts“ von Martin Daske sowie „Emil und die Detektive“, geschrieben von Erich Kästner. Auf der Grundlage der Analyse wird in einem abschließenden Fazit das pädagogische Potential der Kinderhörspiele für den Deutschunterricht bewertet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Die Geschichte des Hörspiels
2.2 Merkmale eines Kinderhörspiels
2.3 Strukturelemente eines Hörspiels
3 Hörspielanalyse
3.1 Analyse des Hörspiels „Wenn du da bist, sieht man nichts“
3.2 Analysen des Hörspiels „Emil und die Detektive“
3.2.1 Bewertungskriterien
4 Fazit
5 Quellenangaben
1 Einleitung
Viele Kinder im Grundschulalter hören gerne Geschichten. Sie lauschen aufmerksam ihren Großeltern beim Geschichten erzählen oder wünschen sich abends vor dem Schlafen gehen noch eine Gute-Nacht-Geschichte. Auch Kinderhörspiele sind daher für die Jungen und Mädchen ein sehr attraktives Medium. Bei dem Zuhören der Erzählungen regen die Kinder nicht nur ihre Phantasie an, sondern erweitern auch ihre Sprachkompetenz und lernen das genaue Hinhören. Aus diesem Grund ist das Medium für den Deutschunterricht in der Grundschule sehr interessant. Doch in der Praxis kommt dieses leider häufig zu kurz, da andere Medien wie beispielsweise das Video im Vordergrund stehen. Dabei eignet sich das Hörspiel aufgrund der weniger kostspieligen Anschaffung besonders gut für den Unterricht in der Schule.[1] Außerdem ist es weiniger komplex als andere Medien und vielseitig einsetzbar.[2] Vor dem Einsatz im pädagogischen Bereich sollten Hörspiele analysiert werden, um ihr Potential für den Unterricht beurteilen zu können und eine geeignete, kindgerechte Auswahl treffen zu können.
Im Folgenden möchte die Verfasserin nun zwei Kinderhöspiele unter Zuhilfenahme verschiedener Kriterien nach Böckelmann analysieren und den pädagogischen Nutzen der Medien aufzeigen. Im ersten Teil der Hausarbeit werden zunächst kurz die theoretischen Grundlagen zusammengefasst, die dieser Analyse zugrunde liegen. Im Anschluss daran folgt die Analyse der Hörspiele „Wenn du da bist sieht man nichts“ von Martin Daske sowie „Emil und die Detektive“, geschrieben von Erich Kästner. Auf der Grundlage der Analyse wird in einem abschließenden Fazit das pädagogische Potential der Kinderhörspiele für den Deutschunterricht bewertet.
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Die Geschichte des Hörspiels
Erst seit 1923 gibt es in Deutschland regelmäßige Rundfunksendungen, die hauptsächlich als Distributionsmedium von Musik und Literatur verstanden werden.[3] Hier beginnt auch die Geschichte des Kinderhörspiels, da Kindersendungen bald Teil des Rundfunkprogramms wurden. Anfangs sendete der Rundfunk Hörbilder, bei denen verschiedene, aneinandergereihte akustische Schauplätze ausgestrahlt wurden.[4] Später entwickelte sich die Hörbühne, die meist Dramenliteratur vertonte und sich somit zu einem akustischen Schauspiel herausbildete.[5] Auch „das Kinderhörspiel konstituierte sich aus dem Kindertheater“[6], dessen Gegenstand hauptsächlich Märchen sind.
Diese neu entstandene Kunstform orientierte sich bald an der zeitgenössischen Kinder- und Jugendliteratur. Besonders geprägt wurde die Geschichte des Hörspiels durch die „Hörspielmacher“ Bertolt Brecht und Walter Benjamin in den 1930er Jahren.[7] Hier kommen außerdem erstmalig die Forderung nach der kommunikativen Funktion des Rundfunks sowie die Nutzung des Mediums als didaktisches Mittel auf.[8] In der Zeit des Nationalsozialismus werden meist Märchenhörspiele für Kinder ausgestrahlt, die auf eine „emotionale Bewegung des kindlichen Hörers ausgerichtet“[9] sind und dem Zweck der Propaganda dienen[10]. Nach dem zweiten Weltkrieg war die Rundfunkpolitik von den Alliierten geprägt.[11] Es gab kaum Neuerungen und das Hörspiel wurde weiterhin als dramatisch-literarische Form verstanden.[12] Hervorzuheben ist in dieser Zeit die Stellung des Rundfunks als nahezu konkurrenzloses elektronisches Medium, zu dessen Nutzern selbstverständlich auch die Kinder zählten.[13] Das Kinderhörspiel orientierte sich in dieser Zeit vor allem an der Kinderliteratur und war daher meist literarisch wortzentriert.[14]





























