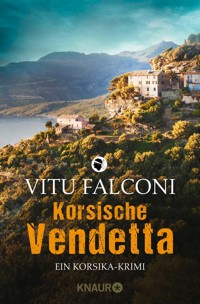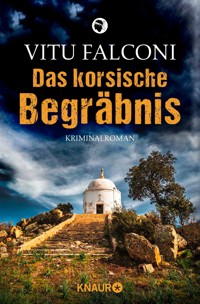
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Eric Marchand
- Sprache: Deutsch
Malerische Strände, zerklüftete Berge und letzte Heimat der Blutrache: »Das korsische Begräbnis« von Vitu Falconi ist der Start in die erste Urlaubs-Krimireihe mit Schauplatz Korsika und jeder Menge Nervenkitzel. Der erfolgreiche französische Krimi-Autor Eric Marchand steckt in einer Schaffenskrise. Sein neuer Roman geht ihm nicht von der Hand. Eine schöpferische Pause muss her – und da seine Urgroßmutter gebürtige Korsin war, bietet sich die faszinierende Insel im Mittelmeer als Urlaubsziel an. Bei seiner Ankunft im Bergdorf Speloncato wird Eric zufällig Zeuge eines korsischen Begräbnis-Rituals. Ein Mann ist bei der Wildschweinjagd ums Leben gekommen, aufgeschlitzt von den Eckzähnen – so die offizielle Version. Eric verfolgt die Zeremonie, und es kommt ihm vor, als verliefe ein unsichtbarer Graben zwischen den Trauergästen. Stumme Blicke, Tränen, grimmiges Kopfschütteln, schließlich: Gewaltbereitschaft. Erics Neugier ist geweckt. Er mietet ein Zimmer bei der mitteilungsfreudigen Madame Borghetti und beginnt nachzuforschen. Bald schon geschehen eigenartige Dinge, und er muss erkennen, dass die fremde Gegend und ihre Geschichte mehr mit ihm selbst zu tun haben, als ihm lieb ist ... Vitu Falconi, hinter dem sich Bestseller-Autor Thomas Thiemeyer verbirgt, arbeitet bereits an weiteren korsischen Fällen für Eric Marchand!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Vitu Falconi
Das korsische Begräbnis
Ein Korsika-Krimi
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Mann kommt bei der Wildschweinjagd zu Tode – allerdings nicht durch das Schwein. Ein Schriftsteller stellt Fragen zu seiner Familie – und gerät dabei in eine jahrhundertealte Blutfehde. Und er trifft auf eine verschlossene junge Frau, die ihn als einzige vor einem furchtbaren Schicksal bewahren kann … Willkommen auf Korsika, mit einer Landschaft so archaisch, so wild und ungezähmt wie seine Menschen. Wo Millionen von Touristen ebenso zum Alltag gehören wie geheimnisvolle Rituale, Vendetta und Gewalt.
»Das korsische Begräbnis« von Vitu Falconi ist der Start in die erste Urlaubs-Krimireihe mit Schauplatz Korsika und jeder Menge Nervenkitzel!
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
Leseprobe
Der Ungewissheit gewidmet
Nessuna Certezza
Ghjuntu u timpurali i ghjàcarifacini a so casa.
Wenn ein Gewitter in der Luft liegt, verkriechen sich Hunde und Katzen in den Häusern.
(Korsisches Sprichwort)
1
In jenen frühen Morgenstunden nahm Paolo Cesari die Welt intensiver wahr als jemals zuvor. Die harzig duftende Macchia, über die kürzlich der erste Regen niedergegangen war. Die aufgeweichte Erde, die nach Oregano und Rosmarin roch. Sowie die Kastanien, deren süßlich moderndes Laub an manchen Stellen eine rutschige Bodenschicht gebildet hatte. All das war in seiner Intensität gleichsam vertraut wie beunruhigend. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es vielleicht das letzte Mal war, dass er diese Luft atmen durfte.
Er wischte mit dem Handrücken den Schweiß von seiner Stirn. Ihm war warm geworden. Während die sternklaren Nächte und frostigen Morgenstunden bereits einen Vorgeschmack des Winters in sich trugen, kam später am Tag der Sommer zurück. Dann ließen einen die erhitzten Felsen, die plätschernden Bäche und schweren Kräuteraromen vergessen, dass die dunkle Jahreszeit bereits ihre dürren Finger ausstreckte.
Paolo sog die Luft ein und öffnete den Mantel. Das schwere Tuch war feucht vom Schweiß. Hinter dem stahlblauen Himmel erhob sich scharf und kantig das Profil des Monte Cintu, des Königs der Berge, in dessen Schatten Paolo sein ganzes Leben verbracht hatte. Er, seine Frau sowie seine beiden Söhne, die bald keinen Vater mehr haben würden. Ghjuvanni, mit seinen pechschwarzen Strubbelhaaren, der breiten Zahnlücke und den sanften braunen Augen. Er würde nächsten Monat dreizehn werden. Fast schon ein Mann. Um ihn machte sich Paolo keine Gedanken. Er würde es verstehen.
Es war Saveriu, der seine Hilfe brauchte. Der Kleine hing an ihm wie die Klette am Wollpullover. Mit seinen neun Jahren war er noch ein Frischling. Wer, wenn nicht sein Vater, würde künftig mit ihm die kleinen Ziegen an die Zitzen der Mütter zurücktreiben, die halbwilden Schweine mit Kastanien bewerfen oder die Wälder nach Pilzen durchstreifen? Wer würde ihm abends Geschichten erzählen und ihm zeigen, wie man mit der Schleuder umging – seine Frau? Gewiss, Ghjulia war wunderbar. Sie war seine Geliebte, seine Vertraute, die beste Köchin der Welt. Aber sie war eben nur eine Frau. Und ab morgen würde sie Witwe sein. Sie würde ihre farbigen Kleider gegen das traditionelle Schwarz tauschen und selbst darin umwerfend aussehen. Sie würde ihren Söhnen erzählen, was geschehen war, und damit etwas in Gang setzen, was auf Korsika seit Jahrhunderten Tradition hatte: die Blutfehde, auch Vendetta genannt. Söhne rächten ihre Väter, Enkel ihre Großväter. Ein immerwährender Kreislauf, der nicht deswegen endete, weil Menschen sich anschickten, den Mars zu erobern oder das Atom in noch kleinere Bestandteile zu spalten. In der großen weiten Welt mochte das von Bedeutung sein, hier auf Korsika aber zählten andere Dinge. Jungs brauchten ihren Vater. Einen Mann, zu dem sie aufschauen konnten. Der ihnen das Jagen beibrachte, der sie lehrte, wie man mit dem Messer umging und einen Hund abrichtete. Sie brauchten jemanden, der sie in den Umgang mit anderen Männern einwies und sie den strengen Ehrenkodex lehrte, der den Korsen seit Jahrhunderten in Fleisch und Blut übergegangen war. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Bei dem Gedanken an seine Söhne wurde ihm schwer ums Herz. Am liebsten wäre er zurückgegangen, hätte sie in den Arm genommen und gesagt: Tut es nicht. Lasst nicht den Wunsch nach Rache euer Leben überschatten. Befleckt nicht eure Hände mit Blut, das ihr nie wieder abwaschen könnt.
Aber dafür hätte er den Lauf der Gestirne ändern müssen. Solange die Sonne im Osten aufging, würde sich hier nichts ändern.
Er zuckte zusammen. Über den nördlichen Hügeln sah er Silhouetten. Aufgereiht wie auf einer Perlenschnur. Da waren sie. Die Füße in schweren Lederstiefeln, gekleidet in Tarnjacken und Hosen, Gewehre über den Schultern und Schirmmützen auf dem Kopf, standen sie mit mindestens zwanzig Meter Abstand zueinander. Sie alle hatten nur ein Ziel: ihn.
Als Paolo sie von Vallica hatte herabkommen sehen, war ihm klar geworden, dass seine Zeit abgelaufen war. Sie würden ihn nicht entkommen lassen. Der Clan hatte beraten, der Clan hatte entschieden.
Paolo senkte den Blick und streichelte Lumio über den Kopf. Der Atem des Cursinu kondensierte zu weißen Wölkchen. Aus dem feuchten Fell stieg Dampf auf. Die gelben und braunen Streifen waren mit Tautropfen bedeckt. Sein Hund war der Letzte, der jetzt noch zu ihm stand.
»Komm«, sagte Paolo. »Machen wir uns auf den Weg.«
Der Pfad war kaum mehr als ein verwitterter Fußsteig, der während der Sommermonate von Hirten und Schafen benutzt wurde. Jetzt, Ende September, traf man hier oben kaum noch jemanden. Die Herden waren bereits seit zwei Wochen unten im Tal, und die paar Wanderer, die sich während der Nachsaison von dem spektakulären Anblick der Berge verzaubern lassen wollten, bevorzugten den westlich gelegenen GR 20.
Das lang gestreckte Tal südlich von Vallica war menschenleer. Wer hierherkam, der hatte etwas zu erledigen.
Paolo schulterte sein Gewehr und setzte den Abstieg fort. Nieselregen hatte eingesetzt, machte die Steine schlüpfrig. Das schroffe, karge Antlitz des Monte Cintu wirkte abweisend – als habe sich der Berg von ihm abgewendet.
Lumio trabte voraus, stieß schnuppernd die Nase in den einen oder anderen Busch und vergewisserte sich, dass er kein Kaninchen übersah. Er bellte nicht, er winselte nicht, stattdessen war er aufmerksam und lauschte. Plötzlich hielt er an. Er hob den Kopf und hielt witternd seine Nase in die Höhe. Seine Haltung verriet Anspannung.
Kein Zweifel, da war etwas.
Oder jemand.
Paolo nahm das Gewehr von der Schulter, prüfte Munition und Visier, dann entsicherte er die Waffe. Er war ein guter Schütze, einer der besten hier im Tal. Er konnte mehrere Schüsse abgeben, ehe sie ihn erwischten. Und kampflos würde er sich nicht ergeben.
Er spürte, wie Hitze unter seinem Mantel emporwallte. Das Adrenalin pulste durch seine Adern. Alle seine Sinne waren geschärft. Seine klammen Finger umschlossen Schaft und Abzug, während er langsam weiterging.
Nebel kroch vom Tal herauf, hüllte Bäume und Felsen in geheimnisvolles Zwielicht. Sonnenfinger tasteten durch den Dunst. Wie schnell das Wetter doch umschlagen konnte. Nach nur wenigen Minuten hatte sich die Sicht auf unter fünfzig Meter verringert. Oben am Hang hörte er das Kläffen der Hunde. Die Jäger waren also auf dem Abstieg.
Vorsichtig ging er weiter.
Nach einer Weile blieb er stehen und sah sich um. Wo steckte Lumio? Es war jetzt etliche Minuten her, dass er ihn zuletzt gesehen hatte. Er stieß einen leisen Pfiff aus. Mehr wagte er nicht, um den Verfolgern seine Position nicht zu verraten.
Voraus im Nebel hörte er das Prasseln von Steinen.
»Lumio?« Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
»Komm zurück.«
Er hielt den Atem an und lauschte. Der Nebel antwortete mit Schweigen. Täuschte er sich oder bewegte sich dort etwas? Paolo meinte, einen menschlichen Umriss zu erkennen, der seitlich gegen einen mächtigen Felsblock gelehnt war und zu ihm herüberblickte. Er schien zu warten.
Beim Näherkommen erkannte er, dass er sich nicht getäuscht hatte. Da war jemand. Ein Mann. Breitschultrig und hochgewachsen. Schwarzer Mantel, Wollmütze, das Gesicht von einem Dreitagebart umrahmt. In der Hand hielt er ein Messer. Als er Paolo kommen hörte, hob er den Kopf.
»Grüß dich, mein Freund. Lange nicht gesehen.«
Paolo blieb stehen und kniff die Augen zusammen. Er erkannte eine mehrfach gebrochene Nase und sanfte braune Augen, in denen sich Bedauern spiegelte. Ein Gesicht, das man nicht vergaß. Paolo war nicht überrascht. Er hätte sich denken können, dass sie ihn schicken würden.
»Mateu.«
»Ich bin erfreut, dass du mich noch kennst. Du scheinst ja in letzter Zeit etwas Probleme zu haben, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden.«
Mateus Stimme war dunkel, besaß aber dieses leichte Lispeln, das für die Santini so typisch war.
»Wer sagt, dass ich nicht zwischen Freund und Feind unterscheiden könnte?«
»Oh, das zwitschern die Spatzen von den Dächern«, erwiderte Mateu. »Man kann es überall hören. Du musst nur mal die Ohren spitzen. Paolo hat uns verraten, pfeifen sie. Er hat seine Seele verkauft.«
»Man sollte nicht alles glauben, was die Spatzen von den Dächern pfeifen.« Paolo kniff seine Augen zusammen. Es war merkwürdig, dass Lumio gar nicht mehr zurückkam. Es sei denn … »Wo ist mein Hund?«
Mateu löste sich aus dem Schatten des Felsens und trat ihm entgegen. Er besaß weder ein Gewehr noch eine Pistole.
Der Lauf von Paolos Waffe wanderte hinauf zu Mateus Brust. »Was hast du getan?«
Der groß gewachsene Mann breitete die Arme aus. Die Geste mochte auf jemanden, der ihn nicht kannte, entschuldigend wirken, doch Paolo wusste es besser. Der Sohn des Clanchefs entschuldigte sich nicht. Bei niemandem. Vielmehr bedeutete die Geste: Schau her, ich habe keine Angst vor dir. Jetzt sah Paolo, dass auf der Messerklinge ein roter Schimmer lag.
»Du weißt, dass ich ihn nicht am Leben lassen konnte«, sagte Mateu. »Er hätte niemals zugelassen, dass ich seinem Herrn etwas antue.« Er senkte seine Arme. »Ein Jammer. So ein schönes Tier. Korsisch, durch und durch. So ganz anders als du.«
»Ich bin mehr Korse, als du es je sein wirst, du Monster«, stieß Paolo aus. »Was ich getan habe, habe ich für meine Familie getan. Aber das wirst du niemals verstehen.« Der Lauf der Waffe zitterte.
Mateu kam einen Schritt auf ihn zu.
»Stehen bleiben«, zischte Paolo. Sein Finger krümmte sich um den Abzug. »Bleib stehen, oder ich werde dich erschießen. Gleich hier und jetzt.«
»Erschießen willst du mich? Mach dich nicht lächerlich.«
»Warum nicht? Ein Jagdunfall, kann immer mal passieren. Besonders, wenn der Nebel aus den Tälern aufsteigt. Wer ist auch so dumm und geht nur mit einem Messer auf die Wildschweinjagd? Hast du kein Gewehr dabei?«
»Das brauche ich nicht, denn ich jage keine Wildschweine«, erwiderte Mateu. »Ich jage Ratten. Und ich glaube, ich habe gerade eine gefunden.« Das Lächeln enthüllte einen goldenen Eckzahn. Paolo hasste dieses Lächeln. Er hatte es schon immer gehasst.
Ein Angstseufzer stieg ihm aus der Kehle. »Wenigstens werde ich dich mit in den Tod nehmen, Mateu«, stieß er aus. »Ich kann dich über den Haufen schießen, wann immer ich will.«
»Kannst du nicht, und das weißt du.«
»Ach ja?«
»Dir dürfte doch klar sein, was geschieht, wenn du mich erschießt, oder? Mein Vater wird deine Familie auslöschen. Nicht nur Ghjulia und die Jungs, ich rede von deiner ganzen verfickten Sippe bis runter zum letzten Halbcousin. Es wird sein, als hätte es euch niemals gegeben. Und jetzt lass den Unsinn und nimm die Waffe runter.«
Paolo bemerkte, dass Mateus linkes Auge nicht braun, sondern grau war. Lag das an den seltsamen Lichtverhältnissen? Wieso war ihm das früher nie aufgefallen?
»Was willst du von mir?«, flüsterte er. Die Stimme schien kaum noch ihm selbst zu gehören.
»Ist das so schwer zu verstehen?« Mateus Augen waren plötzlich sanft und voller Bedauern. »Ich will, dass du das Gesetz des Clans respektierst. So ist dein Tod wenigstens noch zu etwas nütze.«
»Schwachsinn.«
»Kein Schwachsinn, Tradition. Ich gebe dir hier und jetzt mein Wort, dass die Santini euch nicht fallen lassen werden. Wir werden uns um euch kümmern und dafür sorgen, dass es euch an nichts fehlt.«
»Die Santini hier, die Santini da. Ihr glaubt wohl, ihr könnt euch alles erlauben, was?« Paolo spürte, wie sein Widerstand ins Wanken geriet. Tränen füllten seine Augen, ließen seinen Blick verschwimmen. Als er bemerkte, dass sein Gewehrlauf nach unten gesunken war, riss er ihn trotzig wieder hoch. Aber irgendwie schien die Kraft aus seinen Armen gewichen zu sein. »Ihr herrscht hier wie Götter«, sagte er heiser. »Ihr bestimmt, wer welches Land bekommt, entscheidet, wer leben darf und wer stirbt. Aber eure Tage sind gezählt. Ihr habt es jetzt mit jemandem zu tun, der mächtiger ist als ihr. Mächtiger als alle Clans zusammen.«
»Gib nicht uns die Schuld, dass du dich mit den falschen Freunden eingelassen hast«, sagte Mateu. »Du hast einen Fehler gemacht, das kann jedem passieren. Aber dass du dich trotz eindringlicher Warnungen weiter gegen deinen Clan gestellt hast, war mehr als dumm. Du musst gewusst haben, dass du damit nicht durchkommen würdest. Doch jetzt genug davon.« Er hob die Klinge. »Wir wissen, warum wir hier sind. Du hast die Wahl. Stirb einen schnellen und ehrenvollen Tod, oder warte, bis du von den Hunden zerrissen wirst. Wenn du die Ohren spitzt, kannst du sie bereits hören. Sie sind gleich hier.« Die Klinge funkelte geisterhaft. Wie ein Irrlicht tief in den Bergen.
Paolo schwankte. Seine Gedanken zuckten zeitgleich in verschiedene Richtungen. In wirrer Folge spielte er alle Möglichkeiten durch. Doch welchen Weg er auch einschlug, am Ende wartete stets Mateu auf ihn.
Mateu und sein Messer.
Er musste einsehen, dass er sich etwas vorgemacht hatte, als er glaubte, sich irgendwie aus der Situation rausmogeln zu können. Er saß in der Falle.
Zitternd ließ er sein Gewehr sinken.
»Braver Junge.« Mateu lächelte. »Und jetzt komm her.«
Paolo kniete sich hin, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und entblößte seine Kehle. Mateu trat hinter ihn, sodass er ihn nicht mehr sehen konnte. Doch er hörte ihn atmen und roch den durchdringenden Schweißgeruch.
»Mögest du in der Hölle verrotten, Mateu«, flüsterte er. »Du und dein ganzer verfluchter Clan.«
Als er die Klinge sah, schloss er die Augen.
2
Du bist kein stattlicher Mann. Nicht so wie dein Vater.
Mit diesen Worten hatte seine Patentante Letizia ihn am Grab seiner Mutter verabschiedet, ehe sie in den Zug gestiegen und nach Brest davongefahren war. Das war vor fünf Jahren gewesen? War es wirklich schon so lange her? Es kam ihm so unwirklich vor.
Erics Leben war seither irgendwie aus den Fugen geraten. Alkohol, Frauen, Triumphe, Niederlagen – sein Leben glich einer Achterbahnfahrt, wobei die grobe Richtung deutlich erkennbar nach unten wies. Eigentlich wäre es mal wieder Zeit für einen kleinen Aufschwung. Aber woher sollte der kommen? Nichts passierte auf diesem Erdball von allein. Alles war eine Folge von Ursache und Wirkung. Er hätte seinen Arsch bewegen müssen, sein Leben ändern. Aber dafür war er noch nicht bereit.
Seine Patentante mit ihren Marotten und Geschichten passte ebenso wenig in dieses Leben wie der Gedanke daran, dass er nach dem Tod seiner Mutter das letzte verbliebene Familienmitglied war. Sollte er keine Kinder zeugen, würde der Stammbaum an dieser Stelle enden. Ein toter Zweig, der irgendwann abfiel und verrottete.
Und wennschon.
Letizia gehörte zu einem Abschnitt seiner Vergangenheit, mit dem er nichts mehr zu tun haben wollte. Weder hatte er in den vergangenen fünf Jahren ihre Nähe gesucht noch sie die seine. Ein stilles Einverständnis, mit dem es sich gut leben ließ. Doch jetzt tauchten diese Worte auf, wie ein fernes Echo, und erinnerten ihn daran, wer er früher mal gewesen war. Du bist kein stattlicher Mann, Eric Marchand.
Eric strich über seine Stirn. Sein Vater stammte aus der Bretagne. Nachkomme einer Dynastie von Fischern. Hochgewachsen, kräftig – vermutlich mit Wikingerblut in den Adern. Ein Mann, nach dem die Frauen sich umsahen. Erics Gene hingegen waren eher mütterlicherseits geprägt. Dunkler Teint, markante Nase, schmale Schultern. Seit er vierzig geworden war, begann das Haar an den Schläfen lichter zu werden. Auch wölbte sich bei ungünstigen Lichtverhältnissen ein leichter Bauch unter dem T-Shirt. Das gefiel ihm nicht. Es gab Tage, da konnte er sich förmlich beim Älterwerden zusehen. Vor allem nach diesen Nächten, die nur aus Sex und Alkohol zu bestehen schienen.
Wie lange konnte ein Mann so etwas durchziehen, ehe er vor die Hunde ging? Und woran lag es, dass er immer noch so gut bei Frauen ankam? Vielleicht war es ja seine Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Tim Roth, vielleicht aber auch sein ungezügeltes Temperament. Es gab Frauen, die standen auf so etwas.
Dass er jetzt die Notbremse zog und nach Korsika kam, war mehr eine Verzweiflungstat als ein lange geplanter Vorsatz. Er musste sich über einige Aspekte seines Lebens Klarheit verschaffen – nicht zuletzt, was das schöne Geschlecht betraf.
Er war gerade frisch getrennt, das Problem war nur, dass Monique noch nichts davon wusste. Wie so vieles in seinem Leben war auch das eine spontane Entscheidung gewesen. Sie würde ihm die Hölle heißmachen, wenn sie davon erfuhr. O ja, das würde sie. Allerdings musste sie ihn dazu erst mal finden. Und er hatte peinlich genau darauf geachtet, keine Spuren zu hinterlassen.
Nach einem neuen Abenteuer stand ihm nun wahrhaftig nicht der Sinn. Wobei sich ohnehin die Frage stellte, ob sein morbider Charme auch bei Korsinnen wirkte.
Die rothaarige Stewardess an Bord des Fluges AF 4462 jedenfalls schien aus Paris zu stammen. Bereits kurz nach dem Start hatte sie begonnen, ihm Blicke zuzuwerfen, die keinen Zweifel daran ließen, dass sie ihn attraktiv fand. Alles an ihr vibrierte von erotischer Energie. Das vermeintlich schüchterne Senken des Blicks, das Knabbern an der Unterlippe – nicht mal einem Vollpfosten wie seinem Verlagslektor Albert wären die Signale verborgen geblieben.
Albert war übrigens der Einzige, der wusste, was Eric vorhatte, und war diesbezüglich zu absolutem Schweigen verdonnert worden. Und was diese Stewardess betraf: Eric hatte sich während des Fluges ein paarmal mit ihr unterhalten und festgestellt, dass sie recht nett war. Köpfchen hatte sie auch, immerhin wusste sie, wer er war. Aber für seinen Geschmack war sie einfach zu jung. Nicht, dass er etwas gegen junge Körper einzuwenden hatte, aber er wollte nicht schon wieder neben einer Frau aufwachen, die keine Ahnung hatte, wer Andy Warhol war oder Jean Cocteau. Andererseits war er auch kein Mönch, weswegen er ihr dann doch einen Tipp gegeben hatte, in welchem Hotel er logierte.
Du bist kein stattlicher Mann.
Die Kabinentür war aufgegangen, und die Leute begannen das Flugzeug zu verlassen. Eric riss seinen Rucksack aus dem Gepäckfach und machte sich auf den Weg nach vorn.
»Au revoir, Monsieur«, hörte er die Stewardess zu einem älteren Herrn vor ihm sagen. »Danke, dass Sie mit Air France geflogen sind.« Dann war die Reihe an ihm.
»Auch Ihnen einen herzlichen Dank für Ihren Flug mit Air France, Monsieur Marchand. Ich freue mich schon auf Ihren nächsten Roman. Ich hoffe, es war alles zu Ihrer Zufriedenheit?«
»Hätte nicht besser sein können, Bernadette«, sagte er lächelnd. »Und wegen des verloren gegangenen Füllfederhalters – die Adresse meines Hotels haben Sie ja.«
»Selbstverständlich, Monsieur. Wir sind sicher, dass er wieder auftauchen wird. Wir melden uns dann bei Ihnen.« Sie zwinkerte ihm zu.
Eric lächelte zurück und verließ die Maschine.
Warmer Wind schlug ihm entgegen. Der Geruch von Kerosin mischte sich mit den Ausdünstungen des Brackwassersees, an dessen Ufern der Flughafen Poretta gebaut worden war. Die westlich gelegene Bergkette erstrahlte in flammendem Grün.
Außer Eric waren fast nur Korsen in der Maschine. Geschäftsleute und Reisende, die vom Festland in die Heimat zurückkehrten. Eric erkannte sie an den scharf geschnittenen Gesichtern, den schwarzen Haaren und kantigen Nasen, vor allem aber an der Art, wie sie miteinander sprachen.
Korsisch war ein italoromanischer Dialekt, der dem der Toskana oder dem im Norden Sardiniens ähnelte. Eine harte, rau klingende Sprache, deren bevorzugter Vokal das U zu sein schien. Eric hatte ein paarmal versucht, den Gesprächen im Flugzeug zu folgen, hatte aber bald aufgegeben.
Seit sie das Flugzeug verlassen hatten, wirkten die Leute deutlich gelöster. Die heimatliche Erde unter ihren Füßen vermittelte ihnen anscheinend das Gefühl von Sicherheit. Eric nahm sich vor, so schnell wie möglich ins Hotel zu gelangen. Rasch noch den Koffer vom Band geholt, dann machte er sich auf den Weg in die Ankunftshalle.
Die Autovermietung hatte ihren Schalter an der gegenüberliegenden Seite, vis-à-vis dem Parkhaus. Eric war der einzige Kunde. Ein junger Mann saß hinter dem Schreibtisch und sortierte Dokumente. Als er Eric bemerkte, hob er den Kopf. »Bonjour, Monsieur. Herzlich willkommen auf der Ile de la Beauté. Was kann ich für Sie tun?«
Eric zog seine Unterlagen heraus und legte gleich noch Führerschein und Kreditkarte dazu. Der Mann tippte alles in den Computer, geriet dann aber ins Stocken.
»Alles in Ordnung?«, fragte Eric.
Das Gesicht drückte Bedauern aus. »Ich sehe gerade, dass Ihr Fahrzeug noch nicht bereit ist, Monsieur Marchand.«
»Was soll das heißen, nicht bereit? Sie wussten doch, dass ich heute komme.«
»Das ist richtig, Monsieur, nur leider habe ich gerade erfahren, dass sich der Wagen noch in Bastia befindet. Zur Reinigung.«
»Das ist aber ärgerlich. Wie lange muss ich denn warten?«
»Schwer zu sagen. Aber es wird sicher noch eine Weile dauern.«
»Dann geben Sie mir einfach einen anderen.«
»Das geht leider nicht. Im Moment steht kein freies Fahrzeug zur Verfügung. Sehen Sie, Sie haben keine Angaben über die Ankunftszeit gemacht.«
»Keine Angaben …?« Eric stutzte. »Wie viele Maschinen kommen denn hier täglich aus Paris?«
»Eine, Monsieur.«
»Eben.«
Der Junge sah ihn verständnislos an. Vielleicht spielte er auch nur den Ahnungslosen, und der Grund für die Verzögerung war ein anderer. Eric war Franzose, und die waren, dem Hörensagen nach, hier nicht besonders beliebt. Ihm war das egal, Hauptsache, er war bald mobil.
»Bastia, hm? Das trifft sich gut, dahin bin ich auch unterwegs. Sagen Sie Ihren Leuten Bescheid, dass ich den Wagen in der Stadt abhole. Oder besser noch, lassen Sie ihn direkt zu meinem Hotel bringen. Ich nehme ein Taxi.«
»Ihren Wagen bringen wir Ihnen gerne, Monsieur. Nur, hm …«
»Was?«
»Die Kosten für das Taxi werden leider nicht von unserer Firma getragen. Wie ich schon sagte, es fehlen die Angaben über die Ankunftszeit …« Der betrübte Blick wirkte so einstudiert, dass Eric sich fragte, ob es wohl spezielle Seminare dafür gab.
»Lassen Sie’s gut sein«, sagte er. »Ich zahle selbst. Sorgen Sie einfach dafür, dass der Wagen heute noch bei mir eintrifft. Hier ist meine Handynummer. Schicken Sie mir eine SMS, wenn er da ist.«
Das Taxi verließ das Flughafengelände und rollte auf der N 193 in Richtung Norden.
Die Umgebung von Bastia sah aus wie die Peripherie vieler großer Städte. Autowerkstätten, Einkaufszentren, Baustoffhandel. Eric kurbelte die Scheibe ein Stück herunter und genoss den Fahrtwind. Das Wetter war schön, und er hatte vor, den Tag zu genießen. Der Geruch von Oregano und Rosmarin drang ihm in die Nase. Korsika besaß tatsächlich einen eigenen Geruch, das ließ sich bereits auf den wenigen Metern vom Flughafen in die Innenstadt feststellen.
Der Fahrer betrachtete Eric im Rückspiegel. »Sind Sie zum ersten Mal hier?« Sein Französisch klang wie eine Pfeffermühle.
»In der Tat«, erwiderte Eric. »Herrliches Wetter hier.«
»Das kann sich schnell ändern. Sie sind Geschäftsmann?«
»Nicht wirklich«, sagte Eric, der sich momentan eher wie ein Flüchtling fühlte. Er sagte das dem Fahrer, erntete dafür aber nur verständnislose Blicke.
»Flüchtling?« Die beiden Augen musterten ihn wie Silberspäne.
»Nicht so ein Flüchtling natürlich«, winkte Eric ab. »Ich stamme aus Paris.« Was wiederum gar nichts bedeutete, wenn man es genauer betrachtete. Aber der Fahrer hätte so oder so nicht gelacht, selbst dann nicht, wenn Eric ihm den Witz von dem Friseur und dem einäugigen Papagei erzählt hätte.
»Sie sind also kein Arab?«
»Sehe ich so aus?«
»Vielleicht.« Die Silberspäne zwinkerten argwöhnisch und wandten sich dann wieder dem Verkehr zu. Schweigend.
Eric überlegte, was er sagen sollte. Dieses unbehagliche Schweigen gefiel ihm nicht. Humor wurde hier anscheinend mit der Pinzette angebaut.
»Ich habe das nur so dahergesagt«, lenkte er ein. »Es war ein Witz, verstehen Sie. Bitte verzeihen Sie, wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe.«
»Hm«, grummelte der Fahrer. »Flüchtlinge sind gerade ein ziemliches Problem auf der Insel. Seien Sie besser vorsichtig.«
»Im Ernst?« Eric runzelte die Stirn.
»Ja«, der Fahrer schien sich wieder zu entspannen. »Ich sag’s Ihnen ganz ehrlich: Es wäre am besten, wenn diese Leute ihre Koffer packen und zurück nach Hause schwimmen würden. Wir wollen hier keine Flüchtlinge, nicht auf Korsika.«
»Tja, wer will die armen Schweine schon …?«
»Meiner Meinung nach hat jeder Mann die Verpflichtung, in seinem eigenen Land für Ruhe und Sicherheit zu sorgen. Zu kämpfen. Für die eigene Familie, verstehen Sie?«
»Ja schon, nur …«
»Bringt ja nichts, wenn alle guten Männer abhauen. Dann bleiben nur noch die bösen zurück. Das ist doch auch keine Lösung. Ich bin Korse, ich weiß, wovon ich rede.«
Eric schwieg. Klar, er hätte jetzt eine Diskussion über Menschenrechte und Flüchtlingsfragen vom Zaun brechen können, spürte aber, dass er damit nichts erreichen würde.
Es war schon paradox: Da kam er extra aus Paris hierher, und kaum ausgestiegen, erwarteten ihn hier dieselben Probleme wie daheim. Die Welt war ein Dorf.
»Rinaldi.« Der Fahrer sah ihn erwartungsvoll an.
»Wer bitte?«
»Unser neuer Präsident. Ein guter Mann. Konservativ. Nationalist. Sein Vater war lange Jahre im Widerstand aktiv. Seither ist vieles besser geworden, aber es gibt immer noch eine Menge Probleme.«
Eric nickte und biss sich auf die Unterlippe. Er stellte fest, dass er sich bisher viel zu wenig mit Korsika beschäftigt hatte. Wäre er nicht auf die Unterlagen, Briefe und Tagebücher seiner verstorbenen Mutter gestoßen, in denen von einem ehemaligen Familienanwesen die Rede gewesen war, so hätte er vermutlich ein anderes Reiseziel ausgewählt. Aber manchmal spielte einem der Zufall die Karten in die Hand. Und dann nahm man sie und spielte sein Spiel.
Der Rest der Fahrt verlief schweigend. Eric ließ sich im Stadtzentrum absetzen, zahlte eine unverschämt teure Taxigebühr und machte sich in verdrießlicher Stimmung auf den Weg in Richtung Meer.
Während der Fährhafen eher nüchtern und funktionell war, wirkte der Altstadthafen deutlich pittoresker. Hufeisenförmig von der Rue de la Marine umrandet, beherbergte er Kais und Stege, an denen Dutzende kleiner bis mittelgroßer Segeljachten vor Anker lagen. Möwen kreischten, und das Wasser schwappte müde gegen die Hafenmole. Eine Mischung von Salzwasser, Fisch und Kaffeegeruch lag über dem Ort. Die steil aufragenden Altbauten verliehen der Szenerie den Anschein eines Amphitheaters. Eine Bühne, auf der sich das tagtägliche Drama des Lebens abspielte. Freud und Leid, Liebe, Versöhnung, Verbrüderung – sowie immerwährende Feindschaft. Ein Brennglas menschlicher Emotionen, in dessen Zentrum sich Erics Laune sofort besserte.
Zwei Männer stritten, wobei nicht ersichtlich war, wieso. Ging es um Wettschulden oder ein falsch geparktes Auto? Der Streit wurde lautstark vor aller Augen ausgetragen. Eric verstand kein Wort, lauschte aber amüsiert. Wieder einmal schwor er sich, baldmöglichst ein paar Brocken Korsisch zu lernen. Er folgte der Auseinandersetzung eine Weile, dann setzte er seinen Rundgang fort.
Manche der Häuser waren acht Stockwerke hoch und so windschief, dass sie jeden Augenblick zur Seite wegzukippen drohten. Wäscheleinen waren zwischen ihnen gespannt, an denen Schlüpfer, BHs und andere Kleidungsstücke hingen. Blickte man in die Fenster, so konnte man wunderschön hergerichtete Altbauwohnungen mit kostbarem Mobiliar entdecken. Ein interessanter Kontrast zu den heruntergekommenen Fassaden mit ihren schiefen Fensterläden und der abgeblätterten Farbe. Doch das Bild, das sich dahinter verbarg, gefiel Eric. Warum Potemkinsche Dörfer errichten, wenn man das Geld in die Instandhaltung des Wohnbereiches investieren konnte? Wem außer den Touristen nützte schon eine hübsche Fassade?
Alles an diesen Gebäuden sagte ihm, dass die Korsen gerne unter sich waren. Wer sich durch die rohe Einfachheit belästigt fühlte, konnte jederzeit wieder verschwinden.
Als er am Scheitelpunkt des Hufeisens angelangt war, blieb er stehen. Eingezwängt zwischen einem Laden für korsische Spezialitäten und einem Shop der Kleidermarke Blanc du Nil, bemerkte er ein unscheinbares kleines Café. Graue Stoffmarkise, ein paar Metalltische und Stühle, dazwischen einige Holzfässer mit Barhockern, an denen die Eiligen ein Bier oder einen Kaffee genießen konnten. Eric wäre vermutlich achtlos daran vorbeigegangen, wenn er nicht zufällig kürzlich einen Artikel in dem Magazin L’Express gelesen hätte, in dem das Méditerranée abgebildet gewesen war. Zu seiner Glanzzeit hieß es noch Brise de Mer und war der Gründungsort der gleichnamigen und weltberühmten Mafiagruppe.
Ende der Siebzigerjahre hatten sich hier etliche junge Männer aus guten Familien getroffen, Poker gespielt und Pläne geschmiedet, die Welt zu erobern. Da sie nicht auf den Kopf gefallen und gut organisiert waren, waren sie zu einer Bande zusammengewachsen, die Banken und Geldtransporter überfiel und ihre Raubzüge bis nach Paris und ins nicht französische Ausland ausdehnte. Über mehrere Jahrzehnte hinweg verbreitete die Meeresbrise Angst und Schrecken. Sie prägte die organisierte Kriminalität in Frankreich und galt als unbesiegbar. Doch im April 2008 fing ein Gemetzel in den eigenen Reihen an. Mehrere der Anführer wurden erschossen oder fielen dubiosen Unfällen zum Opfer. Ob von der konkurrierenden FLNC, der Korsischen Nationalen Befreiungsfront, oder einer anderen Vereinigung, blieb ungeklärt. Bis heute wurde über den Untergang der Brise de Mer spekuliert. Darüber, ob diese Gruppe wirklich zerschlagen war. Aber natürlich waren das Räuberpistolen. Andererseits liebten die Leute solche Geschichten, vor allem, weil das Banditentum hier auf Korsika eine so lange und abenteuerliche Tradition besaß. Zumindest hatte es so in dem Artikel gestanden, von dem Eric sich wünschte, dass er ihn nicht weggeschmissen hätte.
Neugierig geworden, nahm er an einem der Tische Platz, bestellte einen Kaffee und wartete. Das Hafenpanorama wirkte beruhigend auf seine Nerven. Stimmengemurmel, das Klatschen der Wellen, der Geruch nach Seetang – er spürte, wie seine Gedanken auf Reisen gingen. Zurück in eine nicht allzu ferne Vergangenheit. Hin zu der Frage, warum er eigentlich hier war.
3
Komm rein, mein Freund, und nimm Platz. Kaffee? Oder lieber etwas Stärkeres? Ich weiß doch, dass du einem guten Tropfen nicht abgeneigt bist.«
»Schon mal auf die Uhr geschaut?«
»Als ob dich die Uhrzeit jemals vom Trinken abgehalten hätte.« Albert lachte, aber seine Stimme wirkte angespannt. Ein feines Tremolo, das stets Vorbote unangenehmer Nachrichten war.
Eric runzelte die Stirn. »Was ist los?«
»Nichts.« Ein verlegenes Lachen. »Warum muss denn etwas los sein, damit ich meinen Lieblingsschriftsteller in unserem Haus begrüßen darf?«
»Weil du das sonst nie tust. Und weil du nicht am Telefon darüber sprechen wolltest. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Ich nehme den Drink.«
Albert stieß ein kleines hysterisches Lachen aus, vergewisserte sich mit Blick in Richtung Gang, dass niemand sie belauscht hatte, dann schloss er die Bürotür. »Wohl gesprochen, mein Freund. Ich glaube, ich nehme auch einen.«
Albert Montreuil war Erics Lektor bei Gallimard, dem traditionsreichen Verlagshaus in der Rue Sébastien-Bottin. Es vereinte knapp siebentausend Autoren unter einem Dach und brachte jedes Jahr über tausend Neuerscheinungen auf den Markt. Ein Schlachtschiff in dem immer stürmischer werdenden Buchgeschäft. Großen Verlagen ging zunehmend die Puste aus. Bedroht von Onlineriesen, Selfpublishern und dem eigenen starren Management, schlingerten sie durch die raue See, immer auf der Suche nach dem nächsten großen Bestseller. Doch die wuchsen nicht wie Obst auf den Bäumen. Häufig entstanden sie dort, wo man sie am wenigsten vermutete. Albert hatte es ihm einmal erklärt. Gäbe es ein Rezept für Bestseller, dann wäre alles ganz einfach. Dass die Verlagsriesen aber weiterhin so taten, als ginge es ihnen prächtig, und nicht müde wurden, sich auf den Buchmessen selbst zu feiern, war ein Anachronismus, der an der Realität vorbeiging. Eric fühlte sich bei dem Gedanken daran an das berühmte Streichorchester auf der RMS Titanic erinnert, das an jenem schicksalhaften 15. April 1912 zusammen mit tausendfünfhundert Passagieren im Meer versank. Albert war eine der armen Seelen, die pausenlos unter Deck schufteten und Kohlen in den hungrigen Rachen der Dampfmaschine schaufelten.
Während sein Lektor in seinem Privatschrank nach Flasche und Gläsern kramte, glitt Erics Blick über die Wände und Regale. Viel hatte sich nicht verändert, seit er zum letzten Mal hier gewesen war. Zwischen Buchstapeln und überfüllten Regalen strahlten ihm die Helden der Vergangenheit entgegen. Marcel Proust, Georges Simenon, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Antoine de Saint-Exupéry. Und natürlich der ungekrönte Meister des Absurden, Eugène Ionesco. Eine beeindruckende Ansammlung stummer Helden, die Eric schmerzhaft bewusst werden ließen, welch kleines Rädchen er in diesem gigantisch komplexen Mechanismus war.
Albert kauerte vor seinem Teakholzschränkchen, holte zwei Gläser und eine Flasche Whisky hervor, kam damit zu ihm zurück und platzierte sie voller Stolz vor ihm auf dem Tisch.
»Balvenie 12 Jahre, Single Barrel.«
Eric musterte das Etikett. »Offenbar hast du mir zugehört und endlich mal in guten Stoff investiert.«
»Als ob ich dir nicht immer zuhören würde.« Albert schenkte ihnen je einen Fingerbreit ein, dann hob er das Glas und prostete Eric zu. »Auf die Sonne, das Leben und die schönen Mädchen von Paris.«
»Mögen ihre Röcke niemals länger werden«, erwiderte Eric. »Santé!«
Der Whisky brannte wie Feuer, und Eric verdünnte ihn mit etwas Wasser. Er nickte zufrieden. »Guter Stoff.«
»Wie kommst du voran?«, erkundigte sich Albert beiläufig. »Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, wusstest du noch nicht, wie der Roman ausgehen würde.«
»Daran hat sich nichts geändert«, räumte Eric ein. »Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es das Beste sein wird, Figuret sterben zu lassen. Jede gute Tragödie endet mit dem Tod des Helden, wie du weißt. Und Europa ist nun mal eine verdammte Tragödie.«
»Ja, du hast recht.« Albert wurde leise. »Dennoch bitte ich dich: Tu das nicht.«
»Wie bitte?« Eric stellte das Glas ab. »Ich habe mich wohl verhört.«
Albert starrte in seinen Whisky, als läge dort unten die Antwort auf die Fragen der Welt. »Ich weiß, wie du darüber denkst, und ich befürworte deinen radikalen Ansatz. Aber die Verlagsleitung hat immer noch Hoffnung, dass die Reihe sich noch erholt.«
»Warum sollte sie?«
»Es gibt Gerüchte, dass Gaumont sich für eine Verfilmung interessiert. Das würde deinen Romanen einen riesigen Aufwind bescheren. Stell dir das Plakat vor: Regie Luc Besson. Du wärst im Nu wieder auf den Beststellerlisten.«
»Luc Besson. Dreht der nicht nur noch Science-Fiction-Filme?« Eric lachte zynisch. »Und auf Gaumont ist auch geschissen. Die kaufen Rechte wie im Ramschwarenladen. Und ihr liefert ihnen die Preise dazu.«
»Für die Chance einer Verfilmung würden wir sie vermutlich sogar umsonst hergeben«, sagte Albert schulterzuckend. »Die Tantiemen sind uns egal, es ist der Werbeeffekt fürs Buch, auf den wir scharf sind. Wenn du aber hergehst und Figuret sterben lässt, gibt es keine Möglichkeiten mehr, die Reihe fortzusetzen.«
»Als würde es davon Fortsetzungen geben. Die werden doch nicht mal den ersten verfilmen. Glaubst du im Ernst daran?«
»Möglich ist alles. Aber keiner wird sich diesen Film ansehen, wenn bekannt wird, dass die Figur stirbt. Das ist wie mit John McClane in Die Hard. Die Leute wollen, dass so eine Figur unsterblich ist. Sie darf altern, abstürzen, auf die Beine kommen, wieder hinfallen – alles egal. Hauptsache, sie bleibt am Leben.«
Eric verfiel in Schweigen. Sollte er die Sache mit der Verfilmung wirklich für seine Schreibarbeit in Betracht ziehen? Wie wahrscheinlich war es, dass daraus etwas wurde?
Sein Erstling, Die brennende Stadt, war seinerzeit mit dem Grand Prix du Roman Noir ausgezeichnet worden. In der Laudatio hatte es geheißen: »Marchand versteht es virtuos, Bilder aus Alltag, Abenteuer und Sozialkritik mit den Klängen eines großen Roman noir zu verbinden. Seine erzählerische Reduktion, seine knappen Dialoge, die kurzen Sätze und der hintergründige Humor knüpfen an die Tradition von Raymond Chandler und Dashiell Hammett an. Womit Marchand eine moderne – auf Europa zugeschnittene – Form des amerikanischen Hard-boiled-Krimis gefunden hat. Er darf damit zu Recht als Vertreter des neueren sozialkritischen französischen Kriminalromans, des sogenannten Néo-Polar, angesehen werden.«
Das war fünf Jahre her.
Seitdem gingen die Verkäufe stetig zurück. Was nicht an den Kritiken lag, sondern daran, dass die Leser anscheinend müde geworden waren, auf Probleme hingewiesen zu werden. Besonders seit Macron zum Präsidenten gewählt worden war. Eine unerklärliche Euphorie hatte das Land erfasst. Erics Romane spielten fast ausnahmslos in den Pariser Vororten, den Banlieues, den Schmelztiegeln und Brennpunkten, in denen die Abgründe von Finanzkapitalismus, Korruption und Geldverschwendung am deutlichsten klafften. Dort, wo sich die Polizei nicht mehr hineinwagte und wo völlig neue gesellschaftliche Strukturen entstanden.
Erics Geschichten handelten vom Aufstieg und Fall schillernder Persönlichkeiten, von Drogenbossen, Undercover-Ermittlern und Staatsanwälten, aber auch von Kleindealern, Prostituierten und Menschen, die in dieser Hölle einfach irgendwie überleben und ihre Kinder großziehen wollten. Die schmerzhafte Klarheit, mit der er die Dinge beim Namen nannte, hatte Eric zu Beginn seiner Karriere gute Verkäufe beschert, doch inzwischen schienen sich die Leute an die Zustände gewöhnt zu haben. Sie wollten davon nichts mehr hören und interessierten sich mehr für ihre Vorgärten als für Flüchtlingsproblematik und Finanzkrise.
Eric hatte in Interviews keinen Hehl daraus gemacht, dass er Frankreich für ein Land hielt, das es bereits hinter sich hatte. Griechenland hatte den Anfang gemacht, jetzt waren Italien, Spanien und die Grande Nation an der Reihe. Wie Dominosteine würden sie fallen und dabei alles mit sich reißen, was in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut worden war. Es war ein Prozess, der erst dann aufhörte, wenn von Europa nichts mehr übrig war. Doch selbst erzsozialistischen Blättern wie der L’Humanité war eine solche Sichtweise zu radikal. Pessimismus sei out, hieß es. Heute müsse man wieder nach vorn blicken. Europa müsse zusammenwachsen. Mit vereinten Kräften würde man es schon schaffen.
Eric konnte darüber nur den Kopf schütteln. Die nächste große Finanzkrise stand bereits in den Startlöchern, selbst die Spatzen pfiffen es von den Dächern. Trotzdem taten alle so, als würde schon nichts passieren. Doch diesmal würden die Erschütterungen gewaltig sein. Viel stärker als 2008. Aber sollten die Leute ruhig weiter am Abgrund tanzen, Eric würde sich davon nicht von seiner Meinung abbringen lassen.
»Und was denkst du?«, fragte Albert. »Meinst du, du könntest dich überwinden und deine Hauptfigur nicht sterben lassen?«
»Ich weiß nicht …«
»Bitte. Tu’s für mich.«
»Für dich?« Eric hob eine Braue und lächelte amüsiert.
»Ja«, sagte Albert. »Ich habe diese Reihe von Anfang an begleitet. Ich habe dich, wenn du so willst, entdeckt, auch wenn natürlich du es warst, der die Romane erdacht und geschrieben hat.«
»Das will ich doch meinen …«
»Aber Figuret war ein Stück weit auch mein Baby. Erinnere dich an die nächtelangen Diskussionen, die wir miteinander geführt haben. Ihn sterben zu sehen, wäre unerträglich für mich.«
Eric runzelte die Stirn. Meinte Albert etwa ernst, was er da sagte?
»Ich brauche diesen Hoffnungsschimmer, verstehst du? Ich möchte mich in den Gedanken flüchten können, dass Figuret irgendwo am Strand liegt, eine Blondine im Arm, einen Mai Tai im Glas.«
»Was redest du da nur für einen Quatsch? Figuret am Strand?«
»Warum nicht? Lass ihn die Koffer packen, die Welt bereisen, den ganzen Scheiß hinter sich lassen. Alles, nur nicht den Tod …« Albert verstummte.
Eric sah ihn an und runzelte die Stirn. Dabei fiel sein Blick auf das Porträtfoto auf dem Tisch seines Lektors.
Alberts Vater war vor zwei Monaten gestorben. Einer der Großen bei Gallimard. Verlegerisches Urgestein. Er und Albert hatten ein schwieriges Verhältnis gehabt. Die alte Geschichte: der Sohn im Schatten des Vaters, die Scheidung der Eltern, Affären und Skandälchen. Für die Presse ein gefundenes Fressen, für den Sohn ein Albtraum. Dann folgten Schlaganfall und Niedergang, vor zwei Monaten schließlich der Tod.
Eric hatte gehofft, dass Albert sich nach dem Tod seines alten Herrn freischwimmen und zu eigener Stärke finden würde, aber anscheinend war das Gegenteil der Fall. Zu viele unerledigte Angelegenheiten, zu viele unausgesprochene Worte, für die es jetzt zu spät war. Wie für Eric war die Reihe um Kommissar Figuret für Albert mehr als nur ein paar simple Kriminalromane. In gewisser Weise standen sie für ihre eigene Vergangenheit. Und die ließ man nicht einfach hinter sich.
Darum ging es also. Endlich war die Münze gefallen.
»Hör mal, Albert …« Er hatte ein flaues Gefühl im Magen. Mochte der Whisky auch noch so einladend riechen, er verspürte plötzlich kein Verlangen mehr danach.
Er wollte eigentlich ablehnen, aber dann sah er in dieses niedergeschlagene Gesicht und wusste, dass er es nicht konnte. Nicht jetzt. »Ich werde darüber nachdenken«, sagte er leise.
»Ehrlich?« Alberts Blick zuckte hoch, ein Lächeln auf den Lippen. »O ja, bitte tu das.«
»Ja doch. Aber ich werde mehr Zeit brauchen. Große Teile des Textes müssten umgeschrieben werden.«
»Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Den Erscheinungstermin kann man verschieben, ich habe das bereits abgeklärt. Lass dir die Sache noch mal gründlich durch den Kopf gehen. Hauptsache, du findest einen positiven Abschluss. Die Leute mögen es nicht, wenn Türen endgültig zugeschlagen werden. Sie lieben Happy Ends. Und dieses Buch muss ein Erfolg werden. Unbedingt.«
»Wem sagst du das!«
Albert lächelte. Es war ein Lächeln der Erleichterung und Hoffnung. »Vielleicht täte dir eine kleine Luftveränderung gut. Urlaub machen, mal den Kopf frei kriegen. Das kann manchmal Wunder bewirken. Miete dir irgendwo eine kleine Hütte, geh wandern, fahr Rad und schreib. Viele deiner Kollegen machen das so. Und übrigens komme ich nicht mit leeren Händen.« Er zwinkerte ihm zu. »Ich habe da noch einen kleinen Bonus.« Albert griff in seine Schreibtischschublade und holte einen Briefumschlag heraus, platzierte ihn auf dem dunklen Holz und tippte mit dem Finger darauf.
Eric zog amüsiert eine Braue in die Höhe. »Was ist da drin, Opernkarten?«
»Schau rein.«
»Du willst mich doch nicht etwa bestechen?«
»Nur eine kleine Entscheidungshilfe. Eine Aufstockung deines Garantiehonorars …«
Eric öffnete den Umschlag und blickte auf den Scheck. »Zehntausend Euro?«
Das Lächeln wurde zu einem Grinsen. »Was sagst du?«
»Ich bin sprachlos …«
»War nicht leicht, das bei der Verlagsleitung durchzudrücken, aber ich kann ziemlich hartnäckig sein, wenn es um etwas geht.«
»Das kann ich bestätigen«, sagte Eric. Zerknirscht blickte er auf den Umschlag. Albert hatte da einen wunden Punkt erwischt. Er war gerade ziemlich klamm und konnte das Geld gut brauchen. Aber war er deswegen käuflich? Wohl kaum. Außerdem hatte er noch kein Zugeständnis gemacht, er hatte nur versprochen, es sich noch einmal zu überlegen.
Insgeheim wusste er, dass er sich etwas in die Tasche log. Ein Deal war ein Deal. Also doch käuflich. Eine Hure, genau wie alle anderen. Und warum auch nicht? Warum sollte ausgerechnet er sich als Einziger an die Spielregeln halten?
Scheiß drauf.
Scheiß auf Europa und das ganze verfickte Finanzgesindel. Wie wäre es denn, wenn er Figuret weiterleben und eine zweite Karriere als Hedgefonds-Manager beginnen ließ? So eine richtig brutale Kapitalistensau. Vielleicht wäre das ja eher nach dem Geschmack der Leser.
»Na gut«, sagte er. »Ich bin dabei. Ich werde es so machen, wie du sagst, und für eine gewisse Zeit verreisen. Und ich habe auch schon eine Idee, wohin es geht …«
Das Klingeln des Handys riss Eric aus seinen Gedanken. Er brauchte einen Moment, um sich zu orientieren. Die Hafengeräusche hatten ihn völlig eingelullt.
Er schaltete ein und blickte auf das Display. Eine SMS von Europcar. Der Wagen stand am Hotel zur Abholung bereit. Und dann war da noch eine zweite Nachricht. Von Bernadette. Sie hatte jetzt frei und wollte sich mit ihm treffen. Ob drei Uhr okay wäre. Er schaute auf seine Uhr. Viertel nach zwei. Damit blieben ihm noch fünfundvierzig Minuten.
Er überlegte kurz, dann traf er eine Entscheidung. Bernadette würde ohne ihn klarkommen müssen. Er würde das Hotel stornieren, Bastia verlassen und direkt zu seinem Zielort weiterfahren. Hier hielt ihn nichts mehr.
Hastig packte er alles zusammen, zahlte und machte sich auf den Weg zum Hotel.
4
Laurine sortierte die letzten Pressluftflaschen, prüfte, ob sie wirklich alle entleert waren, und verschloss den Stahlschrank. Dann ließ sie ihren Blick ein letztes Mal durch den Sicherheitsraum schweifen, vergewisserte sich, dass sie nichts vergessen hatte, und verließ die Taucherzentrale. Das Schild über dem Eingang des einstöckigen Gebäudes verkündete: Diving Corsica – Scuba Resort.
Sie fühlte sich heute Morgen ziemlich eigenartig. So, als hätte sie etwas Schlechtes gegessen. Wobei sie sicher war, dass es nicht daran lag, sondern daran, dass heute ihr letzter Tag war. Zumindest für die nächsten sechs Monate.
Sie hatte überhaupt noch keine Ahnung, wie sie die lange Zeit überstehen sollte. Nicht des Geldes wegen, sie hatte genügend zusammengespart, um sich um das Finanzielle keine Sorgen machen zu müssen. Nein, es waren ihre neuen Freunde, die ihr fehlen würden. Yvette und all die anderen.
Mit langsamen Schritten ging sie hinunter an den Strand und blickte über das Meer. Zwar schien die Sonne, trotzdem wirkten die Wellen dunkler als sonst, unheilvoller. Als würden sie irgendetwas ausbrüten. Ein unangenehmer Gestank kam von Westen herüber. Es roch, als würde da draußen irgendetwas verwesen. Laurine rümpfte die Nase. Nicht mal das Meer vermochte ihr heute Trost zu spenden.
Sie zog die Schuhe aus und ging über den feinen Sand auf das Wasser zu. Als ihre Zehen die Wellen berührten, zuckte sie zurück. Kalt war es. Für diese Jahreszeit viel zu kalt. Darüber hinaus hatte sie für einen kurzen Moment das Gefühl gehabt, einen elektrischen Schlag zu spüren.
Merkwürdig. Irgendetwas stimmte nicht.
Sie starrte ins Wasser. Bilder tauchten vor ihrem geistigen Auge auf. Menschen in Aufruhr. Sie schienen Angst zu haben. Die unbestimmte Silhouette eines Mannes wurde sichtbar, doch sein Antlitz war von Wellen verhüllt. Selbst als er sich näherte, vermochte sie keine Details zu erkennen. Ein Fremder? Vielleicht. Und doch wirkte er irgendwie vertraut.
Eine Welle rollte heran, umspülte ihre Füße und zerstörte das Trugbild. Raues Möwenkrächzen holte Laurine zurück in die Wirklichkeit.
Sie hob den Kopf und sah sich um. Wie lange hatte sie hier gestanden? Jedenfalls lange genug, dass dieser grässliche Geruch verschwunden war.
Gedankenversunken drehte sie sich um und ging zum Elektrocaddy. Sie startete das Fahrzeug und fuhr die hundert Meter zurück zum Hauptgebäude im Schneckentempo.
Der Club Med Sant’Ambroggio thronte oberhalb einer felsigen Landzunge, knapp zehn Kilometer nördlich vor Calvi. Er war einer von zwei Club Meds auf der Insel. Während die Anlage in den Sommermonaten aus allen Nähten platzte und von morgens bis abends mit Musik, Gelächter und Kindergeschrei erfüllt war, wirkte sie jetzt wie ausgestorben. Die letzten Reisenden waren vor einer Woche abgereist, und der Club bereitete sich auf den Winterschlaf vor. Ein paar Seminare und Schulungen, dann war hier nur noch das Wartungspersonal.
Laurine hatte den Job vor zwei Jahren angenommen und war im Großen und Ganzen sehr glücklich damit. Klar, manche der Tätigkeiten waren unter ihrer Würde. Zum Beispiel Chauffeurdienste für irgendwelche eingebildeten Promis. Oder das Abholen von Reisegruppen vom Flughafen. Aber meistens war es okay. Wo sonst konnte sie ihren sportlichen Neigungen nachgehen und wurde dafür sogar noch bezahlt? Die Kollegen vom Festland zogen sie – als Landei – gerne auf und witzelten darüber, dass sie in den Kategorien Tauchen, Wandern und Radfahren die einzige Frau war, aber sie respektierten sie. Laurine war nicht auf den Mund gefallen und kannte die Insel wie ihre Westentasche.
Mit ihren sechsunddreißig Jahren gehörte sie zu den Ältesten im Team, und das machte ihr ein bisschen zu schaffen. Ohnehin empfand sie sich nicht als sonderlich attraktiv. Ihre Nase war zu groß, ihre Augen standen zu nah beisammen, und ihre Brauen waren dicht und dunkel. Klar, um ihre pechschwarzen Haare wurde sie von vielen beneidet, aber was nützte das, wenn man ansonsten eine recht knabenhafte Erscheinung besaß?
Umso verwunderlicher, dass sie doch in regelmäßigen Abständen Anträge und Angebote erhielt. Anfangs war sie davon überfordert gewesen, doch inzwischen wusste sie damit umzugehen. Nicht zuletzt dank ihrer Freundin Yvette, die ihr erst mal einen Crashkurs in Sachen Flirten und Abwimmeln verpasst hatte. Yvette stammte aus Nizza. Eine trinkfeste, humorvolle und gut gepolsterte Südfranzösin. Sie hatten den Job zur gleichen Zeit begonnen und waren schnell gute Freundinnen geworden. Doch jetzt war die Saison vorüber, und Yvette fuhr wieder nach Hause. Bei dem Gedanken daran wurde es Laurine schwer ums Herz.
Sie fuhr vor das Hauptportal, stellte den Caddy auf den Parkplatz und ging zum Personalbüro.
Kaum war sie drinnen, wurde die Luft schlagartig stickig. Die Klimaanlage war bereits abgeschaltet worden, und hinter den Panoramafenstern staute sich die Hitze.
Laurine lenkte ihre Schritte nach rechts, als sie plötzlich fröhliches Gelächter hörte. In diesem Moment kamen Yvette und Simone um die Ecke gebogen.
»Da bist du ja endlich«, rief Yvette. »Wir haben schon gedacht, du wärst bereits abgereist.«
»Ohne euch Lebewohl zu sagen? Bestimmt nicht. Ich war bloß kurz drüben am Hafen und habe die Tauchersachen in Ordnung gebracht. Jetzt muss ich mich nur noch abmelden, dann geht es zurück nach Hause.«
»Ist alles okay mit dir? Du siehst so blass aus?«
Laurine überlegte, ob sie den beiden von ihrem Erlebnis am Strand berichten sollte, verkniff es sich aber. Sie hätten es ohnehin nicht verstanden.
»Alles in Ordnung«, sagte sie. »Es liegt sicher nur an der Party gestern. Ich fürchte, ich habe ein bisschen zu viel getrunken.«
»Das haben wir doch alle«, sagte Yvette lachend. »Diese Abschiedsfeiern haben es echt in sich.«
»Dafür siehst du aber blendend aus«, sagte Laurine und meinte es auch so. Wie gerne hätte sie etwas von dem Temperament und der Ausstrahlung von Yvette. Das Leben war einfach nicht fair.
»Danke«, sagte ihre Freundin und hakte sich bei ihr unter.
»Dabei habe ich immer noch einen Brummschädel. Ich hätte weniger von diesen Rumcocktails trinken sollen.«
»Ganz zu schweigen von den Kalorien«, sagte Simone und lachte. Laurine stimmte mit ein. Das Lachen tat ihr gut. Es vertrieb die düstere Vorahnung. »Musst du wirklich schon heute Abend abreisen, Yvette? Ich dachte, wir könnten vielleicht noch ein paar Tage zusammen verbringen. Ein bisschen wandern gehen oder so …«
»Wandern, ich?« Ihre Freundin schaute sie mit großen Augen an. »Wie kommst du denn auf die Idee?«
»Na, oder irgendetwas anderes. Von mir aus auch shoppen gehen, obwohl du weißt, wie sehr ich das hasse.«
Yvette sah sie betrübt an. »Sorry, meine Liebe, aber die Koffer sind gepackt und das Zimmer geputzt. Raoul bringt mich nachher zum Hafen.«
»Das könnte ich doch übernehmen«, sagte Laurine schnell.
»Danke für das Angebot, aber besser nicht. Du weißt doch, wie nah ich am Wasser gebaut bin. Und lange Abschiede sind einfach nicht mein Ding.«
»Meins auch nicht …« Laurine hätte jetzt ebenfalls heulen können, aber sie verkniff es sich. Sechs Monate. »Aber im nächsten Jahr bist du auf jeden Fall wieder mit dabei, oder?«
»Das kann ich dir nicht versprechen«, sagte Yvette. Als sie Laurines entsetztes Gesicht sah, fügte sie schnell hinzu: »Wenn’s nach mir ginge, sofort. Doch ich muss erst mal schauen, wie sich die Dinge daheim entwickeln. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich Genaueres weiß, okay?«
»Ja, unbedingt. Ohne dich ist der Club nicht derselbe.«
»Das will ich doch meinen.« Yvette grinste. »Und jetzt lasst uns die Gehaltsschecks holen und einen Abflug machen, ich werde sonst noch sentimental.«
Als sie die D 71 in die Berge hinauffuhr, konnte sie sich nicht an der Schönheit der Natur erfreuen. Weder an den malerischen Dörfern noch an den atemberaubenden Hängen und Bergen der Balagne. Yvette würde im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr mit an Bord sein? Das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein. Wer außer ihr würde Laurine dann zum Lachen bringen? Wer würde mit ihr zusammen von der großen, weiten Welt träumen?
Nicht, dass sie ihr Dorf nicht liebte – sie war hier aufgewachsen, hier kannte sie jeden Stein und jedes Gesicht –, aber manchmal sehnte sie sich nach der Ferne. Und nach einem edlen Prinzen auf einem weißen Pferd, der sie auf und davon trug. War sie etwa zu anspruchsvoll? Das fand sie nicht. Sie wollte doch nur das, was jeder Frau zustand.
Doch Mateu war wohl kaum dieser Prinz.
Die Trennung vor einem Jahr war mehr als überfällig gewesen. Spätestens an dem Abend, als er sie zum ersten Mal geschlagen hatte, war ihr klar geworden, dass sie einen riesengroßen Fehler begangen hatte. Und das war erst der Beginn des Albtraums gewesen. Im Nachhinein hatte sie sich oft gefragt, wie sie je auf diesen Choleriker hatte herreinfallen können.
Die Trennung war dann nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Und auch wenn Mateu das nicht akzeptieren konnte und ihr immer noch nachstellte, so würde sie doch standfest bleiben. Ob mit oder ohne Yvette. Wenn ihre Freundin meinte, sie müsse Korsika den Rücken kehren, dann war das eben so. Laurine würde auch allein klarkommen. Hatte sie immer getan.
Sie bog von der D 71 rechts ab und erklomm in steilen Serpentinen den Hügel von Speloncato. Die Sonne schien durch die Zweige der Buchen und warf verwirrende Lichtmuster auf die Straße. Durch eine schmale Zufahrt gelangte sie auf den Place de la Libération – das Herz des Ortes. Im Café La Voûte hatte sich eine Gruppe von Radlern in schrill-bunten Outfits niedergelassen, die sich lautstark zuprosteten. Drüben vor der Pension U Sechju saßen ein paar grauhaarige Rentner und studierten Karten.
Laurine fuhr mit ihrem halb verrosteten Nissan Pick-up-Truck einmal im Kreis um den Springbrunnen herum, hupte und stellte den Wagen vor der Kirche Saint-Michel ab. Ihr Bruder hatte ihr diese Kiste vermacht, und da Laurine nicht genug Geld besaß, um sich selbst ein Auto zu kaufen, hatte sie eingewilligt. Glücklich war sie damit nicht. Der Wagen passte kaum durch die Ortszufahrt.
Francine, die zusammen mit ihrem Mann Émile das Restaurant Le Gallieni betrieb, winkte und rief ihr etwas zu, was Laurine aber aufgrund des vorbeiknatternden Postautos nicht verstehen konnte. Sie gab Zeichen, dass sie später noch vorbeikommen würde, und machte sich auf den Weg zu ihrem Haus.
In jeder Hand eine Tüte mit Einkäufen, die sie unterwegs noch erledigt hatte, eilte sie die Stufen zur Oberstadt hinauf.
Speloncato war auf einem Granitfelsen errichtet worden, einem letzten Gebirgsausläufer des Monte Tolu, und schwebte einem Krähennest gleich auf sechshundertfünfzig Metern über der Ebene. An schönen Tagen sah das nur acht Kilometer entfernte Meer aus, als läge es ihr zu Füßen. Sicher ein Grund, warum das Dorf im Sommer zu einem der beliebtesten Ausflugsziele der Balagne zählte.
Laurines Haus gehörte zu den höchstgelegenen im Dorf. Es schmiegte sich an das Berggestein, sodass man fast nicht erkennen konnte, wo der natürliche Fels endete und das Mauerwerk begann. Der Eingang war so niedrig, dass man den Kopf einziehen musste, um nicht anzustoßen.
Sie hatte gerade mit Mühe den Schlüsselbund aus der Jeans gezogen, als sie hinter sich ein verhaltenes Hüsteln hörte. Sie fuhr herum. Ein Mann stand im Schatten des Torbogens und hielt einen Blumenstrauß in der Hand. Das schwarze Hemd bis zur Brust geöffnet, eine Baseballmütze auf der kahlen Stirn, deutete sich ein entschuldigendes Lächeln hinter seinem Bart an.
»Mateu!«
»Ganz schön bepackt. Darf ich dir helfen?« Ohne ihre Antwort abzuwarten, kam er auf sie zu, nahm ihr den Schlüssel aus der Hand und schloss auf. Dann reichte er ihn wieder zurück.
Sie nickte, trat ein und stellte die Einkäufe hinter die Tür. Mateu wartete draußen, den Blumenstrauß in der Hand.
»Ich hab gehört, dass heute dein letzter Arbeitstag war. Ich dachte, ich überrasche dich. Wir können einen netten Abend verbringen, Essen gehen und reden. Wie in alten Zeiten.« Er streckte ihr die Blumen entgegen. »Hier, die sind für dich.«
Laurine spürte, wie sich ihr Magen verkrampfte. Vermutlich war es das, was Francine ihr zurufen wollte. Dass ihr Ex oben auf sie wartete.
»Was soll das, Mateu? Du weißt doch, dass du nicht herkommen sollst«, sagte sie. »Ich habe dir gesagt, dass ich das nicht möchte. Was genau hast du bei unserem letzten Treffen nicht verstanden?«
»Ach komm schon. Heute ist so ein schönes Wetter, und ich dachte mir, du könntest vielleicht ein bisschen Aufmunterung vertragen. Letzter Tag und so. Ich weiß doch, wie sehr du an dem Laden hängst, auch wenn ich es nicht gutheißen kann, dass eine so schöne Frau wie du arbeitet. Dafür sind doch wir Männer da. Ich würde dich gerne auf einen Schluck einladen, nur deswegen bin ich gekommen. Oh, und natürlich um dir das zu geben.« Er zog eine Flasche Weißwein aus der Manteltasche. Seine Bewegungen waren geschmeidig wie die eines Panthers.
»Lass es, Mateu.«
»Aber das ist ein Clos Nicrosi. Weißt du, wie viel der kostet?«
»Ist mir egal. Vermutlich ist er doch nur wieder Teil von irgendeinem Schutzgeld. Ich will ihn nicht.«
»Nun komm schon, Laurine, zier dich nicht wie eine Jungfrau. Ich weiß, dass du keine mehr bist.« Er grinste anzüglich. »Es ist Samstag, da geht man aus. Lass mich dich wenigstens nachher noch zum Essen einladen. Das ist doch wohl das Mindeste.«
»Nein.«
Mateus Miene verfinsterte sich. »Dann willst du mich hier einfach stehen lassen?«
»Will ich, ja. Und jetzt geh. Oder möchtest du, dass ich mit deinem Vater über die Sache rede?«
»Lass meinen Vater aus dem Spiel.«
»Und überhaupt, was ist mit Julietta? Wie ich hörte, hat sie ihre bombastische Hochzeit doch noch gekriegt. Und sie ist schwanger. Glückwunsch. Wann ist es denn so weit?«
»Im Dezember.« In Mateus Augen war ein kurzes Glimmen zu sehen, das aber schnell wieder verschwand. Er setzte erneut sein unverbindliches Lächeln auf. »Du musst doch wissen, dass ich dich liebe. Ich werde nicht aufhören, um dich zu kämpfen.«
»Du bist jetzt mit Julietta verheiratet, vergiss das nicht. Außerdem besteht immer noch eine einstweilige Verfügung. Du musst fünfzig Meter Abstand zu mir halten. Solltest du das vergessen und ich diese Begegnung beim nächsten Mal zufällig mit dem Handy filmen, bist du dran.«
Er sagte nichts dazu, sondern grinste schief und wandte sich dann zum Gehen. »Kommst du morgen zur Beerdigung?«
»Beerdigung?« Laurine hob den Blick. »Wer ist denn gestorben?«