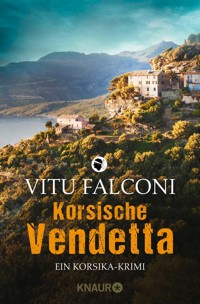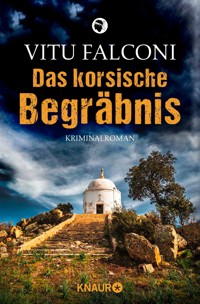6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Eric Marchand
- Sprache: Deutsch
So mörderisch wie malerisch: Der neue Korsika-Krimi von Vitu Falconi dreht sich um einen spektakulären Fund in den Tiefen des Mittelmeers und um ein lebensgefährliches Tauch-Abenteuer - aber auch um die atemberaubende Natur der Insel und den Mut der Menschen dort. Vor der wildromantischen Küste Korsikas ist man auf Spuren jenes römischen Schiffes gestoßen, das den »Schatz von Lava« geladen haben soll. Die Insel wird von einem regelrechten Goldrausch erfasst, "ehrenwerte" korsische Familien wollen unbedingt vor der Pariser Regierung an den Schatz gelangen. Das Wrack kann nur mithilfe eines Apnoe-Tauchers geborgen werden, der in der Lage ist, sich ohne hinderliche Sauerstoffflaschen durch die Felsspalten in der Tiefe zu zwängen. Ein Job für Laurine, die Freundin des Krimi-Schriftstellers und Wahl-Korsen Eric Marchand, der wenig begeistert von diesem Abenteuer ist. Doch weder Laurine noch Eric ahnen, wie gefährlich der Tauchgang tatsächlich werden wird... Ein Krimi-Muss für jeden Mittelmeer-Urlaub!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Vitu Falconi
Korsische Gezeiten
Ein Korsika-Krimi
Knaur e-books
Über dieses Buch
Vor der wildromantischen Küste Korsikas ist man auf Spuren jenes römischen Schiffes gestoßen, das den »Schatz von Lava« geladen haben soll. Die Insel wird von einem regelrechten Goldrausch erfasst, »ehrenwerte« korsische Familien wollen unbedingt vor der Pariser Regierung an den Schatz gelangen. Das Wrack kann nur mithilfe eines Apnoe-Tauchers geborgen werden, der in der Lage ist, sich ohne hinderliche Sauerstoffflaschen durch die Felsspalten in der Tiefe zu zwängen. Ein Job für Laurine, die Freundin des Krimi-Schriftstellers und Wahl-Korsen Eric Marchand, der wenig begeistert von diesem Abenteuer ist. Doch weder Laurine noch Eric ahnen, wie gefährlich der Tauchgang tatsächlich werden wird…
Inhaltsübersicht
Dópu un mèse di sicchina c’è sèmpre un temporale.
Nach einem Monat der Trockenheit gibt es immer ein Gewitter.
(Korsisches Sprichwort)
I
Wellen schwappten leise gluckernd gegen die Bordwand. Hin und wieder stieg eine von ihnen etwas höher und versprühte feine Tropfen. Wind war aufgekommen und führte den Geruch von Jod, Salz und Sonne mit sich. Die mitternachtsblauen Wogen wiegten die Paladin mit ruhigem Schlag, doch niemand hatte in diesem Moment Augen für die Schönheit des Meeres.
An Bord herrschte angespannte Stille.
François prüfte die Werte auf seinem Tauchcomputer und machte einen letzten Systemcheck. Der Gasdruck war optimal. Manometer, Zeitmesser, Puls- und Herzfrequenzsensoren arbeiteten fehlerfrei. Die Stirnlampe und der Handscheinwerfer waren ebenfalls in Ordnung. Die Minuten, ehe man ins Wasser stieg, waren die wichtigsten. Was man jetzt vergaß, konnte sich in der Tiefe rächen. Die See war keine rücksichtsvolle Ehefrau. Eher glich sie einer nervösen Geliebten; schön zwar, aber nachtragend und eifersüchtig, wenn man ihr nicht die volle Aufmerksamkeit schenkte. Wer von ihrer salzigen Umarmung aufgenommen werden wollte, der musste sich vorbereiten, durfte nicht eine Sekunde unachtsam sein.
Die Teammitglieder warteten gespannt auf die Beendigung seiner Vorbereitungen und den Moment, in dem er endlich das Zeichen geben würde. Doch er nahm sich Zeit, ließ sich nicht drängen und genoss den Augenblick. Es fühlte sich an, als wäre die Luft aufgeladen von knisternder Energie.
Gewissenhaft prüfte er noch einmal die Ventile an seiner Doppelflasche, nahm einen Zug am Mundstück und nickte zufrieden. Das Trimix war in Ordnung. Das Atemgemisch aus Sauerstoff, Stickstoff und Helium war ursprünglich vom Militär entwickelt worden und stand nun auch Sporttauchern zur Verfügung. Eine spezielle Mischung für Tiefen bis hundertfünfzig Meter. Nicht, dass François vorhatte, so weit runterzugehen. Ihn interessierten nur die ersten fünfzig Meter. Aber was seine Gesundheit betraf, ging er kein Risiko ein. Es gab immer noch zu viele Taucher, die glaubten, man könne unterhalb von dreißig Metern mit Druckluft tauchen. Sie vergaßen dabei, dass der Stickstoff erhebliche Probleme verursachen konnte. Je höher der Partialdruck, desto mehr von dem Gas diffundierte durch die Kapillarmembranen und löste sich im Blut. Stieg man zu schnell wieder auf, bildeten sich aufgrund des abnehmenden Außendrucks Stickstoffbläschen im Blut und führten zu der berüchtigten Dekompressionskrankheit. Die Folgen: Schmerzen in den Gelenken und in den Arm- und Beinmuskeln. Dann kamen Schwindel, starke Müdigkeit, Kopfschmerzen, Brust- und Rückenschmerzen, Atemnot, Herz-Kreislauf-Probleme, Hörverlust, Sprachstörungen, Sehstörungen, Störungen des Bewusstseins, Lähmungen, Bewusstlosigkeit und schließlich der Tod.
Natürlich gab es auch Taucher, die ohne jegliches Equipment bis hundert Meter oder tiefer gingen. Freitaucher, Apnoeisten, Verrückte. Spinner, die testen wollten, wo ihre Grenzen lagen, und die dabei ihr Leben riskierten. Besonders verantwortungsvoll war das nicht. Dass sie außer einer Schwimmbrille und einem Neoprenanzug nichts am Leibe trugen, war so ziemlich das Einzige, worum François sie beneidete. Das Gewicht der Tauchausrüstung einschließlich Weste und Bleisäckchen betrug gute fünfzehn Kilo. Momentan glich er eher einem gestrandeten Wal denn einem Menschen.
Er konnte kaum erwarten, zu sehen, was da unten war. Das schiffseigene Ortungssystem hatte einen dunklen Schatten entdeckt. Eine schmale Kluft, etwa dreißig Meter lang und vier Meter breit. Vielleicht wirklich nur ein Schatten, aber es bestand eine winzig kleine Chance, dass es etwas anderes war.
Dieser Meeresabschnitt war nicht irgendeine unbedeutende Bucht, was sich hier vor zweitausend Jahren abgespielt hatte, ließ auch heute noch das Herz jedes Schatzsuchers höherschlagen. Der Fund hatte in den Achtzigerjahren für Aufsehen gesorgt, inzwischen aber war es still um ihn geworden. Wie es schien, gab es nichts mehr zu entdecken. Angeblich war das Rätsel gelöst und der Fall abgeschlossen. Zumindest, wenn man den Pressemitteilungen des französischen Instituts für Unterwasserarchäologie Glauben schenkte. Was François nicht tat. Er war überzeugt davon, dass der eigentliche Schatz noch gar nicht gefunden worden war. Er beendete seine Vorbereitungen und richtete den Daumen nach oben.
Die Sonne brannte von dem wolkenlosen Himmel auf sie herab. Das Licht ließ die Farben verblassen. Holzplanken, Metallbeschläge, Taue und Kunststoffverkleidungen, alles wurde auf harte Kontraste reduziert. Selbst die Männer in ihren T-Shirts und Bermudas wirkten wie Scherenschnitte. Stumm standen sie da und beobachteten ihn hinter ihren Sonnenbrillen.
Magnus Hansen, Norweger und Leiter ihrer kleinen Freibeutertruppe, stand ebenfalls in voller Montur vor ihm. Er würde sein Partner bei diesem Tauchgang sein.
»Und? Wie sieht’s aus? Geräte okay?« Sein Französisch war etwas holperig, aber deutlich besser als François’ Norwegisch.
»Bist du startklar?«
»Mais oui«, sagte François.
»Na, dann ab ins Wasser. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder Konservenluft zu schnuppern.«
François setzte die Maske auf, biss auf das Mundstück und schlappte in Richtung Reling.
Unter dem Neopren war es bereits unangenehm heiß. Er atmete kräftig ein und aus. Für einen kurzen Augenblick schmeckte das Gemisch, als habe jemand alte Zeitungen und Getriebeöl verdampft, doch das war nur der erste Moment. Jetzt war es wieder absolut neutral. Nur, dass es dazu neigte, einem den Mund auszutrocknen.
Er setzte sich auf die Reling, Rücken zum Meer, und warf einen letzten Blick zum Festland hinüber. Einen guten Kilometer entfernt leuchteten die roten Granitklippen der Bucht von Lava. Hier hatte vor gut dreißig Jahren alles angefangen. Die Seeigeltaucher, der Schwarzmarkthandel, der Einsatz der Polizei, die vielen Festnahmen – die Region war eine Quelle von Geschichten, Gerüchten und Spekulationen und hatte unter Schatztauchern eine gewisse Berühmtheit erlangt. Sollte es ihnen heute vielleicht endlich gelingen, das Rätsel zu lösen? François spürte, wie ein Kribbeln über seinen Rücken lief.
Magnus tippte ihm auf die Schulter, formte mit Daumen und Zeigefinger ein O und ließ sich hintenüberfallen. Klatschend traf er auf das Wasser.
François folgte seinem Beispiel. Er presste Lungenautomat, Tauchcomputer und Nitroxflasche an den Bauch, legte das Kinn auf die Brust und ließ sich ebenfalls fallen.
Das Wasser empfing ihn mit einem sanften Ruck.
Er sank ein Stück nach unten, dann tauchte er wie ein Korken wieder auf. Der weiße Rumpf der Paladin war direkt neben ihm. Über sich sah er die Köpfe der Besatzungsmitglieder. Er gab ihnen zu verstehen, dass alles in Ordnung war, spülte sein Schlauchsystem mit der Luftdusche frei und wandte sich Magnus zu. Der war bereits mit seinen Vorbereitungen fertig, hatte den Inflatorschlauch in die Höhe gerichtet und entleerte seine Weste. Gurgelnd und schäumend versank er in den Fluten.
François atmete aus, dann ging es für ihn ebenfalls abwärts.
Schlagartig war das Gewicht verschwunden, und die Temperaturen wurden angenehm.
Das Wasser war glasklar. Die Sicht betrug mindestens fünfzehn Meter. Grünblaues Licht umgab ihn. Ein Schwarm Mönchsfische tummelte sich unterhalb von Ruder und Schraube.
François lächelte hinter seiner Maske. Er fühlte sich wie eine Amphibie, die für einen kurzen Moment der Orientierungslosigkeit an ihren Heimatort zurückgefunden hatte. Hier im Meer lag seine wahre Bestimmung. Nur hier fühlte er sich wahrhaftig frei. Doch es war ein kurzer Moment, den er sich gönnte, schließlich waren sie zum Arbeiten hier.
Die ersten fünf Meter erforderten die meiste Konzentration. Das Problem war der Auftrieb. Weste, Neopren, Atemluft – all das zog einen nach oben. Als Profi wollte er natürlich so wenig Blei wie möglich mit sich nehmen, umso einfacher würde später das Auftauchen werden. Aber Blei abwerfen? Niemals.
Er zwang sich also, seine Lunge zu entleeren, und begann mit dem Druckausgleich. Fünfundvierzig Meter. Kein Pappenstiel.
Rein rechnerisch nahm der Druck alle zehn Meter um etwa ein Bar zu. Das bedeutete, dass dort unten fünf Kilogramm Gewicht auf jedem Quadratzentimeter des Körpers lasteten. Auch auf dem Trommelfell, diesem papierdünnen Häutchen am Ende des Gehörgangs. Aber der Druck hatte auch seine guten Seiten. Immerhin löste sich damit das Problem des Auftriebs von ganz allein.
Immer weiter ging es abwärts. Inzwischen war das Wasser deutlich kühler geworden. François begrüßte die schützende Schicht des Neoprens. Der Rumpf der Paladin ähnelte aus der Entfernung einem Bügeleisen, das die Wasseroberfläche zerteilte. Wellen kräuselten sich um den Schiffsrumpf. Ein Schwarm Mönchsfische schwebte über den blass leuchtenden Himmel. Ein Barsch kreuzte ihren Weg. Dann tauchten die ersten Felsen auf.
Das Licht war bereits so weit geschwunden, dass sie ihre Lampen einschalten mussten. Lange bleiche Finger tasteten durch die Dunkelheit, hoben einzelne Details hervor und ließen andere verschwinden.
Sie brauchten nicht lange, um zu finden, wonach sie suchten. Da lag sie. Die Felsformation, die ihnen auf dem Sonar angezeigt worden war. Wie ein gigantisches Maul erstreckte sich die Kluft über den Meeresgrund.
Inzwischen waren sie auf dreißig Meter Tiefe. Das leuchtende Display seines Tauchcomputers erhellte die Umgebung, während François näher an einen der großen Brocken herantrieb.
Das Gestein war über und über mit Braunalgen überwuchert. Der stark verwitterte Granit bot einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen eine Heimat. Schwämme, Seescheiden, Röhrenwürmer, daneben zahlreiche Krustenanemonen, die vorzugsweise die tiefen Spalten bevölkerten.
Er streckte seine Hand aus und berührte den Felsen. Kleine Brocken lösten sich ab, rieselten in die Tiefe. Die Felswand war durchsetzt mit Rissen, Spanten und Höhlen. Wie ein Turm aus Bauklötzen, der von einem ungeduldigen Kind übereinandergestapelt worden war.
Ein Gefühl der Beklemmung überkam ihn, als er den Strahl seines Handscheinwerfers die Felswand entlang in die Tiefe gleiten ließ. Diese Felsformation erinnerte ein wenig an die Calanche. Eine Felslandschaft aus rotem Granit, die mit ihren bizarren Schlössern und Türmen eines der größten Naturwunder Korsikas darstellte. Dies hier sah so ähnlich aus, nur mit dem Unterschied, dass es unter Wasser war.
Magnus war bereits einige Meter tiefer gesunken. Er blickte zu ihm herauf und gestikulierte heftig. Hatte er etwas gefunden?
François spürte, wie sein Herz schneller schlug. Bitte, lass es keinen falschen Alarm sein, dachte er. Bitte, lieber Gott, mach, dass es das ist, worauf wir so lange gehofft haben.
Er entließ einen Schwall Luft aus seiner Weste und begab sich in einen steilen Sinkflug. Magnus ließ ihm den Vortritt, schließlich war er es gewesen, der als Erster die Anomalie am Meeresboden entdeckt hatte. François wusste diese Aufmerksamkeit zu schätzen.
Der Druck auf den Ohren nahm zu. Er machte einen weiteren Druckausgleich, tat es jedoch halbherzig, ohne sich die nötige Zeit zu nehmen. Er konnte jetzt nicht mehr warten. Zu sehr beschäftigte ihn der Gedanke, was dort unten wohl auf sie warten mochte.
Und dann sah er es.
Was auf dem Sonar nur als diffuser Schatten zu sehen gewesen war, entpuppte sich im zuckenden Schein seiner Lampe als eine Struktur von beträchtlicher Abmessung und hohem Alter. Natürlich lagen hier nicht irgendwelche Holzplanken herum, die waren von der See längst zerstört worden, aber François war erfahren genug, um zu erkennen, dass der Meeresboden an dieser Stelle deutlich anders aussah. Auf einer Länge von vielleicht zwanzig oder dreißig Metern war der Schlamm dunkel verfärbt. Bakterien hatten sich hier niedergelassen, deren Ausscheidungen zu dieser Veränderung geführt hatten. Der Streifen war viel zu gerade und symmetrisch, um natürlichen Ursprungs zu sein. Darüber hinaus waren die Steine, die hier rumlagen, von eigentümlicher Größe und Ebenmäßigkeit. Konnte es sein, dass dies gar keine Steine waren …?
Mein Gott, dachte er. Es waren Amphoren. Hunderte.
Die meisten existierten nur noch als Bruchstücke, doch viele waren noch intakt. Amphoren. Das konnte nur bedeuten, dass es ein Schiff war und dass es aus römischer Zeit stammte.
Das Schiff.
François benötigte einen Moment, um sich zu sammeln. Sein Verstand war wie benebelt. War es nur der Schock, oder hatte er es beim Abtauchen vielleicht doch etwas zu heftig angehen lassen? Scheiß drauf! Ein Moment wie dieser widerfuhr einem vielleicht einmal im ganzen Leben. Ein wenig Aufregung war da verzeihlich, oder?
Er sah dieses Wunder dort unten liegen und wusste, dass es für ihn jetzt kein Halten mehr gab. Er musste sicher sein, dass er sich das nicht alles nur einbildete. Er musste es anfassen.
Mit einem heftigen Druck auf den Knopf seiner Tarierweste entleerte er den Rest des Luftvorrats und ließ sich komplett nach unten sinken. Der Lichtstrahl enthüllte einen Teppich von Tonscherben. Alles war damit bedeckt.
Der Aufprall fiel heftiger aus als erwartet. Der Boden schien zu erzittern und wirbelte eine erhebliche Menge Schwebeteilchen in die Höhe. Eine Wolke aus Sand und Staub hüllte ihn ein, trübte das Licht seiner Lampen und raubte ihm die Sicht. Doch was er in den Tiefen des Schlamms mit seinen Fingern ertastete, entlockte ihm einen Freudenschrei. Da waren Strukturen. Kein Stein und auch kein Metall, dafür war es zu weich. Holz vermutlich oder eine andere organische Substanz. Leder vielleicht oder Segeltuch?
Im Licht seiner Lampe blitzte etwas auf. Er griff danach und spürte das Gewicht. Es war Metall. Ein großer Klumpen zusammengebackener Münzen.
Mit hektischen Bewegungen versuchte er, die Seepockenverkrustungen mit dem Messer abzukratzen. An einer kleinen Stelle brach der Belag ab und ließ ihn einen Blick auf das werfen, was sich darunter befand. Das war weder einfaches Silber noch banale Bronze. Nur ein Metall auf der Welt besaß so einen Glanz. Gold!
Atemlos blickte er zu seinem Freund hinauf.
Allein was er in diesen wenigen Augenblicken entdeckt hatte, war mehr wert als alles, was daheim auf seinem Bankkonto lag. Wie viel, das vermochte er nicht mal ansatzweise zu schätzen. Hunderttausend, vielleicht eine Million? Und welche Wunder mochten dort unten noch auf sie warten?
Er ließ den Brocken fallen, hob beide Hände und wedelte wild zu Magnus hinauf. Sein Freund hatte seine Position nicht verändert. Er schwebte etwa zehn Meter über ihm und kam nicht herab.
Warum?
Noch einmal winkte François. »Nun komm schon«, nuschelte er in sein Atemgerät. »Worauf wartest du denn noch? Es ist eine Sensation.« Doch Magnus machte keine Anstalten, seiner Aufforderung zu folgen.
Eigenartig.
Irgendetwas stimmte nicht, seine Haltung verriet es. Zu angespannt, zu nervös. Statt nach unten zu blicken, wo die Musik spielte, sah Magnus sich nach allen Seiten um, ließ den Strahl seiner Handlampe hektisch in alle Richtungen zucken.
François spürte ein warnendes Kribbeln in seinem Nacken. Was war nur los mit seinem Freund? Trieb sich vielleicht ein Hai in der Nähe herum? Wenig wahrscheinlich. Von den für den Menschen besonders gefährlichen Arten gab es im Mittelmeer nur zwei: den weißen Hai und den Tigerhai. Doch in den Statistiken spielten beide kaum eine Rolle. Alle zwei Jahre gab es einen Haiangriff, und das bei fünfzig Millionen Menschen, die an einem Sommertag durchschnittlich im Mittelmeer badeten. Das war ein Witz. Da starben deutlich mehr an einem Hitzschlag.
Trotzdem, irgendetwas beunruhigte Magnus. Zu dumm, dass sie nicht miteinander reden konnten.
François erinnerte sich, dass er letztes Jahr einen Antrag auf die Anschaffung von Helmtauchgeräten eingebracht hatte. Doch er war damit gegen Wände gelaufen. Klar, es war eine vollkommen andere Art des Tauchens. Zwei Helfer waren dafür nötig. Einer, der den Atemschlauch führte, wieder ein anderer, der die Anzeigetafeln kontrollierte, Tiefe und Tauchzeit im Auge behielt und mithilfe der integrierten Sprecheinrichtung mit dem Mann dort unten kommunizierte. Dafür aber hatte der Taucher die Hände frei. Er konnte unbegrenzt auf dem Boden des Meeres herumwandern, sich verständigen, mit der Helmkamera filmen und musste sich keine Gedanken um solche Sachen wie Dekompression machen. Natürlich war das Equipment nicht ganz billig, und so war letztlich niemand für die Idee zu begeistern gewesen. Jetzt ärgerte es François, dass er sich nicht vehementer dafür eingesetzt hatte.
Er blickte nach oben. Das wenige Licht, das noch von der Oberfläche bis hier heruntergedrungen war, hatte sich verabschiedet. Als wäre dort oben eine dunkle Wolke aufgezogen. Eben noch war der Himmel strahlend blau gewesen, jetzt wurde er zunehmend dunkler. Der Wetterbericht hatte für die folgenden Tage einen wolkenlosen Himmel angekündigt. Und noch etwas war seltsam. War das Wasser eben noch glasklar gewesen, so begann es sich jetzt mehr und mehr einzutrüben. Schwebeteilchen schoben sich ins Blickfeld, wurden vom Licht der Handlampe zerstrahlt. Magnus war inzwischen kaum noch zu erkennen. Sand rieselte von den Felswänden herab. Und was war das für ein dumpfes Poltern?
François richtete das Licht auf die neben ihm aufragende Felswand – und erstarrte. Vom Fels war nicht mehr viel zu sehen. Er war eingehüllt in einen Schleier aus Sand und Staub, der unaufhörlich von oben herabregnete. Das Poltern nahm an Lautstärke zu. François meinte sogar eine Bewegung unter seinen Füßen zu spüren. Ein Schlingern, als bestünde der Boden aus Gummi. Wie Schuppen fiel es ihm von den Augen
Das war ein Erdstoß. Ein gottverdammtes Erdbeben.
Es musste eingesetzt haben, als François unten auf dem Grund aufgekommen war. Aufprall und Druck hatten seine Sinne verwirrt.
Aus dem Augenwinkel bemerkte er einen schwarzen Brocken, der wie ein Asteroid von oben auf sie herunterfiel. Magnus schien die Gefahr nicht zu bemerken, da er ausschließlich nach unten blickte. Noch immer versuchte er, François auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen.
François deutete nun seinerseits hektisch nach oben, doch Magnus schien nicht zu begreifen, was er meinte. Dann schlug der Felsen ein. Er traf die Druckluftflasche seines Kollegen und brach das Ventil ab. Ein scharfes, metallisches Knacken ertönte, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Zischen. Zu zweihundert Bar komprimiertes Gas entwich schlagartig aus den Druckluftflaschen und riss den unglücklichen Expeditionsleiter wie eine Stoffpuppe mit sich. Einer Boden-Luft-Rakete gleich schoss er in einer aufwärts geneigten Spirale in die Höhe. François sah noch kurz, wie der leblose Körper herumgeschleudert wurde, dann war er aus seinem Blickfeld verschwunden.
Himmel!
Er ließ Gas in seine Weste schießen und stieß sich vom Grund ab. Über ihm hatte sich der gesamte Himmel verdunkelt. Die Felswand kollabierte. Im Schein seiner Lampe sah er, wie sich riesige Brocken aus ihrer Verankerung lösten, krachend und polternd gegeneinanderschlugen und unaufhaltsam auf ihn herabstürzten. Das Poltern schwoll zu einem Donnern an.
François stöhnte vor Entsetzen. Seine Zuversicht schrumpfte auf die Größe einer Erbse. Panisch strampelnd, versuchte er, den Wagenladungen von Gestein zu entkommen. Die Lampe entglitt seinen Händen und fiel zu Boden. Mit hektischen Bewegungen suchte er nach der Schlaufe für das Notventil, doch er fand sie nicht. Wowar das Scheißding, wenn man es brauchte?
Ein Stein traf seine Schulter, ein anderer verfehlte nur knapp seinen Kopf. Er kippte um und musste mit ansehen, wie tonnenschwere Brocken auf ihn herabfielen. Sie zerschlugen die Lampe und tauchten alles in eine kryptische Finsternis. Dann traf ihn irgendetwas vor die Brust. Es presste ihm die Luft aus der Lunge und zermalmte ihn mit der Wucht eines Güterzuges. Im Bruchteil einer Sekunde hauchte François Michaud sein Leben aus.
II
Der Flughafen Bastia-Poretta platzte aus allen Nähten. In der Wartehalle standen Hunderte von Reisenden, die sich für ihren Abflug bereit machten. Die meisten wollten einchecken, etliche mussten durch die Security oder ihr Sperrgepäck aufgeben. Hauptsächlich Ältere und Familien mit kleinen Kindern, da in vielen Ländern noch keine Schulferien waren. Ziemlich viele Deutsche, wie Laurine belustigt feststellte, was wiederum dem Klischee vom reiselustigsten aller Völker entsprach. Dicht gefolgt von den Chinesen und Japanern.
Aber sie hatte jetzt ganz andere Sorgen. Die Maschine aus Paris war mit Verspätung eingetroffen, und so stand Laurine sich hier bereits seit vierzig Minuten die Beine in den Bauch. Das Flughafenpersonal wirkte überfordert, die Leute waren genervt, die Kinder aufgedreht. Ein ganz normaler Samstag auf einer Insel, deren einziger internationaler Flughafen dem Ansturm mal wieder nicht gewachsen war. Dabei hatte die Hauptsaison noch gar nicht begonnen.
Laurine sah Passagiere über das Vorfeld laufen und Richtung Passkontrolle gehen. Wie es schien, hatte die Warterei ein Ende. Türen glitten zur Seite, es wurde gelacht und geredet, dann trafen die Ersten bei der Gepäckausgabe ein. Laurine hob das Schild mit der Aufschrift Club-Resort Sant’ Ambroggio in die Höhe.
Sie gehörte zum Stammpersonal des Club Méditerranée, und das seit gut zwei Jahren. Ein Job, über den sie sehr froh war, immerhin lebte sie allein und musste zusehen, wie sie finanziell über die Runden kam. Ihr Spezialgebiet war das Tauchen, doch war sie auch ausgebildete Bergführerin und leitete Reisende auf steilen Wanderwegen quer durch die korsische Bergwelt.
Das Stammpersonal mit Korsen zu besetzen war ein kluger Schachzug der Firmenleitung gewesen. Auf diese Weise verringerte man das Risiko von Anschlägen. Die Nuits bleues, die Blauen Nächte, von denen es in der Vergangenheit etliche gegeben hatte, gehörten der Vergangenheit an. Die Korsen waren recht eigen mit der Auswahl von Unternehmen, die sie auf ihrer Insel duldeten. Wer nicht nach ihren Regeln spielte, spielte gar nicht, und so hatte es bis heute keine der großen internationalen Hotelgruppen geschafft, hier Fuß zu fassen. Lediglich das Best Western und der Club Med bildeten die Ausnahme, und das auch nur, weil sie Schutzgeld, beschönigend Revolutionssteuer genannt, an die Nationalisten zahlten.
Ein kahlköpfiger Mann mit Trommelbauch und Schnurrbart führte die Gruppe von Rentnern an. Er richtete seine stechenden Augen auf Laurine. »Sind Sie vom Club Med?«
Sie presste das Schild mit der überdeutlichen Aufschrift vor die Brust. »Ja, das bin ich. Mein Name ist Laurine. Madame Selème schickt mich, Sie hier abzuholen und auf die andere Inselseite zu fahren. Hatten Sie einen angenehmen Flug?«
»Eingezwängt auf einen Raum von der Größe eines Hühnerkäfigs, Sie machen wohl Witze.« Er strich über seinen Bart. »Ich habe das Gefühl, die Plätze werden jedes Mal kleiner und das Handgepäck immer größer. Sie hätten das Chaos in der Gepäckaufbewahrung erleben sollen.« Er schnaubte. »Na, immerhin gab es ein Sandwich aus Wellpappe und einen müden Kaffee. Das entschädigt einen doch ungemein für eingeschlafene Füße und malträtierte Bandscheiben, oder?« Er drehte sich um und gab den anderen mit Handzeichen zu verstehen, dass er hier alles geregelt hatte.
Laurine überflog die Gruppe. Vier Frauen, vier Männer. Keiner jünger als fünfundsechzig. »Herzlich willkommen auf der Île de Beauté«, erhob sie ihre Stimme über den stetig wachsenden Lärmpegel. »Ich freue mich, dass Sie alle wohlbehalten hier angekommen sind, und hoffe, dass Sie eine Menge Spaß und gute Laune mitgebracht haben.«
»Ist hier immer so viel los?«, fragte eine Dame mit blau meliertem Haar. Sie rümpfte angewidert die Nase. »Ist ja schlimmer als in Orly.«
»Das sind les Allemands«, grummelte der Schnauzbärtige. »Die sind immer gleich in Hundertschaften unterwegs. Rudelbildung, scheint bei denen genetisch zu sein. Und jetzt überfallen sie unsere Insel.«
Laurine bemühte sich krampfhaft, ihr Lächeln aufrechtzuerhalten. Dass er als Franzose es wagte, von unserer Insel zu sprechen, stieß ihr übel auf. Pinzutu hießen solche Leute hier in der Sprache der Einheimischen. Abfällig für Festlandsfranzosen.
»Herrschaften, das Gepäck wird noch eine Weile brauchen«, sagte sie. »Ich würde Ihnen empfehlen, die Toiletten aufzusuchen, solange der Rest der Passagiere noch nicht auf dieselbe Idee gekommen ist. Einfach dort entlang und dann die Treppe runter. Ich halte solange die Stellung.«
Laurine wusste aus Erfahrung, dass Menschen in diesem Alter zu einer schwachen Blase neigten. Sie tat das nicht ganz uneigennützig. Ihnen stand eine anderthalbstündige Autofahrt bevor, und sie hatte keine Lust, alle zehn Kilometer anzuhalten. Ihr Angebot wurde dankbar angenommen.
Kurze Zeit später saßen sie alle angeschnallt im Kleinbus und waren auf dem Weg. Die Strecke führte auf der gut ausgebauten Bundesstraße quer durch die Berge an Castello-di-Rostino, Ponte Leccia und Pietralba vorbei bis nach Île-Rousse. Von dort aus waren es nur noch wenige Kilometer an der Küste entlang bis nach Sant’ Ambroggio.
Der Motor des Citroën Jumper schnurrte, der Tank war voll, und auch die Rentner hatten inzwischen bessere Laune. Was nicht zuletzt an den Piccolöchen lag, die Laurine mitgenommen und verteilt hatte. Ein kleiner Trick, den ihr ihre Freundin Yvette verraten hatte. Dank des gehobenen Alkoholpegels hatten die Gruppenmitglieder ihre gute Laune wiedergefunden, sodass Laurine sich ganz auf den Verkehr konzentrieren konnte.
Hinter Petinella bogen sie rechts ab. Die T 20 war die schnellste Verbindung, um über die Insel zu kommen. Draußen zogen die bewaldeten Flanken der Castagniccia an ihnen vorbei. Das Land war auf dieser Seite wesentlich grüner und bewaldeter als drüben im Westen. Die Genuesen hatten im fünfzehnten Jahrhundert die ersten Kastanienbäume gepflanzt und die Einheimischen dazu verpflichtet, mindestens vier Bäume im Jahr zu setzen. Das hügelige Gebiet im Nordosten Korsikas spielte während des achtzehnten Jahrhunderts eine wichtige Rolle für die korsische Unabhängigkeitsbewegung. Von den umliegenden Klöstern zogen Freiheitskämpfer wie Pasquale Paoli aus, um für den Widerstand einzutreten. Damals war die Castagniccia eines der wohlhabendsten Gebiete Korsikas, mit einer Bevölkerungsdichte, die die sämtlicher anderen Provinzen in den Schatten stellte. Noch heute zeugen die prächtigen Barockbauten von dem damaligen Wohlstand. Aber mit dem Einzug des Tourismus zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts verlor das Gebiet seine Vormachtstellung. Geld wurde nun woanders verdient, und die jungen Leute wanderten ab. Die Bergdörfer verarmten und verfielen. Manche gerieten fast völlig in Vergessenheit.
Laurine wurde immer etwas melancholisch, wenn sie hier entlangfuhr. Das Land war ein Spiegel für Vergänglichkeit, für eine Zeit, die lange vorüber war. Gleich einer Operndiva, deren Glanz man nur noch hinter Schichten von Schminke, Seide und Spitzen erahnen konnte. Noch immer schwebte etwas davon über dem Land, aber man musste ein feines Gespür besitzen, um es zu erkennen.
»Sagen Sie mal, Fräulein, meinen Sie, wir könnten mal irgendwo eine kleine Pause einlegen?«
Laurine zuckte zusammen. Das Gesicht des Bärtigen war neben ihr aufgetaucht und holte sie aus ihren Gedanken. Sein Atem roch nach Alkohol. »Wir fahren schon eine ganze Weile, und einige von uns müssen mal. Der Sekt drückt ziemlich auf die Blase, wenn Sie verstehen, was ich meine.« Er grinste anzüglich.
Ihr Blick zuckte zum Tachometer. Sie waren gerade mal zwanzig Kilometer weit gekommen. Das konnte ja heiter werden.
»Vor wenigen Minuten haben wir das Hotelrestaurant Accendi Pipa passiert«, sagte sie. »Soll ich umkehren?«
Er schüttelte den Kopf. »Ach wo. Ein lauschiges Plätzchen irgendwo hinter einem Busch ist für uns völlig ausreichend. Oder hat jemand ein Problem damit, in der freien Natur zu pinkeln?«
»Damen links, Herren rechts«, rief einer.
Gelächter erklang.
»Sehen Sie«, sagte er. »Wir sind ja schließlich keine alten Leute. Wenn Sie also irgendwo ein Örtchen für uns finden könnten, wären wir Ihnen sehr …« Weiter kam er nicht, denn in diesem Moment trat Laurine aufs Gas.
Hart.
Der Motor heulte auf. Der Jumper machte seinem Namen alle Ehre. Aus dem Augenwinkel sah Laurine, wie der Schnauzbart nach hinten kippte. Es gelang ihm gerade noch, sich an einer Lehne festzukrallen. Die anderen schrien erschrocken auf.
»He, sind Sie noch ganz bei Trost?«, brüllte ein Mann von hinten. Der Schnauzbart war viel zu verblüfft, um einen Ton herauszubringen.
Schweigend konzentrierte Laurine sich auf die Strecke vor ihnen. Jetzt fand auch der Führer der Gruppe seine Stimme wieder. Sein Kopf war puterrot. »Ich sagte, Sie sollen anhalten, nicht beschleunigen«, donnerte er heiser. »Was ist denn in Sie gefahren?«
Sie achtete nicht auf ihn. Sein Wutausbruch vermischte sich mit dem Motorengeheul zu einem Hintergrundrauschen. Es war, als hätte ihr jemand ein dickes Kissen auf die Ohren gedrückt.
Der Jumper raste wie ein wild gewordenes Tier. Hitze und Gestank quollen in den Fahrgastraum. Es roch nach verschmorten Kabeln und überhitztem Metall. Die Nadel zuckte auf hundertvierzig Stundenkilometer. Zum Glück war die Straße vor ihnen frei, sie wäre sonst unwiderruflich mit dem Vordermann kollidiert.
Laurine umklammerte das Lenkrad und starrte geradeaus. Ihre Finger waren schweißnass. Sie konnte nicht anders, als stur nach vorn zu schauen und aufs Gas zu treten. Es war, als habe eine fremde Macht von ihr Besitz ergriffen. Vor ihr erstreckte sich das letzte Stück der Brücke. Noch etwa dreihundert Meter. Die Brücke! Was war damit?
In diesem Moment spürte sie die Bewegungen. Ein sanftes Schwingen. Wie auf einem Boot, nur stärker. Viel stärker.
Und es nahm an Heftigkeit zu.
Zuerst dachte sie, ein Reifen wäre geplatzt, doch dann bemerkte sie, wie die Stromleitungen neben der Fahrbahn hin und her pendelten. Wie Taktstöcke, die die Luft zerteilten. Die Kabel bewahrten sie davor, umzufallen und auf die Fahrbahn zu krachen.
Rechts löste sich eine Wagenladung Geröll aus dem Hang, polterte talabwärts und löste eine Staublawine aus.
Wellen liefen wie Wasser über den Asphalt. Die Brücke machte Bewegungen wie ein junges Pferd. Die Verwerfungen waren beträchtlich. Kreischend flog der Jumper über den Asphalt. Sie spürte, wie er in die Luft gehoben wurde und dann krachend und schlingernd jenseits der Brücke auf festen Grund traf. Sie waren drüben. Sie hatte es geschafft.
Dann bremste sie.
Das ABS-System brachte den Wagen stotternd zum Stillstand. Etwa fünfzig Meter legten sie noch zurück, dann kamen sie zur Ruhe.
Wie erstarrt saß Laurine da, die schweißnassen Hände um das Lenkrad geklammert. Ihr Herz schlug wie ein Presslufthammer. Sie konnte nicht sprechen, konnte kaum atmen. Der scharfe Geschmack nach Magensäure erfüllte ihren Mund.
Autos kamen ihr entgegen, bremsten ab und hielten auf ihrer Höhe an. Nicht wegen ihnen, sondern weil die Fahrt für sie hier zu Ende war. Ohne in den Rückspiegel zu blicken, wusste Laurine, was geschehen war.
Doch hinten im Wagen schien man davon noch nichts mitbekommen zu haben. Der Schnauzbart hatte sich hochgerappelt und begann damit, Laurine auf die wüsteste Art zu beschimpfen. »Eine Ungeheuerlichkeit ist das«, wetterte er. »So etwas habe ich ja in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Sind Sie völlig verrückt geworden? Frauen wie Ihnen gehört der Führerschein entzogen. Ich werde mich umgehend bei der Leitung des Club Med über Sie beschweren. Ich werde dafür sorgen, dass Sie nie wieder auf den Sitz eines Transporters dürfen. Ja, am besten, man feuert Sie gleich, dann können Sie kein Unheil mehr anrichten.« Er hörte gar nicht mehr auf, sondern schien sich gerade erst so richtig warmzulaufen.
Laurine beachtete ihn gar nicht. Stattdessen registrierte sie mit allen Sinnen, was um sie sie herum vorging – die anhaltenden Erschütterungen, die zunehmende Zahl der Menschen auf der Straße, die Ausrufe des Entsetzens. Erst als die Frau des Schnauzbartes ihm die Hand auf den Arm legte und ihn bat, sich doch nicht so fürchterlich aufzuregen, wurde er ruhiger.
»Henri«, sagte sie erst leise, dann bestimmter, »ich glaube, es wäre besser, wenn du jetzt schweigst.«
»Warum? Hast du nicht erlebt, was vorgefallen ist? Wie kannst du Partei für diese Frau ergreifen, du warst doch dabei? Wir können froh sein, dass wir noch am Leben sind.«
»Ja, das können wir«, sagte seine Frau, »und ich denke, wir sollten Mademoiselle Laurine auf Knien dankbar dafür sein.«
»Danken, ich soll mich bei ihr bedanken? Hast du den Verstand verloren? Sie hat …« Damit brach er ab.
Laurine saß noch immer da, als wäre sie mit dem Lenkrad verwachsen. Vor ihrem geistigen Auge zuckten Bilder in schneller Abfolge. Bilder von Verwüstung und Tod. Von einer einstürzenden Brücke, von einem zerschmetterten Kleintransporter und dessen neun Insassen, von denen keiner das Unglück überlebt hatte. Sie sah Notarztwagen, Hubschrauber und Fernsehteams. Für einen Moment konnte sie sogar Eric sehen, wie er die Nachricht von ihrem Tod erhielt. Sein versteinertes Gesicht brannte sich tief in ihr Gedächtnis ein.
Doch das war nicht, was wirklich geschehen war. Vielmehr war es eine alternative Realität, die niemals stattgefunden hatte.
Wenn sie bis zu diesem Zeitpunkt Zweifel an ihren speziellen Fähigkeiten gehabt hatte, so waren diese ein für alle Mal vom Tisch gefegt. Was sie gerade erlebt hatte, war an Klarheit und emotionaler Wucht nicht zu überbieten. Sie wusste schon immer, dass sie über das zweite Gesicht verfügte, aber es war noch niemals so unverhüllt in Erscheinung getreten. Die Erkenntnis übermannte sie.
Ihr wurde übel.
Sie riss die Tür auf, stolperte an den Straßenrand und übergab sich. Gelblicher Magensaft schoss aus ihrem Mund und klatschte auf den ausgedörrten Boden. Nur ein kurzer Moment, dann war es vorbei.
Die Erde hatte sich beruhigt, und auch ihr Herz schlug wieder normal. Sie blickte in Richtung ihrer Schützlinge.
Die Gruppe war umringt von Menschen, die alle in den Abgrund starrten. Der Abgrund, an dem wenige Minuten zuvor noch eine Brücke gewesen war. Der schnauzbärtige Henri war bleich wie ein Handtuch. Ihm schien erst jetzt bewusst geworden zu sein, was sich soeben abgespielt hatte. So aufbrausend er im Unrecht war, so stumm blieb er, als es darum ging, seinen Fehler einzuräumen. Eine Entschuldigung, das Eingeständnis eines Irrtums? Niemals. Vor allem nicht vor den anderen. Das war etwas, was einem Mann in seiner Position offensichtlich schwerfiel.
Laurine war es egal. Sie hatte ihre Pflicht getan. Jetzt würde sie auch noch den Rest erledigen. Die Gruppe wohlbehalten abliefern, berichten, was passiert war, und den Rest des Tages freinehmen. Sie ging zu den anderen und blickte in die klaffende Lücke, wo sich eben noch eine intakte Brücke befunden hatte. Die Bruchstücke der Fahrbahn unten im Graben sahen aus wie Teile eines zerstörten Puzzles.
III
Erics Finger bewegten sich über die Tastatur.
Kommissar Figuret schob seine Schiebermütze nach hinten, kratzte sich die Stirn und warf Michelle einen letzten, sehnsuchtsvollen Blick zu. »Und du bist sicher, dass du nicht mitkommen möchtest? Sieh dir doch mal dieses Wetter an. Seit Wochen nur Kälte und Regen. Martinique soll um diese Jahreszeit ein Paradies sein.«
»Das Paradies ist kein Ort für mich, das weißt du doch, Éduard. Abgesehen davon würden sie Mädchen wie mich da ohnehin nicht reinlassen.«
»Das käme auf einen Versuch an.«
»Lass gut sein. Schick mir mal ’ne Postkarte. Und lass den Kopf nicht hängen, ich werde dich schon irgendwann besuchen kommen, versprochen. Jetzt beeil dich, sonst verpasst du noch den Flieger.« Sie hauchte ihm einen Kuss auf die Lippen und ließ ihre Hand sanft über seinen Po gleiten. So, als wolle sie ihm zu verstehen geben, auf was er von nun an verzichten musste. Dann löste sie sich lächelnd von ihm und sagte: »Und jetzt los, du alter …«
Eine seltsame Schwingung drang an sein Ohr. Lautlos beinahe, aber doch allgegenwärtig. Wie der Flügelschlag einer riesigen Fledermaus. Erics Finger verharrten in der Luft. Er hörte auf zu tippen und blickte vom Laptop auf.
Im Regal gegenüber klirrten die Gläser. Auf der Oberfläche in seinem Wasserglas waren Ringe zu sehen. Der Flügelschlag verwandelte sich in ein Dröhnen, das zunehmend dem eines schweren Lkws ähnelte. Doch das war unmöglich. In den Altstadtgassen von Speloncato war kein Schwerlastverkehr erlaubt. Die Sträßchen waren für Lkws ohnehin zu eng. Ein Hubschrauber vielleicht?
In diesem Moment wurde die Tür aufgerissen, und seine Vermieterin tauchte auf. Madame Borghetti war kreidebleich. »Was sitzen Sie noch hier?«, fuhr sie ihn mit ihrem kratzigen korsischen Akzent an. »Haben Sie denn die Erdstöße nicht mitbekommen?«
»Erdstöße?« Die Erkenntnis traf ihn mit der Wucht eines Vorschlaghammers. Das war es also.
Eric hasste Erdbeben, er hatte eine instinktive Abneigung gegen Naturgewalten. Sie ließen den Menschen so klein aussehen. Und was gab es Lächerlicheres als einen verschreckten und verschüchterten Homo sapiens?
In diesem Moment trat ein Riese von außen gegen das Haus. Gläser fielen aus dem Regal und zerschellten auf dem Parkett. »Schwingen Sie endlich Ihren Hintern aus dem Stuhl, und folgen Sie mir, schnell.« Die alte Dame schoss, wie von der Tarantel gestochen, davon.
Eric klappte seinen Laptop zusammen, presste ihn wie ein Neugeborenes an seine Brust und eilte hinter der alten Dame her. Nicht zum ersten Mal war er verwundert darüber, wie agil sie für ihre sechsundsiebzig Jahre war. Das lag vermutlich an der guten Ernährung und der vielen Bewegung. Als er sie endlich einholte, waren sie bereits im untersten Stockwerk angelangt.
»Was ist mit Laurine?«, rief er keuchend. »Wir müssen doch nach ihr sehen. Nachschauen, ob es ihr gut geht.«
»Keine Zeit. Außerdem ist sie sowieso nicht im Ort.«
»Wo ist sie denn?«
»Unterwegs nach Bastia, irgendwelche Touristen abholen.«
Eric presste die Lippen aufeinander. Laurine war fort, ohne ihm Bescheid zu sagen? Na gut, das war nichts Neues. Sie kam und ging, wie sie wollte, und manchmal sahen sie sich tagelang nicht. Trotzdem versetzte es ihm jedes Mal einen kleinen Stich ins Herz, wenn er spürte, dass sie Geheimnisse vor ihm hatte.
Madame Borghetti betrat die Küche und eilte von dort aus in die Speisekammer. Sie hielt einen Schlüssel in der Hand und schloss damit eine schwere Holztür auf. Die Tür befand sich in der hintersten Ecke, neben der Kiste mit den Kartoffeln. Eric war diese Tür noch nie aufgefallen, allerdings hatte er es auch noch nicht gewagt, ungefragt die Speisekammer zu betreten. Seine Vermieterin hatte ihn bereits einmal vor die Tür gesetzt, sie konnte es jederzeit wieder tun.
»Wohin führen Sie mich?«, fragte er verwundert. »Die Speisekammer sieht nicht viel stabiler aus als der Rest des Hauses. Ich verstehe nicht …«
»Fragen Sie nicht, kommen Sie«, lautete die barsche Antwort.
Die Scharniere quietschten protestierend. Offenbar war diese Tür seit Ewigkeiten nicht mehr geöffnet worden.
»Rein da, los«, befahl die alte Dame. »Und stoßen Sie sich nicht den Kopf. Die Decke ist ziemlich niedrig.«
Ein weiterer Erdstoß ließ die Einmachgläser klirren. Die Würste baumelten an der Decke. Geduckt trat Eric ein.
Er hatte einen Weinkeller oder einen zusätzlichen Vorratsraum erwartet, doch er sah sich getäuscht.
Verwundert runzelte er die Stirn. Eine Flucht von Stufen führte in die Tiefe. Sie war nur notdürftig beleuchtet und schien ins Innere des Berges zu reichen. Eine einzelne Lampe verströmte schwefelgelbes Licht. Kühle, modrige Luft schlug ihm entgegen. Sie umfing ihn wie ein feuchtes Handtuch und ließ ihn erschauern. Obwohl draußen sommerliche Temperaturen herrschten, hatte das Felsgestein noch immer die Kälte des Winters gespeichert. Er zog den Kopf ein und schritt die grob behauenen Stufen hinab. Das Knirschen von Sand und feinem Geröll warf Echos an die Wände. Hinter der Lampe machte der Gang einen Knick und endete in einer Art Grabkapelle. Ein Raum war mit einer gewölbten Decke versehen, und an der rechten Seite befand sich ein kleiner Altar mit Weihwasserbecken und Kruzifix.
Als er Schritte hinter sich hörte, drehte Eric sich um.
»Ich hatte gehofft, so etwas nie wieder erleben zu müssen«, sagte Madame Borghetti mit kurzatmiger Stimme. »Das letzte Beben war 2011. Damals hatten wir die Befürchtung, es könnte einen Tsunami geben, doch zum Glück war das Beben wohl zu weit draußen. Ein paar Häuser sind zu Bruch gegangen, getötet wurde aber niemand. Trotzdem ist es jedes Mal beängstigend, wenn sich die Erde bewegt. Viele der älteren Gebäude sind nicht so stabil, wie es scheint.«
»Das glaube ich gerne«, stieß Eric aus. »Erinnern Sie sich noch an das schwere Erdbeben in Mittelitalien 2016? Viele der alten Ortschaften sind einfach dem Erdboden gleichgemacht worden.« Er sah sich um. »Was ist das hier für ein Raum? Davon wusste ich gar nichts.«
»Das ist auch so beabsichtigt.« Die alte Dame zündete eine Kerze an. »Wir Korsen haben gerne unsere kleinen Geheimnisse.«
»Was Sie nicht sagen«, erwiderte Eric.
Seit er vor einem halben Jahr auf diese Insel gekommen war, hatte sich viel ereignet. Er hatte Freunde und Feinde gefunden, war seiner Familiengeschichte auf die Spur gekommen und hatte einen alten Fluch besiegt. Kein schlechter Einstand, wie er fand. Doch akzeptiert wurde er deswegen noch lange nicht. »Ich bin zur Hälfte Korse«, sagte er. »Meinen Sie nicht, das wäre Grund genug, mich in das eine oder andere Geheimnis einzuweihen?«
»Sie mögen Korse sein«, sagte sie, »aber Sie sind auch ein Giuliani.«
Er zuckte zusammen. Diesen Namen so offen ausgesprochen zu hören, traf ihn unvorbereitet. Niemand hatte das bisher in seiner Gegenwart gewagt. Aber es stimmte. Er war der letzte Nachkomme einer Familie von Mördern und Schlächtern, die einst ein ganzes Dorf ausgelöscht hatten. Damit war er einerseits Teil der korsischen Geschichte, andererseits aber auch jemand, den man lieber vergessen würde. Einer alten korsischen Tradition folgend, hatte man ihm eine Beerdigung spendiert, bei der zwar sein Name bestattet wurde, nicht aber er selbst. Ein erlegtes Wildschwein hatte bei dieser kuriosen Veranstaltung seinen Platz eingenommen. So waren die leicht erregbaren korsischen Gemüter vorerst besänftigt. Das Scheinbegräbnis hatte das Problem aber nur an der Oberfläche gelöst. Der Schmerz reichte tiefer. So gesehen war Madame Borghettis Einschränkung durchaus verständlich.
Wer Korsika bereiste, der fühlte sich teilweise ins Europa des neunzehnten Jahrhunderts versetzt. Versteckt zwischen den mächtigen Gipfeln der Berge gab es Dörfer, in denen die Uhren anders tickten. Offenbar hatte er gerade so einen Ort entdeckt.
»Abgesehen davon ist das hier nicht besonders geheimnisvoll«, sagte Madame Borghetti. »Eigentlich hätten Sie auch selbst darauf kommen können. Es ist eine unterirdische Kapelle, wie Sie unschwer erkennen können.« Sie fing an, herumzugehen und ein wenig abzustauben.
Eric sah sich verwundert um. »Wozu dient sie?«
»Zum Beten natürlich. Und als Grabstätte.« Sie deutete auf einige Wandnischen neben dem Altar. Fotografien und Namensschildchen waren dort angebracht. »Einige meiner Vorfahren sind hier bestattet. Zum Beispiel liegen hier mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter. Daneben ihr Bruder mit seiner Frau und ihren zwei Töchtern. Meinen verstorbenen Mann konnte ich trotz intensiver Bemühungen leider nicht mehr hier beisetzen. Die Gesetze wurden in den Fünfzigerjahren geändert. Aber wie Sie sich denken können, erfüllt dieser Ort noch einen anderen Zweck. Es ist ein Fluchttunnel.«
Eric kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. »Es muss ungeheuer aufwendig gewesen sein, den Raum hier unten anzulegen. Eine überirdische Kapelle wäre sicher deutlich günstiger gewesen.«
Madame Borghetti lächelte. »Treten Sie näher, das dürfte Ihnen gefallen.« Sie stand neben einer halbrunden Felsvertiefung, die Eric ursprünglich für eine architektonische Verzierung gehalten hatte – bis er den rostigen alten Riegel sah, der halb verborgen im Schatten lag.
»Eine Geheimtür?«
»Packen Sie mal mit an.« Madame Borghetti schob den Riegel zur Seite und zog an der Tür. Eric kam ihr zu Hilfe, und gemeinsam gelang es ihnen, die sperrige Tür einen Spalt weit aufzukriegen. »Sehen Sie hinein, nur nicht schüchtern.«
Er steckte seinen Kopf hindurch.
Dahinter befand sich ein weiterer Gang, an dessen Ende ein daumengroßer Fleck Tageslicht leuchtete.
»Der Fels unterhalb von Speloncato ist durchzogen von verborgenen Schächten und Gängen«, sagte sie. »Sie alle münden an irgendwelchen Orten, weit weg vom Ortszentrum. Die Küsten und meeresnahen Orte waren jahrhundertelang Überfällen ausgesetzt. Eroberer kamen und gingen, erwischt haben sie uns fast nie. Wenn der Kampf aussichtslos erschien, haben wir uns in die Berge zurückgezogen. Das Problem waren die nächtlichen Überfälle. Manchmal kamen sie so leise, dass wir keine Zeit hatten, uns vorzubereiten. Dann durfte man froh sein, wenn man so etwas hier hatte.«
Eric versuchte etwas zu erkennen, doch es war einfach zu dunkel. »Wohin führt er?«
»Sehen Sie selbst nach.«
»Und Sie?«
Sie schüttelte den Kopf. »Für mich ist das nichts. Ist mir zu schmutzig. Außerdem gibt es Ratten.«
»Ratten …«
Sie neigte den Kopf und zwinkerte ihm zu. »Na, kommen Sie, Eric. Ein Giuliani wird doch keine Angst vor ein paar kleinen Nagern haben, oder?«
»Vorausgesetzt, sie beißen nicht. Diese Insel hat mehrfach bewiesen, dass sie es mir nicht leicht machen will. Ach, was soll’s? Wenn Sie sagen, es lohnt sich, werde ich mich auf den Weg machen. Zumal ich das Gefühl habe, dass das Beben vorüber ist. Kommen Sie mit?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich muss mich ans Mittagessen machen, schließlich habe ich nachher noch eine Verabredung mit meinem Krimiklub. Aber Sie werden es schon finden. Einfach geradeaus und dann durchs Dorf zurück.« Sie zwinkerte ihm zu.
Der Krimiklub! Eric hatte die alten Damen nicht vergessen. Fünf Schwarze Witwen auf der Suche nach Mord und Totschlag. Und er gefangen in ihrem Netz. Er lächelte gequält.
»Dann bis nachher.«
Quietschend und scheppernd fiel die Tür hinter ihm ins Schloss. Eric zog sein Handy heraus, schaltete die Taschenlampen-App ein und ging los. Tastend und stolpernd arbeitete er sich den schmalen Gang vorwärts.
Es war tatsächlich nicht viel mehr als ein Fluchttunnel. Man hatte bei der Anlage keinen gesteigerten Wert auf Komfort oder Bequemlichkeit gelegt. Wahrscheinlich war es mühsam genug gewesen, ihn mit den damals üblichen Gerätschaften durch den harten Granit zu treiben. Die Bauarbeiten mussten Monate gedauert haben. Wenn nicht sogar Jahre.
Korsen waren traditionell keine Küstenbewohner. Niemals waren sie Seefahrer gewesen und galten als relativ wasserscheu. Für sie war das Meer stets mit Risiken verbunden gewesen, mit Überfällen, Eroberungsversuchen, Plünderungen. Die Berge hingegen bedeuteten Freiheit und Autonomie. Hier lagen ihre Rückzugsorte, wenn wieder mal die Malaria wütete, wenn Piraten die Küsten heimsuchten oder die gnadenlose Hitze das Leben in den Ebenen erschwerte. Erst der aufkommende Tourismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte ihre Einstellung gewandelt. Wenn Korsen etwas noch mehr liebten als ihre Frauen, so waren es ihr Besitz und ihr Vermögen. Je stattlicher, desto besser.
Wasser tröpfelte von den grob behauenen Wänden. Moose und Algen wucherten aus den Spalten. Eric rümpfte die Nase. Hier roch es wie im Pariser Untergrund, einem Geflecht aus Höhlen und Gängen, das von manchen Reich der Dunkelheit oder einfach Schrecklicher Keller genannt wurde. Letzte Ruhestätte von über einer Million Toten. Die Pariser Leichenkammern waren legendär. Ganz so schlimm war es hier zwar nicht, aber seit er die Katakomben zum Schauplatz eines seiner Romane auserkoren hatte, waren dunkle Gänge und Stollen ein rotes Tuch für ihn.
Ein dicker Tropfen platschte auf seinen Kopf. Vermutlich verlief über ihm eine undichte Wasserleitung. Die Bausubstanz in diesen alten Bergdörfern war teilweise viele Hundert Jahre alt. Der Boden war uneben und von herabgefallenen Gesteinsbrocken bedeckt. Hin und wieder tauchte eine Pfütze auf, die er umging. Er bildete sich ein, das Quieken davoneilender Ratten zu hören. Seine Schritte sandten hallende Echos in beide Richtungen. Er trat in irgendetwas Feuchtes, Matschiges, vermied es aber, nach unten zu blicken. Die letzten Meter legte er im Eiltempo zurück.
Nach einigen Schritten stand er im Freien. Die Augen zusammenkneifend, sah er sich um. Der Ausgang befand sich am Fuße eines Steilhangs, halb verborgen hinter Brombeerbüschen und Lavendelsträuchern. Er musste ein paar von ihnen zur Seite schieben. Dann entdeckte er, dass er in einem kleinen verwilderten Garten unterhalb der Altstadt herausgekommen war. Zwischen Kirschbäumen und Pinien öffnete sich der Blick ins Tal. Ein Kirchturm ragte dort auf, daneben die Kuppel eines Mausoleums.
Er hörte Stimmen in unmittelbarer Nähe. Zwei Frauen sprachen miteinander. Nicht aufgeregt oder panisch, sondern ruhig. Eine von ihnen lachte. Ansonsten war alles ruhig. Keine Alarmanlagen, keine Sirenen, kein Glockenläuten.
Irgendwo krähte ein Hahn.
Eric atmete erleichtert auf. Das Erdbeben schien wirklich vorbei zu sein. Hoffentlich war nichts Schlimmes passiert. Vor allem um Laurine machte er sich Sorgen. Sie neigte dazu, Naturgewalten auf die leichte Schulter zu nehmen und sich körperlichen Gefahren auszusetzen. Dass sie gerne mit dem Rad fuhr und Tauchkurse gab, war ja noch akzeptabel. Aber musste sie sich auch noch als Bergführerin betätigen? Vermutlich waren seine Sorgen unbegründet, Laurine konnte gut auf sich selbst aufpassen. Aber es war nun mal so, dass fast alle seine Gedanken um sie kreisten. Das Gefühl, ihr könne etwas zugestoßen sein, war für ihn unerträglich.
Für den Abend hatte sich noch das Geschwisterpaar Ciosi auf einen Besuch angekündigt. Petru war Reporter beim Corse Matin, Battista Künstlerin in Pigna. Seit ihren Abenteuern vor einem halben Jahr waren sie alle gute Freunde geworden. Es dürfte ein vergnüglicher Abend werden – vorausgesetzt, Laurine würde kommen. Sie hatte immer so schrecklich viele Verpflichtungen, und er hatte bisher noch keine Nachricht von ihr erhalten. Aber darüber konnte er sich später noch Gedanken machen. Jetzt wollte er zurück und das Kapitel, an dem er gerade arbeitete, zu Ende schreiben.
Er entdeckte einen Trampelpfad, der zur Kirche Saint-Michel führte, und stieg den Hügel hinauf.
IV
Es war kurz nach 19 Uhr, als Laurine zwischen den alten Gebäuden auftauchte. Sie trug ein hellblaues Kleid, ein Paar Schnürsandalen und eine Umhängetasche aus farbig bedrucktem Stoff. Ihre langen schwarzen Haare hatte sie mit einem Tuch hochgebunden, wodurch ihre Ohrringe schön zur Geltung kamen. Sie sah einfach umwerfend aus.
Eric konnte nichts dagegen tun, aber jedes Mal, wenn er diese Frau sah, machte sein Herz einen Sprung. Was hatte sie nur an sich, dass sie ihn so um den Verstand brachte?
Ein halbes Jahr waren sie jetzt befreundet. Bereits beim ersten Mal hatte es zwischen ihnen gefunkt, jedenfalls bildete er sich das ein. Er, ein Pariser Schriftsteller auf der Flucht vor den Dämonen der Vergangenheit, sie eine tief verwurzelte Korsin mit einem Gespür für die Welt jenseits der Realität. Zwei Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Und doch gab es da ein Band, das sie untrennbar miteinander verknüpfte. Das mochte damit zusammenhängen, dass Eric ebenfalls korsische Wurzeln hatte und noch auf der Suche nach seiner Identität war, mochte aber auch daran liegen, dass Laurine einen großen Hunger auf die Welt besaß und Eric als ihr Ticket in die Welt betrachtete. Beides waren gute Gründe zusammenzubleiben. Aber Eric spürte, dass da noch mehr war. Ein tiefer liegendes Geheimnis, das sie verband. Und solange er nicht herausgefunden hatte, was das war, würde er seine Finger nicht von ihr lassen können.
Laurine strauchelte kurz, fing sich aber wieder und setzte ihren Weg fort. Sie wirkte blasser als sonst, irgendwie angeschlagen. Instinktiv spürte Eric, dass etwas nicht stimmte. Besorgt stand er auf.
Laurine traf bei ihm ein, winkte dem Wirt zu und rief: »Émile, Pastis. Aber einen großen. Kein Eis.«
Jetzt wusste Eric mit Gewissheit, dass etwas nicht stimmte. Laurine trank so gut wie nie Alkohol.
»Hallo du«, sagte er schüchtern. »Alles okay bei dir? Hübsch siehst du aus.«