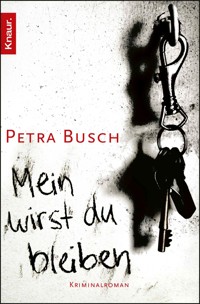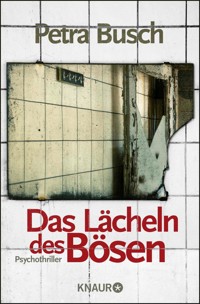
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nina Bach, 28, chaotischer Freigeist und von ihrer Familie verstoßen, ist schockiert: Ihre ältere Schwester Frauke, eine erfolgreiche Chirurgin, hat sich das Leben genommen – und sich vor dem Suizid offenbar selbst die Haut des Unterarms abgezogen. Nina hat Frauke gehasst. Doch Selbstmord hält sie für ausgeschlossen und beginnt nachzuforschen. Der zuständige Rechtsmediziner Emil Koswig will ihr nicht helfen. Bis Nina entdeckt, dass auch Koswigs Ehefrau sich selbst getötet und davor ein Auge herausgerissen hat. Gemeinsam suchen sie nach dem Hintergrund für die entsetzlichen Taten, und Nina verliebt sich dabei in den charmanten Arzt. Als die dritte Selbstmörderin auf seinem Obduktionstisch liegt, begreift Nina, dass sie Nummer vier sein soll. Doch nicht einmal Koswig glaubt ihr … »So einfühlsam und genau wie Petra Busch erzählt im Augenblick keine andere deutsche Autorin von Verbrechen und Mord.« WDR 5 »Petra Busch schafft es, den Leser bis zum Schluss angenehm auf die Folter zu spannen.« Ruhr Nachrichten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Petra Busch
Das Lächeln des Bösen
Psychothriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nina Bach, 28, chaotischer Freigeist und von ihrer Familie verstoßen, ist schockiert: Ihre ältere Schwester Frauke, eine erfolgreiche Chirurgin, hat sich das Leben genommen – und sich vor dem Suizid offenbar selbst die Haut des Unterarms abgezogen. Nina hat Frauke gehasst. Doch Selbstmord hält sie für ausgeschlossen und beginnt nachzuforschen. Der zuständige Rechtsmediziner Emil Koswig will ihr nicht helfen. Bis Nina entdeckt, dass auch Koswigs Ehefrau sich selbst getötet und davor ein Auge herausgerissen hat. Gemeinsam suchen sie nach dem Hintergrund für die entsetzlichen Taten, und Nina verliebt sich dabei in den charmanten Arzt. Als die dritte Selbstmörderin auf seinem Obduktionstisch liegt, begreift Nina, dass sie Nummer vier sein soll. Doch nicht einmal Koswig glaubt ihr …
Inhaltsübersicht
Ein Jahr zuvor
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
Sechs Wochen später
Freunde, Helfer und Ideen
Ein Jahr zuvor
Die Grillen waren seit Wochen unruhig. Noch vor dem ersten Schimmer des frühen Morgenlichts begann ihr lautes Zirpen, und es erstarb in diesen warmen Nächten erst weit nach Mitternacht. Jetzt schwoll es an, als wollten die Tiere sie an diesem Spätnachmittag warnen. Ihr einen Schrei entgegenschicken: Kehr nicht an diesen Ort zurück!
Später würde man sagen, dass es der heißeste Tag des Sommers gewesen war. Und dass es nicht verwundert, wenn Menschen bei achtunddreißig Grad im Schatten zu solchen Grausamkeiten fähig waren.
Sie blickte den Schienenstrang entlang, der sich durch Stoppelfelder und Wiesen zog. Über dem Metall flirrte grell die Hitze, und die Eichenbohlen lagen schwer in ihrem kohlschwarzen Schotterbett. Letztes Jahr hatten sich noch ein paar zähe Wildkräuter durch den Kies geschoben. Jetzt war alles verbrannt. Kein Windhauch schaffte Erleichterung.
Ein Schmetterling tanzte über vertrocknetes Gestrüpp und setzte sich auf ihre nackte Schulter. Ein Tagpfauenauge. Doch nur einen Moment später flatterte es auf und ließ sich nicht weit entfernt auf einer Holzbohle nieder. Seine purpurfarbenen Flügel mit den vier blau-gelben Kreisen klappten alle paar Atemzüge auf und zu.
Sie sog tief den Geruch nach Teeröl und wildem Salbei ein.
Noch vor Sonnenuntergang würde der letzte Güterzug hier vorbeirauschen, ein Waggon wie der andere. Eine Reihe gleichgültiger, staubiger Metallgehäuse.
Heute Morgen hatte sie sich entschieden. Sie würde es tun. So wie in den letzten Monaten konnte sie nicht weiterleben. Kein Streit mehr. Keine Tränen. Kein schreiendes Schweigen.
Schon glaubte sie, unter ihren Füßen das leichte Vibrieren zu spüren und dieses ferne metallische Singen des Zuges zu vernehmen, das es in dieser Intensität nur an diesem Ort gab. Sie wusste nicht, woran das lag. Vielleicht daran, dass hier keine Stimmen der Stadt, keine Verkehrsgeräusche und kein Kindergeschrei ihre Sinne absorbierten, oder dass der nahe gelegene See leichte Erschütterungen und sogar Schall besonders gut leitete. Vielleicht war es auch nur die kaum wahrnehmbare Beschleunigung ihres Herzschlags und der Druck in den Schläfen, was sie an diesem Ort immer begleitete, und das Zittern kam aus ihr selbst.
Langsam ging sie weiter, die Schienen entlang Richtung See. Gelbe Grashalme schoben sich in ihre Sandalen, piksten sie, und wohin sie auch trat, scheuchte sie Heuschrecken auf. Manche hüpften senkrecht in die Luft wie kleine Feuerwerkskörper, andere sprangen hin und her, anscheinend orientierungslos, so wie sie selbst es viel zu lang gewesen war. Als Kind hatten sie die Ferien oft auf Kreta verbracht. Der Sommer hier, nur wenige Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt, klang und duftete fast wie der Sommer in den griechischen Bergen. Dort, hoch über dem Meer, stand noch heute das Ferienhaus ihrer Eltern.
Hier aber war kein Ort für Kinder. Nicht mehr.
Hinter der Kurve, den See schon im Blick, sah sie das Haus. Oder das, was einmal ein Haus gewesen war. Sie blieb stehen.
Die letzten Tage hatten sich endlos dahingezogen. Nachts hatte sie wegen des Babys keinen Schlaf gefunden. Und tagsüber stöhnte die Welt unter der Hitze der sengenden Sonne.
Sie ging quer über die Obstbaumwiese auf das Haus zu. Es roch süßlich. Fliegen summten um die kleinen fauligen Äpfel herum, die niemand geerntet hatte und die zu Boden gefallen waren. Von dem alten Birnbaum hingen noch immer die zerfaserten Seile herab. Das Brett der Schaukel lag im hohen Gras, wurmzerfressen und grau wie ihre Seele. Vor wenigen Tagen erst hatte sie ihren Mann am Telefon flüstern hören: »Seit Leas Geburt ist sie … sie löst sich geradezu auf, verstehst du?« Sie war mit dem Stillen fertig gewesen und hatte den Tag mit ihm besprechen wollen. »Sie hat eine postnatale Depression«, hatte er weitergeflüstert, während sie hinter der angelehnten Tür stehen geblieben war und gelauscht hatte. Ihr Mann hatte sie nicht bemerkt. Statt zu ihm zu gehen und mit ihm zu reden, war sie wieder nach oben gegangen, wo Lea gleichmäßig atmend in ihrem Bettchen lag.
Heute früh hatte sie sich extra schön gemacht. Das zitronengelbe Sommerkleid mit den Spitzenträgern angezogen und die Ohrringe mit den hängenden Tropfen angelegt, die ihre Großmutter ihr auf dem Sterbebett gegeben hatte. Dazu trug sie die weißen Riemchensandalen. Lidstrich, wenig Rouge. Die Handtasche mit den Swarovski-Steinen. Darin die Tabletten. Der Moment sollte perfekt werden.
Die Grillen zirpten lauter.
Sie freute sich. Und glaubte gleichzeitig, sich aus Angst übergeben zu müssen.
Die Fensterscheiben des Hauses waren zerbrochen. Der Putz an der Fassade bröckelte ab, und im oberen Stockwerk haftete noch immer Ruß um die Fenster. Dem Knacken hinter ihr schenkte sie zunächst keine Beachtung. Erst, als sie nur noch wenige Meter von dem dunklen Rechteck entfernt war, in dem einmal die Haustür gewesen war, drehte sie sich um.
Hatte sie Schritte gehört?
Doch da waren nur die verkrüppelten Apfelbäume, der Waldrand im Osten und links vom Haus der Schuppen, vor dessen winzigen blinden Fenstern dicke Spinnweben klebten.
Sie trat in das Haus.
Auf dem Boden lagen Scherben, die Tapeten mit den beigefarbenen Ovalen lösten sich in Streifen von der Wand. Er hatte nichts weggeräumt, obwohl er es versprochen hatte. Für heute. Für diesen Tag. Sie hätte es wissen müssen.
Tiefe Trauer erfasste sie. Das Leben hätte so schön werden können. Sie ging durch die alten Räume. Ein letztes Mal. In der ehemaligen Küche standen eine einzelne, wackelige Spüle und ein schmutziger Gasherd, der nicht angeschlossen war. Ein Loch klaffte in der Wand, wo jemand eine Armatur herausgerissen hatte. Im Wohnzimmer lagen die Reste einer Schrankwand am Boden, einige Bretter waren auf das grüne Polstersofa gefallen, das aufgedunsen wie ein Frosch in der Ecke hockte. Oben im Schlafzimmer stand noch das große Ehebett, fast unversehrt, darüber hing das Kreuz. Im Badezimmer die rissigen, zum Teil abgeplatzten Fliesen und die rußgeschwärzte Decke. Hier musste das Feuer ausgebrochen sein. Die Feuerwehr war schnell gekommen. Doch nicht schnell genug für alle Bewohner.
Kurz sah sie das Haus vor sich, wie sie es geliebt hätte. Mit einer hübschen himmelblauen Haustür und ebensolchen Fensterrahmen. Leuchtend weiße Fassade. Wie in Kreta. Eine Küche mit sonnengelben Schrankfronten. Taubenblaue Fliesen im Bad und eine riesige Eckbadewanne.
Durch das scheibenlose Fenster zog ein sanfter Luftzug. Wieder knackte es. Und da stand er. Eine Silhouette in der Badezimmertür.
Sie hielt die Luft an. Griff mechanisch nach den Trägern ihres Kleides. Die weiche Baumwolle spannte über ihren prallen, milchgefüllten Brüsten.
»Da bist du ja.« Die Silhouette löste sich aus dem Türrahmen, er kam in das Badezimmer.
Sofort stellten sich die Härchen auf ihren Armen auf. War das schon der nahende Güterzug, dem die wabernde Luft um Minuten vorauseilte? »Was machst du hier? Du wolltest erst um achtzehn Uhr kommen«, presste sie hervor.
Er umarmte sie flüchtig. »Mir Sorgen um dich?«
Sie nickte, vermutlich mussten sich seine Augen erst an das Halbdunkel gewöhnen. Sie ging zwischen der Wanne und dem Waschbecken hin und her, plötzlich ruhelos, und ihr Herz pochte schneller. Sie blieb stehen, den Rücken ihm zugewandt, und blickte in die flirrende Hitze hinaus. Von hier oben konnte sie das Seeufer hinter den Wiesen sehen. Die Grillen zirpten gleichgültig.
»Du siehst wunderschön aus.«
Sie konnte das Lächeln in seiner Stimme hören. »Du wolltest das Haus aufräumen. Damit ich … damit wir … es schön haben.« Noch konnte sie zurück. Lea zuliebe. Sie musste ihr Leben nicht hier beenden.
»Du hast dich also entschieden?«, fragte er.
Sag es laut! Er wartet darauf! Er hilft dir! »Ich … ja«, flüsterte sie, den Blick gesenkt. Die Bodenfliesen bestanden aus braunen und grünen Rauten.
»Und wie?« Er trat hinter sie, sie spürte seinen Atem warm in ihrem Nacken, während seine kühle Hand über ihre Schulter strich. Er hatte immer kühle Hände, sogar im Hochsommer.
Sie wandte sich um und versuchte ein Lächeln. Ihr Kopf schmerzte. »Ich werde es tun. Ich werde hier sterben.«
Sein Kiefer spannte sich an. Lange Zeit sagte er nichts. Dann: »Und das sagst du mit einem Lächeln?«
»Hältst du dich an unsere Abmachung?«
Er nickte.
»Du wirst renovieren und ihn hierherholen?«
»Ich werde es tun.«
»Du hast schon so viel versprochen. Aber du kriegst nicht einmal die einfachsten Dinge hin. Du wolltest hier aufräumen! Für mich.«
Er umarmte sie erneut, fester. »Bitte, lass uns nicht streiten. Nicht in diesem Moment. Ich hatte einfach keine Zeit.«
Sie löste sich aus seiner Umarmung. »Und du wirst jede verbleibende Minute meines Lebens an meiner Seite sein. Du hilfst mir!«
In der eintretenden Stille hätte sie sich am liebsten die Ohren zugehalten. Das Pochen in ihren Schläfen schwoll an, und das Zirpen der Grillen wurde zum Schrei in ihrem Kopf. Sie schloss die Augen. Wusste, dass er sie jetzt mit diesem weinerlichen Blick betrachtete. Wieder legte sich seine Hand auf ihre Schulter. Diese kühle Hand. Sie schob sie beiseite.
»Du liebst ihn sehr, oder?« Seine Stimme war ein leises Krächzen.
»Wie man einen solchen Menschen eben lieben kann.«
»Du bist krank«, flüsterte er schließlich. »Aber … ich bin an deiner Seite, das weißt du. Wir machen alles so, wie wir es besprochen haben.«
»Danke.« Ihr war, als wüchsen ihr zarte Flügel, die sie wie das Tagpfauenauge einfach ausbreitete und dann in den Sommerhimmel schwebte. »Und du wirst Lea ein gutes Leben ermöglichen?«
»Das haben wir doch so besprochen.«
Zweifel schlichen sich in ihr Herz. Sie sollte weglaufen. Ihre Entscheidung verschieben. Doch sie hatte keine Kraft mehr. Keinen Mut. Keine Freude an diesem Leben. »Du versprichst es also?«
Ein Käfer krabbelte aus einer aufgeplatzten Fuge unter der Badewanne hervor.
»Versprochen.« Ruckartig trat er auf das winzige Tier. Es knackte kurz, dann lagen die grünlichen Flügel zersplittert zwischen den Rauten.
»Spinnst du?« Sie stolperte zurück. »Was soll das?« Die Handtasche entglitt ihren Händen und fiel zu Boden.
»Ich übe.«
Sie stolperte weiter zurück. Stieß mit dem Kopf an den Boiler.
Er kam näher.
Sie sah Leas kleines Gesicht vor sich. Erinnerte sich, wie ihr Kind die Augen zum ersten Mal auf sie, die Mutter, richtete, die kleinen Finger um ihren großen Daumen schloss. Wie Lea gluckste, wenn sie sie an ihre Brust legte. Sie sah Leas Lachen und roch die süßliche, weiche Babyhaut. Und plötzlich bereute sie. Bereute ihre Entscheidung. Dass sie hierhergekommen war. Und dass sie diesen Menschen vor sich jemals in ihr Leben gelassen hatte.
»Durst?« Er zog eine Plastikflasche aus einem Rucksack.
Sie schüttelte den Kopf.
Er seufzte. »Angst? Ich tu dir doch nicht weh. Du tust dir selbst weh.« Er hielt ihr die Flasche hin und zog die Augenbrauen hoch. »Wasser. Brauchst du doch sowieso für deine Tabletten.« Er blickte auf die Handtasche hinab. »Du hast sie doch dabei?«
»Warum hast du den Käfer zertreten?« Weshalb war er so aggressiv?
»Die Hitze. Tut mir leid. Komm, trink jetzt.«
Zögerlich griff sie nach der Flasche. Auch sie war kühl. Er konnte noch nicht lang hier sein. Sie trank. Es schmeckte köstlich. Klar und prickelnd und ein wenig säuerlich.
»Du bist oft hier in letzter Zeit. Ich habe dich beobachtet.«
Sie wischte sich über den Mund. »Du machst Witze.«
»Nein, nie. Das weißt du doch.«
»Stimmt.«
»Ich stehe zu dir und deiner Entscheidung, wenn du es willst. Wir haben das hier besprochen, und hier werden wir es zu Ende bringen.«
Ein leichter Schwindel erfasste sie. Er stützte sie am Arm und hielt ihr das Röhrchen mit den Tabletten hin. Sie schüttete ein paar in ihre Hand, schluckte sie, trank die Wasserflasche in einem Zug halb aus. Gleich. Gleich würde die Wirkung einsetzen.
Kurz darauf bewegten sich die Rauten auf dem Boden. Sie spürte seine Finger hart um ihren Oberarm greifen.
»Hey, was ist denn? Du schwankst ja.«
Sie setzte sich auf den Badewannenrand und ließ den Kopf auf die Brust sinken.
»Du musst keine Angst haben. Es wird nicht weh tun.«
Jetzt kam eine dunkelgrüne Raute auf sie zu. Eine hellgrüne flatterte direkt vor ihrem Gesicht. Die Grillen lachten höhnisch.
»Du musst dich an meine Anweisung halten!«, sagte sie, als sie trotz seines Griffes von der Wanne zu Boden glitt und sich das Kleid über ihre Beine und den Hintern bis zum Rücken hochschob. Sie schämte sich nicht. Sie hatte einen frischen Slip angezogen. Oder doch nicht? Die Wände umkreisten sie, und sie versuchte vergeblich, die Bilder des Morgens in ihrem Kopf zu sortieren. Der weiße Schrank, die Frisierkommode, die ihr Mann so altmodisch fand, den Wickeltisch, Lea, die plötzlich ihr zitronengelbes Kleid trug und glucksend lachte. Sie hörte ihn ein »Ja« murmeln und flüsterte »danke«, als die Rauten des Bodens zu weichen Wellen wurden und sich über die Türschwelle hinaus und die Treppe hinunter bis über die Obstbaumwiese ergossen. Sie lächelte, als sie ihre purpurnen Schmetterlingsflügel ausbreitete und durch den Raum schwebte. Neben ihr flog Lea. Sie war winzig und hatte zitronengelbe Seidenflügel, und unter ihnen sah sie seinen Rucksack und die Wasserflasche liegen. Sie glitt darüber hinweg, Seite an Seite mit ihrer Tochter, doch die hellgrüne Raute bildete Arme aus und griff nach ihr, verfolgte sie, wurde immer schneller. Sie fiel hinter Lea zurück, konnte sich dem Griff nicht entwinden, und dann hörte sie unter sich, aus weiter Ferne, seine Stimme: »Ganz ruhig, du hast es bald geschafft«, und gleichzeitig rief Lea im Sonnenlicht »Komm weiter, Mama« und schlug sachte mit den Flügeln. Jetzt, jetzt, dachte sie, und dann bohrte der Schmerz sich in ihren Kopf, die Raute lachte höhnisch und riss ihr ein Augenlid hoch. Sie hob die Hand zu dem Auge, doch im selben Moment entflammte ihre rechte Gesichtshälfte so heiß, dass sie abstürzte, während Feuerzungen über ihre Haut leckten und sich durch die Augenhöhle in ihr Gehirn fraßen. Sie schmeckte Staub und warmes Eisen.
Irgendwann später, als sie noch nicht ganz verbrannt war, kam endlich der gewaltige Luftzug, und das Singen der Schienen trug sie zu Lea in den Himmel. Und als das Singen zum Dröhnen wurde, immer greller und schmerzhafter, als das Vibrieren der Waggons ihren ganzen Körper erbeben ließ, realisierte sie in einem letzten klaren Moment, dass sie auf den Gleisen lag. Das glühende Metall fraß sich in ihren Nacken und vibrierte unter der Last der Eisenräder, die auf sie zurasten, und die Grillen verstummten, und sie wusste, dass sie Lea nie wiedersehen würde.
1
Beeil dich.«
Der Vorhang blähte sich ins Zimmer wie ein weißes Segel und streifte ihre Schulter. Er hatte dieselbe Farbe wie das Tuch über seinem Gesicht. Nina saß rittlings auf ihm und bewegte sich langsam. Sie war dankbar für die frische Luft und den Duft nach Lindenblüten, die der Wind, zusammen mit einem fernen Donnergrollen, in den kleinen stickigen Raum trug. Das Frühjahr und die ersten Sommerwochen waren kalt gewesen und die Linden um den Rathausplatz spät dran mit ihrer üppigen Blüte. Der Hochsommer hatte im Juli vieles nachzuholen.
Er atmete schwer, wie er es immer tat.
Sie schlief heute zum achten Mal mit ihm. Seit ihrem ersten Besuch wiederholte er diese zwei Wörter ständig. »Beeil dich!« Als ob seine Zeit nicht einmal mehr bis zum Orgasmus reichen würde. Falls er den überhaupt schaffte. Seine Stimme klang dumpf und ein wenig rauh. Mit jedem weiteren Mal, das sie hier war, verstand sie ihn schlechter. Gesehen hatte sie ihn noch nie.
Sie bewegte sich schneller.
Von der Straße drang Motorenlärm durch das offene Fenster, jemand hupte. Freitagabendverkehr. Geschäftsleute auf dem Weg nach Hause. Familienkarossen auf der Fahrt ins Wochenende, zu Verwandten oder Freunden. Dorthin, wo Geborgenheit wartete.
Im Zimmer war es dämmrig. Sie hatten kein Licht angemacht.
Als er fertig war und stoßweise nach Luft rang, stieg sie von ihm herunter, wusch sich an dem Waschbecken mit den Papiertüchern aus dem Spender und zog Slip und Rock an.
Er stöhnte leise. »Danke.«
Sie setzte sich auf den Bettrand und streichelte seine Hand. Das Tuch über seinem Gesicht war aus schwerer Seide, und dort, wo sein Mund war, hatte der feuchte Atem einen dunklen Fleck gemalt. Ansonsten war er nackt. »Ich mach nur meinen Job.« Sie wunderte sich, dass er überhaupt noch vögeln konnte.
Ein Blitz durchschnitt die Dunkelheit, dieses künstliche Schwarz, das sich an diesem Spätnachmittag über die Kleinstadt gestülpt hatte ähnlich einem Taucheranzug. Für wenige Sekunden hob sich sein Körper wie ein weißlich -fahler Leichnam von den Laken ab. Dann versank alles wieder im grauen Halbdunkel.
»Wann wollen Sie mich wiedersehen?«, fragte Nina.
»Sehen!« Sein heiseres Lachen fiel genau mit dem ersten Donner zusammen. Das Gewitter musste sich mit rasender Geschwindigkeit nähern. Ein Fensterflügel schlug scheppernd auf und zu. »Ich mach zu.«
»Nein.« Seine Finger schlossen sich matt um Ninas Hand.
Sie blieb sitzen, verschränkte seine Finger mit ihren und zog sie in ihren Schoß. Auf dem meergrünen Stoff ihres Rockes wirkte seine Haut noch dünner und sein Arm zerbrechlich wie ein vertrockneter Ast in dem aufkommenden Sturm draußen. Wenn sie sein Alter nicht gekannt hätte, würde sie glauben, einen Siebzigjährigen zu berühren. Markus Ohmer war neunundvierzig.
»Also, wann sehen wir uns?«, fragte Nina.
»Nie! Du würdest vor mir fliehen.«
»Sie bezahlen mich dafür, hier zu sein.«
»Wann sterbe ich? Sag es mir.« Sein Händedruck wurde fester. »Wie lang noch?«
Wieder zuckte ein Blitz über die Stadt, und innerhalb weniger Augenblicke prasselten dicke Regentropfen herab, spritzten vom Fensterbrett auf das Bett, und die Dächer der umliegenden Häuser glänzten nass.
Nina liebte Gewitter, und in diesen schwülen Julitagen kam sie voll auf ihre Kosten. Die unbändige Gewalt, die die Menschen so klein erscheinen ließ, bestätigte sie in dem Glauben, dass der Mensch ein Nichts im Kosmos war. Und wenn er ihn verließ, würde die Erde nicht einen einzigen Regentropfen um ihn weinen.
Sanft strich sie über seinen Arm. Seine Haut war trocken und rauh. Donner krachte über den Lärm der Autos hinweg. Der Geruch nach nassem Straßenstaub mischte sich unter den der Lindenblüten.
»Noch vierundzwanzig Tage. Sie sterben am fünften August. An Ihrem fünfzigsten Geburtstag.«
»Du begleitest mich!«
»So haben wir’s vereinbart. Und ich habe längst alles organisiert, das wissen Sie.« Sie sah auf die kleine silberne Uhr, die sie an einem geflochtenen Lederband um den Hals trug. »Wir haben noch fünfzehn Minuten. Was wünschen Sie sich in der Zeit?« Nina würde auch noch zwanzig oder dreißig Minuten bleiben. Dass es Ohmer an seinen letzten Tagen gutging, war ihr wichtig. Wichtiger als das Geld. Doch sie wollte Markus’ Ehefrau nicht begegnen. Der Frau, die eine Fremde dafür bezahlte, dass sie ihren Mann anfasste, weil sie selbst sich ekelte. Dass Nina mit Markus schlief, wusste Silvia Ohmer nicht. Wahrscheinlich wäre es ihr auch egal. Sie weigerte sich sogar, ihren Ehemann in die Schweiz zu fahren und damit seinen letzten Wunsch zu erfüllen: selbstbestimmt und in Würde das zu beenden, was einmal ein gutes Leben gewesen war.
»Sitz einfach bei mir. Fass mich an. Ich möchte das Leben spüren.«
So saß Nina neben ihm, streichelte seine Schultern und Arme, dann seine Brust, die immer mehr einfiel. Sie ließ ihre Hände über Ohmers Rippen gleiten, über seinen Bauch, das schmale Becken, die Beine und zurück.
Er schwieg, und sie wünschte sich, nur für einen Augenblick das Tuch von seinem Gesicht heben zu dürfen und zu sehen, was für ein Mensch er war.
Dann klingelte ihr Handy. Ozzy Osbournes Stimme schepperte dumpf vor sich hin, Revolution in their minds, und Nina fragte Ohmer: »Kann ich?« Sie ärgerte sich, dass sie wieder einmal vergessen hatte, es leise zu stellen. Es war schließlich Ohmers Zeit.
»Mach nur.« Er klang, als lächle er, und Ozzy sang: »The children start to march.«
Sie rutschte vom Bett, riss ihre große Patchworktasche vom Boden und wühlte darin. Als sie das Handy nicht fand, kippte sie den Inhalt auf den Boden. »Against the world in which they have to live.« Das Smartphone fiel auf den Teppich. Unbekannt stand auf dem Display – nichts Ungewöhnliches in ihrem Job. »Hey, hier Nina.« Sie nahm das Gespräch an. »Was kann ich für Sie tun?«
Niemand antwortete.
»Hallo?« Sie stand jetzt neben dem Bett und blickte auf Ohmers Körper. Die wenigen dunklen Haare auf der Brust. Die Rippen, die jede wie ein scharfer Grat hervorstanden. Draußen schmatzten Reifen über den nassen Asphalt. Das Gewitter ließ nach.
»Nina? Nina Bach?«
»Klar. Wer ist da?«
Wieder Stille. Dann eine leise Stimme: »Frauke.«
Es war, als sei der Tod in das Zimmer getreten. Doch nicht zu Ohmer, sondern zu ihr. Augenblicklich versteifte sie sich, nur um im nächsten Moment wie ein Gummiseil, das jemand angerissen hatte, zu zittern. Sie wollte Blitze sehen, viele Blitze, jetzt sofort! Sie wollte krachenden Donner hören, in den Regen hinausrennen und schreien, bis jemand sie packte oder schlug oder umarmte. Irgendetwas, was sie in die Realität zurückholte. Doch der Regen fiel monoton, und Markus Ohmer, erschöpft und vollgepumpt mit Morphium, atmete gleichmäßig und schwer.
»Frauke«, flüsterte Nina.
»Ich muss dich sehen.«
Sehen.
Sie blickte auf das Tuch über Ohmers Gesicht. Der dunkle Fleck war größer geworden. Sie wollte das Tuch herunterreißen. Ihm ins Gesicht schreien, dass Frauke kein Recht hatte anzurufen. Doch sie wusste, dass da kein Gesicht mehr war.
Stattdessen lachte sie auf. »Willst du mich verarschen?« War ja klar. Da rief sie nach fast dreizehn Jahren an, als sei nie etwas passiert, und bestimmte wie eh und je, wo es langging.
»Willst du nicht wissen, warum ich dich anrufe?« Die Verbindung war so klar und Fraukes Stimme so nah, dass Nina unwillkürlich die Schultern ein wenig nach vorn zog – wie zum Schutz. »Lass mich in Ruhe«, zischte sie, und jetzt roch sie den Tumor. Den Eiter. Das Blut. Den Krebs, der von einem menschlichen Gesicht nichts als ein zerfressenes Loch statt einer Nase und zwei zugewucherte Augen übrig gelassen hatte. Markus hatte ihr das so gesagt, und Nina hatte nicht nachgehakt. Das Leben ihrer Kunden war nicht ihres.
»Bitte, Nina! Komm mich besuchen! Ich muss dir etwas erzählen. Du wirst dich freuen.«
Nina drückte auf das Gespräch-Beenden-Symbol, so fest, so angewidert, als wolle sie ein Ungeziefer zerquetschen, warf das Handy in ihre Tasche, bückte sich und raffte Bürste, Shampoo, Tampons, zwei Packungen Kondome, Tabak, Feuerzeuge, ihr Notizbuch und das Ledersäckchen mit ihrem Geld zusammen. Dann rannte sie aus dem Zimmer, durch den Flur, hinaus aus der Wohnung. Sie eilte die Treppe hinunter, stolperte auf dem ersten Absatz über den Saum ihres knöchellangen Rocks, rappelte sich auf und nickte unten bei den Briefkästen Markus Ohmers Frau zu, die mit ihren langen roten Fingernägeln gerade einen Briefumschlag aufschlitzte.
Keuchend trat Nina auf den Gehsteig hinaus. Ihr linkes Knie schmerzte von dem Sturz. Mit zitternden Händen drehte sie sich eine Zigarette, während ihr Haar sich nass und kalt auf ihre Wangen legte. »Geh an, du Scheißding«, fluchte sie, als die winzige Flamme des Feuerzeugs mehrmals vom Sturm ausgeblasen wurde. Als die Zigarette endlich brannte, zog sie den Rauch tief in ihre Lunge.
»Verdammte Hacke!« Sie trat gegen die nächstbeste Mülltonne.
2
Ich versteh’s nicht.« Kriminalhauptkommissar Stefan Wenner wandte sich vom Fenster ab und sah Emil Koswig über die aufgebahrte Frau hinweg an. Seine etwas zu sonnengebräunten Hände hielten sich am Revers seines etwas zu eng sitzenden Jacketts fest.
Der Rechtsmediziner hob die Schultern. »Wir haben schon Skurrileres gesehen.«
»Aber ihr Arm und … und das genau ein Jahr, nachdem …«
»Lass es gut sein, Stefan.« Emil Koswig blickte auf die Tote. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war er von Stefan Wenner in deren Wohnung gerufen worden. Fünf Stunden später hatte der Bestatter die Frau ins Kühlfach des Instituts geschoben und den transparenten Plastikbeutel mit dem blutumrandeten Stück Haut zu dem Leichnam gelegt. Das Skalpell hatten die Kriminaltechniker sichergestellt. Genauso wie das Gestell aus Metallstangen mit den zwei eingeschraubten Federn und der Zange. Es hatte mit den Gummifüßchen auf dem Rand der Badewanne gestanden. Offenbar extra dafür abgemessen und selbst zusammengelötet. Koswig sah noch jetzt den Leichenfundort vor sich. Von dem Anblick hatte er sich nicht losreißen können: Ein zierlicher Körper, der sich verschwommen unter dem roten Wasser abzeichnet; ein weißes Gesicht mit leicht geöffneten, trüben Augen; helles langes Haar, das auf der Oberfläche schwimmt. Sie scheint zu lächeln. Fast lebendig. Fast glücklich. Fast so wie die Frau, die mit sturmzerzausten Haaren über dem Meer vor dem Leuchtturm steht und lacht. Die Frau auf dem Foto, das noch immer auf Koswigs Nachttisch stand.
Nachdem die Kriminaltechniker alles dokumentiert und fotografiert hatten, ließen sie das Wasser ab. Hände und Füße weißlich verdickt, Livores nur schwach ausgebildet, hatte er in Gedanken bereits diktiert, als das Blutwasser gurgelnd im Abfluss verschwand. Grünliche Hautverfärbung und Ablösen der Haut an Fingern, Zehen und den Füßen durch frühzeitige Fäulnisveränderungen. Linke Unterarmbeugeseite mit fast rechteckig geformtem Hautdefekt mit glattrandigen Wundrändern … Schnittverletzungen in der linken Handgelenksbeuge … Das endgültige Obduktionsprotokoll würde seine Sekretärin nach der Sektion abtippen. Sachliche Formulierungen für einen gewaltsamen Tod mit Verstümmelungen.
Für eine letzte Stunde waren die Entstellungen jetzt verborgen: Hier, im Abschiedsraum des Institutes für Rechtsmedizin, hatte die Präparatorin das Gesicht von Frauke Bach gewaschen und gepudert und ihr Haar gekämmt. Ihr Körper war mit einem hellen Leinentuch bedeckt, das bis zum Boden reichte und das Stahlgestell des Leichenkarrens verdeckte. Ein paar Klappstühle für Angehörige, ein Tisch mit einer Bibel und einem schlichten Stand-Holzkreuz darauf. Die weißen Wände waren mit farbenfrohen Landschaftsbildern behängt. Wiesen, Bäche mit Brücken darüber, Hügel, die vor Grün nur so strotzten. Ein paar gelbe Rosen standen neben der Toten. Der klägliche Versuch, der Situation ein wenig das Grauen zu nehmen.
Es war Montag früh, halb neun Uhr, und die innere Leichenschau hätte vor fünfzehn Minuten beginnen sollen.
»Frauen.« Wenner seufzte, und sah im selben Moment schuldbewusst zu Emil Koswig. Zumindest interpretierte Koswig den kurzen Blick des Polizisten als Scham wegen seiner unüberlegten Bemerkung. Koswig war es gewohnt. Es machte ihm nichts mehr aus.
»Ich meine ja nur … Die Schwester wollte um acht Uhr hier sein!« Wenner kam um die Tote herum zu Koswig und berührte eine der Rosen. »Weich wie Frauenhaar«, murmelte er und sah zum bestimmt fünften Mal auf seine klobige Armbanduhr. »Frau Bach wird nicht mehr viel Zeit haben zum Abschiednehmen.«
»Hör mal, wenn es dir zu lang dauert, dann …«
Die Tür flog auf, und ohne ein Klopfen oder einen Gruß stand eine junge Frau vor den beiden Männern. Sie keuchte laut. Direkt aus der Hölle, schoss es Koswig durch den Kopf, als er ihre kirschroten, kinnlangen Haare, die schwarz geschminkten Augen und die vor Wut verzerrten Lippen musterte. Ihr dunkelgrüner Rock und die maigrünen Handstulpen bissen sich mit ihrer Haarfarbe.
»Haben Sie mich angerufen?« Sie warf einen bunten Sack neben die Tür und stellte einen großen Rucksack, den sie schwungvoll von ihren Schultern hievte, daneben. Die Träger ihres Tops rutschten dabei herunter. Mit einer harten Bewegung zog sie sie wieder hoch und verschränkte die Arme vor der Brust. Die Schwester einer so gepflegten Toten hatte Koswig sich anders vorgestellt. Er selbst trug eine feine Stoffhose und ein helles Hemd.
Der Kommissar zog die Augenbrauen hoch. »Wenn Sie Nina Bach sind, dann habe ich Sie angerufen, ja.«
»Hey, ich habe nichts …« Jetzt erst schien sie die Tote hinter den Männern zu registrieren. Sie ließ die Arme sinken, stand einen Moment reglos da und kam dann näher. Emil Koswig trat beiseite und überließ Wenner das Gespräch. Wenner war ein Macho. Mitte fünfzig, verheiratet, drei Kinder, zwei Geliebte. Vermutlich konnte er deshalb bestens taktieren und verharmlosen.
»Ich bin Stefan Wenner.« Er streckte ihr die kräftige Hand hin. »Und das da« – er nickte in Richtung seines Kollegen – »ist Professor Koswig vom Institut für Rechtsmedizin.« Statt seine Hand zu nehmen, schob sich Nina Bach eine Haarsträhne hinters Ohr. Ihr silbernes Ohrgehänge klimperte dabei.
»Mein ehrliches Mitgefühl, Frau Bach«, sagte Wenner. »Wollen Sie einen Moment allein sein mit Ihrer Schwester?«
Die Frau sog hörbar Luft ein. »Machen Sie sich nicht die Mühe. Ich bin sofort wieder weg.«
Koswig trat näher. Nina Bach roch nach Seife und dem typischen Staub der U-Bahn. Sie war knapp zwei Köpfe kleiner als er mit seinen eins neunzig. »Lassen Sie sich Zeit.«
Sie sah auf. Ihre Augen waren fast so schwarz wie der Kajalstift, mit dem sie diese umrandet hatte, und im rechten Auge hatte sie einen bernsteinfarbenen Fleck am Rand der Iris. »Warum ist sie in diesem … Institut? Und was habe ich damit zu tun?«
»Ihre Schwester starb unter ungeklärten Umständen.« Wenner fuhr sich durch das graue Bürstenhaar.
Nina Bach lachte auf. »Unter ungeklärten Umständen? Frauke? Da hat sie sich ja tatsächlich mal was Neues einfallen lassen.«
Die Mühe mit den Rosen und dem Schminken der Toten hätten sie sich offenbar sparen können.
Wenner verzog keine Miene. »Frau Bach, es ist möglich, dass Ihre Schwester Opfer eines Verbrechens geworden ist. Oder aber« – er zögerte – »dass sie sich das Leben genommen hat.«
»Selbstmord? Vergessen Sie’s.« Sie trat direkt an die Bahre heran und kaute auf ihrer Oberlippe.
»Was macht Sie da so sicher?«, fragte Koswig.
Als er in den Plastiküberschuhen über die Bluse und Unterwäsche gestiegen war, die vor dem Badezimmer gelegen hatten, wusste er bereits, dass ihn hier etwas anderes erwartete. Dabei war es ein Leichenfundort wie so viele, die er in seinen vierzehn Berufsjahren als Facharzt schon gesehen hatte. Auf dem Badewannenrand hatte das exakt ausgeschnittene Stück Haut gelegen. Bittere Galle war ihm in die Kehle gestiegen. Emil Koswig hatte hart geschluckt und sich sofort wieder in der Gewalt gehabt. Die Polizisten begrüßt. Sich die Sachlage erklären lassen. Seinen Koffer geöffnet und das Thermometer in den Anus der Toten eingeführt.
Nina Bach streckte die Hand aus, und Koswig glaubte, sie wolle der Schwester durchs Haar streichen. Sofort zog sie sie zurück. Streckte sie wieder aus, ließ sie sinken. Dann drehte sie sich um und hob sich den Rucksack, auf dem eine zusammengerollte Isomatte festgeschnallt war, auf den Rücken. »Eine Frauke Bach bringt sich nicht um, ganz einfach.« Sie griff nach dem Sack, der aus Hunderten bunter Stoffflicken bestand.
Es war eine große Schultertasche, wie Koswig jetzt erkannte.
»Geht das auch etwas konkreter?« Wenner stellte sich breitbeinig vor Nina Bach.
»Nein!«
»Das wird die Obduktion hoffentlich klären«, versuchte Koswig einzulenken.
»Und was sollte ich dann hier?« Sie funkelte ihn an. »Ich war die gesamte Nacht unterwegs für diese zwei Minuten … Show!«
»Abschied nehmen.«
»Abschied«, sagte sie sarkastisch, »tolle Idee.« Und schon polterte sie hinaus.
»Frau Bach, Sie kommen bitte heute Nachmittag ins Präsidium«, rief Wenner ihr nach, »Punkt sechzehn Uhr.«
»Leck mich am Ärmel«, kam es durch die offene Tür zurück, und weg war sie.
Die Männer sahen sich kurz an. Wenner schüttelte den Kopf. »Was war das denn? Unverschämtes Weibsbild. Sie ist schon am Telefon so zickig gewesen. Interessiert sich null für das, was ihrer Schwester zugestoßen ist.«
»Vielleicht mit Recht. Vielleicht war unsere Tote ja ein Ekel?«
»Jaja, ich weiß. Geschwisterneid, Hass, Liebe, Erbschaften, ach, zum Teufel. Ein Sumpf wahrscheinlich. Und ich darf darin herumwühlen.«
»Lass uns erst mal schauen, was wir da überhaupt haben.« Koswig löste die Bremse des Leichenkarrens und zog das Leinentuch über Bachs Gesicht. »Auch wenn du lieber andere Dinge tun würdest … da musst du jetzt durch. Und falls wir hier ein spektakuläres Tötungsdelikt haben, müssen deine Frauen warten.«
Wenner grinste kurz, presste dann aber die Lippen aufeinander.
Koswig konnte nicht leugnen, dass es ihm eine gewisse Freude bereitete, Wenner zu verunsichern. Der Macho fragte sich garantiert, wie viele seiner Frauengeschichten bekannt waren. Oder ob Koswig nur Wenners Ehefrau und Töchter gemeint hatte. Da jeder im Team Koswigs Geschichte kannte, wehrten sie sich nicht gegen seine Scherze und Ironie, die oft an Sarkasmus grenzten, sondern hielten den Mund.
Koswig schob Frauke Bach Richtung Tür.
»Was macht eigentlich Morrell?«, fragte Wenner.
»Der Chef ist krank.«
Der Karren schepperte über den Fliesenboden des neonbeleuchteten Flurs. Es roch nach Desinfektionsmittel.
»Immer noch? Was ist denn mit ihm?«
»Vertraust du meinen Fähigkeiten nicht?« Koswig drehte sich kurz um und zwinkerte, doch der Stich hatte gesessen.
»Ach was! Du bist der beste Oberarzt und eine echte Koryphäe.« Wenner grinste schon wieder. »Das Institut könnte sich keinen besseren stellvertretenden Direktor wünschen.«
»Das wollte ich hören.« Noch während sie durch den Flur und die schweren Metalltüren gingen, rief Koswig im Büro seines Assistenzarztes an. »Wir sind so weit, Julius. Kommst du bitte in Saal drei? Und bring die Damen Weinmann und Fischer mit.«
Emil Koswig bewegte vorsichtig den verletzten Arm der Toten. Durch die Chirurgenhandschuhe fühlte er sich weich und fast warm an. Die Totenstarre hatte sich in den kleinen Gelenken bereits wieder gelöst, Ellbogen und Schultern waren noch nicht voll beweglich. Das weiße Licht der OP-Lampe zeigte die moosgrünen, etwa handtellergroßen Verwesungsflecke und jeden der vielen Schnitte überdeutlich und grell.
Er blickte auf die Verletzung, die er so gern ignoriert hätte: Dort, wo am Unterarm die Haut fehlte, lag das Fettgewebe offen da – doppelt so groß und genauso gelb wie ein Pfund Butter. Die Einblutungen zeigten ihm schon jetzt, dass Frauke Bach zum Zeitpunkt der Verstümmelung noch gelebt hatte.
Koswig nickte Julius Tamm – dem Assistenzarzt – und den beiden Präparatorinnen zu und nahm sein Diktiergerät. Das Team stand in grüner OP-Kleidung und transparenten Schürzen um den Obduktionstisch, umgeben von Materialschränken, Glasvitrinen, Tafeln und Waagen, weiß gekachelten Wänden und dem Geruch des toten, sich selbst verdauenden Fleisches. Der Geruch, den Koswig nur noch dann wahrnahm, wenn er sich bewusst darauf konzentrierte. Würgen ließ der Gestank höchstens noch seine Studenten – heute waren drei anwesend – oder unerfahrene Polizeibeamte.
Sie würden mit dem sichersten Anzeichen für einen Suizid beginnen: dem tiefen Schnitt im Handgelenk, der direkt an das Ende der großen Hautläsion grenzte.
»Linker Arm knöchern stabil«, sprach Koswig in das Aufnahmegerät, während Charlotte Fischer das Skalpell tief von Schulter zu Schulter der Toten zog. Nicht ein Blutstropfen quoll mehr heraus. Die Schnittkante blieb glatt und weiß. »Am linken Unterarm und an der linken Hand teils blutige Antragungen. In der Handgelenksbeuge eine vier Zentimeter lange, quer verlaufende und maximal zwei bis drei Zentimeter klaffende Weichteildurchtrennung.«
Julius Tamm legte während des Diktierens ein Lineal neben die Wunde und fotografierte alles. Doris Weinmann, die zweite Präparatorin, ließ mit lautem Rauschen Wasser in das Becken am Fußende des Seziertisches ein. Die Füße der Toten sahen – genau wie die Hände – wie grobe weiße Wachskerzen aus und lagen fast neben dem Schlaucheinlass des Beckens. Quer über den Unterschenkeln der Toten stand der Organschneidetisch. Auf seiner ausgezogenen Instrumentenablage glänzten Skalpelle, die Knorpel- und Organmesser, Rachiotom, Schädelspalter, Muskelhaken, Darmscheren und Autopsiesäge.
Fischer führte in einem zweiten Schnitt das Skalpell mittig vom Brust- zum Schambein hinab und legte dann mit raschen, geübten Schnitten Rippen und Brustbein unter der Fettschicht frei.
»Die glatten Wundränder geringgradig eingeblutet«, dokumentierte Koswig die Handgelenksverletzung weiter und beobachtete gleichzeitig jedes Detail von Fischers Arbeit. »Ellenseitiges Wundende seicht auslaufend.«
Tamm zog mit zwei Pinzetten den Schnitt in der Handgelenksbeuge auseinander. Koswig beugte sich vor. »Im Verlauf des Handgelenkschnittes wurden Fettgewebe, Muskulatur und Sehnen durchdrungen und die linke Speichenschlagader unvollständig durchtrennt.« Das Gerät knackte, sobald er den Aufnahmemodus stoppte oder weiterlaufen ließ.
»Hat sie gut hinbekommen.« Charlotte Fischer griff nach der Knochenschere. Die Frau war groß und mollig und hatte ihr pechschwarzes Haar stets zu einem Knoten gebunden, aus dem ein paar Strähnen frech hervorlugten. »Hätte ja auch eine Invagination werden können.« Mit lautem Knacken durchtrennte sie die ersten Rippen. Das Wasser rauschte monoton.
»Was heißt das?« Kommissar Wenner wirkte gequält.
»Hätte sie die Arterie komplett durchtrennt« – die nächsten Rippen knackten –, »hätten sich wahrscheinlich die Gefäßstümpfe eingestülpt. Und dann wird das nichts mit der tödlichen Blutung. Und die haben wir hier ja wohl.«
»Frauke Bach war Ärztin.« Wenner schob die Hände in die Taschen seiner Jeans. »Sie wusste sicher, wie …«
»Immer langsam, Frau Fischer!« Koswig hasste voreilige Schlüsse. Auch wenn die Präparatorin vermutlich recht hatte.
»Das ist doch ein Lehrbuchsuizid!«, sagte einer der Studenten und lächelte. »Darf ich auch mal?« Er deutete auf die Knochenschere. Koswig nickte, und Charlotte Fischer reichte sie ihm. Der Student spannte die Kiefermuskeln an und drückte die Schere fest zu – jetzt war auch das Brustbein durchtrennt. Er hob Rippen und Brustbein aus der Toten. »Sieht aus wie ein Tannenzweig aus Knochen«, sagte der junge Mann und legte das Knochengebilde mit den anhaftenden Fettresten neben die Tote. Die glitschigen Gedärme und Organe lagen jetzt offen in der Bauchhöhle.
Wenner trat zurück und lockerte seinen Krawattenknoten. »Ist es das? Ein Lehrbuchsuizid?« Er und ein Kollege von der Kriminaltechnik waren die einzigen Anwesenden in Zivilkleidung.
»Aber natürlich, wir …«
»Darauf wette ich jedes meiner Pfunde! Alles voller Probierschnitte.« Charlotte Fischer warf dem lächelnden Studenten einen bösen Blick zu und deutete dann mit der Schere auf den Arm der Toten. Von der herausgeschnittenen Haut hatte noch immer niemand gesprochen. Eine stille Übereinkunft des Teams. Rücksichtnahme. Sprachlosigkeit. Koswig wusste, was in ihnen vorging. Es berührte ihn nicht. Er nickte. Die Blicke der Präparatorin spürte er fast körperlich auf seinem Gesicht. Auch Tamm und Wenner musterten ihn. Stur blickte er auf den Arm der Toten. Diktierte weiter, während Julius Tamm das Lineal an einen Schnitt nach dem anderen legte: »Schulter- und handwärts der genannten Weichteildurchtrennung je zwei parallel dazu verlaufende, sehr oberflächliche und glattrandige Hautläsionen mit einer maximalen Eindringtiefe von ein bis zwei Millimetern. Die Längen der Läsionen betragen …« Da war es wieder. Das leichte Zittern seiner Hand und der Schmerz in den Fingergelenken, der ihn nie vergessen lassen würde. Reiß dich zusammen! Sie dürfen es nicht sehen. Nicht dein Unbehagen. Nicht deine Zweifel. Er schaute auf. Kühl. Sachlich. Entschlossen. »Und das da? Gehört das auch zu einem Lehrbuchsuizid?« Er legte die Hand neben das riesige, butterfarbene Rechteck. Fleisch, Sehnen und Fett. Es zeigte scharfe Wundränder. Unmöglich, sich solch eine Verletzung selbst beizubringen. Haut ließ sich nicht einschneiden und abreißen. Sie musste abpräpariert werden. Unter Spannung. Dazu brauchte man zwei Hände. Normalerweise.
Niemand sagte ein Wort, nur das Rauschen des Wassers war zu hören.
»Diese Apparatur«, wandte Koswig sich schließlich an den Kriminaltechniker. »Habt ihr die schon genauer untersucht?«
Der dünne, schwarzhaarige Mann, der bisher nur beobachtet hatte, bejahte. »Noch Samstagnacht. Die Zange, die mit den Stäben verlötet war, ist eine Chirurgenzange. Es gibt Hautpartikel daran. Sie stammen von der Toten. Das ganze Ding ist sehr stabil gebaut. Vier Füße mit gummierten Standflächen.« Er zeigte auf den Organschneidetisch. »Fast dieselben. Plus Querstäbe mit einem Federmechanismus, der die Zange unter Druck zusammenpresst.«
»Und das Skalpell?«
»Frauke Bachs Blut, Bachs DNA, Bachs Fingerabdrücke. Nichts sonst.«
Koswig holte tief Luft. Schon in Bachs Badezimmer war er sicher gewesen, keine Hinweise auf Fremdeinwirkung zu finden. »Sie hätte also die Haut selbst einschneiden, in diese Apparatur klemmen, und mit der rechten Hand abpräparieren können?«
»Sieht ganz so aus. Und als Chirurgin …« Der Kriminaltechniker hob die Schultern.
»Passt zur Suizidthese. Also auf zur Routine.«
Sie entnahmen Organe, spülten sie ab, wogen sie und stückelten sie. Danach schnitten sie die Kopfhaut von Ohr zu Ohr auf und zogen das Gesicht über den Schädel bis auf die Brust. Sägten dann den blanken Schädel auf, entnahmen das Gehirn und zerteilten es in Scheiben. Sie lagerten Gewebeproben ein und beschrifteten das braune Halblitergefäß mit der Sektionsnummer 2014-46-1507, Frauke Bach.
Neues kam nicht ans Licht. Die Fakten standen fest: Alle Verletzungen waren umblutet, also prämortal entstanden. Und alle hatte sich Frauke Bach selbst beibringen können. Abwehr- und Deckungsverletzungen, die für eine Fremdbeibringung oder ein Kampfgeschehen gesprochen hätten, fehlten. Der Arm war voller Probierschnitte – typisch für Suizidenten, die noch zögerten. In der Wohnung gab es keinerlei Einbruchsspuren. Blieben noch die toxikologischen Analysen, die Emil Koswig sofort veranlassen musste. Kein Mensch präparierte sich bei vollem Schmerzempfinden Haut ab, demzufolge erwartete er Spuren starker Schmerzmittel.
Als Doris Weinmann Organe, Gehirn und die abpräparierte Haut in den Bauchraum gab und der Student schon den Spezialfaden in das dicke Nadelöhr schob, legte Charlotte Fischer eine Hand auf Koswigs Schulter. »Chef?«
Erst jetzt bemerkte Koswig, dass er wie paralysiert neben der Leiche stand und in den blutgefüllten Bauchraum starrte. Dass die Bilder in seinem Innern durcheinanderwirbelten. Gedärme. Knochensplitter. Ein aufklaffender Hinterkopf, ein Unterkiefer, nur noch über Weichteile mit dem Kopf verbunden und in drei Teile geborsten. Die Hirnhautlappen. Die Haut auf der Badewanne. Das Auge im Waschbecken. Zerstörte Leben.
»Es tut mir leid«, sagte Charlotte leise.
Weinmann stopfte Frauke Bachs Schädel mit Papiertüchern aus und zog das Gesicht wieder über die Knochen. Der Student begann unter ihrer Anleitung mit der groben Naht.
»Selbstmord? Vergessen Sie’s. Oder was sagte die Schwester?« Stefan Wenners Stimme durchbrach unangemessen laut die Stille.
Koswig drehte sich zu ihm. »Du kannst das Offensichtliche ruhig aussprechen. Es ist schließlich meine Arbeit. Und auch eure. Also erledigt sie und hört mit diesem beschissenen Mitleid auf! Ich hasse es!«
Der Student grinste, und Koswig wurde zornig.
»Hey, es ist nicht unsere Schuld. Wir geben uns hier alle Mühe! Du musst nicht auf uns wütend sein.«
Wieder trat Stille ein. Koswigs Herz schlug hart gegen seine Rippen. Er wollte etwas sagen, schluckte es aber hinunter.
»Okay«, fuhr Wenner zögerlich fort, »Frau Doktor Bach hat sich, wie es aussieht, umgebracht und vorher verstümmelt. Aber das ergibt keinen Sinn!«
»Hat der Tod denn einen Sinn?«, stieß Koswig hervor. Vergebens versuchte er zu verhindern, dass seine Hand sich zur Faust ballte. Rasch schob er sie unter die OP-Schürze und schaute auf die weißen Wandfliesen. Sein Blick glitt die klaren Fugen entlang. Waagrecht, senkrecht, waagrecht, senkrecht. Kachel für Kachel. Das hatte ihn schon ein Mal gerettet. Dann hielt er es nicht mehr aus. »Macht das ohne mich fertig.« Jeder würde es verstehen.
Draußen schloss er sich in der Toilette ein, riss die Latex-Handschuhe von den Händen, beugte sich über das Waschbecken und würgte. Er keuchte und widerstand dem Impuls, aus dem Institut zu laufen, zu rennen, immer weiter, hinaus aus der Stadt, bis sein Körper brannte und seine Seele an ihrem Grab gefror. Er nahm die randlose Brille ab und spritzte sich Wasser ins Gesicht. Du bist Oberarzt! Du bist für das Institut verantwortlich, solange Morrell krank ist! Er hob den Kopf. Dein Team vertraut dir! Fachlich und menschlich! In den Spiegel wollte er nicht blicken. Er wusste auch so, was die anderen sahen: einen großen, attraktiven Mann mit müden blauen Augen und hohlen Wangen. Einen, der mit der schweren Last nicht zurechtkam. Einen Profi, der Dinge zu übersehen drohte und Fehler machte. Der älter aussah, als er es mit seinen zweiundvierzig Jahren war. Ungerecht. Aggressiv. Ein Arschloch.
»Willst du das, ja? Willst du das sein?«, schrie er und schlug mit der Faust auf das Waschbecken. Der Schmerz schoss von den Fingern bis in die Schulter. Als er sich beruhigt hatte, blickte er doch in den Spiegel und flüsterte: »Was ist nur aus dir geworden, Emil.«
3
Suizid! Nina stapfte die vierspurige Straße entlang, in der einen Hand den Plastikbeutel mit dem Zettel, in der anderen eine Zigarette.
Die Luft war feucht und der Himmel stahlblau und von weißen Fädchen durchzogen. Noch immer brannte die Sonne. Links über den Fabrikgebäuden bildeten sich Gewittertürme. Der Rucksack drückte. Auf Ninas Rücken sammelte sich Schweiß.
»Ein paar hundert Meter weiter ist ein Park. Rechte Seite«, hatte Kommissar Wenner zum Abschied gesagt und sie durch die Sicherheitsschleuse bis vor das weitläufige Polizeipräsidium begleitet. Dabei war sein Blick an ihren Ohrhängern mit den zahllosen maigrünen Strasssteinchen hängengeblieben, über ihr moosgrünes Top und den Rock bis zu den Bikerstiefeln und zurück gewandert. »Fahren Sie Motorrad?«
»Sehe ich aus wie ein lebender Organtransport?«, hatte sie geantwortet und gedacht: Aber mit meinen Schuhen kann ich deine wichtigsten Organe zu Omelett machen. Du hältst mich also für eine Schlampe und schiebst mich gleich in die Schublade »Lebt im Park«. Ich kenne Typen wie dich. Die mit diesem geheuchelten Mitleidstonfall und dem angewiderten Blick. Schon klar, kein Wunder, dass ich zu der eleganten, gebildeten Frau Doktor kein gutes, oder besser: gar kein Verhältnis hatte.
»Wie gesagt: Sobald der Fall abgeschlossen ist, können Sie in die Wohnung Ihrer Schwester.«
Nina wurde schon bei dem Gedanken daran schlecht.
Suizid! Die hatten doch irgendetwas übersehen bei der Obduktion! Und Abschiedsbrief gab es auch keinen. Nur diesen verfluchten Zettel. Sie ballte die Hand zur Faust, es raschelte. Der Zettel enthielt eine Zeichnung: einen Hasen, dessen Körper die Form eines Herzens hatte. In dem Herz stand das Wort Schwester. Daneben ihre, Ninas, Handynummer.
Sie ging einige hundert Meter weiter und ignorierte die Abgase der Autos und Busse. Weit konnte es nicht mehr sein.
Über eine Stunde hatte sie vorhin mit dem Kommissar geredet. Pragmatisch war er gewesen, fast frostig. Wenner hatte hinter seinem ausladenden Schreibtisch gesessen, die Hände flach auf ein paar Blätter Papier gelegt. Er trug noch immer das graue Jackett und die ziegelrote Krawatte vom Morgen, als habe er sich passend zur Backstein-Optik seines Büros gekleidet. Kein Muskel bewegte sich in seinem ledrigen Gesicht, das Nina an schlecht gemachte Solariumswerbung erinnerte. Obwohl er sie aus kleinen, stahlgrauen Augen direkt ansah, fühlte sie sich wie ein weißer Fleck. Als sei Wenner ein Nachrichtensprecher und sie eine unbeteiligte Zuschauerin vor irgendeinem Fernsehgerät.
Sie saß ihm gegenüber, die Beine übereinandergeschlagen, ihre Tasche lag unter dem dünn gepolsterten Besucherstuhl. Wenner tippte auf die Papiere, das vorläufige Obduktionsprotokoll, wie er sagte, und erklärte ihr dessen Inhalt: Selbsttötung. Das stimme mit den Ergebnissen der Spurensicherung überein. Der Tod sei am Freitagabend zwischen neunzehn und dreiundzwanzig Uhr eingetreten. Die Todesursache war ein Verbluten infolge eines tiefen Schnittes im Handgelenk. Hypovolämischer Schock.
»Dauert so was lang?«, fragte sie betont cool. Sie kannte die Antwort.
»Das müssen Sie einen Mediziner fragen.« Wenner beugte sich vor und schob die Papiere, in die er gar nicht hineingesehen hatte, sauber zusammen. »Die Putzfrau hat sie gefunden.«
»Ich hätte wetten können, dass es ein reicher Ehemann war.«
»Ihre Schwester war nicht verheiratet.«
Sie biss sich auf die Oberlippe. »So?«
»Kein Mann, keine Kinder.«
»Dann gibt’s wenigstens keine kleinen Würmchen, die ich jetzt an der Backe hätte.« Das hätte ihr gerade noch gefehlt. »Oder wären die zu meinen Eltern gekommen?«
Wenner sah sie nachdenklich an. »Sie wissen es nicht?«
»Was?«
Der Kriminalhauptkommissar holte tief Luft. »Können Sie sich vorstellen, weshalb Ihre Schwester nicht mehr leben wollte?«
»Keine Ahnung, wir haben uns mehr als zwölf Jahre nicht gesehen.« Sie griff nach ihrer Tasche. Sie musste hier raus.
»Und gehört?«
»Auch nicht.«
»Wir haben die Wohnung noch in der Nacht nach dem Auffinden, also spät am Samstag, durchsucht. Keine Einbruchspuren, kein Hinweis auf Abwehrverletzungen oder einen Kampf. Nicht ein einziger Anhaltspunkt dafür, dass sich eine zweite Person in der Wohnung aufgehalten hat. Kein Abschiedsbrief.« Wenner stand auf. Der Stuhl ächzte, als die Federung entlastet wurde. Aus einem Metallregal nahm er eine transparente, etwa handtellergroße Tüte. Als er zu ihr kam, quietschten seine Schuhsohlen auf dem Boden.
»Das gehört Ihnen.« Er legte einen durchsichtigen Plastikbeutel vor Nina und setzte sich wieder.
Sie starrte auf den Inhalt. Ein vergilbter Zettel. Nina stand mit Bleistift darauf, dahinter ihre Handynummer. In Ninas Handschrift. Auf einem Papier, herausgerissen aus einem der Notizblöcke, die Nina seit ihrer Kindheit verwendete. »Fuck.« War ja klar gewesen. Wie sonst hätten die Bullen ihre Nummer herausfinden sollen außer über Fraukes Wohnung. Und sie hatte ihre Handynummer immer behalten, bei jedem neuen Gerät. Geschäftlich war das wichtig. Denn sie war in keinem Telefonbuch zu finden. Nirgendwo im Internet. Alles lief über Mundpropaganda oder fürsorgliche Live-Akquise, wie sie es selbst gern nannte.
Sie berührte den Plastikbeutel mit den Fingerspitzen. Wie lang war es her, dass sie ihre Nummer für Frauke aufgeschrieben hatte? Zwölf Jahre? Dreizehn? Es musste bei einer ihrer letzten Begegnungen gewesen sein. Im September 2002. Neben die Telefonnummer hatte jemand – offenbar Frauke – mit blauem Kuli den Hasen gekritzelt. Und Schwester in seinen Herzkörper geschrieben. Alle Striche waren mehrmals nachgezogen, als habe Frauke den Hasen während des Telefonierens gezeichnet. Ihre Schwester hatte den Zettel all die Jahre aufbewahrt!
»Sie hat sich mündlich verabschiedet. Per Telefon. Nicht wahr, Frau Bach?« Wenner riss sie aus der Erinnerung.
Nina schwieg.
»Hat Ihre Schwester nichts erwähnt? Nach all den langen, langen Jahren?« Nina roch Wenners Atem. Kaffee und Zahnpasta. »Frauke und Sie sprechen miteinander – und noch am selben Abend nimmt sie sich das Leben. Sie müssen doch etwas gemerkt haben!«
»Spionieren Sie mir nach? Haben Sie Fraukes Anrufe überprüft? Und was spielt das überhaupt noch für eine Rolle?«
»Ihre Schwester hat sich vor dem Suizid verstümmelt. Absichtlich.« Er klopfte auf die Papiere. »Sie hat sich aus dem Unterarm ein großes Stück Haut herausgeschnitten. Fachlich perfekt gemacht. Wollen Sie es lesen?« Er schob das Obduktionsprotokoll über den Tisch.
»Wozu?« Sie sprach zu laut. Zu aggressiv.
»Sie lag in einer Badewanne voller Blutwasser«, sagte Wenner und erzählte etwas von einem Apparat zum Einspannen und Abpräparieren von Haut. Als er erwähnte, dass Frauke als promovierte Chirurgin genau wusste, wie sie wo zu schneiden hatte, lachte Nina kurz auf. Chirurgin! Sie schluckte und sah ihren geliebten Plüschhasen mit der roten Latzhose vor sich, der fast so groß wie Nina selbst gewesen war und den Frauke beim Spielen mit dem Tranchiermesser ihrer Mutter aufgeschlitzt hatte. Es war immer Fraukes Traum gewesen, Chirurgin zu werden. Sie hatte es also tatsächlich geschafft.
»Auch wenn Sie sich kaum für Ihre Schwester interessieren: Sie müssen sich jetzt um alles kümmern.« Wenner stand auf. Der Stuhl ächzte erneut. »Ich rufe Sie an, wenn Sie Ihre Schwester beerdigen können. Wir haben übrigens noch nicht mit Ihren Eltern gesprochen. Möchten Sie das übernehmen?«
»Ich hab keine Ahnung, wo sie sind. Und es ist ihr Job, sich um Fraukes Beerdigung zu kümmern, nicht meiner. Sie sind die nächsten Angehörigen.«
»Sie wissen es also wirklich nicht?«
»Was, zum Teufel? Haben Sie noch mehr frohe Botschaften? Nur zu.«
»Seniorenstift Gorbitzer Berg ist die Adresse. Ich habe dort angerufen. Ihre Eltern sind … nicht mehr ganz in der Gegenwart. Geistig.«
»Seniorenstift? Sie meinen wohl Altenheim!« Geistig verwirrt? Na toll. Aber was sollte sie auch erwarten. Ihr Vater war schon leicht dement gewesen, als er Nina, die schweigend und mit nassem Gesicht auf dem Rücksitz des alten Fords gesessen hatte, durch das graue Tor gefahren und den fremden Leuten übergeben hatte. Und ihre Mutter tat immer alles, was Vater tat. Inklusive krank werden. Tote Schwester, weggetretene Eltern. Typisch. Nina zog Niederlagen geradezu an.
»Seniorenstift«, wiederholte Wenner und zeigte ein freundliches Lachen. »Dort dürfen die Bewohner ihre Betten noch selbst machen.«
»Scherzkeks.«
Der Polizist wurde ernst. »Gehen Sie hin.« Er öffnete die Bürotür. Auf dem Flur liefen Leute eilig hin und her. »Ihre Eltern können sich nicht um Fraukes Begräbnis kümmern. Reden Sie wenigstens mit ihnen, wenn es geht. Und nichts für ungut wegen der Befragung. Es ist eine ungewöhnliche Selbsttötung. Fraukes Papiere müssen wir vorläufig behalten. Wir haben Kontoauszüge, ihre Arbeits- und einen Immobilienvertrag gesichert. Nur bis alles offiziell abgeschlossen ist. Wir müssen die toxikologischen Ergebnisse noch abwarten. Eine Formsache. Danach können Sie …«
»Fraukes Krempel interessiert mich nicht.«
Er blickte kurz auf seine polierten Schuhe und schürzte die Lippen. Dann hob er den Kopf. »Es gibt auch ein Testament.«
»Und?« Nina musterte demonstrativ desinteressiert die Regale im Büro. Bücher, ein paar Edelsteine und silbergerahmte Fotos einer Frau mit schwarzem Pagenschnitt, mehrere Kinder. Was hätte sie auch sagen sollen? Dass Frauke schon seit Ninas dreizehntem Lebensjahr tot für sie war? Dass Geld für Nina keine Bedeutung hatte? Sie nie viel besessen und noch weniger gebraucht hatte? Seit sich damals das schwere graue Tor nach über einem Jahr wieder geöffnet hatte und Nina frei gewesen war, wollte sie einfach nur leben. Und mit ihrem Dasein die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Gelungen war es ihr nur zum Teil. Sie hatte sich eine große Portion Sarkasmus zugelegt. Manchmal schoss sie damit über das Ziel hinaus. Viele schreckte das ab. Doch alles war besser als die Wirklichkeit. Dieser verdammte, aussichtslose Kampf um ein wenig echte Liebe.
»Die Wohnung gehört Ihrer Schwester.«
»Das müssen Sie den Erben sagen. Ich zähle garantiert nicht dazu.«
Wenner legte die Hand auf die Türklinke. »Wir haben einen Hinterlegungsschein gefunden. Das heißt, das Testament liegt beim Amtsgericht. Sie werden dann informiert. Wo sind Sie zu erreichen?«
»Handy.« In fremden Häusern, dachte sie. In fremden Betten. In Heimen. Leeren Fabrikhallen. Büros. Im Park.
»Ich rufe Sie an, wenn Sie Fraukes Wohnungsschlüssel abholen können. Die Papiere legen wir in die Wohnung zurück. Einiges davon werden Sie für den Bestatter brauchen.« Er räusperte sich, und sein Zahnpasta-Kaffee-Geruch hüllte sie ein. »Nehmen Sie dann besser eine Freundin mit in die Wohnung. Die Reinigung ist Sache der Angehörigen. Falls Sie die Adresse einer Spezialfirma brauchen …«
Sie hatte nicht mehr zugehört. Hatte wie mechanisch den Stuhl nach hinten geschoben, war aufgestanden und an Wenner vorbei durch den Flur und die Treppen hinab bis zur Sicherheitsschleuse geeilt. Unten hatte Wenner sie eingeholt.
Für die Polizei war der Fall offenbar so gut wie abgeschlossen. Für Nina dagegen begann jetzt die Drecksarbeit. Sie musste ihre Eltern aufsuchen, vermutlich die Wohnung putzen und den ganzen Mist mit der Beerdigung organisieren. Sie hatte mal wieder die Arschkarte gezogen.
Ihre Schritte knirschten dumpf auf dem Kies, als sie durch das schmiedeeiserne Tor trat. Der Park war weitläufig und voller Menschen. Erschöpft ließ sie sich unter einem Baum ins Gras sinken. Wie Feuerzungen krochen die Strahlen der Abendsonne über die Baumstämme. Ein paar Jogger liefen keuchend an Nina vorbei, Leute mit Hunden, Frauen mit Kinderwägen, Männer mit Aktentaschen und starren Gesichtern. Auf einer Bank, nur wenige Schritte entfernt, saß ein Mann mit grauem Vollbart. Er war barfuß und hielt einen Tetrapak in der Hand. Neben ihm lag eine getigerte Katze. Etwas weiter weg spielten ein paar Kinder Frisbee. Nina lehnte sich an den Stamm, schloss die Augen und lauschte den Abendgeräuschen. Schritte. Hundegebell. Stimmen, Rufe, Vogelgezwitscher. Das monotone Rauschen der Autos. Dazwischen fröhliches Kinderlachen. Auch hier, viele hundert Kilometer von Markus Ohmers Zimmer über dem Rathausplatz entfernt, duftete es nach Lindenblüten.
Die Rinde drückte hart gegen ihren Rücken.
Nina hatte Großstädte nie gemocht. Zu viele Menschen, zu viel Gewalt, zu wenig Grün. Und zu wenige Leuchtkäfer im Sommer. Unter dem Himmel zu sitzen und ihr Blinken oder Dauerleuchten zu sehen, schenkte Nina kleine Glücksmomente. Es waren Signale. Du machst alles richtig. Deine Fürsorge ist gut für die Welt. Auch wenn dein Leben hart ist. Menschen, die ihre Fürsorge brauchten, fand Nina auch außerhalb der Zentren. In kleinen Städten oder ländlichen Gegenden. Dort, wo sie sich orientieren konnte und nachts, falls sie kein Dach über dem Kopf fand, keine Angst haben musste, an jeder Ecke angemacht, überfallen oder sogar vergewaltigt zu werden. Hier und heute war sie fremd. Hatte weder Stammkunden noch Bekannte. Wo sollte sie in den nächsten Tagen hin? Sie musste wohl unter irgendeinem Gebüsch schlafen. Und morgen erst einmal Kohle auftreiben. Ihre Kleidung und Haare waschen. In Städten war man ständig schmutzig. Und bei aller Not waren Nina Sauberkeit und Selbstachtung heilig.
Das Kinderlachen näherte sich, und als sie die Augen öffnete, kam ein Junge auf sie zugelaufen. Ruckartig blieb er stehen, der Mund war zu einem Lachen geöffnet. Er hatte zwei große Zahnlücken. Dann bückte er sich rasch nach dem roten Frisbee, das zu ihr geflogen war, und rannte davon. Die andern johlten, und schon warf er das Frisbee zu seinen Freunden.
Hatte sie mit Frauke jemals so ausgelassen gespielt und gelacht?
Der Mann auf der Bank sah zu ihr herüber. Er reckte einen Daumen in die Luft. »Kinder!« Die Katze hob den Kopf.
Frauke hatte so anders ausgesehen heute früh in diesem Abschiedsraum. Weich, freundlich. Und nicht so dünn, wie Nina sie in Erinnerung hatte. Nina hatte sie berühren wollen. Doch ihr Gehirn hatte sich geweigert, den Arm diesen Befehl vollständig ausführen zu lassen. Nina wollte wissen, wie Frauke sich anfühlte. Ob sie im Tod noch kühler war als im Leben. Ob ihre Haut so zart war, wie ihr Freund Peter es immer behauptet hatte. Ob die Narbe an der Schläfe wirklich hart geblieben war, wie Frauke es ihr vorgeworfen hatte.
Fast hatte Nina sich geschämt. Nicht vor Wenner und dem Leichenarzt, sondern vor sich selbst. Tagtäglich berührte sie fremde Menschen. Alte, Kranke, Behinderte. Sie tauschten Intimitäten aus, wenn sie es wünschten. Meistens tat sie es gern. Und sie mochte den Großteil ihrer Kunden. Markus Ohmer gehörte dazu. Und Ines Klein, die vom Hals abwärts gelähmte, ältere Frau, der sie erotische Geschichten vorlas und dabei ihren Nacken kraulte. Auf Ines Kleins Sofa konnte Nina jeden Montag übernachten und zudem die Waschmaschine benutzen. Auch Smoothie mochte sie gern. Den dicken Koch mit der Glatze und dem kleinen Penis, dessen richtigen Namen sie nicht kannte. Smoothie verzauberte andere mit seinen Köstlichkeiten und strahlte die Restaurantbesucher an. Doch nachts, wenn die Welt satt und zufrieden im Bett lag und vögelte, saß er mit seinem Hund allein vor dem Fernseher und verzehrte sich nach den Zärtlichkeiten einer Frau. Nina gab sie ihm. Ausgeschlossen waren einzig Zungenküsse und ungeschützter Sex. Ansonsten kannte Nina keine Tabus. Doch der Gedanke, Frauke auch nur mit dem kleinen Finger zu berühren, hatte ihr ein kaltes Kribbeln über den ganzen Körper gejagt.
Ines Klein!