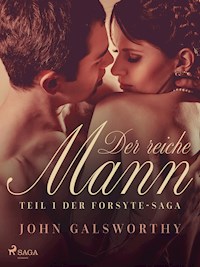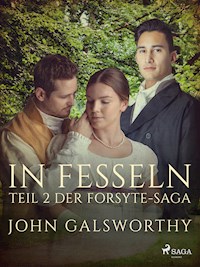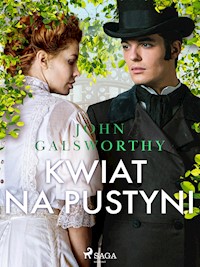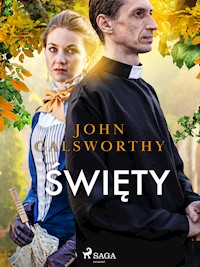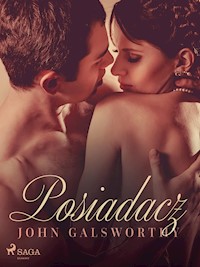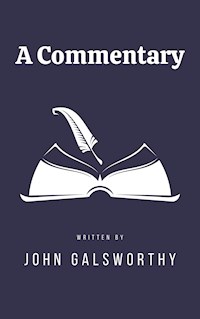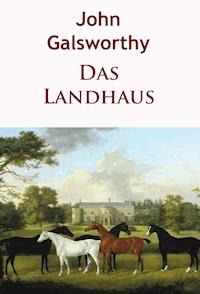
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie ein leiser Windhauch, der durch das starre Schweigen eines Nebels dringt, so wurde eine hohe, helle Frauenstimme vernehmbar: »Oh, danke sehr; ich nehme das Coupé!« Vom ersten Lakaien, der ihr die Sachen trug, begleitet, näherte sich eine Dame. Durch den weißen Schleier hindurch, der sie verhüllte, gewahrte des Ehrenwerten Geoffrey Winlow lässig umherschweifender Blick ein Paar schimmernde Augen. Nachdem sie sich noch einmal umgedreht hatte, verschwand sie in dem Coupé. Gleich darauf erschien ihr Kopf hinter der Schleierhülle wieder. »Hier drinnen ist noch Platz genug, George!« George Pendyce trat rasch heran und stieg zu ihr in den Wagen. Ein Räderknirschen, und das Coupé rollte davon ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
John Galsworthy
Das Landhaus
Titel der englischen Originalausgabe:The Country House
idb
ISBN 9783962249939
W. H. Hudson
zugeeignet
» ... 's ist ein wüster Garten.«
Erster Teil
Erstes Kapitel
Eine Jagdgesellschaft auf Worsted Skeynes
Es war das Jahr 1891, der Monat: Oktober, der Tag: ein Montag. Draußen, im Dunkel vor dem Bahnhofsgebäude von Worsted Skeynes nahmen die verschiedenen Gefährte von Mr. Horace Pendyce – Kremser, Coupé und Gepäckwagen – allen freien Raum für sich in Anspruch; und ebenso hatte das Gesicht seines Kutschers offenbar Monopol auf das Licht der einzigen Bahnhofslaterne.
Rosig angehaucht, mit dichtem, kurzgeschorenem, grauem Backenbart und fest aufeinander gepreßten Lippen thronte er hoch oben in dem herben Ostwind gleich einem Wahrzeichen des Feudalsystems. Drinnen auf dem Bahnsteig warteten in langen Livreeröcken mit Silberknöpfen, das feierliche Aussehen gemildert durch die etwas schief gerückten Zylinderhüte, der erste Lakai und der zweite Reitknecht auf die Ankunft des Sechs-Uhr-fünfzehn-Zuges.
Der erste Lakai zog aus seiner Tasche ein Blatt Briefpapier mit Wappen und Initialen, das die zierlichen, regelmäßigen Schriftzüge von Mr. Horace Pendyce zeigte. Mit näselnder, etwas spöttischer Stimme begann er laut zu lesen: »›Der Ehrenwerte Geoffrey Winlow und Gattin das blaue Zimmer mit Toilettenraum; die Jungfer das kleine gelbe. Mr. George das weiße Zimmer. Mrs. Jaspar Bellew das goldne. Der Herr Hauptmann das rote. General Pendyce das rosa Zimmer; sein Kammerdiener die hintere Dachstube.‹ So, das sind alle.«
Der Reitknecht, ein rotbackiger junger Bursch, hörte nicht zu. »Wenn Mr. Georges ›Ambler‹ Mittwoch gewinnt«, meinte er, »dann hab' ich fünf Pfund sicher in der Tasche. Wer reitet für Mr. George?«
»Na, James, natürlich.«
Der Reitknecht pfiff durch die Zähne.
»Ich will zusehen, daß ich morgen bei der Waage dabei sein kann. Hast du auch gewettet, Tom?«
»Da steht ja noch etwas auf der andern Seite«, gab der Lakai zur Antwort. »Grünes Zimmer rechter Flügel – kriegt der Foxleigh; nicht viel los mit ihm. So eine ›Nimm was du kriegen kannst und rück nichts raus‹-Sorte! Aber zu schießen versteht er! Darum laden sie ihn ja auch bloß ein!«
Hinter einer Wand dunkler Bäume hervor lief jetzt der Zug ein.
Den Bahnsteig herunter kamen die ersten Reisenden, zwei Viehhändler mit langen Stöcken, die in ihren Friesröcken daherstapften und einen Geruch von Stall und schwarzem Tabak um sich verbreiteten. Dann hinter ihnen ein Paar und einige einzelne Gestalten, die sich möglichst weit entfernt voneinander hielten: Mr. Horace Pendyces Gäste. Ganz langsam kamen sie, einer nach dem andern, bis an die Wagen und blickten eifrig geradeaus, als fürchteten sie, einander zu erkennen. Ein hochgewachsener Mann im Pelz, dessen hochgewachsene Frau eine silberbeschlagene Ledertasche trug, redete den Kutscher an:
»Abend, Benson! Mr. George sagt, Hauptmann Pendyce hätte ihm erzählt, daß er erst mit dem Neun-Uhr-dreißig-Zug ankäme. Ich denke, wir fahren –«
Wie ein leiser Windhauch, der durch das starre Schweigen eines Nebels dringt, so wurde eine hohe, helle Frauenstimme vernehmbar:
»Oh, danke sehr; ich nehme das Coupé!«
Vom ersten Lakaien, der ihr die Sachen trug, begleitet, näherte sich eine Dame. Durch den weißen Schleier hindurch, der sie verhüllte, gewahrte des Ehrenwerten Geoffrey Winlow lässig umherschweifender Blick ein Paar schimmernde Augen. Nachdem sie sich noch einmal umgedreht hatte, verschwand sie in dem Coupé. Gleich darauf erschien ihr Kopf hinter der Schleierhülle wieder.
»Hier drinnen ist noch Platz genug, George!«
George Pendyce trat rasch heran und stieg zu ihr in den Wagen. Ein Räderknirschen, und das Coupé rollte davon.
Der Ehrenwerte Geoffrey Winlow sah wieder zu dem Kutscher hinauf.
»Wer war das, Benson?«
Der Kutscher, der sich vertraulich hinunterbeugte, hielt seine plumpe, weißgekleidete Hand gespreizt in der Höhe von Winlows Hut und antwortete:
»Mrs. Jaspar Bellew, gnädiger Herr. Die Frau Gemahlin vom Hauptmann Bellew, dem das Haus ›Die Föhren‹ gehört.«
»Aber ich glaube, die wären nicht mehr –«
»Nein, gnädiger Herr; sind sie auch nicht!«
»Ah!«
Eine ruhige, etwas dünne Stimme ließ sich vom Kremser her vernehmen:
»Aber Geoff!«
Der Ehrenwerte Geoffrey Winlow folgte seiner Gattin, Mr. Foxleigh und dem General Pendyce in den Kremser, und wieder hörte man Mrs. Winlows Stimme:
»Darf meine Jungfer mit herein? – Kommen Sie, Tookson!« ...
Der weiße, langgestreckte, niedrige Herrensitz, der stattlich dastand inmitten ausgezeichneter Güter, war durch eine Heirat mit der letzten Worsted in den Besitz von Mr. Horace Pendyces Ur-Ur-Ur-Großvater gekommen. Ursprünglich war der schöne Grundbesitz, in kleinere Anwesen geteilt, an Pächter vergeben gewesen, die, ohne daß man sich um sie gekümmert, recht gut vorwärtsgekommen waren und ansehnliche Pacht gezahlt hatten. Jetzt wurde das Gut nach neuesten Methoden bewirtschaftet und ergab ein kleines Defizit. Von Zeit zu Zeit machte Mr. Pendyce Zuchtversuche mit neuen Rindern oder Rebhühnern und ließ bei den Schulen einen Flügel anbauen. Sein Einkommen war glücklicherweise unabhängig von diesem Grundbesitz. Er lebte im besten Einvernehmen mit dem Pfarrer und den Verwaltungsbehörden und führte nicht selten Klage darüber, daß seine Pächter nicht auf dem Lande bleiben wollten. Seine Gattin war eine Totteridge und sein Wildbestand vortrefflich. Daß er ein erstgeborener Sohn gewesen war, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Seiner individuellen Überzeugung nach stand England im Begriff, am Individualismus zugrunde zu gehen, und er hatte sich zur Aufgabe gemacht, diesen Fehler zum wenigsten bei seinen Pächtern auszumerzen. Indem er an Stelle ihres Individualismus seine eigenen Neigungen, Ideen und Empfindungen, ja, man hätte sagen können, seinen eigenen Individualismus setzte – was ihn oft genug Geld kostete – hatte er einigermaßen seine Lieblingstheorie bewiesen, nämlich, daß die Entwicklung des Individualismus einen Niedergang des Gemeinwesens bedeute.
Wenn man ihm jedoch die Sache derart vor Augen führte, konnte er sich sehr ereifern, denn er hielt sich nicht etwa für einen Individualisten, sondern für einen ›konservativen Kommunisten‹, wie er es nannte. Seinen landwirtschaftlichen Interessen gemäß, war er natürlich Schutzzöllner; ein Zoll auf Getreide, das war ihm klar, mußte für Englands Wohlstand von ungeheurer Bedeutung sein. Oft genug erklärte er: ›Ein Zoll von vier oder fünf Shilling auf Getreide, und ich würde aus meinem Grund und Boden einen Gewinn herauswirtschaften‹.
Mr. Pendyce besaß hingegen andere Eigenheiten, in denen sich nicht allzuviel Individualität verriet. Er war ein Gegner jeder Änderung in der bestehenden Ordnung der Dinge, machte sich über alles schriftliche Notizen und fühlte sich nie glücklicher, als wenn er von sich, von seinem Grundbesitz reden durfte. Er besaß einen schwarzen Spaniel, John genannt, mit langer Schnauze und noch längeren Ohren, den er selbst aufgezogen hatte; und das Tier war nur glücklich in seiner Nähe.
Der Erscheinung nach gehörte Mr. Pendyce eigentlich zur alten Schule, mit seiner hochaufgerichteten, beweglichen Gestalt und dem dünnen Backenbart, dem er jedoch seit mehreren Jahren einen Schnurrbart hinzugefügt hatte, der herunterhing und schon angegraut war. Er trug breite Krawatten und Gehröcke. Er war kein Raucher.
An der Spitze seiner mit Blumen und Silber beladenen Tafel saß er zwischen der Ehrenwerten Mrs. Winlow und Mrs. Jaspar Bellew. Auffallendere und verschiedenartigere Nachbarinnen hätte er sich nicht wünschen können. Die Natur hatte sie beide gleich hoch an Wuchs, stattlich und schön geschaffen; und doch war zwischen diesen zwei Frauen ein Abstand, den auszufüllen Mr. Pendyce, ein Mann von hagerer Statur, vergeblich sich bemühte. Eine dem aschblonden Typ der englischen Aristokratie anhaftende Seelenruhe lag beständig auf Mrs. Winlows Antlitz, wie das Lächeln eines Frosttages. In seiner gewissen Ausdruckslosigkeit überzeugte es den Beobachter sofort, daß er eine Frau bester Herkunft vor sich habe. Wäre je ein entschiedener Ausdruck auf ihren Zügen erschienen, Gott weiß, welche Folgen das gezeitigt hätte. Sie hatte stets die Ermahnung ihrer Nurse befolgt: ›Um alles in der Welt, schneiden Sie kein Gesicht, Miß Truda; wenn die Uhr schlägt, bleibt's stehen!‹ Seit jenem Tage hat Gertrude Winlow, die von Hause aus und durch ihre Heirat zum Adel des Landes gehörte, nie wieder das Gesicht verzogen, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht einmal, als ihr Sohn geboren worden war. Und da mußte nun gerade auf der andern Seite des Hausherrn diese rätselhafte Mrs. Bellew mit den grüngrauen Augen sitzen, die von den würdigsten Vertreterinnen ihres Geschlechts mit instinktiver Mißbilligung angesehen wurde! Eine Frau in ihrer Lage hätte alles Auffällige vermeiden sollen; aber die Natur hatte ihr eine gar zu bemerkenswerte Erscheinung verliehen. Es hieß, daß sie sich vor zwei Jahren nur deshalb von Hauptmann Bellew getrennt und ihre Besitzung ›Die Föhren‹ verlassen hatte, weil sie einander überdrüssig waren. Man erzählte sich auch, daß sie George, den ältesten Sohn von Mr. Pendyce, in seinen Huldigungen offenbar ermunterte.
Lady Malden hatte vor Tische zu Mrs. Winlow die Bemerkung gemacht:
»Was ist's nur eigentlich mit dieser Mrs. Bellew? Ich habe sie nie gemocht. Eine Frau in ihrer Lage müßte sich viel zurückhaltender benehmen. Ich begreife überhaupt nicht, wie man sie hier einladen konnte, wo ihr Mann doch ganz in der Nähe wohnt. Es geht ihr übrigens pekuniär recht mäßig. Sie versucht es auch gar nicht zu bemänteln. Sieht doch bedenklich nach Abenteurerin aus!«
Mrs. Winlow hatte darauf erwidert:
»Sie ist ja wohl eine Cousine oder so etwas von Mrs. Pendyce. Die Pendyces sind mit aller Welt verschwägert. »Wie peinlich! Man weiß nie ...«
Lady Malden gab zurück:
»Verkehrten Sie mit ihr, als sie hier auf dem Lande lebte? Ich kann diese Frauen, die mit den Männern um die Wette reiten, nicht ausstehen. Sie und ihr Mann waren ja unglaublich! Sie spricht immer nur davon, welches Hindernis sie genommen und wie sie es genommen hat; und sie wettet und besucht die Rennen. Ich müßte mich sehr täuschen, wenn George Pendyce nicht in sie verschossen ist. Sie gehört zu den Frauen, denen die Männer immer auf den Leim gehen!«
An der Spitze seiner Tafel, auf der vor jedem Gast ein Menü stand, in der sorgfältigsten Handschrift seiner ältesten Tochter geschrieben, saß Horace Pendyce und löffelte seine Suppe.
»Diese Suppe«, bemerkte er eben zu Mrs. Bellew, »weckt die Erinnerung an Ihren Herrn Vater in mir; er hat sie nämlich sehr gern gemocht. Ich hatte immer große Hochachtung vor Ihrem Vater – ein prachtvoller Mann! Ich behauptete immer, er sei der tatkräftigste Mensch, den ich, abgesehen von meinem eigenen guten Vater, gekannt habe, und der war der eigenwilligste Mann in den drei Königreichen.«
Mr. Pendyce bediente sich oft des Ausdrucks ›in den drei Königreichen‹, dem manchmal die Erklärung folgte, daß seine Großmutter von Richard III. abstamme, während seines Großvaters Familie auf die Cornwall-Riesen zurückging, von denen einer – das pflegte er mit geringschätzigem Lächeln hinzuzusetzen – einst eine Kuh über eine Mauer geschleudert hatte.
»Nur war mir Ihr Herr Vater ein zu eifriger Anhänger des Individualismus, Mrs. Bellew. Ich habe bei der Bewirtschaftung meiner Güter reichliche Erfahrungen mit dem Individualismus gemacht, und ich habe gefunden, daß ein Individualist niemals zufrieden ist! Meine Pächter haben alles, was sie brauchen, aber sie zufriedenzustellen, ist unmöglich. Da ist zum Beispiel einer, namens Peacock, ein halsstarriger, ganz beschränkter Mensch! Ich gebe ihm natürlich nicht nach. Wenn man dem seinen Willen ließe, dann würde er auf die ganz altmodische Manier der Landbewirtschaftung zurückgreifen. Er möchte mir das Gehöft gern abkaufen. Altes, ungesundes System der Freibauern! Gleich ist er mit der Redensart da, sein Großvater hätte es auch so gehalten. So ein Kerl ist das. Ich hasse allen Individualismus. Er richtet England zugrunde! Sie werden nirgends besser gebaute Wohnhäuser oder bessere Wirtschaftshäuser finden als auf meinem Grundbesitz. Ich bin für Zentralisation. Sie wissen wohl, wie ich mich selbst immer bezeichne: als einen konservativen Kommunisten. Meiner Meinung nach ist das die Partei der Zukunft. Sehen Sie, Ihres Vaters Wahlspruch war: ›Jeder für sich!‹ Auf dem Lande täte das nie gut! Besitzer und Pächter müssen Hand in Hand arbeiten. Übrigens – Sie kommen doch am Mittwoch mit uns nach Newmarket? George läßt ein famoses Pferd im Rutlandshire-Rennen laufen – ein ganz famoses Pferd. Ich bin sehr froh, daß er nicht wettet. Nichts auf der Welt ist mir so verhaßt wie Spielen und Wetten!«
Mrs. Bellew streifte ihn mit einem Seitenblick, und ein leises, ironisches Lächeln zuckte um ihre vollen, roten Lippen. Aber Mr. Pendyces Aufmerksamkeit hatte sich schon seiner Suppe zugewandt. Als er die Unterhaltung wieder aufnehmen wollte, sprach die schöne Frau mit seinem Sohne, und der Hausherr wandte sich, ein wenig die Stirn runzelnd, zu Mrs. Winlow. Ihr Zuhören hatte etwas Automatisches und Lebloses; sie schien sich durch ein allzu entgegenkommendes Verständnis nicht ermüden zu wollen. Aber eine geduldige Zuhörerin fand Mr. Pendyce in ihr.
»Das Land verändert sich«, begann er, »verändert sich von Tag zu Tag. Das Herrenhaus ist nicht mehr das, was es war. Eine große Verantwortung ruht auf uns Besitzern. Wenn wir nicht standhalten, bricht alles zusammen.
Was konnte es in der Tat Schöneres geben als dieses Herrenhausleben, wie es Mr. Pendyce führte; mit seiner geschäftigen Behaglichkeit, seiner moralischen Sauberkeit, mit seinem Zusammenwirken von frischer Luft und blumendurchdufteter Wärme, seiner vollkommenen geistigen Ruhe, seinem Nichtswissenwollen von Leiden irgendwelcher Art und seiner Suppe – vor allem und gewissermaßen als Sinnbild wirkend – seiner Suppe, hergestellt aus Fleischstücken sorgfältig gemästeter Tiere.
Mr. Pendyce hielt diese Art von Leben für die einzig vernünftige; diejenigen, die es lebten, für die einzig vernünftigen Menschen. Er betrachtete es geradezu als eine Pflicht, dieses Leben zu führen mit seinem gesunden, einfachen und doch behaglichen Kreislauf, umgeben von Geschöpfen, die für seinen eigenen Tisch aufgezogen wurden – umgeben gleichsam von einem Meer von Suppe! Und daß da Menschen waren, die in Städten zu Millionen ihr Dasein fristeten, einer dem andern nicht das Brot gönnend, viele von ihnen arbeitslos, und alle die andern Begleiterscheinungen ungesunder Verhältnisse, diese deprimierenden Vorstellungen waren ihm schrecklich! Aber auch das Leben in den Vorstädten, jenes Dasein in den schiefergedeckten Häusern, die in kleinen Reihen dastehen und so sehr einander gleichen, daß ihr Anblick jedem Menschen von Geschmack unerträglich ist, auch diese Art von Dasein mißfiel ihm höchlich. Und doch war er bei all seiner Vorliebe für ein Leben auf eigenem Grundbesitz nicht etwa ein reicher Mann; sein Einkommen überstieg ja kaum zehntausend Pfund jährlich.
Die erste Jagdgesellschaft der Saison, bloß für das Buschwerk und die an der Jagdgrenze liegenden Gehege, war, wie gewöhnlich, so angesetzt, daß sie mit dem letzten der Newmarket-Rennen zusammentraf, denn Newmarket war bequem von Worsted Skeynes zu erreichen; und obgleich Mr. Pendyce das Wetten verabscheute, lag ihm daran, sich auf dem Rennplatz zu zeigen. Er wollte als ein Mann gelten, der sich für den Sport nur um des Sportes willen interessierte, und er war stolz darauf, daß sein Sohn den ›Ambler‹, von dem man viel erwartete, so billig gekauft hatte und ihn nur aus Liebhaberei laufen ließ.
Die Gäste waren mit Bedacht ausgewählt. Zur Rechten von Mrs. Winlow saß Thomas Brandwhite (von der Firma Brown & Brandwhite), der eine Stellung, die man nicht gut ignorieren konnte, in der Finanzwelt einnahm und nebenbei zwei Landsitze und eine Vergnügungsjacht besaß. Sein längliches, durchfurchtes Gesicht, mit dem dicken Schnurrbart, zeigte meistens einen verdrießlichen Ausdruck. Er war aus der Firma ausgeschieden und saß nur noch im Aufsichtsrat verschiedener Gesellschaften. An seiner Seite sah man Mrs. Hussell Barter, mit jenem rührenden Ausdruck in den Zügen, wie man ihn bei vielen englischen Frauen antrifft. Es war der Gesichtsausdruck der Frau, die immer ihre Pflicht, ihre nicht leichte Pflicht erfüllt; der Frau, deren Augen über den einst rosigen, jetzt welken Wangen groß und angstvoll blicken; deren Art zu reden ungekünstelt, freundlich, offen, ein wenig schüchtern ist; die in ihrer Stimme etwas Hoffnungsloses und doch Tröstliches hat; eine jener Frauen, die immer von Kindern, Leidenden, alten Leuten umgeben sind, weil sie von ihr Beistand erwarten; Frauen, die sich niemals den Luxus leisten, unter dem Ansturm der Pflichten zusammenzubrechen. Eine von diesen Frauen war Mrs. Hussell Barter, die Ehegattin des Pastors Hussell Barter, der morgen die Jagd, aber nicht das Rennen am Mittwoch mitmachen sollte. An ihrer andern Seite saß Gilbert Foxleigh, ein schlankgewachsener Mann mit langem, schmalem Kopf, kräftigen, weißen Zähnen und tiefliegenden, hungrigen Augen. Er gehörte der in der Gegend ansässigen Familie der Foxleighs an und war einer von sechs Brüdern. Als unschätzbar erwies er sich für die Besitzer von Jagden oder jungen, halbwilden Pferden, in einer Zeit, da, wie Foxleigh es auszudrücken pflegte, ›kaum ein einziger von den Jungen auch nur noch einen Schimmer vom Reiten oder Schießen hat‹. Es gab keine Art von Vierfüßlern, Vögeln oder Fischen, die er nicht mit ebensoviel Geschicklichkeit wie Behagen zu vernichten imstande war und vernichtete. Sein einziges Mißgeschick war sein Einkommen, das sehr unbedeutend war. Er hatte Mrs. Brandwhite zu Tisch geführt, mit der er aber wenig sprach; er überließ es ihrem andern Nachbarn, General Pendyce, die Kosten der Unterhaltung zu tragen.
Wäre Charles Pendyce ein Jahr früher als sein Bruder, anstatt ein Jahr nach ihm zur Welt gekommen, so wäre jetzt er naturgemäß der Besitzer von Worsted Skeynes gewesen, und Horace wäre statt seiner bei der Armee. So aber hatte er, nachdem er ziemlich mühelos Generalmajor geworden, mit einem Ruhegehalt den Dienst quittiert. Der dritte Bruder – hätte er vorgezogen, ins irdische Dasein zu treten – würde die geistliche Laufbahn eingeschlagen haben, bei der eine gute Pfarre seiner geharrt hätte; er hatte aber anders gewählt, und so war die Pfarre notwendigerweise auf eine Seitenlinie übergegangen. Wenn man Horace und Charles von hinten sah, konnte man sie nur schwer unterscheiden. Beide waren hager, hochaufgerichtet, mit leicht abfallenden Schultern; aber Charles Pendyce bürstete das Haar vorn und hinten von einem Mittelscheitel nach beiden Seiten, und beim Gehen knickte er in den Knien ein wenig ein. Von vorn gesehen waren sie leichter zu unterscheiden, denn des Generals Backenbart breitete sich über seine Wangen, bis er den Schnurrbart erreichte; und in seinen Zügen lag etwas Verhalten-Unzufriedenes wie bei einem Individualisten, der ein ganzes Leben lang sich einer Richtung zugehörig gefühlt hatte, von der er sich schließlich losgesagt, zwar ohne einen Verlust zu empfinden, aber doch mit einem unbestimmten Gefühl des Gekränktseins. Er hatte nicht geheiratet, es gewissermaßen für überflüssig haltend, da Horace ihm ja doch schon vom Start an um ein Jahr voraus war; und so lebte er mit einem Diener in Pall Mall, nahe seinem Klub.
In Lady Malden, die seine Tischdame war, beherbergte Worsted Skeynes eine tadellose Frau und eine Persönlichkeit, deren Nachmittagstees für Arbeiter in der Londoner Season sich einer gewissen Berühmtheit erfreuten. Kein Arbeiter, der daran teilgenommen, hatte je das Haus verlassen, ohne ein Gefühl ehrlicher Hochachtung für dessen Herrin. Sie war eine Frau, die sich in jeder Lebenslage ihre Stellung zu wahren wußte. Sie war die Tochter eines höheren Kirchenbeamten, und sie sah im Sitzen am besten aus, da sie ziemlich kurze Beine hatte. Ihr Gesicht zeigte lebhafte Farben; der Mund war energisch und ein wenig groß, die Nase wohlgeformt, das Haar dunkel. Sie sprach mit kräftiger Stimme und pflegte ihre Worte nicht zu wägen; an ihr lag es auch, daß ihr Gatte, Sir James, reaktionären Ansichten über die Frauenfrage huldigte.
Um die Ecke, am Ende des Tisches, unterhielt der Ehrenwerte Geoffrey Winlow die Hausfrau mit Erzählungen über die Balkanländer, die er vor kurzem besucht hatte. Sein Gesicht, von normannischem Typus, zeigte regelmäßige, wohlgebildete Züge und einen behaglichen, klugen Ausdruck. Er war liebenswürdig und gewandt; nur ab und zu merkte man, daß er von der unfehlbaren Richtigkeit seiner Ansichten überzeugt war und jeder Versuch, ihn eines Besseren zu belehren, ihm höchst überflüssig erschien. Sein Vater, Lord Montrossor, dessen Besitzung Coldingham etwa sechs Meilen von hier entfernt lag, würde ihm, so nahm man an, im Laufe der Zeit seinen eigenen Sitz im Oberhause überlassen.
Und neben ihm saß Mrs. Pendyce, die Hausfrau. Ein Porträt von ihr hing über der Anrichte am andern Ende des Zimmers; und obgleich es ein Modemaler gewesen, der das Bild gemalt, hatte er doch einen Schimmer von jenem ›Gewissen Etwas‹ erfaßt, das noch jetzt, nach zwanzig Jahren, über ihrem Antlitz lag. Sie war nicht mehr jung; durch ihr dunkles Haar zogen sich weiße Fäden; aber sie war auch noch nicht alt, denn mit neunzehn Jahren hatte sie geheiratet, und jetzt zählte sie erst zweiundfünfzig. Ihr Gesicht war ziemlich schmal und bleich, und ihre Augenbrauen waren dunkel und gewölbt und immer ein wenig hochgezogen. Sie hatte dunkelgraue Augen, die manchmal fast schwarz schienen, denn die Pupillen weiteten sich, wenn sie in Erregung geriet. Ihre Lippen waren ein ganz kein wenig geöffnet, und der Ausdruck dieser Lippen und Augen hatte etwas fast rührend Sanftes, fast rührend Erwartungsvolles. Aber all das war doch nicht jenes ›Gewisse Etwas‹. Das war vielmehr der äußere Widerschein eines tiefinneren Empfindens, daß sie nie nötig hätte, um irgendwelche Dinge zu bitten, einer instinktiven Überzeugung, daß eben jene Dinge schon ihr Eigen wären. An jenem ›Gewissen Etwas‹ und an ihren schmalen, durchsichtigen Händen war sie leicht als eine Totteridge zu erkennen. Ihre Stimme mit dem etwas schleppenden besonderen Tonfall klang sympathisch, sowie ihre meist ein klein wenig gesenkten Augenlider bekräftigten diesen Eindruck. Über ihrem Busen, der das Herz einer Lady barg, hob und senkte sich köstliche alte Spitze.
Um die Ecke, ihr zunächst, plauderten Sir James Malden und Beatrice Pendyce (die älteste Tochter) über Pferde und Jagd. Bé sprach aus freien Stücken selten von etwas anderem. Ihr Gesicht war gut und freundlich, aber nicht besonders hübsch, und sie schien von dieser Tatsache so tief innerlich überzeugt, daß sie ein wenig scheu geworden war und sich stets bereit zeigte, ihre kleinen Dienste anderen zur Verfügung zu stellen.
Sir James hatte graue Bartkoteletten und durchfurchte, scharfe Züge. Er entstammte einer alten Familie aus Kent, die sich in Cambridgeshire angesiedelt hatte; seine Jagd war berühmt. Er war auch Friedensrichter, Hauptmann der Yeomanry, ein eifriger Kirchenbesucher und sehr gefürchtet von den Wilddieben. Er hielt, wie schon erwähnt, an reaktionären Ansichten fest, da er sich vor Lady Malden, seiner Gattin, etwas fürchtete.
Links von Miß Pendyce saß der Pfarrer Hussell Barter, der morgen an der Jagd, aber nicht an dem Rennen vom Mittwoch teilnehmen wollte.
Der Pfarrer von Worsted Skeynes war nicht groß gewachsen, und sein Haupt war vom vielen Denken ein wenig kahl geworden. Sein breites, regelmäßiges Gesicht war glattrasiert, lebhaft gerötet, und erinnerte an die Porträts des achtzehnten Jahrhunderts. Er hatte volle, leicht faltige Wangen, eine etwas vorgeschobene Unterlippe, und über den großen, hellen Augen traten starke Brauen hervor. In seiner Erscheinung lag etwas Gebieterisches; und seine Worte brachte er mit einer Stimme hervor, der die Gewohnheit, von der Kanzel herabzureden, eine weittragende Kraft verliehen hatte, so daß es einem förmlich schwer wurde, nicht hinzuhören, wenn er mit irgend jemandem eine Privatunterhaltung führte. Vielleicht war es ihm auch nicht unangenehm, daß seine Äußerungen in vertraulichen Angelegenheiten allgemeine Beachtung finden sollten. In mancher Hinsicht war er wirklich typisch. Unentschiedenheit, Zweifel, Duldsamkeit – abgesehen von derjenigen gegen seine eigenen Anschauungen – waren ihm unleidlich. Der Phantasie brachte er ein tiefes Mißtrauen entgegen. Seine Lebenspflicht sah er sehr deutlich vor sich, und die der andern vielleicht noch deutlicher; dabei ermutigte er seine Pfarrkinder keineswegs zu selbständigem Denken. Diese Gewohnheit schien ihm eine allzu gefährliche. Er gab seiner Meinung sehr energischen Ausdruck, und wenn er einmal Anlaß zum Tadeln fand, so sprach er von dem Sünder als einem ›Menschen ohne Charakter‹, ›einem elenden Burschen‹ mit solchem Ton tiefster Überzeugung, daß seine Zuhörer gar nicht anders konnten, als unbedingt überzeugt sein von dem moralischen Unwert der betreffenden Person. Er hatte eine derbe, frische Art zu reden, und seine Gemeinde hing an ihm; er war ein guter Kricketspieler, ein noch besserer Angler, ein tüchtiger Schütze, obgleich er, wie er oft sagte, eigentlich gar keine Zeit für die Jagd übrig hatte. Der Einmischung in materielle Angelegenheiten enthielt er sich, hingegen gab er scharf acht auf die Ansichten seiner Pfarrkinder und eiferte sie an, treu zu der bestehenden Ordnung der Dinge – zum Britischen Reich und zur Englischen Kirche – zu halten. Er hatte sein Pfarramt ererbt, und zum Glück besaß er einiges Privatvermögen, denn er hatte eine zahlreiche Familie. Seine Tischdame war Nora, die jüngere der beiden Pendyce-Töchter; sie hatte ein rundliches, offenes Gesicht und ein bestimmteres Wesen als ihre Schwester Beatrice.
Ihr Bruder George, der Erstgeborene, saß zu ihrer Rechten. Er war mittelgroß und trug das rotbraune Gesicht mit dem kräftigen Unterkiefer glattrasiert. Er hatte graue Augen und einen energischen Mund; das dunkle, sorgfältig gebürstete Haar begann auf dem Scheitel ein wenig dünn zu werden, zeigte aber jenen eigenen Glanz, den man beim Haar mancher Lebemänner sehen kann. Er kleidete sich mit auffälliger Eleganz. Erscheinungen wie der seinen pflegte man in Piccadilly zu jeder Tages- und Nachtzeit zu begegnen. George war für die Militärkarriere bestimmt gewesen, hatte das notwendige Examen aber nicht bestanden, was jedoch nicht ihm persönlich, sondern seiner anererbten Verständnislosigkeit für Rechtschreibung zur Last zu legen war. Wäre er der zweitgeborene Sohn, Gerald, gewesen, er hätte, der Familientradition entsprechend, ohne jede Schwierigkeit zweifellos das Offiziersexamen bestanden. Und wäre Gerald (jetzt Hauptmann Pendyce) George, der Erstgeborene, gewesen, so wäre vielleicht er durchgefallen. So lebte George in seinem Londoner Klub mit sechshundert Pfund Jahreseinkommen und verbrachte einen großen Teil seiner Zeit damit, in einem Eckfenster den Rennkalender zu studieren.
Jetzt blickte er von der Tischkarte auf und sah verstohlen um sich. Helen Bellew hatte sich, ihm ihre weiße Schulter zukehrend, in eine Unterhaltung mit seinem Vater vertieft. George war stolz auf seine Selbstbeherrschung, aber es lag etwas sonderbar Verlangendes in seinem Gesicht. Man konnte es wohl begreifen, daß sie manchen Leuten zu schön war für die Situation, in der sie sich befand. Ihre Gestalt erschien hoch, biegsam und voll; jetzt, seitdem sie nicht mehr so eifrig jagte, war sie noch etwas voller geworden. Das Haar, das sich in lockeren Flechten um ihre breite, niedrige Stirn legte, zeigte einen seltsam weichen Glanz. Eine leise Spur von Sinnlichkeit lag um ihren Mund. Der obere Teil des Gesichts erschien zu breit, aber die Augen waren prachtvoll – eisgrau, manchmal fast grün, strahlend und von dunklen Wimpern umrahmt.
In dem Blick, mit dem George sie anstarrte, lag fast etwas Ergreifendes; als ob ein Mensch wider seinen Willen zum Hinsehen gezwungen würde.
Die Geschichte spielte schon den ganzen Sommer hindurch; und noch immer wußte er nicht, woran er war. Bald schien sie ihn gern zu haben; bald wieder behandelte sie ihn, als ob er nichts zu hoffen hätte. Was er als Spiel begonnen hatte, war tödlicher Ernst geworden. Und das allein war schon tragisch. Jene behagliche Gemütsruhe, die des Lebens Atem ist, war fort; seine Gedanken beschäftigten sich unaufhörlich mit ihrer Person. Gehörte sie wohl zu jenen Frauen, die die Bewunderung der Männer hinnehmen, ohne je ihrerseits etwas zu geben? Wartete sie nur, um ihrer Eroberung noch sicherer zu werden? Nach diesen Rätseln forschte er Hunderte von Malen, wenn er im Dunkeln wach dalag. Es war für George Pendyce, dessen einfache Glaubensregel ›Leben und Genießen‹ hieß, und der an Entsagen nicht gewöhnt war, etwas Furchtbares um jenes stete Verlangen, das ihn nie verließ, das er, ebensowenig wie Essen und Trinken, zu entbehren vermochte, und von dem er nicht wußte, wann es enden würde. Er hatte Helen Bellew schon gekannt, als sie noch auf ›Die Föhren‹ lebte, war ihr bei den Jagden begegnet, aber seine Leidenschaft datierte erst von dem letzten Sommer. Sie war ganz plötzlich emporgeflammt aus einem Flirt, der beim Tanz begonnen hatte.
Ein Lebemann macht keine psychologischen Studien an sich selbst; er fügt sich in sein Schicksal mit rührender Selbstverständlichkeit. Hat er Hunger, so muß er essen, ist er durstig, muß er trinken. Weshalb er Hunger hat, wann ihm der Hunger gekommen ist, dem nachzuforschen liegt ihm ganz fern. Keine ethische Betrachtung der Dinge verwirrte ihn; eine verheiratete Frau, die nicht mit ihrem Gatten lebte, zu erobern, stand nicht im Widerspruch mit seinen Moralanschauungen. Was nachher kommen sollte, überließ er der Zukunft, mochte sie auch noch so viele unangenehme Möglichkeiten bergen. Was ihn wirklich beunruhigte, lag viel näher; das war die viel ursprünglichere und einfachere Empfindung, in einem Strom zu treiben, der so stark war, daß er ihn mit sich fortzureißen drohte.
»Ah, ja, die Sache steht schlimm. Gräßlich peinliche Sache für die Sweetenhams! Der junge Mensch mußte den Abschied nehmen. Was mag sich der alte Sweetenham gedacht haben? Er hätte doch wissen müssen, daß sein Sohn sich da bös verrannt hatte. Mir scheint, Bethany selbst war der einzige, der nichts bemerkt hat. Zweifellos ist Lady Rose zu verurteilen!« Mr. Pendyce war es, der dies sprach.
Mrs. Bellew lächelte.
»Meine Sympathie ist ganz und gar auf Lady Roses Seite. Was denken Sie, George?«
George runzelte die Stirn.
»Ich habe Bethany immer für einen Esel gehalten«, war seine Antwort.
»George hat keine Moral«, meinte Mr. Pendyce. »All unsere jungen Leute haben keine Moral. Ich bemerke das mehr und mehr. Sie haben die Jagd ganz und gar aufgegeben, wie ich höre, meine Gnädige?«
Mrs. Bellew seufzte.
»Wie soll man jagen, wenn man fast nichts hat?«
»Ah ja, Sie leben in London! London wirkt verderblich. Die Menschen haben da nicht mehr das Interesse für Jagd und Landwirtschaft wie früher. Ich kann George nicht zu uns aufs Land herausbekommen. Nicht etwa, daß ich ein Muttersöhnchen aus ihm machen will. Junge Leute sollen sich austoben.«
Nachdem er so die Naturgesetze anerkannt, griff der Gutsherr wieder zu Messer und Gabel.
Aber weder Mrs. Bellew noch George folgten seinem Beispiel; die schöne Frau saß da, die Augen auf ihren Teller gesenkt, mit der leisen Spur eines Lächelns um die Lippen. George lächelte nicht, und seine Augen, in denen ein tiefes, ungestümes Begehren lag, wanderten von seinem Vater zu Mrs. Bellew und von Mrs. Bellew zu seiner Mutter. Und als ob über alle diese Gesichter, Blumen und Früchte hinweg ein unsichtbarer Strom zu ihm hinüberführte, nickte Mrs. Pendyce ihrem Sohne leise zu.
Zweites Kapitel
Die Jagd
An der Spitze der Frühstückstafel saß, aufmerksam mit dem Essen beschäftigt, Mr. Pendyce. Er verhielt sich ziemlich schweigsam, wie es sich für einen Mann, der eben das Familiengebet gesprochen hat, geziemte; aber dieses Schweigen und der Stoß halboffener Briefe zu seiner Rechten hatten etwas Autokratisches.
›Bitte, ganz zwanglos; tut, was euch beliebt, kleidet euch, wie euch beliebt; sitzet, wo ihr wollt, esset und trinkt, was ihr mögt – aber –‹ jeder Blick seiner Augen, jeder Satz seiner wortkargen, nicht allzu heiteren Unterhaltung schien jenes ›aber‹ zu wiederholen.
Am Ende des Frühstückstisches saß Mrs. Pendyce hinter einer silbernen Kanne, der ein feiner Dampf entstieg. Ihre Hände machten sich unablässig mit den Tassen zu schaffen, indes ihre Lippen ebenso unablässig leise Worte sprachen, die sich aber nie auf sie selbst bezogen. Ein wenig zur Seite geschoben und unbeachtet lag ein Stück trockenen Toasts auf einem kleinen, weißen Teller. Zweimal nahm sie es zur Hand, bestrich ein wenig davon mit Butter und legte es wieder hin. Einen Augenblick gönnte sie sich Ruhe, und ihre Augen, die sich auf Mrs. Bellew geheftet hatten, schienen zu sagen: ›Wie bildhübsch Sie aussehen, Liebste!‹ Dann wurde sie, die Zuckerzange aufnehmend, wieder geschäftig.
Auf der langen, weißgedeckten Anrichte gab es eine ganze Anzahl von Gerichten, die man nur dort findet, wo man die Tiere für den eigenen Küchenbedarf heranzüchten kann. An dem einen Ende dieser Reihe von Fleischspeisen stand eine große Wildpastete, aus deren Teigrand kunstgerecht ein Dreieck herausgeschnitten war; an der andern Seite lagen auf zwei ovalen Schüsseln vier kalte Rebhühner in verschiedenen Stadien der Zerstörung. Hinter ihnen stand ein Korb aus durchbrochenem Silber mit drei blauen und einer gelben Weintraube und einer silbernen Traubenschere, die, weil sie stumpf war, nie benutzt wurde. Aber sie gehörte zum Silberschatz der Totteridge und trug deren Familienwappen.
Im Zimmer war keinerlei Bedienung zu sehen; nur von Zeit zu Zeit öffnete sich eine Seitentür, und irgend etwas wurde hereingebracht – was die Annahme nahelegte, daß hinter der Tür Dienerschaft bereitstand, die nur darauf wartete, hereingerufen zu werden. Man konnte tatsächlich glauben, der Hausherr hätte erklärt: ›Zwar könnten Ihnen ein Butler und zwei Diener die Speisen servieren, aber Sie sind hier in einem einfachen Gutshaus!‹
Ab und zu erhob sich einer der männlichen Gäste mit einer Serviette in der Hand und fragte eine Dame: »Darf ich Ihnen irgend etwas vom Büfett holen?« Wurde gedankt, dann ging er dennoch hin, um seinen eigenen Teller zu füllen. Drei Hunde, zwei Foxterriers und ein altersschwacher Skyeterrier, gingen unruhig im Kreise umher und beschnüffelten die Servietten der Fremden. Aus der lebhaft geführten Unterhaltung klangen dann und wann einzelne Sätze heraus: »Famoser Stand das, am Walde! Erinnern Sie sich, Jerry, wie im vergangenen Jahr die Schnepfe vor Ihnen aufstieg?« »Und der gute alte Herr traf nicht einmal daneben! Haben Sie etwas geschossen?« »Dick-Dick! Bist ein gutes Tier – komm her, zeig, was du kannst!« »Nicht anrühren! So – darfst's nehmen!« – »Ist er nicht famos?«
Zu Mr. Pendyces Füßen oder neben seinem Stuhl, von wo aus er übersehen konnte, was es auf dem Tische gab, saß der Spaniel John, und von Zeit zu Zeit rief der Hausherr, ihm irgend etwas hinhaltend:
»John! – Greifen Sie nur tüchtig zu, Sir James; ich behaupte immer, ein Mensch, der nicht genügend gefrühstückt hat, ist zu nichts zu gebrauchen!«
Und Mrs. Pendyce blickte dann mit hochgezogenen Brauen forschend über den Tisch hin, indem sie leise fragte:
»Noch eine Tasse? Bitte, geben Sie! Zucker gefällig?«
Nachdem alle fertig waren, entstand ein Schweigen, gleichsam als ob jeder empfände, daß er sich einer unwürdigen Beschäftigung hingegeben. Als er die letzte Beere gegessen hatte, wischte sich Mr. Pendyce den Mund und erklärte:
»Sie haben noch eine Viertelstunde Zeit, meine Herren! Um viertel nach Zehn brechen wir auf.«
Mrs. Pendyce, die mit einem unbestimmten, ironischen Lächeln auf den Lippen am Tische sitzengeblieben war, aß ein Stückchen von ihrem gestrichenen Toast, das schon trocken und ledern geworden war, gab das übrige den ›lieben Hunden‹ und sagte:
»George! Du mußt eine neue Jagdkrawatte haben, mein Junge! Deine grüne da ist ganz verschossen. Ich wollte schon immer ein paar Seidenreste aus der Stadt mitbringen. Hast du heute morgen schon gehört, was dein Pferd macht?«
»Ja – Blacksmith sagt, es ist in bester Form.«
»Ich rechne so bestimmt darauf, daß er dir das Rennen macht. Dein Onkel Hubert hat einmal viertausend Pfund beim Rutlandshire verloren. Ich erinnere mich noch ganz deutlich; mein Vater mußte sie damals bezahlen. Ich bin so froh, daß du nicht wettest, mein Junge!«
»Aber, liebe Mutter, ich wette doch!«
»Ach, George, dann hoffentlich nicht hoch! Sag es nur ja nicht dem Vater; er ist wie alle Pendyces: nur nichts riskieren!«
»Beabsichtige ich auch gar nicht, liebe Mutter; aber ich riskiere ja gar nichts und kann doch einen Haufen Geld gewinnen.«
»Aber, George, ist das in Ordnung?«
»Freilich ist's absolut in Ordnung!«
»So; na, ich verstehe nichts davon.« Mrs. Pendyce senkte die Augen; eine leise Röte stieg in ihr bleiches Gesicht. Dann sah sie zu ihm auf und sagte hastig: »George, ich möchte eine ganze Kleinigkeit auf dein Pferd setzen – aber richtig setzen – sagen wir einen Sovereign.«
George Pendyces gesellschaftliche Grundsätze erlaubten ihm nicht, gerührt zu erscheinen. Er lächelte.
»Gut, Mutter; ich werde für dich setzen. Es wird etwa acht zu eins geben.«
»Heißt das, ich bekomme, wenn er gewinnt, acht Sovereigns?«
George nickte.
Mrs. Pendyce blickte versonnen auf seine Krawatte.
»Ich denke, du könntest auch zwei Sovereigns für mich setzen, einer ist ja gar nichts; und ich rechne so fest darauf, daß er gewinnt. Ist Helen Bellew heute nicht entzückend? Es hat etwas so Erfreuliches, wenn eine Frau früh morgens am schönsten ist.«
George wandte sich ab, um zu verbergen, daß er rot wurde.
»Ja, sie sieht wirklich sehr frisch aus.«
Mrs. Pendyce blickte ihn an; in der einen ihrer hochgezogenen Brauen lag ganz leiser Spott.
»Ich will dich nicht aufhalten, mein Junge; du kommst zu spät zum Aufbruch.«
Mr. Pendyce, ein Jäger der alten Schule, der aller Mode zum Trotz noch Pointers hielt, obgleich er sie nicht mehr gebrauchen konnte, widersetzte sich der Benutzung von zwei Flinten.
›Jeder, dem daran liegt, in Worsted Skeynes auf Jagd zu gehen‹ pflegte er zu sagen, ›muß mit einer Flinte auskommen, wie es auch mein guter, alter Vater vor mir getan hat. Er wird gute Beute machen – Scharrvögel gibt's bei uns nicht‹ – (er ließ seine Fasanen nicht fett werden, damit sie höher steigen konnten) – ›aber Treibjagden soll er bei mir nicht erwarten – die sind einfach ein Abschlachten!‹
Er hatte eine besondere Vorliebe für Vögel – sie waren sozusagen sein ›Steckenpferd‹, und seine Glaskasten bargen eine erstaunlich große Sammlung jener Spezies, die in Gefahr waren, auszusterben. Indem er die Tiere so konservierte, glaubte er ihnen etwas Gutes zu tun, da er ja gewissermaßen damit vor einer Welt für sie eintrat, die bald keine Gelegenheit mehr haben würde, sie in lebendem Zustande zu sehen. Es war übrigens sein Wunsch, daß diese Sammlung ein unzertrennlicher Teil des ganzen Besitztums werden und mit ihm auf seinen Sohn und danach auf seines Sohnes Sohn übergehen sollte.
›Sehen Sie sich mal diesen Dartfordschläger an‹, pflegte er zu sagen, ›prächtiges Tierchen – wird mit jedem Tag seltener. Ich hatte die größte Mühe, mir diese Rarität zu verschaffen. Sie würden mir's nicht glauben, wenn ich Ihnen sagte, was ich dafür gezahlt habe.‹
Einige seiner seltensten Exemplare hatte er selbst geschossen, und zwar auf Jagdexpeditionen, die er eigens zu diesem Zwecke unternommen hatte; die weitaus meisten aber hatte er durch Kauf erwerben müssen. In seiner Bibliothek fanden sich ganze Reihen wohlgeordneter Bände, die sich auf diesen fesselnden Gegenstand bezogen; und seine Sammlung von Eiern seltener, fast gänzlich ausgestorbener Vogelarten war eine der schönsten in den ›drei Königreichen‹. Ein Ei pflegte er mit ganz besonderem Stolze zu zeigen als das letzte, das überhaupt von dieser eigenartigen Vogelart zu haben war. »Bekommen habe ich es«, erklärte er dabei, »von meinem guten alten schottischen Jagdgenossen Angus, der es dem Vogel direkt aus dem Nest genommen hat. Es war nur dieses eine darin. Diese Spezies ist jetzt ausgestorben«, fügte er hinzu, indem er das zarte, porzellanartige Oval liebevoll mit seiner braunen, von ganz feinen, dunklen Härchen bedeckten Hand umfaßt hielt. Er war ein echter und rechter Vogelliebhaber, verurteilte die Sonntagsjäger oder jene rohen, unbedachten Personen, die, ohne selbst eine Sammlung zu haben, mutwillig aus bloßem Unverstand Königsfischer oder sonst irgendwelche seltenen Vogelarten vernichteten. ›Diese Menschen müßten ausgepeitscht werden‹, pflegte er zu sagen; denn er war der Ansicht, daß kein solcher Vogel getötet werden durfte, ausgenommen, es geschähe zu einem besonderen Zweck und in einem fernen Lande. Es war bezeichnend für die Wesensart von Mr. Pendyce und seine ganze Anschauungsweise, daß, sobald ein seltener, gefiederter Gast auf seinem eigenen Gebiet erschien, man von diesem wie von einem Ereignis sprach und ihn mit der größten Vorsicht am Leben erhielt, weil man hoffte, daß er vielleicht hecken und den Vogelbestand des Gutes mehren würde. War es aber bekannt, daß er zu Mr. Fullers oder Lord Quarrymans Gebiet gehörte, deren Güter an Worsted Skeynes grenzten, und bestand unmittelbare und ernste Gefahr, daß er zurückfliegen könnte, so fiel er der Flinte anheim und wurde ausgestopft, um der Nachwelt erhalten zu bleiben. Eine Begegnung mit einem andern Grundbesitzer, welcher derselben Liebhaberei huldigte – es gab deren mehrere in der Umgegend –, raubte Mr. Pendyce gewöhnlich für eine Woche lang die Ruhe, verstimmte ihn und bewog ihn, sofort seine Bemühungen zu verdoppeln, um seine eigene Sammlung durch ein ganz besonders seltenes Stück zu vermehren.
Seine Anordnungen für die Jagd waren sorgsam durchdacht. Kleine Streifen Papier, auf denen die Namen der einzelnen Schützen geschrieben standen, wurden in einen Hut getan und nacheinander wieder herausgezogen, was der Hausherr stets selbst besorgte. Hinter dem rechten Flügel des Hauses hielt er nochmals Revue ab über die Treiber, die an ihm vorbei zum Hof hinaus ziehen mußten, jeder mit einem langen Stecken in der Hand und einem blöden Ausdruck im Gesicht. Noch fünf Minuten Anweisungen für den Forstwart, und dann brachen die Schützen zum ersten Treiben auf, jeder mit seiner Waffe und einem ausreichenden Vorrat an Patronen versehen.
Leuchtender Nebel hing über dem Gras, da die Sonne den schweren Tau hinwegtrocknete; Drosseln hüpften und liefen und suchten ihr Versteck; Krähen krächzten friedlich in den alten Ulmen. Bei einer Biegung fuhr der nach Mr. Pendyces eigenen Angaben hergestellte Wildwagen, von einem langmähnigen Pferd gezogen, das ein alter Mann lenkte, gemächlich seinen Weg zum Sammelplatz nach dem ersten Treiben.
George blieb, die Hände tief in den Hosentaschen, ein Stück zurück, um die Wonne des frischen, stillen Morgens zu genießen, die sanften, fröhlich-hellen Vogellaute, diesen Chor der Waldeswelt. Der Duft der Wiesen stieg zu ihm auf, und er dachte:
›Was für ein famoser Tag zur Jagd!‹
Der Gutsherr, in einem Anzug, dessen Farbe so gewählt war, daß kein Wild ihn bemerken konnte, mit Ledergamaschen und einer Stoffmütze mit Luftlöchern – seine eigene Erfindung – bekleidet, holte seinen Sohn ein; und auch der Spaniel John, der für die Vogelsammlung eine fast ebenso große Leidenschaft besaß wie sein Herr, kam heran.
»Du stehst am äußersten Flügel, George«, meinte Mr. Pendyce, »bei dir werden die Vögel hoch sein.«
George trat von einem Fuß auf den andern und pustete ein Stäubchen von seinem Flintenlauf, und der Geruch des Öls rief eine sonderbare wohlige Unruhe in ihm hervor. Alles andere, selbst Helen Bellew war vergessen. Da erhob sich aus der Stille ganz von fern ein Geräusch; ein Fasanhähnchen tauchte in ziemlich flachem Fluge, das Gefieder in der Sonne wie Seide leuchtend, aus dem grün-goldnen Buschwerk auf, machte eine Wendung nach rechts und verlor sich im Unterholz. In beträchtlicher Höhe zog ein Flug Tauben vorüber. Das Tack-Tack der Stöcke, die gegen die Bäume schlugen, begann; da plötzlich schoß raschelnd ein Fasan auf. George riß die Flinte an die Backe und drückte ab. Der Vogel schien plötzlich in der Luft still zu stehen, tat einen Stoß vorwärts und stürzte mit einem Klatsch jäh ins Gras. Der tote Vogel lag da im Sonnenschein, und ein sieghaftes Schmunzeln spielte um Georges Lippen. Er empfand die ganze Freude des Daseins.
Der Gutsherr hatte die Gewohnheit, während der Jagd seine Eindrücke in einer Art geistigen Merkbuches niederzulegen. Er kreidete diejenigen an, die einen Vogel verfehlten oder nicht in den Kopf trafen, oder die ihn mit dem Blei so zerfetzten, daß er keinen Marktwert mehr hatte. Auch diejenigen wurden vermerkt, die einen Hasen etwa nur in den Lauf schossen, so daß man das arme Vieh schreien hören konnte wie ein gemartertes Kind; ebenso alle, die, ruhmbegierig, tote Tiere, die sie nicht selbst geschossen hatten, ihrer eigenen Beute zuzählten, oder die mit Vorliebe dem Nachbar das Wild vor der Nase wegknallten, oder die Treiber gar zu oft ins Bein trafen. Gegen diese Tatsachen wog er jedoch unbewußt nicht wegzuleugnende soziale Gesichtspunkte ab, als da etwa waren: Der Titel von Winlows Vater, Sir James Maldens Gehege, die demnächst auch abgeschossen werden mußten; Thomas Brandwhites Stellung in der Finanzwelt; General Pendyces nahe verwandtschaftliche Beziehungen zu ihm selbst; und die hohe Bedeutung der Englischen Kirche. Nur Foxleigh gegenüber hatte er keine Milderungsgründe nötig. Der Bursche knallte einfach ausnahmslos alles nieder, was in seinen Bereich kam – und vielleicht war es gut so, denn Foxleigh besaß weder Titel noch Jagden, weder eine finanzielle Stellung noch ein Kirchenamt! Und bei dem Gutsherrn sprach noch ein Moment mit: Die Freude, allen seinen Gästen eine gute Jagd zu bieten, denn sein Herz war gütig.
Die Sonne war hinter dem Gehölz niedergegangen, als die Schützen sich zum letzten Treiben des Tages versammelt hatten. Aus dem Häuschen des Forstwarts in der Talsenkung, wo spätes Rot in dem braunen Gewirr von wildem Wein hing, stieg, durch den Wald emporgetrieben, ein Nebel von Holzrauch auf. Kein Ton war vernehmbar, nur ein leises Regen in der Luft, entfernte, weit entfernte Menschen- und Tierlaute, wie sie nie ganz verstummen an einem Abend auf dem Lande. Hoch über dem Wald kreisten noch ein paar aufgescheuchte Tauben, sonst war nichts Lebendiges zu sehen; aber ein Streifen Sonnenlichtes stahl sich schräg über das Jagdgehege und breitete seinen Glanz über die am Boden liegenden Blätter, bis der ganze Wald in Zauberglut zu erbeben schien. Aus diesem glühenden Walde hatte sich ein verwundetes Kaninchen geflüchtet, das am Sterben war. Am Abhang eines Grashügels lag es auf der Seite, die Hinterfüße eingezogen, die Vorderläufe wie die Hände eines betenden Kindes. Regungslos wie tot lag es da; alles, was noch von Leben in ihm war, drängte sich in seine schwarzen, sanften Augen. Klaglos, folgsam, willenlos kehrte es mit seinen sanften, umherirrenden Augen zurück zur Mutter Erde. Auch Foxleigh mußte dahin eines Tages gehen, aber er mit der Frage an die Natur, weshalb sie ihn getötet habe.
Drittes Kapitel
Die frohe Stunde
Es war die Stunde zwischen Tee und Abendessen, da der Geist des Herrenhauses, im Bewußtsein eines guten Gewissens, im Halbschlummer ruhte.
Nachdem er gebadet und sich umgekleidet hatte, ging George Pendyce mit seinem Wettbuch ins Rauchzimmer. In einer Ecke, in der er durch einen hohen Wandschirm aus gepreßtem Leder vor Zug und Belästigung geschützt war, ließ er sich in einem Lehnstuhl nieder und verfiel in leisen Schlaf.
Wie er dasaß, die Beine gekreuzt, das Kinn in die Hand gestützt, die geschmeidige Gestalt lässig gestreckt, ging ein leiser Wohlgeruch von Seife von ihm aus, als ob in dieser vollkommenen Ruhe seine Seele ihren natürlichen Duft ausatmete. Seine Phantasie, die an der Grenze des Traumlandes angelangt war, durchbebten leise Regungen von Heldentum und kühnem Streben – der Ausklang von körperlichem Wohlbehagen nach einem langen Tag im Freien, des Gefühls, geborgen zu sein vor allem, was unangenehm und gefahrdrohend ist. Stimmen weckten ihn.
»George ist kein schlechter Schütze!«
»Hat sich beim letzten Anstand unerhört blamiert; Mrs. Bellew stand bei ihm. Wie Rauch zogen sie über ihm her; er konnte ihnen nicht einmal mit einem Streifschuß beikommen.«
Das war Winlows Stimme. Nach kurzem Schweigen ließ sich Thomas Brandwhite vernehmen.
»Es ist verkehrt, die Damen teilnehmen zu lassen an der Jagd. Ich tue es nie. Was meinen Sie, Sir James?«
»Falsches Prinzip – ganz falsch!«
Darauf ein Lachen – Brandwhite lachte – das Lachen eines Menschen, der seiner selbst nie ganz sicher ist.
»Dieser Bellew ist ein toller Kerl. Er heißt hier in der Gegend der Desperado. Säuft wie ein Loch und reitet wie der Deibel. Sie trieb's damit auch ziemlich wild. Ich habe die Beobachtung gemacht, daß in einer jagdliebenden Gegend immer so ein Paar existiert. Haben Sie ihn mal gesehen? 'n hagerer, hochschulteriger Bursch mit 'nem bleichen Gesicht, kleinen, dunklen Augen und rotem Schnurrbart.«
»Ist sie noch jung?«
»Dreißig oder zweiunddreißig.«
»Wie kam es, daß sie auseinandergingen?«
Man hörte das Anstreichen eines Zündholzes.
»Sie kennen ja die Redensart vom Kessel, der ebenso schwarz ist wie der Topf.«
»Man merkt, sie läßt sich gern bewundern. Diese Eitelkeit hat schon manche Frau zugrunde gerichtet!«
Winlows gleichmütige Stimme wurde wieder vernehmbar.
»Sie hatten, glaube ich, ein Kind, das dann starb. Und danach – hm – da gab's irgendeine Affäre, soviel ich weiß, aber man ist nie ganz dahinter gekommen. Bellew mußte infolgedessen den Abschied nehmen. Sie ist schlechter Laune, wenn sie nichts Aufregendes erlebt, erzählt man; läuft gern auf dünnem Eis, muß immer einen haben, der hinter ihr herläuft. Wenn der arme Teufel schwerer ist als sie, plumps, bricht er ein.«
»Schlägt nach ihrem Vater. Ich habe den alten Cheriton im Klub gekannt – einer von der alten Sorte von Landedelleuten; heiratete mit sechzig seine zweite Frau und begrub sie mit achtzig. Den alten ›Sekt und Piquet‹ nannten sie ihn; hatte mehr uneheliche Kinder als irgendeiner in Devonshire. Ich sah, wie er Points von einer halben Krone setzte in der Woche, ehe er starb. Da liegt's im Blut. Was wiegt George? – hahaha!«
»Da gibt's wirklich nichts zu lachen. Brandwhite! Wir können noch eine Partie machen bis zum Dinner, wenn Sie spielen wollen, hm, Winlow?«
Stühle wurden gerückt, Fußtritte scharrten, und eine Tür fiel ins Schloß. George war wieder allein; ein kleiner, roter Fleck brannte ihm auf jeder Wange. Vorbei waren jene leisen Regungen von Heldentum und kühnem Streben, vorbei jene Empfindung ehrlich verdienten Wohlbehagens. Er erhob sich, verließ seinen stillen Winkel und schritt auf dem Tigerfell vor dem Kamin hin und her. Dann zündete er sich eine Zigarette an, warf sie fort und zündete eine frische an.
›Auf dünnem Eis laufen!‹ Das sollte ihn nicht zurückhalten! Ihr Geschwätz sollte ihn nicht zurückhalten, auch nicht ihr Höhnen; es würde ihn nur um so rascher vorwärts treiben.
Er warf die zweite Zigarette fort. Es geschah sonst nicht, daß er um diese Stunde des Tages den Salon betrat; aber heute ging er hinüber.
Als er leise die Tür öffnete, sah er den langgestreckten, behaglichen Raum von großen Petroleumlampen erhellt. Mrs. Bellew saß am Klavier und sang. Die Teetassen standen noch auf einem Tisch am andern Ende des Zimmers; aber man war fertig. So weit wie möglich von den andern entfernt, im Erker, spielten General Pendyce und Bé Schach. Mitten im Zimmer saßen, nahe einer der großen Lampen, Lady Malden, Mrs. Winlow und Mrs. Brandwhite beieinander, ihre Gesichter dem Klavier zugewandt. Und auf all diesen Gesichtern lag ein leiser Unwille oder ein Staunen, etwa wie: ›Wir haben uns eben über so interessante Dinge unterhalten; es war nicht recht, uns zu stören.‹
Vor dem Kamin stand mit gespreizten Beinen Gerald Pendyce. Ein wenig abseits, die dunklen Augen auf die Sängerin geheftet, saß mit einer Stickerei im Schoß die Frau des Hauses, und auf ihrem Kleidersaum lag Roy, der alte Skyeterrier.
»Hätt' ich gewußt, ehe ich geküßt, Daß Liebe so falsch und flüchtig ist, Mit silbernem Schloß in güldnen Schrein Hätt' ich mein Herz geschlossen ein. O wehe, wehe! Lieb' und Treu' Sind nur gut, solang sie neu. Doch wenn sie alt geworden und grau, Vergeht die Lieb' wie Morgentau.«
Das war das Lied, das George beim Eintreten hörte, und es klang bebend und ersterbend zu Ende mit den letzten Akkorden des schönen Flügels, der ein wenig verstimmt war.
Er starrte die Sängerin an, und obgleich er nicht musikalisch war, kam doch ein Ausdruck in seine Augen, den er hastig zu verbergen suchte.
In der Mitte des Zimmers ließ sich ein leises Gemurmel vernehmen, und vom Kamin her rief Gerald hinüber: »Schönsten Dank! Das war famos!«
Aus dem Erker hörte man die Stimme von General Pendyce: »Schach!«
Mrs. Pendyce nahm ihre Stickerei, auf die eine Träne getropft war, wieder zur Hand und sagte leise:
»Ich danke Ihnen, Liebste; das war wunderschön!«