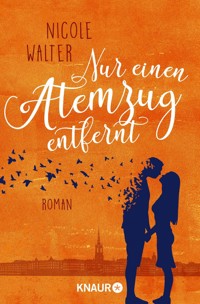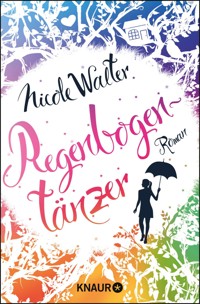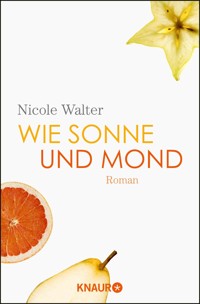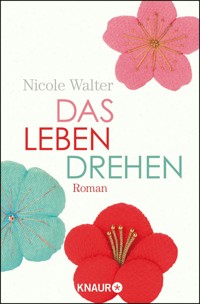
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich bitte Sie um Ihren Mann. Nicht für lange, weil … ich muss sterben.« Dieser Satz und die Begegnung mit der ungewöhnlichen Amelie stellen Marlenes Leben von einem Tag auf den anderen auf den Kopf. War sie, die erfolgreiche Ärztin, nicht eben noch glücklich verheiratet? Mit Markus, ihrem Markus? Und wer ist diese bezaubernde Frau, die sich in ihr Leben gedrängt hat? Marlene, Ärztin aus Leidenschaft, fasst einen Entschluss. Sie wird nicht zulassen, dass Amelie stirbt, wird ihr helfen, die Krankheit zu besiegen. Doch da ahnt sie noch nicht, dass sie ausgerechnet von ihrer Rivalin mehr über das Leben lernen wird, als sie je vermutet hat. Und das, was Amelie in ihr bewegt, lässt sich nicht mehr zurückdrehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Nicole Walter
Das Leben drehen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Amelie ist eine etwas verrückte, aber liebenswerte Hutmacherin, die sich beharrlich weigert, mit dem Strom zu schwimmen.
Marlene dagegen ist Ärztin und kämpft tagtäglich engagiert um das Leben ihrer Patienten. Ihre Ehe mit dem Fotografen Markus ist scheinbar gut, nur ein wenig in die Jahre gekommen. Und nun steht da diese Frau vor ihr und verlangt schier Unmögliches von ihr:
Ich bitte Sie um Ihren Mann, nicht für lange, weil… ich muss sterben.«
Zuerst ist Marlene fassungslos, doch dann lässt sie sich auf die quirlige und lebensfrohe Amelie ein – und auf eine Freundschaft, die ihr ganzes Leben verändert.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Quellenangaben
Mein Dank gilt
Für meine Mutter Edith Walter
und meinen Partner im Leben Manfred Lingen
Um in dieser Welt zu leben,
muss man fähig sein,
drei Dinge zu tun:
lieben, was sterblich ist;
es mit aller Kraft festhalten,
wissend, dass das eigene Leben davon abhängt;
und wenn die Zeit kommt, es loszulassen,
loslassen
Mary Oliver
1
Auf einmal waren sie da, die ersten Schneeglöckchen. Endlich wieder Leben nach einem viel zu langen Winter. Über Nacht hatten sich im November Bäume, Büsche, Straßenlaternen, Fahrräder, die man vor der Tür vergessen hatte, in zu Weiß erstarrte Skulpturen verwandelt. Der Schnee türmte sich neben den Straßen und in den Vorgärten auf, schob sich auf einen zu, grub einen ein, bis man an ihm zu ersticken glaubte. Achtzehn Wochen Stillstand, Stille.
Marlene hasste den Winter. Ihre Mutter war im Winter gestorben. Sie war damals acht gewesen, und wenn sie heute daran dachte, sah sie nicht nur ihre Mutter – so gebrechlich, dass sie sich in ihrem eigenen Schatten aufzulösen schien –, sie sah diese Tür. Diese Tür, die vor ihr ins Schloss fiel und den Weg zu ihrer Mutter versperrte. Für immer. Seither hasste sie nicht nur den Winter, sondern auch geschlossene Türen.
Doch jetzt war es schon fast März, der Winter war vorüber – hoffentlich endgültig –, in der Luft lag neben dem unentwegten Summen des Großstadtverkehrs dieses Flüstern – Frühling, Frühling –, und der Himmel war wie die Glaskugel, die ihr der Vater von einer Reise in den Orient mitgebracht hatte und von der es hieß, dass sie böse Geister vertrieb. Man kniff ein Auge zu und verlor sich mit dem anderen in einem Labyrinth aus Blautönen. Aber nur für einen Augenblick. Dann trat Marlene wieder ein in die Parallelwelt des Krankenhauses, die einschloss und ausschloss von dem Leben draußen. In der nicht mehr zählte, was man eben noch hatte tun wollen. Die Zigarette, die man rauchen, die Frau, den Mann, das Kind, die man küssen, die Verabredung, die man unbedingt einhalten, den Einkauf, den man noch schnell erledigen, die S-Bahn, in die man einsteigen wollte. Vorbei. Manchmal nur für ein paar Tage oder Wochen, manchmal für immer.
Für Marlene, Ärztin auf der onkologischen Station eines Münchner Krankenhauses, war es der Tag der ersten Schneeglöckchen, an dem ihr altes Leben vorbei war und ihr neues begann. Am Morgen hatte sie die Schneeglöckchen entdeckt, gepflückt und in eine Vase auf ihren Schreibtisch gestellt. Jetzt war es Abend. Schräg einfallende Schatten. Die Hektik des Tages war vorüber und die Motoren der medizinischen Maschinerie gedrosselt. Marlene legte die rechte Hand auf die Türklinke ihres Arztzimmers, dachte noch, dass sie schon längst ihren mit Kaffee und Blut gesprenkelten Arztkittel hätte wechseln sollen – »so viel zu Halbgöttin in Weiß« –, betrat das Arztzimmer und sah – einen Hut.
Keinen gewöhnlichen Hut. Eher ein Wagenrad in Rosarot, an das sich seitlich eine große Mohnblume klammerte, und mit einem weißen Schmetterling, der wie ein Satellit am Hinterkopf eines Außerirdischen wippte. Marlene wollte noch sagen: »Was machen Sie denn da?« Da drehte sich der Hut schon langsam zu ihr um.
Es gibt Menschen, von deren Gesicht man nicht genug bekommen kann. Das Gesicht der jungen Frau war ein solches. Außergewöhnlich. Vor allem die Augen. Groß, dunkel – vorwurfsvoll, als sie Marlene jetzt ansah und sagte: »Als Gott den Schnee erschaffen hat, hat er lange nicht gewusst, was er ihm für eine Farbe geben soll …«
»Wie bitte?« Marlene war irritiert. »Was wollen Sie?«
»… dann sind ihm die Blumen eingefallen«, fuhr die junge Frau fort. »Und er hat sie gebeten, etwas von ihrer Farbe abzugeben, doch alle Blumen lehnten ab.«
Die junge Frau mit dem schrecklichen Hut war nicht nur außergewöhnlich. Sie war höchst seltsam. Marlene strich über ihren schmutzigen Arztkittel: »Sie können nicht einfach so in mein Büro kommen.«
Die junge Frau antwortete nicht, nahm stattdessen die Schneeglöckchen aus der Vase. »Bis auf die Schneeglöckchen. Sie haben dem Schnee ihre Farbe geschenkt. Und so wurde der Schnee weiß, und das Schneeglöckchen ist die einzige Pflanze, der er nichts tut.« Versonnen betrachtete sie die Wassertropfen, die sich am Ende des Stengels bildeten. Tropfen, Tränen, dachte Marlene, ertappte sich dabei, rief sich zur Ordnung – sentimentaler Quatsch –, und in diesem Moment sah die junge Frau sie auch schon an: »Der Schnee tut den Schneeglöckchen nichts, aber der Mensch reißt sie aus der Erde. Wieso?«
Die junge Frau war nicht nur außergewöhnlich, seltsam. In Marlene stieg ein ungutes Gefühl auf. Sie war verrückt. »Schneeglöckchen geben Biowärme ab«, sagte sie kühl, »und die lässt den Schnee schmelzen, so einfach ist das.«
»Sie glauben nicht an Gott?«
»Ich hol den Sicherheitsdienst.« Mit einer schnellen Bewegung wandte sich Marlene zur Tür, doch da fuhr die junge Frau schon leise fort: »Ich heiße Amelie und bitte Sie um Ihren Mann. Nicht für lange. Weil …«, ein kurzes Zögern, »… weil ich sterben werde.«
Langsam drehte sich Marlene wieder zu ihr um. Ein Lächeln lag auf Amelies Gesicht, als sie weitersprach, als hätte sie das andere nie gesagt: »Wussten Sie, dass man Schneeglöckchen auch das hübsche Februarmädchen nennt? Sie sind das Symbol für Hoffnung.«
2
Marlene lief durch die Straßen. Das Flüstern in der Luft, der Glaskugelhimmel, die Schneeglöckchen, die Ahnung von Frühling, sie waren noch da, und trotzdem war von einer Sekunde zur anderen ganz plötzlich alles anders. Vor einem Schaufenster blieb sie stehen. Sie war noch immer fünfunddreißig, etwas zu dünn und etwas zu angestrengt, um wirklich hübsch zu sein. Das blonde Haar straff nach hinten gebunden, kaum Make-up und das wenige, das sie trug, verwischt und abgeblättert, Hemdbluse, Jeans, flache Schuhe, flacher Busen, Mantel. Amelie dagegen – sie war so … Als Marlene ein Kind war, hatte ihre Mutter ihr einmal ein Kleid aus Organza genäht. Amelie war wie dieser Stoff. Durchscheinend, schillernd, so fein, dass er leicht knitterte und beschädigt werden konnte. Das Kleid hatte ebenso wenig zu ihr gepasst, wie diese Amelie zu Markus passte.
Markus. Erst gestern hatten sie noch miteinander geschlafen. Nein, nicht nur miteinander geschlafen. Sie hatten sich ineinandergefügt wie zwei Hälften, die erst gemeinsam ein Ganzes bildeten. Und jetzt sollte sie sich von einer Sekunde zur anderen einreihen in die Schlange betrogener Ehefrauen? Nichts geahnt. Nichts gefühlt, komplett verarscht! Natürlich wusste sie um das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel auf ihrer Station. Ein Stationsarzt von der Inneren mit der OP-Schwester. Die Anästhesistin mit dem Chefarzt. Links herum, rechts herum und dann wieder von vorn. Aber doch nicht sie. Und nicht Markus.
»Ich heiße Amelie und bitte Sie um Ihren Mann. Nicht für lange. Ich werde sterben.«
»Sie lügen«, hatte Marlene geantwortet. Kühl. Von oben herab. Normalerweise war man im Vorteil, wenn man im Stehen auf eine Person hinuntersah, die saß. Aber da war dieser Hut, der die junge Frau schützte und Marlene verunsicherte. Denn unter dem Hut war es jetzt still. Sehr still. Dann nahm Amelie ihn ab. Keine breite Krempe mehr, die je nach Neigung des Kopfes das Gesicht verhüllte oder preisgab. Es war eine stumme Aufforderung an Marlene: Ich nehme den Hut, und du nimm deine Maske ab. Lass uns so sein, wie wir sind. Nackt und verletzlich. Einfach nur zwei Frauen, die denselben Mann lieben.
Marlene zog noch eine Maske über die Maske, bis ihr wahres Gesicht völlig dahinter verschwand. Amelie dagegen blieb so, wie sie war, schön, schutzlos – ehrlich. Und da wusste Marlene, noch ehe Amelie ihr die Fotos reichte, dass es keine Lüge gewesen war. Dass Markus dieser jungen Frau nicht hatte widerstehen können. Trotz der Spitzenbluse, die, wie Marlene erst jetzt sah, falsch geknöpft war, und dem weiten langen Rock, der aus der Mottenkugeltruhe ihrer Großmutter zu stammen schien. Amelie, ein Wesen zwischen den Zeiten.
Marlene nahm die Fotos nicht, warf aber einen Blick darauf. Amelie und Markus. Markus und Amelie. Amelie und Markus. Geknipst in irgendeinem Schnellautomaten am Bahnhof oder an einer U-Bahn-Haltestelle. Jetzt hatte Marlene noch ein anderes Bild vor Augen. Wie sie selbst Markus in so einen Schnellautomaten hatte ziehen wollen, sie war damals fünfundzwanzig und er dreißig, nur so zum Spaß, und wie er sich geweigert und fast getobt hatte: Was in Schnellautomaten geknipst werde, seien keine Fotos, das sei seelenloser Mist. Wenn sich der Mensch so sah, sei es kein Wunder, dass er mit Verbrechen an der Umwelt allmählich die eigene Lebensgrundlage zerstöre, um sich am Ende dadurch selbst zu zerstören. So, wie der Mensch auf einem Foto aus dem Schnellautomaten aussah, geschah es ihm recht, dass die Erde an ihm kaputtging, jawohl.
Markus neigte gelegentlich zur Übertreibung. Denn von einem Foto aus dem Schnellautomaten ging die Welt bestimmt nicht unter. Außer vielleicht ihre eigene. Jetzt. In diesem Augenblick. Markus!
Er war Fotograf. Ein engagierter, ein sehr guter Fotograf. Und dann schob sich, mit fast zynischer Lust, ein Wort in Marlenes Gedanken: »gewesen«. Markus war ein sehr guter Fotograf gewesen. Heute waren seine Fotos blutleer. Heute setzte er sich auch mit einer Verrückten in einen Schnellautomaten und grinste dämlich in den Auslöser.
»Ich weiß, Markus denkt nur an sich.« Amelie legte die Fotos auf den Schreibtisch. »Aber ich verspreche Ihnen, wenn er zu Ihnen zurückkommt, wird er zum ersten Mal auch an Sie denken.«
Marlene wusste nicht, was sie zuerst tun sollte: dieser Person sagen, wie anmaßend sie war, oder sie fragen, weshalb sie glaubte, sterben zu müssen, doch da fiel die Tür schon hinter Amelie zu. Marlene blieb zurück mit den Fotos, bekam keine Luft mehr, wie immer, wenn sich eine Tür vor ihr verschloss, riss die Tür wieder auf. Der Gang war leer. Amelie war verschwunden, und für einen Augenblick hatte Marlene das Gefühl, es habe sie nie gegeben. Aber da waren die Fotos auf ihrem Schreibtisch. Diese verdammten Fotos auf ihrem verdammten Schreibtisch! Und im selben Augenblick hatte Marlene eine unbestimmte Ahnung gehabt, die sie am liebsten sofort aus ihrem Kopf verbannt und in winzige Fetzen zerrissen hätte, aber sie blieb, und sie war hartnäckig: Nicht nur Markus, auch Marlene würde sich dem, was Amelie war, auf Dauer nicht entziehen können.
Noch stand Marlene vor dem Schaufenster, noch wollte sie sich nicht von ihm lösen. Solange sie ihr Spiegelbild sehen konnte, war sie nicht so allein inmitten ihrer Einsamkeit. Einer Einsamkeit, die sie nicht erst jetzt befiel. Sie war ein Teil von ihr. Ein Teil, der sich wie eine unsichtbare Wand zwischen sie und die anderen schob. Der es nicht zuließ, dass sie einem anderen Menschen wirklich nahekam. Auch nicht Markus.
Nicht Amelie hatte gelogen, Marlene hatte sich selbst belogen. Markus und sie hatten miteinander geschlafen, einfach nur miteinander geschlafen. Die beiden Hälften, die erst gemeinsam ein Ganzes bildeten, gab es schon lange nicht mehr.
»Völlig normal, nach zehn Jahren Ehe.« Marlene gehörte nicht zu den Frauen, die mit anderen Frauen über Sex und ihre Ehe redeten. Aber sie hörte zu, wenn andere Frauen über Sex und ihre Ehe redeten, die Krankenschwestern, die Kolleginnen, die Nachbarinnen auf dem Hausflur, die beiden Freundinnen in der S-Bahn. Rein, stöhnen, raus, seufzen, Kuss, umdrehen, schlafen. Fließbandliebe. Jeder Handgriff saß. Hauptsache, das Zeit-Leistungs-Verhältnis stimmte. Bei den anderen war es offenbar ebenso wie bei ihr und Markus. Sie musste sich also keine Gedanken machen. Nach einer ihrer 24-Stunden-Schichten wäre sie ohnehin nicht dazu in der Lage gewesen, weder zum Denken noch zu erotischen Turnübungen oder solidem Ausdauersex. Kurz und bündig musste es sein. Markus schien zufrieden. Schließlich hieß es, ein Orgasmus in regelmäßigen, nicht allzu langen Abständen verlängere das Leben eines Mannes. Und sie war beruhigt gewesen. Bis heute. Doch jetzt sehnte sie sich zum ersten Mal nach etwas, was sie bisher nicht vermisst hatte. Nach jemandem, mit dem sie reden konnte. Nach einer Freundin.
»Ich dachte immer, Schaufensterpuppen gehören hinters Schaufenster, nicht davor!«
Marlene drehte sich gelassen um und sah sich einem Mann gegenüber. Es ist schon seltsam, was ein Gehirn in einem Sekundenbruchteil registriert, obwohl es gar nicht damit beauftragt wurde: leicht italienischer Akzent. Nicht unattraktiv. Sportlich. Grübchen im Kinn. Nettes Lächeln. Mitte vierzig. Zu auffallende Krawatte. »Darf ich Sie zu einem Espresso einladen?« Angenehme Stimme. Warm und tief. Hat zu Hause bestimmt Frau und Kinder. Macht fremde Frauen an. Fremdgeher. Betrüger. Schweinehund!
Und in diesem Moment geschah etwas, wofür Marlene auch noch sehr viel später jede Verantwortung ablehnte.
Ihre rechte Hand hob sich. Im Zeitlupentempo. Marlene, dachte sie noch verwundert, was tust du da? Und im nächsten Augenblick hatte sie dem Mann schon eine kräftige Ohrfeige verpasst. Er war verblüfft. Sie war verblüfft. Dann sagte sie mitten in ihrer beider Verblüfftheit hinein: »Tut mir leid, die war eigentlich für meinen Mann bestimmt, aber der ist gerade leider nicht da.« Dachte noch, irgendwie schade, und ging mit schnellen Schritten davon.
Marlene hatte noch nie jemanden geschlagen. Sie hatte noch nie aus Wut eine Vase zerschmettert, nicht einmal gegen eine leere Colabüchse hatte sie jemals getreten. Nur einen kleinen Vogel in ihrer Hand erstickt, aber da war sie noch ein Kind gewesen. Jetzt war sie erwachsen, kontrolliert und beherrscht, ihre Gefühle waren geordnet wie die Wäsche in ihrem Schrank, exakt zusammengelegt, Kante auf Kante, in dem jeweils für sie bestimmten Fach. Bis zu jenem Tag, an dem Amelie anfing, ihre Spuren zu hinterlassen.
Amelie, verdammt! Warum hatte sie nicht einfach weiter mit Markus ins Bett gehen, den Mund halten und sterben können?
3
Draußen zog die Großstadt an Marlene vorbei. Oder das, was aus der S-Bahn von ihr zu sehen war. Abbruchhäuser, mit Graffiti besprühte Lagerhallen, ein Schrottplatz, viel Müll, abgestorbene Bäume und Büsche, ein sehr gepflegter Friedhof – Marlene schloss rasch die Augen, wie immer, wenn der Friedhof auftauchte, zählte bis fünf, machte sie wieder auf, der Friedhof war verschwunden – und wieder Schrott, ein abgestorbener Baum, Graffiti und Müll.
Sie überlegte, wie sie Markus begegnen sollte: kalkuliert überlegt oder kalkuliert emotional. Und dann hatte sie eine Idee: überhaupt nicht! Überhaupt nicht würde sie ihm begegnen, alles so wie immer. Niemand zwang sie, Markus auf etwas anzusprechen, was nichts weiter war als eine verrückte junge Frau in ihrem Arztzimmer und ein paar Fotos aus einem Schnellautomaten, die wer weiß wie entstanden sein konnten. Unwillkürlich hatte Marlene ein Bild vor Augen. Amelie, die mit dem Zeigefinger in der Jackentasche eine Waffe simulierte, Markus in die Kabine schubste und ihn so dazu zwang, mit ihr die Fotos zu machen. Marlene lachte auf, und ein kleines Mädchen mit Zahnlücke und Pferdeschwanz lächelte sie an. Marlene lächelte zurück und wunderte sich. Bisher hatte sie noch nie jemand in der S-Bahn angelächelt. Nun ja, sie hatte auch noch nie in der S-Bahn gelacht. O Gott, sie fühlte sich so verraten. Nicht, weil Markus mit Amelie im Bett, sondern weil er mit ihr in diesem Schnellautomaten gewesen war. Das kleine Zahnlückenmädchen sah die Hilflosigkeit in Marlenes Gesicht. Sein Lächeln erlosch, während draußen die ersten Lichter angingen.
Im Halbdunkel der anbrechenden Nacht floss die Großstadt weiter vorüber, und als Marlene an ihrer S-Bahn-Haltestelle ausstieg, erneut eingezwängt in einen Menschenstrom, hatte sie endgültig einen Entschluss gefasst. Sie würde Markus tatsächlich nichts von diesem seltsamen Besuch erzählen. Dinge wurden nur wahr, wenn man sich mit ihnen beschäftigte. Was man ignorierte, gab es auch nicht.
Die Wohnung, die sie vor drei Jahren gekauft hatten – drei Zimmer, Küche, Bad mit Badewanne, Bad mit Dusche, kein Abstellraum – lag in einer Neubaugegend. Junge Bäume brauchen Jahrzehnte, um erwachsen zu werden. Häuser wachsen über Nacht in den Himmel hinein. Zumindest schien es Marlene so, immer wenn ein neuer Kran vor einem Fenster auftauchte und ankündigte, dass sich der Horror fortsetzte, vor dem sie und Markus niemand gewarnt hatte. Beton statt Felder. Am liebsten hätte Marlene die Baufirma verklagt, aber Markus wollte keinen Ärger. Den suchte er offenbar lieber woanders. In einer kleinen Affäre mit dieser Amelie.
Marlene betrat die Wohnung, die sie mit viel Weiß eingerichtet hatte, als habe sie die Sterilität des Krankenhauses auch zu Hause fortsetzen wollen. Sie hasste den Winter, aber sie liebte seine Farbe. Weiß suggerierte: Mir wird nichts geschehen. Markus hätte bunt bevorzugt, aber Marlene hatte sich durchgesetzt, dafür hatte Markus bestimmt, welches Bad zur Dunkelkammer werden sollte. Da Markus wie fast alle Männer lieber duschte als badete, hatte er sich für das Badewannenbad entschieden. Marlene verzichtete auf ihr heißes Bad, und Markus hatte die Dunkelkammer in diesen drei Jahren nur ein einziges Mal genutzt. Er arbeitete jetzt digital. Bearbeitete seine Fotos am Computer. Doch an diesem Abend – war das rote Licht an.
Kaum hatte Marlene die Wohnungstür aufgesperrt, sprang es ihr schon entgegen. Betreten verboten! Marlene blieb stehen, war wie erstarrt und fühlte sich erneut verraten. Gleichzeitig zuckten die vielen Momente vor ihrem inneren Auge auf wie ein Blitzlichtgewitter, all diese besonderen Momente, in denen sie und Markus einander nah gewesen waren. Momente, in denen sich das, was gerade noch Fotopapier im Entwicklungsbad gewesen war, allmählich herausschälte zu einem Augenblick, der vor dem Vergessen bewahrt wurde. Die Hände des alten Mannes. Das kleine Mädchen, das schamhaft seinen Rock festhält, den der Wind bläht. Der Fensterrahmen, von dem schon die Farbe abblättert und den nur eines schmückt: der Wimpel von Bayern München. Da hatte Markus sie noch teilhaben lassen an seiner Arbeit und dem, was er auf seinen einsamen Streifzügen durch München sah. Inzwischen fotografierte er nur noch Belanglosigkeiten für irgendwelche Zeitungen.
»Schließlich müssen wir irgendwie die Raten für die Wohnung bezahlen, die übrigens deine Idee war und nicht meine«, rechtfertigte sich Markus nicht nur vor ihr, sondern vor allem vor sich selbst dafür, dass er sein Talent nicht mehr nutzte, um etwas Besonderes aus seinem Leben zu machen. Etwas Einzigartiges, so wie die Momente einzigartig gewesen waren, die er auf seinen Fotos festgehalten hatte. Und Marlene hatte sich schuldig gefühlt, weil Ärzte in Krankenhäusern nicht mehr so gut verdienten wie früher und sie nicht mit den anderen auf die Straße gegangen war, um für mehr Geld zu kämpfen. Sie hatte es einfach nicht fertiggebracht, ihre Patienten allein zu lassen, nur des Geldes wegen. Das hatte sie noch ein wenig mehr zur Außenseiterin gemacht, obwohl sie auf der Seite ihrer Kollegen war. Vielleicht hätte sie ihnen das einmal sagen sollen.
Und jetzt das rote Licht über der Dunkelkammer. Betreten verboten! Du bleibst draußen! Ausgeschlossen. Die Tür vor ihr verschlossen. Sie ist wieder acht Jahre alt und spürt diese Kälte. Weiße Wände, weiße Menschen. Hinter der Tür hört sie ihren Vater weinen. Angst. Und niemand, der ihre Hand hält. Mama!
Marlene fror, zog ihre Jacke enger um sich und sah nur dieses Licht, bis es in ihr war und um sie herum. Rot, Liebe, Leidenschaft, Erotik, Amelie. Sie war überzeugt: Amelie hatte etwas damit zu tun, dass Markus wieder fotografierte. Richtig fotografierte. Das spürte sie. Aber Rot steht nicht nur für Liebe und Leidenschaft, es erhöht auch den Blutdruck, macht aggressiv, im Mittelalter wurden die Todesurteile mit Rot unterschrieben. Rotes Licht, Todesurteil! Geschlossene Tür, Todesurteil! Etwas explodierte in ihr, spie das Rot wieder aus, bis alles nur noch rot war.
Rot. Blut. Blutgetränktes Laken. Ihr Vater, der eine Krankenschwester anfleht, es zu wechseln, und Marlene steht auf den Zehenspitzen und lugt durch den Türspalt. Sie weiß, sie darf das nicht. Aber sie ist ihrem Vater auf dem neuen Fahrrad ins Krankenhaus gefolgt. Sie ist neugierig, und sie sehnt sich nach ihrer Mutter, die schon so lange nicht mehr bei ihr zu Hause war. Sie sieht die Krankenschwester, die zu ihrem Vater sagt: »Ihre Frau wird sowieso in den nächsten Stunden sterben!« Eine kalte Frau. Kalt wie der Winter. Es ist Winter. Die Krankenschwester stößt die Tür weit auf, Marlene presst sich eng gegen die Wand, atmet nicht, und dann verlässt die Krankenschwester den Raum und ihre Mutter. »Ja, gehen Sie nur zu den Patienten, die Sie noch brauchen«, ruft ihr der Vater wütend nach. Er bemerkt nicht, dass Marlene weiter zwischen den Türangeln hindurchschielt und beobachtet, wie er nun selbst am Laken zieht und zerrt. Verzweifelt. Aufhört, als die Mutter zu wimmern beginnt. Noch verzweifelter ist. Offenbar tut ihr jede Berührung weh. Dazu diese vielen Schläuche, und dieser Bauch, der aussieht, als sei ein Baby darin. Aber es ist etwas anderes darin, etwas, was Marlene nicht versteht und was ihr Angst macht. Die Krankenschwester kommt mit einem frischen Laken zurück, will die Tür schließen und entdeckt Marlene. Klein. Schmal. Acht Jahre alt. Sie ist nicht mehr kalt, sondern voller Mitgefühl. Marlene will jedoch nur ihre Mutter, so wie sie gewesen ist. So lustig und so … Niemals wieder hat sie sich so beschützt gefühlt wie in ihren Armen. Eine andere Krankenschwester reicht ihr ein Stück Schokolade, und Marlene übergibt sich in ihren Schoß.
Auch jetzt war Marlene auf einmal übel. Da war sie wieder, diese Sehnsucht. Wenn Mütter sterben, stirbt mit ihnen die Kindheit. Auch wenn man erst acht Jahre alt ist. Und nicht nur die Kindheit, sondern auch ein Stück Leben.
Marlene schwankte leicht, lehnte sich mit der Stirn an die kühle Wand. Ruhig, ganz ruhig. Das tat gut. Sie war kein Kind mehr, das mit ansehen musste, wie hilflos sein Vater war. Sie war erwachsen. Diesmal würde sie nicht draußen bleiben, sie würde die Tür aufstoßen, auf Markus einschlagen, bis er sie in den Arm nahm, so wie sie es damals bei ihrem Vater hätte tun sollen. Dann würden sie und ihr Vater heute vielleicht noch miteinander reden, und sie würden wissen, was aus dem anderen in den letzten siebzehn Jahren geworden war. Er musste jetzt zweiundsiebzig sein. Erstaunlich. Sie hatte schon so lange nicht mehr an ihn gedacht …
Marlene fuhr sich über die Stirn, als wolle sie jeden Gedanken an ihn fortwischen, und war überrascht, als sie trotz der Abkühlung an der Wand noch Schweißperlen spürte. Auch die schüttelte sie ab. Sie wollte nicht sentimental sein, sie war erwachsen und wollte sich auch so benehmen. Sie würde sich beherrschen, ganz ruhig die grelle Deckenbeleuchtung einschalten und damit alles zerstören, woran Markus gearbeitet hatte. Vielleicht Tage. Vielleicht Wochen. Vielleicht sogar Monate. Was wusste sie noch von ihm? Was wusste er noch von ihr? Jetzt würde zumindest er sie kennenlernen. Auf eine Weise, von der er nicht einmal ahnte, dass sie so sein konnte. Sie übrigens auch nicht. Vor allem, als sie jetzt so etwas wie Genuss und Vorfreude fühlte.
Marlene holte tief Luft – eins, zwei, drei –, legte die Hand auf die Türklinke, bereitete noch ihren Satz vor: »Oh, tut mir leid, ich hab das rote Licht gar nicht gesehen«, drückte die Türklinke herunter, das rote Licht ging aus, und Markus stand vor ihr. Etwas erstaunt, noch etwas abwesend.
»Du bist schon da?«
»Ja!«
Marlene war zutiefst enttäuscht. Offenbar gab es eine unsichtbare Macht, die manche Menschen zwang, gut zu sein.
»Natürlich, du hast ja gesagt, dass du heute früher kommst. Die Pizza ist schon im Ofen.« Er beugte sich leicht nach vorn, Markus und sie waren fast gleich groß, und küsste sie, nicht auf den Mund, sondern auf die Wange. Das tat er immer, zumindest schon sehr lange, doch heute fiel es ihr zum ersten Mal wieder auf. Heute waren ihre Nervenzellen in Alarmbereitschaft und empfingen jeden auch noch so feinen Impuls, den Markus aussandte. Kuss auf Mund ist gleich Liebe. Kuss auf Wange ist, was von Liebe übrig bleibt.
Dennoch – was man ignorierte, gab es nicht. Sie war nun doch froh, dass Markus ihren theatralischen Auftritt verhindert hatte. So blieb sie hinter den Kulissen, konnte beobachten, abwarten, tun, als sei alles wie immer. Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Ich habe einen Mordshunger.«
»Du hast wieder den ganzen Tag nichts gegessen.«
Sie sah die Besorgnis in seinen Augen, war gerührt und gleichzeitig böse auf sich, weil sie gerührt war. Er betrog sie, belog sie, und nur, weil er sich ein einziges Mal um sie sorgte, musste sie gegen diesen verdammten Kloß im Hals ankämpfen, damit sie nicht losheulte. Dann kam ihr der rettende Gedanke: Amelie war runder als sie. Sie war von jener Weiblichkeit, die Männer fasziniert, und sie hatte einen größeren Busen. Vermutlich war es einfach nur das, was er ihr damit sagen wollte. Marlene war zu mager, um für ihn erotisch zu sein. Hätte sie mehr gegessen, wäre ihm diese kleine Affäre erspart geblieben. Der Kloß war fort. Die Wut war wieder da. Sehr gut. Denn mit ihr konnte sie umgehen, sie kontrollieren. Hätte sie das nicht gelernt, hätte sie als Kind vermutlich nicht überlebt.
»Ich hatte heute einen Neuzugang« – bewusst wählte sie ein unverfängliches Thema –, »ein junger Mann. Tumore im Hals, in der Lunge, ein fünf Zentimeter großer Tumor in der Wirbelsäule, da vergeht einem der Appetit.«
»Mir ist er jetzt auch vergangen.«
Markus hatte dunkles Haar und ein Gesicht, das tagsüber manchmal etwas hart wirkte. Nachts aber, wenn er schlief und die Falten um den Mund verschwanden, wurde sein Gesicht weich und schön. So wie damals, als sie ihn kennengelernt und für den attraktivsten Mann auf Erden gehalten hatte. Noch heute, wenn sie wach lag, stützte sie sich auf den Unterarm und betrachtete ihn. Geheime Augenblicke, die ihr peinlich gewesen wären, hätte Markus sie bei einem von ihnen ertappt. Es waren Augenblicke, in denen sie ihn unendlich tief liebte, die sie ruhig werden und schließlich einschlafen ließen.
Jetzt aber war er ihr fremd, und seine Augen waren bewölkt. Diese besonderen Augen, die sich wie der Himmel ständig verändern konnten. Manchmal waren sie einfach nur blau, dann war es wieder, als leuchtete die Sonne aus ihnen. Leuchtendes Lächeln. Leuchtende Augen. Hatten Markus und Amelie noch mehr gemeinsam? Verdammt, warum konnte sie nicht aufhören, plötzlich alles, was sie dachte und tat, mit dieser Frau in Zusammenhang zu bringen? Jedenfalls waren Amelie und Markus zwei verdammte Egomanen. Menschen, die nur an sich dachten. Oder wie hätte man sonst eine Frau bezeichnen können, die sich einfach in das Büro der Ehefrau ihres Geliebten setzte und sagte: »Ich bitte Sie um Ihren Mann. Nur für kurze Zeit, weil … ich sterben muss!«
Erst jetzt merkte sie, dass Markus nicht mehr neben ihr stand, sondern längst in die Küche gegangen war. Sie war kurz irritiert, bis ihr einfiel, wie wenig er es leiden konnte, wenn sie über Krankheiten sprach. Sie folgte ihm.
»Tut mir leid, aber ich hatte einen anstrengenden Tag, und es ist nicht immer leicht.«
»Du hast immer einen anstrengenden Tag, und es ist nie leicht.«
Er schaltete den Ofen aus, holte die Pizza heraus. Sie dampfte. Der Geruch würziger Salami vermischte sich mit dem von Knoblauch, Chili, Zwiebeln und geschmolzenem Gorgonzola. Pizza picante. Markus machte alles selbst, sogar den Pizzateig. Dazu einen Brunello. Marlene lief das Wasser im Mund zusammen, und plötzlich wusste sie, dass es ihr mit Selbstdisziplin gelingen würde, Amelie aus ihrem Leben zu verbannen. Dann stellte sie ihm aber doch diese eine Frage, die sie ihm auf keinen Fall hatte stellen wollen.
»Seit wann fotografierst du wieder? Ich meine, richtig! Mit deiner alten Mamiya!«
Markus trank einen Schluck, die Wolkendecke, die über seinen Augen lag, zog sich langsam zurück: »Seit wann interessierst du dich wieder für meine Arbeit?«
Auch Marlene trank einen Schluck, um für die richtige Antwort Zeit zu gewinnen. Jetzt zählte jedes Wort: »Ich habe mich immer dafür interessiert, und das weißt du, es ist nur …«
Er wartete nicht ab, fuhr sie gleich an: »… dass ich ja deiner Meinung nach nicht mehr fotografiert habe, sondern nur geknipst! Aber das Knipsen bringt eben Geld.«
»Dreißig Euro pro Bild.«
Die falschen Worte. Sie hatte gerade die falschen Worte gewählt, und Markus regte sich weiter auf.
»So billig würde sich eine Mutter Teresa der Krebskranken nie verkaufen! O nein, die würde sogar noch Geld dafür bezahlen, damit sie helfen kann.«
Er war so schrecklich aggressiv. Und es dauerte eine ganze Weile, bis Marlene ihre Stimme wiederfand. Die Pizza wurde kalt und mit ihr die Gerüche, die Marlene einen Moment lang lebendig gehalten hatten. Dann endlich sagte sie: »Ich habe immer gedacht, du liebst mich, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass du mich nicht einmal magst!«
»Deinen Heiligenschein mag ich nicht. Und deinen unausgesprochenen Vorwurf, dass ich meine Seele verkaufe, während du deine ständig fütterst – mit den Patienten, die du geheilt hast.«
Er durfte nicht so weitermachen. Und sie durfte nicht zulassen, dass er das wenige zerstörte, das offenbar nur noch zwischen ihnen war. Sie liebte ihn. Sie wollte ihn nicht verlieren.
»Zeigst du mir deine Fotos?«
Markus war nicht mehr wütend. Er war überrascht. »Du willst sie wirklich sehen?«
Marlene nickte, und er lächelte zum ersten Mal an diesem Abend. »Danke!«
»Wofür?«
»Dass du dich wieder für mich interessierst.«
»Ich habe nie damit aufgehört.«
»Doch, das hast du, und das Schlimme ist«, eine Spur von Traurigkeit lag jetzt in seinen Augen, »du hast es nicht mal gemerkt.«
Ihr Blick wurde fassungslos. »Das stimmt nicht, so gleichgültig bin ich nicht.«
»Doch, das bist du. Zumindest was mich betrifft!«
So hatte Markus noch nie mit ihr gesprochen, nicht einmal, als sie noch miteinander gesprochen hatten, richtig miteinander gesprochen. Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Amelie hatte schon zu viele Spuren hinterlassen, um sie noch aus ihrem Leben vertreiben zu können. Markus ließ sie allein. Sie trank ihr Glas mit einem Zug leer und änderte ihren Entschluss: Sie würde, ja, sie musste Markus auf Amelie ansprechen.
»Markus …«
»Sie sind alle aus der Bahnhofsgegend.« Markus war aus der Dunkelkammer zurückgekehrt, setzte sich ihr gegenüber, breitete die Fotos vor ihr aus, und Marlene sagte kein Wort mehr. Denn es waren die besten Fotos, die Markus je gemacht hatte. Das sah sie auf den ersten Blick. Studien von Menschen und Situationen. Ein blinder Akkordeonspieler im Großstadtgrau vor dem bunten Fernwehplakat eines Reiseveranstalters. Ein türkischer Laden mit all seinen glitzernden Wunderlampen, aufeinandergestapelten Fernsehern, handgeknüpften Teppichen, Leder- und Silberwaren, türkischen Süßigkeiten, Orientgewürzen, und mittendrin ein Sarg, in dem ein alter Mann aufgebahrt war, die trauernde Familie um sich herum.
»Er hat es sich so gewünscht, weil dieser Laden in der Fremde seine einzige Heimat war.« Die Menschen ließen Markus selbst in ihrer Trauer ganz nah an sich heran. »Einmal hat er mir erzählt, dass er jede Nacht davon träumt, noch einmal das Licht der Ägäis zu erleben, das immer ein wenig so wirkt, als ob es tanzt. Und sein Elternhaus wollte er noch einmal sehen, im Schatten einer alten Zeder.«
Marlene fiel ein Lied der Tscherkessen ein, eines Volkes aus dem Kaukasus, das sich auch in der Türkei angesiedelt hatte. Eine türkische Patientin hatte es ihr einmal vorgesungen und dann übersetzt: In die Fremde flog der Falke. Mit Sehnsucht im Herzen flog und stürzte der Falke. Und wieder schwang er sich auf. Halte ihn nicht, fessle ihn nicht. Er ist auf der Reise, auf dem Weg in die Fremde.
Sie nahm das Foto, suchte in dem stillen Gesicht des toten alten Mannes nach etwas. Nach einem Aufatmen, nach einem Zeichen, dass er angekommen war. Aber tote Gesichter waren einfach nur tot. Sie legte das Foto zurück zu den anderen.
»Und hat er es noch einmal gesehen, das tanzende Licht der Ägäis? Und sein Elternhaus?«
Markus schüttelte langsam den Kopf: »Dafür war er schon zu krank.« Er sah sie mit einem eigenartigen Ausdruck an und rückte näher. »Du hast schon so viele Menschen sterben sehen, Marlene. Was glaubst du, wohin geht das alles, was uns ausmacht? Ich meine, von unserem ersten Atemzug an stopfen wir alles in uns rein, was wir nur kriegen können. Liebe, Wissen, Glück, Schmerz. Wir sind gierig nach allem, was wir erleben können, und wir lernen jede Sekunde dazu. Bis wir bis obenhin voll sind, und dann – Deckel drauf, ritsch-ratsch, Reißverschluss zu und ab in die Kiste.« Seine Stimme wurde eindringlich: »Also, was glaubst du, wohin verschwindet das alles, wenn wir nicht mehr da sind?« Plötzlich lag ein leichtes Lächeln über seinem Gesicht. »Na ja, vielleicht gibt’s ja so was wie einen himmlischen Müllschlucker mit Wiederaufbereitungsanlage für die nächste Generation.«
Marlene schluckte. »Die Wissenschaft sagt, Freude, Leid, Erinnerungen, Identität, freier Wille und das Gefühl von Liebe sind nichts anderes als das Mit- und Gegeneinander einer riesigen Ansammlung von Nervenzellen.«
»Du denkst tatsächlich, wenn wir miteinander bumsen, dann nur, weil gerade mal wieder ein paar Nervenzellen in unserem Hirn aufeinanderknallen?« Er sah sie ungläubig an.
»Wenn du es unbedingt so ausdrücken musst, ja.«
Seine Stimme klang so scharf, dass sie zusammenzuckte: »Ich spreche die Dinge eben so aus, wie sie sind, und verstecke mich nicht wie du hinter irgendwelchen Theorien!« Er wurde sanfter: »Was denkst du wirklich? Wo sind wir, wenn wir tot sind?«
»Ich weiß es nicht!« Ihre Hände waren eiskalt. »Ich meine, woher soll ich das wissen?«
Markus rückte wieder ab: »Natürlich weißt du das nicht! Du bist ja für die Lebenden da und nicht, wenn jemand stirbt. Dann schiebst du ihn ab.«
In ihrem Gehirn funkte es SOS. Nicht dieses Thema heute Abend. Nicht dieses Thema.
»Hast du ihn gut gekannt? Den alten Mann aus dem türkischen Laden?«
»Lenk nicht ab.« Seine Stimme wurde schärfer. »Lass dich endlich mal auf so ein Gespräch ein.«
»Ich habe mich eingelassen.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen.«
Markus sah ihre Schutzhaltung, ließ von ihr ab und schüttelte resigniert den Kopf: »Ich habe bei ihm immer meinen Mokka getrunken. Da sind wir ins Gespräch gekommen.«
Nicht die Tatsache, dass Markus türkischen Mokka in einem kleinen Laden in der Bahnhofsgegend trank, ließ Marlene aufhorchen, sondern das Wörtchen »immer«. Und ihr fiel noch etwas ein, was sie die türkische Patientin gelehrt hatte: »Türkischen Mokka rührt man nicht um, denn der Kaffeesatz am Grund der Tasse schmeckt bitter.«
»Wem wirst du die Fotos anbieten?«
»Müller und Hansen.«
»Ein guter Verlag.«
»Morgen um elf hab ich einen Termin. Sie wollen einen Bildband daraus machen.«
»Super.« Ihre Freude kam spontan. »Das wolltest du schon immer.«
Ein Blick, und für einen Augenblick war wieder dieses Gefühl von »wir beide« zwischen ihnen und eine Ahnung, dass es für immer sein könnte. Marlene lächelte leicht, nahm das nächste Foto und sah – Amelie. Sie stand vor einem kleinen Hutmacherladen, trug etwas auf dem Kopf, was einem Wagenrad nicht unähnlich war, und fegte mit einem Besen den Asphalt. Marlene lächelte nicht mehr.
»Wer ist das?«
»Irgendein Mädchen. Sie macht Hüte und fegt gegen den Wind.«
»Gegen den Wind?«
»Sie ist ein bisschen verrückt.«
»Und wie heißt sie?«
»Hab ich vergessen. Ist auch nicht so wichtig.«
Marlene sah ihn an, suchte nach irgendetwas in seinem Gesicht, in seinen Augen, in der Stimme, in irgendeiner noch so kleinen Geste. Nach irgendetwas, was ihn verriet. Nichts. Da begriff sie, wie gut er lügen konnte, und sie fragte sich, wie oft er schon so gelogen hatte.
Sehr viel später, als sie im Bett lagen, nahm er ihre Hand. »Wir sind uns schon lange nicht mehr so nah gewesen wie heute Abend.«
Sie nickte, ließ seine Hand nicht los und dachte: Und noch nie weiter voneinander entfernt.
4
Man muss wissen, wann Schluss ist!«
Marlene hatte schlecht geschlafen, steckte mitten in einer Ehekrise, von der Markus noch immer nichts wusste, und jetzt war ihr auch noch Dr. Ralph Gerlach auf den Fersen. Bei anderen Ärzten wehte der Arztkittel, bei ihm wehten Eitelkeit und Arroganz. Und er würde sie auch an diesem Morgen nicht in Ruhe lassen; einem Morgen, an dem die Sonne Lichtmosaike auf das Bohnerwachslinoleum zeichnete und die Onkologie für einige Augenblicke zu einem freundlichen Ort machte. Nein, Gerlach würde sie weiterverfolgen, bis sie aufgab. Sie gab auf. Jetzt. Marlene blieb abrupt stehen, drehte sich langsam zu ihm um, lächelte sanft. »Sie wollen kündigen? Wie schön!«
»Ich? Kündigen?« Gerlach schnappte nach Luft und sah sie empört an. »Ich rede von Frau Meissner. Ihr noch eine Hochdosis-Chemo zu verpassen.«
»Die Tumorkonferenz hat es so entschieden.«
»Weil Sie dafür gekämpft haben wie eine … Als ginge es um Ihr Leben.«
Dieser überhebliche Ton, dieser arrogante Blick. Sie nahm sich zusammen. »Frau Meissner will diese Therapie unbedingt.«
»Kaputte Schleimhäute? Ein einziger Schmerz, den sie nur noch mit einer hohen Dosis Morphium aushält, die ihre Sinne benebelt? Und wofür?« Er vibrierte förmlich vor Aufregung. Kollegen und Patienten drehten sich nach ihnen um, gingen weiter. »Für nichts«, krächzte er weiter. »Und das hätten Sie ihr als ihre behandelnde Ärztin klarmachen müssen.« Dann wurde seine Stimme überraschend sanft: »Reden Sie noch mal mit ihr, Frau Dr. Schyra. Lassen Sie zur Abwechslung einen Patienten einfach nur sterben.«
Bisher war Marlene davon überzeugt gewesen, dass Ralph Gerlach kein Arzt war, sondern ein Krankenhausroboter, den man aus Kostengründen auf die Station geschmuggelt hatte. Jetzt erschien er ihr zum ersten Mal menschlich, und deshalb wollte sie es ihm auch erklären: »Frau Meissner will noch einmal die Jungvögel fliegen sehen.«
Stille. Und dann eine völlig irrationale Hoffnung. Wenn sogar Gerlach sie in diesem Moment verstand, dann war es richtig, mit Frau Meissner zu kämpfen, so lange sie selbst es wollte. Ganz gleich, wie schmerzhaft es war. Ganz gleich, wie viel es kostete. Sie hatte noch nicht zu Ende gedacht, da ärgerte sie sich schon über sich selbst. Seit wann war ihr Gerlachs Meinung wichtig? Und schon pumpten sich seine Lungen auf, ein einziger Ausdruck der Empörung. »Hundertfünfundzwanzigtausend Euro, nur weil eine Patientin noch einmal sehen will, wie die Vöglein fliegen.« Und dann war alles an ihm nur noch kalt: »Das nenn ich eine Grabbeigabe!«
Wortlos wandte Marlene sich ab und ging hinaus in den Krankenhauspark, sah den blauen Himmel, sah die Vögel fliegen, sah ein kleines Mädchen, dem schon fast alle Haare ausgefallen waren, und begann zu weinen. Es war, als flösse mit ihren Tränen alles aus ihr heraus, die Angst, die Einsamkeit, diese große große Traurigkeit, und als blieben sie mit ihren Tränen auf ihrer Haut kleben. Von oben bis unten, am ganzen Körper. Und nur aus einem einzigen Grund: damit endlich alle sahen, wer und wie sie wirklich war.
Dann wischte sie sich mit dem Handrücken energisch die Tränen ab, ging ins Krankenhaus zurück und betrat gleich darauf das Zimmer von Frau Meissner. Elfriede Meissner war Sängerin und hatte sogar einmal eine Langspielplatte aufgenommen. Arien aus »La Bohème«. Jetzt war sie alt, hatte eine brüchige Stimme, brüchige Venen, vor allem aber hatte sie Krebs, und je schlechter es ihr ging, desto dicker war das Make-up, das sie auflegte.
»Am Anfang hat man alles«, hatte sie einmal zu Marlene gesagt, »und am Ende nur noch Angst.«
Angst vor dem Sterben. Und Marlene bekämpfte seit Monaten mit ihr diese Angst, die auch ihre eigene war. Mit einer Chemotherapie und noch einer Chemotherapie. Niemals aufgeben. Und schon gar nicht das Leben.
Marlene setzte sich zu der alten Frau, streichelte ihr die Wange, in die sich die Falten so fein eingegraben hatten, als hätten sie Skrupel, die fast durchscheinende Haut zu verletzen. »Es wird nicht einfach werden!«
Elfriede Meissner lächelte leicht. Die Berührung tat ihr gut. »Ich will leben, so lange es geht.«
Marlenes Blick streifte das gerahmte Foto auf dem Beistelltisch. Es zeigte Elfriede Meissner als junge Frau. Schön. Jung. Lebenssprühend. Seltsamerweise waren alle alten Menschen auf ihren Jugendfotos irgendwie schön. Vielleicht, weil man sie nicht mehr mit anderen verglich, sondern nur noch mit sich selbst.
Marlene trug in Frau Meissners Krankenakte ein: »Beginn der Hochdosis-Chemotherapie: 27. Februar, elf Uhr.«
Elf Uhr! Markus! Plötzlich wusste sie, was sie zu tun hatte. Und das sofort. Jede weitere Minute Warten würde sie nicht überstehen.
Eine halbe Stunde später parkte Marlene – an diesem Tag hatte sie ausnahmsweise einmal nicht die S-Bahn genommen – vor einer Jugendstilvilla in Nymphenburg. Mit ihren Türmchen und Erkern, verborgen hinter einer hohen Hecke, wirkte sie ein wenig so, als blinzele sie noch verschlafen aus der Vergangenheit ins Heute. Marlenes Blick fiel auf das goldene Schild neben dem schmiedeeisernen Tor. Verlag Müller & Hansen. Sie konnte noch zurück. Noch konnte sie zurück. Sie schloss die Augen und stellte es sich ganz genau vor. Dieses Flirren und Vibrieren. Noch ein Hauch von Parfüm, die Lippen schnell nachgezogen, ein bisschen Puder auf die Nase, den Busen nach oben geschoben, den Rock nach unten gezogen, die Brille zurechtgerückt. Fotografen wirkten auf Frauen. Und auf einmal war die karrierebewusste Cheflektorin keine karrierebewusste Cheflektorin, die kühle Sekretärin keine kühle Sekretärin, die chaotische Pressetante keine chaotische Pressetante mehr. Sie waren alle einfach nur noch weiblich. Frauen. Und hinter Markus her! Mein Gott, sie wurde allmählich paranoid. Dennoch stellte sie sich weiter mit fast masochistischem Vergnügen vor, wie Markus in dieser illustren Runde seinen Charme versprühte wie heute Morgen sein Rasierwasser im Badezimmer. Eine Wolke von Egoiste, die sich über die Kacheln legte. Sie hatte gehüstelt und kaum noch Luft bekommen; bei anderen Frauen wurde möglicherweise PEA freigesetzt. Ein kleines Molekül, das Hände feucht werden lässt, die Herzfrequenz hochschraubt und die Schmetterlinge im Bauch zum Flattern bringt.
Markus umflattert von bunten, sexy Schmetterlingen. Nein, keine Skrupel. Kein Nachdenken mehr. Den Traum von einem Bildband mit einem Foto von Amelie, den würde sie gründlich zunichtemachen. Sie würde mitten in die Besprechung platzen und ihm auf den Kopf zusagen, dass er sie betrog. Es war die richtige Zeit und der richtige Ort, um ihn so bloßzustellen, wie sie sich von ihm bloßgestellt fühlte. Sie würde ruhig bleiben und kühl und fast mikroskopisch genau beobachten, wie er allmählich die Fassung verlor. Wie hatte ihr Professor an der Universität immer gesagt? »Der Angriff auf eine entartete Zelle sollte immer überraschend sein!«
Entschlossen stieg Marlene aus dem Wagen, betrat den Verlag und sah sich suchend um. Die Empfangssekretärin, Kurzhaarfrisur, Brille und lange Ohrringe, wurde auf sie aufmerksam.
»Kann ich Ihnen helfen?«
»Marlene Schyra. Mein Mann …«
»Nächster Gang rechts, immer geradeaus und die erste Tür links, da ist der Konferenzraum«, leierte die Empfangssekretärin herunter und wirkte nicht eben so, als habe Markus sie sonderlich beeindruckt.
»Danke!«
»Gern!«
Ein Lächeln. Ein Nicken. Ein Anklopfen. Und dann stand Marlene nicht vor dem halben Dutzend erotischer Frauen, die sie erwartet hatte, sondern vor zwei Männern im dunklen Anzug, vermutlich Verleger und Cheflektor, vor allem aber stand sie vor Markus, der sie zunächst verblüfft und dann besorgt ansah und sie wie nebenbei den beiden Männern vorstellte.
»Das ist Marlene, meine Frau.« Er griff nach ihrem Arm, als fürchte er, dass sie gleich umfiel. »Marlene, ist etwas passiert?«
Marlene kam sich plötzlich vor wie eine Schlafwandlerin, die gerade noch mit einem Gefühl von Allmacht über die Dächer hatte tänzeln und den Menschen auf den Kopf spucken wollen, jetzt aber aufgewacht war und bemerkte, dass sie nichts anhatte und es bei nur einem falschen Schritt tief nach unten ging.
»Nein, nichts, nichts ist passiert«, beeilte sie sich zu versichern, lächelte betont locker in die Männerrunde. »Ich war nur grade in der Gegend, und da dachte ich … ganz spontan … Aber das war dumm von mir, so … ich meine, überhaupt zu denken, meine ich!« Markus’ Gesichtsausdruck blieb ratlos, und auch die beiden Männer sahen sie an, als hielten sie sie, gelinde gesagt, für etwas merkwürdig.
Ihr Verhalten war merkwürdig. Sie war merkwürdig. Was war nur seit ihrer Begegnung mit Amelie aus ihr, einer relativ vernünftigen, ihr Tun stets durchkalkulierenden, hochengagierten Ärztin geworden? Eine eifersüchtige Verrückte mit Kurzschluss im Gehirn und Hang zum Hochdramatischen. Vermutlich litt sie unter einem posttraumatischen Belastungssyndrom.
»Es tut mir leid«, fuhr sie rasch fort. »Dann will ich auch nicht länger stören.«
So, und jetzt den letzten Rest von Haltung zusammenkratzen, sich langsam umdrehen und dann schnell aus dem Konferenzraum laufen, wieder gelassen an der Empfangssekretärin vorbeigehen und so tun, als sei nichts gewesen, und sich später für Markus eine sehr sehr gute Ausrede ausdenken. Doch in diesem Moment entdeckte sie das Foto von Amelie in Markus’ Hand. Ihre Kehle wurde eng, aber sie blieb ruhig, als sie ihm das Foto aus der Hand nahm – die beiden Männer im Raum hatten keine Bedeutung mehr –, und genauso kühl, wie sie es sich vorgenommen hatte, sagte: »Du weißt nicht, wie sie heißt? Sie heißt Amelie. Und du hast eine Affäre mit ihr.«
Sie gab ihm das Foto zurück, lächelte den beiden Herren zu, von denen sie noch immer nicht wusste, wer sie eigentlich waren, verließ den Raum und triumphierte. Nein, sie triumphierte nicht. Sie fühlte sich einfach nur leer. Ihre Schritte wurden langsamer. Normalerweise rannten die Ehemänner hinter ihren Ehefrauen her, wenn die Ehefrauen ihre erotischen Machenschaften aufgedeckt hatten. Doch hinter ihr blieb alles still. Keine Schritte, kein schwerer Atem, kein: Bitte lass uns miteinander reden. Es hatte nichts zu bedeuten. Es war ein Fehler. Verzeih mir. Ich liebe nur dich.
Andere Frauen regten sich darüber auf, wenn ihre Männer versuchten, sich mit so banalen Worten aus der Affäre zu ziehen. Marlene wäre in diesem Moment für jedes Klischee dankbar gewesen. Doch hinter ihr blieb es noch immer still.
Sie kam an der Sekretärin vorbei, nickte ihr zu, und ihre Schritte wurden noch langsamer. Wann kam er endlich? Sie konnte doch nicht inmitten der Empfangshalle zu trippeln beginnen. Oder wie beim Alkoholtest der Polizei auf einer unsichtbaren Linie einen Fuß vor den anderen setzen. Und einfach stehenbleiben konnte sie auch nicht. Das würde ja so aussehen, als warte sie auf ihn. Verdammt, wo blieb er? Sie öffnete die Tür. Gleich würde sie ins Freie treten, sich in ihren Wagen setzen und ins Krankenhaus zurückfahren. Und dann? Wie sollte sie einem Mann verzeihen können, dem offenbar ein Bildband wichtiger war als ihre Ehe?
Doch da stand er vor ihr. Schweigend. Traurig.
»Ich bin froh, dass du es endlich weißt.«
Jetzt fühlte sie sich nicht mehr leer. Jetzt hatte sie Angst. Wirklich Angst. Und sie begann zu ahnen, wie wichtig Markus tatsächlich für sie war.
Sie sagte nichts, nahm nur ihr Handy, wählte die Telefonnummer ihrer Station und sagte: »Ich bin krank, Schwester Maria. Nein, ich komme heute nicht mehr ins Krankenhaus.«
Sie klappte das Handy zu, und Markus sah sie mit seinen Wolkenaugen an: »Du hast die Stationsschwester belogen. Das hast du noch nie getan.«
Ich hatte auch noch nie Angst, dich zu verlieren. Doch das sprach sie nicht aus. Die Tür zu ihren Gefühlen blieb verschlossen.
5
Auch in den Isarauen atmete die Natur auf, atmete wieder nach diesem viel zu langen Winter. Markus und sie waren oft hier spazieren gegangen. Früher. Hier hatten sie geredet, geschwiegen, gelacht, ihre Sorgen geteilt, einander geliebt. Ihre Berührungen, Gefühle, Worte, eingebrannt in die Jahresringe der Bäume. Aufgesogen von der Erde; geheimnisvoll schimmernd, mit jedem Kieselstein, den Markus so oft über das Wasser hatte springen lassen, für immer versunken auf dem Grund der Isar.
Sie suchte im Wasser nach ihrem Spiegelbild. Wann nur hatte sie aufgehört zu sein, wie sie einmal gewesen war? War sie überhaupt einmal eine andere gewesen? Jemand, der so war, wie sie einmal hatte sein wollen?
»Wenn man jung ist«, Markus bückte sich nach einem Kieselstein, balancierte ihn in der hohlen Hand, »hat man eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie das Leben einmal sein soll.«
Marlene löste sich vom Wasser, sah sich um. Noch lag an vielen Stellen Schnee. Doch dort, wo die blasse Erde hervorschaute, konnte man das satte weiche Braun des Frühlings erahnen.
»Und man ist fest überzeugt, dass das Leben auch so wird, wie man es sich vorstellt. Man muss nur immer schön dranbleiben …«
Und schon bald würden auch die Auwälder am Rand des Kiesbetts nicht mehr aussehen, als seien sie magersüchtig, nichts als graue Baumskelette, die in den Himmel ragten.
»Ich bin drangeblieben. Und was ist passiert?«
Nein, sie würden wieder wild und üppig grün sein und sich in der Isar spiegeln.
»Nichts. Nichts ist passiert!«
In diesem ruhig dahinziehenden Fluss, der plötzlich übersprudeln konnte wie ein spielendes Kind, manchmal aber auch gefährlich war mit seinem Sog, der einem den Boden unter den Füßen wegzog.
»Nichts, wovon ich sagen könnte, das ist mein ganz eigenes, mein ganz besonderes Leben. Ein Leben, das nur mir gehört.«
Wie hatte er sich ausgedrückt? Ein Leben, das nur mir gehört! Und was war mit ihrem, ihrem gemeinsamen Leben? Gehörte Markus nicht mehr dazu, oder, was noch viel schlimmer war, hatte er nie wirklich dazugehört? Hatten sie Kreise gezogen, so wie der Kieselstein in Markus’ Hand es tun würde, ließe er ihn endlich über das Wasser springen? Immer parallel, sich aber nur hin und wieder berührend? Jetzt war Marlene nicht mehr weich und nachdenklich. Jetzt verschanzte sie sich hinter kühler Sachlichkeit, wie so oft, wenn sie unsicher war und Angst hatte.
»Und du meinst, diese Amelie gibt dir ein Leben, das nur dir gehört?«
»Durch sie fühle ich mich zumindest wieder lebendig.« Jetzt schleuderte er den Kieselstein ins Wasser. Der Kieselstein hoppelte und versank.
»Das Blöde ist nur«, und die nächsten Worte waren für Marlene fast eine Genugtuung, »deine Amelie wird sterben.«
Die Vögel zwitscherten, die Isar suchte sich weiter leise schmatzend ihren Weg zwischen den Steinen hindurch. Das Geräusch der Großstadt, fern und gedämpft, aneinanderschabende und kratzende Kieselsteine unter den Füßen vereinzelter Spaziergänger, und trotzdem war es still. So still, als habe Markus mit ihren Worten aufgehört zu atmen.