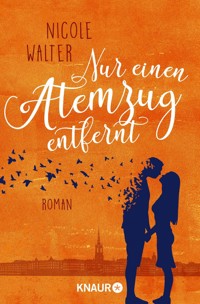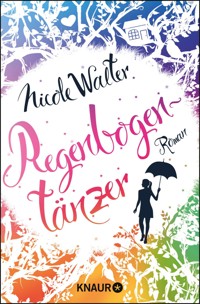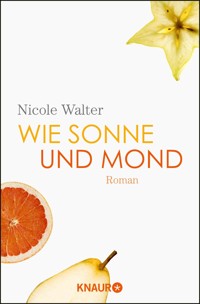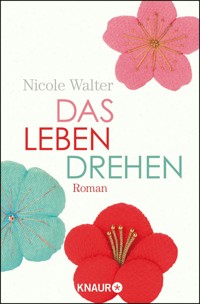6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman über Achtsamkeit, Liebe und und die Kostbarkeit des Moments von der Bestseller-Autorin Nicole Walter Leon lebt sein Leben nicht - er hetzt durch sein Leben. Für ihn zählt nur eines: Erfolg und Geld – und das innerhalb kürzester Zeit. Diese Geschwindigkeit wird ihm zum Verhängnis, als er sich eines Tages auf der Fahrt durchs liebliche Chiemgau mit dem Auto überschlägt. Etwa zur selben Zeit ist Johanna unterwegs auf ihrem Achtsamkeits-Spaziergang, bei dem sie sich ganz auf den Moment einlässt. Sie entdeckt den in seinem Sportwagen eingeklemmten Leon, leistet Erste Hilfe und verständigt den Notarztwagen. Ein schrecklicher Moment für Johanna – aber auch ein besonderer, denn für sie ist sofort klar: Das ist er, der Eine, den sie nie wieder loslassen darf. Johanna bringt ihn ins Haus ihrer geliebten Großmutter Marceline, um ihn dort so richtig wieder aufpäppeln zu lassen. Marceline aber ist eine ganz besondere Frau, die nur eines im Sinn hat: so viele besondere Momente wie möglich zu sammeln, bevor sie ganz im Vergessen versinkt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Nicole Walter
Das Glück umarmen
Roman
Mit Fotografien von Manfred Lingen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Leon lebt sein Leben nicht – er hetzt durch sein Leben. Für ihn zählt nur eines: Erfolg und Geld – und das innerhalb kürzester Zeit. Diese Geschwindigkeit wird ihm zum Verhängnis, als er sich eines Tages auf der Fahrt durchs liebliche Chiemgau mit dem Auto überschlägt.
Etwa zur selben Zeit ist Johanna unterwegs auf ihrem Achtsamkeitsspaziergang, bei dem sie sich ganz auf den Moment einlässt. Sie entdeckt den in seinem Sportwagen eingeklemmten Leon, leistet Erste Hilfe und verständigt den Notarztwagen. Ein schrecklicher Moment für Johanna – aber auch ein besonderer, denn für sie ist sofort klar: Das ist er, der Eine, den sie nie wieder loslassen darf.
Johanna bringt ihn ins Haus ihrer geliebten Großmutter Marceline, um ihn dort so richtig wieder aufpäppeln zu lassen.
Marceline aber ist eine ganz besondere Frau, die nur eines im Sinn hat: so viele besondere Momente wie möglich zu sammeln, bevor sie ganz im Vergessen versinkt.
Inhaltsübersicht
Motto I
Widmung
Motto II
Prolog
Glück 1
1. Kapitel
Glück 2
2. Kapitel
Glück 3
3. Kapitel
Glück 4
4. Kapitel
Glück 5
5. Kapitel
Glück 6
6. Kapitel
Glück 7
7. Kapitel
Glück 8
8. Kapitel
Glück 9
9. Kapitel
Glück 10
10. Kapitel
Glück 11
11. Kapitel
Glück 12
12. Kapitel
Glück 13
13. Kapitel
Glück 14
14. Kapitel
Glück 15
15. Kapitel
Glück 16
16. Kapitel
Glück 17
17. Kapitel
Glück 18
18. Kapitel
Glück 19
19. Kapitel
Glück 20
20. Kapitel
Glück 21
21. Kapitel
Glück 22
22. Kapitel
Glück 23
23. Kapitel
Glück 24
24. Kapitel
Glück 25
25. Kapitel
Glück 26
26. Kapitel
Glück 27
27. Kapitel
Glück 28
28. Kapitel
Glück 29
29. Kapitel
Glück 30
30. Kapitel
Glück 31
31. Kapitel
Glück 32
32. Kapitel
Glück 33
33. Kapitel
Glück 34
34. Kapitel
Glück 35
35. Kapitel
Glück 36
36. Kapitel
Glück 37
37. Kapitel
Glück 38
38. Kapitel
Glück 39
39. Kapitel
Glück 40
Dank
Es gibt im Menschenleben Augenblicke,
wo er dem Weltgeist näher ist als sonst
und eine Frage frei hat an das Schicksal.
Johann Christoph Friedrich von Schiller in Wallensteins Tod
Für Edith, meine Marceline, auch wenn der Verstand meiner Mutter bis zum letzten Tag geschliffen war wie ein funkelnder Diamant …
Frühling
Wie draußen hell der Frühling steht!
Der Erde Klang
ist ein Gebet,
das leise sich im Winde dreht,
ist wie ein Mensch, der kommt und geht
und atmet,
einen Herzschlag lang
Edith Walter, Die Dichterbühne 1950
Fly away my little birdy,
fly away
how much I love you
I never could say
I never could say how hard my need
for your tirilli-song, ever so sweet
run away on your golden spurs
my little horse,
my heart is yours
you never can escape
ever running so wild
because I stay by you
like a homeless child
Edith Walter, 2016
und
dazwischen
dieses verdammte wunderbare und viel zu kurze Leben …
Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2093 bei Altenmarkt. Ein Porschefahrer war von Altenmarkt in Richtung Truchtlaching unterwegs. Kurz vor Offling kam er aus noch ungeklärten Gründen von der Straße ab. Vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit. Das Fahrzeug wurde mehrere Meter weit in die angrenzende Wiese geschleudert, der verunfallte Porschefahrer mit schweren Verletzungen vom BRK in ein Krankenhaus gebracht. Die DLRG Truchtlaching war als Ersthelfer vor Ort. Die Polizei Altenmarkt hat den Unfall aufgenommen. Ch
Korrektur zum Verkehrsunfall am Donnerstag auf der Staatsstraße 2093 bei Altenmarkt. Nicht die DLRG Truchtlaching war als Ersthelfer an der Unfallstelle, sondern Johanna Schmidtbauer (28) aus Offling, Enkelin von Marceline Schmidtbauer, der bekannten Fotografin und Inhaberin der Whiskeybrennerei Schmidtbauer. Ch
»Hier sind wir wieder, Ihr Radio Chiemgau 99,4, zu Gast beim Maxi Wildgruber. Heute sitzt mir eine junge Frau gegenüber. Johanna Schmidtbauer. Grüß Gott, Frau Schmidtbauer, oder darf ich Johanna sagen?«
»Johanna ist schon okay.«
»Also Johanna, Sie haben … oder darf ich du sagen?«
»Du ist schon okay. Sonst komm ich mir so alt vor. Und das bin ich nicht … ich meine, schon so alt. Ich bin ja noch nicht mal dreißig, also praktisch noch jung.«
»Du musst nicht nervös sein, Johanna.«
»Ich bin nicht nervös. Ich muss nur kurz atmen. Ist das in Ordnung, wenn ich atme?«
»Ich bitte darum.«
»Ich meine nicht das normale Atmen, sondern … Schauen Sie, wie sich mein Bauch jetzt sanft hebt und senkt. Das bringt die Ruhe zurück und die Aufmerksamkeit, genau auf diesen Moment. Das tut gut. Ich mein, ein Radiomoderator hat bestimmt auch ziemlich viel Stress.«
»Ommmm. Liebe Zuhörer, da wir nur ein Radio sind und kein Fernseher: Johanna macht jetzt zwischendurch mal eine kleine Meditationsübung.«
»Entschuldigung. Ich mach das halt nicht jeden Tag. Das Meditieren schon, im Radio sein, meine ich.«
»Du rettest ja vermutlich auch nicht jeden Tag ein Menschenleben, Johanna?«
»Gleich … Muss nur schnell vorher erzählen, dass ich mir, früher … hihi …, also, wenn ich mir den Pumuckl angehört habe …«
»Wenn wir vielleicht doch zurück zu unserem Thema … Hast du gedacht, dass du mal die …«
»Also, was ich immer gedacht hab, war, dass der Pumuckl und der Meister Eder direkt im Radio sitzen …«
»Johanna!«
»Entschuldigung, ich bin nur so aufgeregt, und wenn ich aufgeregt bin, dann rede ich viel.«
»So viel zum Erfolg der Meditation, liebe Zuhörer.«
»Meditation ist super, liebe Zuhörer. Probieren Sie es aus, achtsam leben. Hab ich von meiner Großmutter, Whiskeybrennerei Schmidtbauer, Offling, gleich hinter dem Ortsschild links, wir geben an jeden jedoch nur eine Flasche ab.«
»Dann hätten wir das mit der Werbung also auch.«
»Entschuldigung, aber das Whiskeybrennen hat Marceline mir beigebracht und … Achtsamkeit.«
»Und das warst du, Johanna, achtsam … Wie fühlt man sich, wenn man einem Menschen das Leben rettet und dafür die Rettungsmedaille verliehen bekommt?«
»Wie man sich fühlt, weiß ich nicht, nur, wie ich mich fühle.«
»Und wie fühlst du dich, Johanna?«
»Mir ist das peinlich.«
»Peinlich?«
»Weil’s ja nicht das Leben vom Leon war, sondern nur das Sprunggelenk, und der Kio war ja auch noch da …«
»Das Auto hat angefangen zu brennen, Johanna. Wenn du ihn nicht rechtzeitig herausgezogen hättest … Das war mutig.«
»Es hat nicht gebrannt. Nur ein bisserl aus der Motorhaube gequalmt.«
»Der Wagen hätte aber zu brennen anfangen können.«
»Autos brennen nicht so leicht, das gibt’s nur im Film, hat jedenfalls die Feuerwehr gesagt.«
»Das, liebe Zuhörer, ist Johanna Schmidtbauer, die partout kein rettender Engel sein will, ha, ha … Aber rausgezogen, Johanna, hast du ihn schon.«
»Der Leon meint, er hätte es auch allein geschafft, ohne mich und den Kio.«
»Kann es sein, dass ihr beide euch recht ähnlich seid? Du und dein Leon?«
»Er ist nicht mein Leon. Und gleich sind wir auch nicht … denn jeder Mensch ist anders. Einzigartig.«
»Was ich meine ist: Du erkennst nicht an, was du getan hast, und dieser Leon rast wie ein Verrückter und möchte dir absprechen, dass du ihm das Leben gerettet hast?«
»Ein Raser? Nein, das ist der Leon ganz bestimmt nicht. Ein Raser rast, und der Leon ist nur ein bisserl zu schnell gefahren … So was kommt vor. Und jetzt tut’s dem Leon weh und nicht mir …«
»Dreimal Leon in einem Statement, das nennt man Namenserwähnungszwang. Ist das der Beginn einer großen Liebesgeschichte?«
»Natürlich nicht! Aber a G’sicht hat er schon … wie ein gemalter Engel vom Botticelli …«
»Du weißt schon, Johanna, wenn man einem das Leben rettet, ist man den Rest seines Lebens für denjenigen verantwortlich.«
»Ich hab sein Leben nicht gerettet. Aber wenn der Leon mich in Zukunft braucht, Herr Wildgruber, dann bin ich für ihn da.«
»Mit diesen wunderbaren Worten und einem kleinen Lehrgang über Achtsamkeit und Meditation …«
»Darüber sollten Sie mal eine Sendung machen, nicht über mich …«
»… verabschiede ich mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Maxi Wildgruber. Und jetzt, passend zum Thema, gibt’s den Song von den Beatles: Help.«
Help
I need somebody, help,
not just anybody, help,
you know I need someone, help
»Das ist jetzt aber schon a bisserl kitschig, Herr Wildgruber, und passt auch nicht so ganz.«
»Mikro aus.«
»Oh, das war jetzt auf Sendung?«
»Mikro aus!«
»Atmen, Herr Wildgruber, ganz ruhig durchatmen … der Bauch hebt und senkt sich.«
»Auuuus!«
»Ich hab doch gar nichts gemacht?«
Johanna lief.
Mehr noch, sie rannte, als seien sämtliche Allegorien des Ruhms und der Tugend in Gestalt der Frauenfiguren hinter ihr her, die das Gewölbe des Antiquariums in der Münchner Residenz schmückten.
Gerade war das Antiquarium als der schönste und prächtigste Renaissancesaal nördlich der Alpen bezeichnet worden, da war Johanna aufgesprungen und auf den Saum ihres bodenlangen Dirndls getreten – ein bodenlanges Dirndl ist schließlich festlicher als eins, das nur bis zum Knie reicht –, ein kurzes Ritsch und ein noch kürzeres Ratsch, und der Mann im dunklen Anzug verstummte mitten in seiner Rede. Er sah Johanna an, Johanna schaute verlegen zurück, lächelte etwas schief, raffte ihren Dirndlrock mit dem zerrissenen Saum und lief, so schnell es ihre hohen Absätze zuließen, Richtung Ausgang. Der Redner fuhr mit seiner Rede fort, als sei nichts gewesen. Spontan seien die Helden des Alltags, selbstlos und beherzt … Für den Bruchteil einer Sekunde blieb sein Blick auf einem etwa zwölfjährigen Jungen haften. Im Gegensatz zu der alten Dame im roten Sari, die neben ihm saß, hatte er sich den Gästen des Antiquariums angepasst und trug wie alle anderen einen Trachtenanzug. Seine Hautfarbe war dunkel und sein schwarzes Haar zwar mit viel Pomade sorgfältig gescheitelt, aber dennoch kraus.
Johanna indessen stemmte die Tür des Antiquariums auf, floh aus der Situation, vor den Worten, floh vor der Medaille, die sie nicht verdiente, weil sie so sehr bereute … Rannte durch die weitläufigen Trakte des Sitzes bayerischer Herzöge, Kurfürsten und Könige, bis sie endlich den Brunnenhof mit seinen beiden kleinen Bronzelöwen erreichte.
Rieb man die Löwenköpfe, so hieß es, hatte man Glück.
Sie hatte sie gerieben, sogar wie verrückt hatte sie an den Löwenköpfen gerieben, doch es war sinnlos gewesen.
»Was ist Liebe für dich, Johanna?« Leon hatte sie angesehen mit Augen, die etwas ratlos schienen und Großmutter Marcelines Blick ähnelten, wenn sie mit einer Schachtel voll Rechnungen, Quittungen und Kontoauszügen an ihrer Steuererklärung saß.
»Den, den man liebt, in allen Liedern hören, Leon.« Aus Ratlosigkeit war Hilflosigkeit geworden. Am liebsten wäre sie in ihn hineingeschlüpft, um ihn von innen heraus zu wärmen.
»In allen Liedern? Da höre ich nur alle möglichen Töne.«
»Dann, Leon, hast du noch kein bisserl geliebt.«
Und jetzt war Leon fort, ehe sie noch die Chance gehabt hatte, ihm das Lieben beizubringen und die Wärme und das Sich-sicher-Fühlen.
Sie, Johanna, hatte ihn sich für immer und gründlich versaut.
1
Die ersten Knospen nach einem zu langen Winter.
Verdammt, war er spät dran. Den Fuß noch stärker aufs Gaspedal drücken. Von der Abendsonne durchwirktes junges Grün, Löwenzahngelb in Wiesen, die auf- und abschwangen, sanftes Wellenspiel, nahtlos übergehend in das tiefe Braun der Felder, doch nichts davon nahm Leon wahr.
Geübter Blick. Schneller Reflex. Vom dritten Gang in den vierten schalten und wieder zurück. In einer Stunde ging Sarahs Flugzeug nach Tokio, und wenn es blöd lief, würde er sie vorher nicht mehr sehen. Sarah war Homestagerin und von einer großen, international agierenden Immobilienfirma beauftragt worden, Wohnungen, die zum Verkauf standen, mit Möbeln aus Pappe, Art déco und Kunstblumen so aufzuwerten, dass sie höhere Erträge brachten. Stimmte das Ambiente, wurden die Immobilien schneller und zu einem höheren Preis verkauft, vor allem an in Tokio lebende Europäer.
»Ich bin jetzt ein ganzes Jahr weg, und du musst zu diesem blöden Seglerfest!« Sie hatte ihn gekränkt angesehen, während er die Häkchen ihres BHs, eins nach dem anderen, löste.
»Komm halt mit.« Er grinste und band sich mit BH und geübten Fingern das halblange Haar zurück, damit es ihm nicht ins Gesicht fiel und störte bei dem, was er gleich zu tun gedachte. Die Frauen liebten diese Geste. Fanden sie sexy.
»Ich hab noch so viel zu erledigen, Schatz.« Sarah schlang ihm die Arme um den Hals.
»Dann bin ich doch sowieso nur im Weg.« Er befreite sich und machte sich an ihrem Höschen zu schaffen. Frauen liebten es, wenn er es gelegentlich auch mal zerriss. Sarah hatte es ihm verboten. Ihre Dessous waren teuer.
»Aber du bist rechtzeitig zurück, um mich zum Flughafen zu bringen?«
»Sowieso, Schatz.«
»Schön.« Sarah ließ Arme Arme sein und umschlang mit den nackten Beinen seinen Rücken, knapp oberhalb seines Pos, so fest, dass er ihr nicht entkommen konnte. Ein kurzer Moment der Panik, er hasste es, wenn er nicht einfach wegkonnte, wenn er wegwollte. Doch er war der Mann, somit stärker als Sarah, und so stieß er zu, immer wieder, so lange, bis sie losließ und sich ihm seufzend ergab. Mit diesem Ausdruck in den Augen, den er so an ihr mochte, kurz bevor sie kam. Das war gestern Abend gewesen. Ein zufriedenes Lächeln umspielte seinen Mund, während sein rechter Fuß weiter mit dem Gaspedal tanzte.
Sarah war perfekt. Perfektes Aussehen, perfekter Job, fast perfekt im Bett. Draußen raste die Landschaft an ihm vorbei. Genügend Matchpoints für eine gemeinsame Zukunft. Wurde auch Zeit mit fünfunddreißig. Hoppla! Was machte der Idiot da vorn. Sightseeing? Leon trat voll auf die Bremse, gab wieder Gas, setzte zum Überholen an, kurbelte das Seitenfenster herunter, blieb kurz auf gleicher Höhe wie der altersschwache Opel neben ihm und schrie: »Depp! Das Gaspedal aus dem Fenster geworfen, oder was?« Der Fahrer, ein alter Mann, wie konnte es auch anders sein, sah ihn erschrocken an. Leon tippte sich gegen die Stirn, gab wieder Gas und scherte knapp vor einem entgegenkommenden Wagen ein. Lautes Hupen. Leon grinste. Adrenalin at its best … Fuhr aber etwas gemäßigter weiter. Sein Lebensplan war genau getaktet. Zuerst Karriere, dann Familie.
Das Einzige, das ihn an Sarah störte, war, dass sie ihre Lust nicht hinausschrie. Sogar in den leidenschaftlichsten Momenten blieb sie stumm und er danach irgendwie leer. Seelenverlassen, hätte seine Mutter es genannt. Die Kehle wurde eng. Tote Eltern waren nichts für Feiglinge.
Ein Blick auf die Uhr im Display. Shit, er war wirklich spät dran. Wegen des Seglerfests am Chiemsee. Mitnehmen, was geht. Ablenken und gleichzeitig wichtige Leute treffen. Business mal nicht as usual. Trotzdem – es wurde allmählich Zeit, zu lernen, seinen Schwanz unter Kontrolle zu halten, selbst wenn ihm die Frauen ihr Dekolleté unter die Nase schoben und er schon ahnte, wie sie duften würden da unten, wo auch sein Himmelreich war. Manche rochen nach Gewürzen, Rosmarin mit etwas Pfeffer, eine feuchte Wildnis wie von Sonne erwärmt. Andere nach Honig. Herb und bitter oder, wie Bea vom Seglerfest, süß wie Marzipan. Ein Wahnsinnsgefühl, sich in dem Duft zu versenken. Bea war der perfekte Fick gewesen, sie hatte sich die Seele aus dem Leib geschrien. Er grinste. Männersport! Warum eigentlich mit etwas aufhören, das so guttat, nur weil man liiert war. Der Mensch an sich war nun mal nicht monogam, auch wenn Sarah regelmäßig damit drohte, ihn zu verlassen, wenn er sie betrog. Sie durfte es eben nicht erfahren.
Weiter Kilometer um Kilometer in den Asphalt brennen. Er liebte diese engen Kurven. Dazu wechselnder Fahrbahnbelag. Die Landstraße als eine einzige Herausforderung.
Brauntöne im Schilfgürtel am Ufer der Alz. Der Motor heulte auf. Dieser Sound. Hand auf dem Schalthebel. Fuß abwechselnd auf Gas, Bremse, Kupplung. Keine Zeit, keinen Sinn für das idyllisch gelegene Gehöft vor dunkler Waldschranke mit frühlingsblühendem Bauerngarten vor bläulich-schneeigem Chiemgaugipfel. Stattdessen immer wieder Blick auf den Tacho. Adrenalin pur. »Fuck!« Rausch der Geschwindigkeit. »Yeah!« Sarah abholen und dann auf die Hundertstelsekunde pünktlich vor dem Flughafengebäude einparken. »Jawohl.« Sarah zumindest damit beeindrucken.
»Ich hab ein Lächeln gefunden.« Sein Standardspruch. »Ist es zufällig deins?«
Damit hatte er sie gekriegt.
Er bekam alle …
… und alles. Er war Leon. Leon, der König der Welt.
Es war dieser eine winzige Moment der Unachtsamkeit. Etwas, das ihm so gut wie nie passierte, doch exakt in dieser Sekunde, obwohl die Straße komplett frei war, verlor er die Kontrolle über seinen Porsche. Mit hundertachtzig Stundenkilometern, das registrierte sein Gehirn noch, kam der Wagen von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und blieb ordentlich und exakt, wie Leon es ihm abverlangt hätte, auf seinen vier Rädern liegen. Ein ganzes Stück von der Landstraße entfernt. Inmitten von jungem Grün, das sich möglicherweise über diesen seltsamen Gast wunderte, vor einem dunklen Waldgürtel. Leuchtende Abendsonne. Löwenzahnwiese. Idyllisches Geläut von Kuhglocken. Das Wasser der Alz sich in der Ferne spiegelnd wie ein silbernes Tablett. So lag Leon erst einmal da, zusammengestaucht in seinem kaputten Baby, den Kopf recht gemütlich in den Airbag gebettet, der sich vorschriftsmäßig geöffnet hatte. Bewegen? Fehlanzeige! Und dann geschah das, wovon er gelegentlich gehört, was er aber nie geglaubt hatte. Sein Leben begann sich vor seinem geistigen Auge abzuspulen. Oder zurückzuspulen wie eine Filmrolle. Und da er unfähig war, sich zu bewegen, kam er auch nicht mehr aus der Nummer raus.
Das rasante Hinaufklettern auf der Karriereleiter bis zum Management, die vielen Frauen, die er weniger mit dem Herzen als vielmehr mit seinem durchtrainierten Body geliebt hatte und noch liebte. Stressabbau beim gelegentlichen Pokern in von Rauch geschwängerten Räumen, ab und zu eine Nase Kokain, etwas Chillen, um den Tag smooth ausklingen lassen oder um den nächsten Tag durchzuhalten. Rein ins Meeting, raus aus dem Meeting, dann ins nächste, rein, raus, rein, raus … auch der Sex war mit Koks besser. Und es war gut gegen die Angst. Davor, dass die anderen ihn erkannten, so wie er war. Dass er nichts war. Nichts! Ein einziger Fake. Studien- und Teenagerzeit folgten, und dann entstand in dem Licht der Abendsonne, das sich in seiner Windschutzscheibe spiegelte, ein Bild.
Das Bild eines etwa sieben- oder achtjährigen Jungen, der durch hohes Gras hüpft, ungelenk wie ein Fohlen, die Beine zu lang und zu dünn, aber den Kopf voller Träume, die in ihm widerhallen, ähnlich einem Glockenspiel. Träume wie Windvögel, ihre Schwingen aus Papier weit über den Stoppelfeldern ausbreitend. Jetzt erkannte Leon den Jungen. Der Junge war er. Etwas in ihm erinnerte sich wieder, als er in dieser zunehmend unbequemen Position lag. Er erinnerte sich, wie frei er sich als Kind gefühlt hatte. Mit so viel Zukunft vor sich. Das Leben unendlich. Er unsterblich. Weil alles möglich war und er sich nicht vorstellen konnte, dass es irgendwann nicht mehr so sein würde. Damals hatte er so viel Freude verspürt. Und heute? Wann hatte er sich das letzte Mal aus tiefstem Herzen gefreut? Er erinnerte sich nicht.
Der Geruch einer frisch gemähten Wiese schob sich durch den schmalen Spalt des nicht ganz geschlossenen Seitenfensters – nachdem er den Alten beim Überholen beschimpft hatte, hatte er es nicht mehr ganz geschlossen –, schlüpfte in seine Nase, setzte sich in den feinen Härchen fest, kroch bis hinauf ins Gehirn, wo die Geruchserinnerung saß. Leons Inneres war plötzlich zum Überquellen voll, erinnerte ihn daran, was alles noch möglich gewesen wäre, und dass er, obwohl er vielleicht erst jetzt sterben würde, im Grunde schon lange tot war. Gleichzeitig schwor er sich, wenn er aus diesem ganzen Mist hier wie durch ein Wunder doch noch lebend herauskommen würde, würde er alles anders machen.
Ein silbernes Flugzeug am tiefblauen Himmel. Sarah. Ihr schönes, regelmäßiges Gesicht mit Himmelsaugen. Sie hatte etwas von Marietta Slomka, der Moderatorin des heute-journal. Auch Sarah wirkte immer ein wenig unnahbar. Genau das hatte ihn an ihr gereizt. Sarah. Stets korrekt in exakt gebügelter weißer Bluse. Auch mit ihnen wäre so viel mehr möglich gewesen. Hätte er es zugelassen. Reue. Sinnlos. Weil vorbei. Die Sehnsucht ist der Vorbote von etwas Neuem, auch das war noch in seinem Kopf, ehe sich die Dunkelheit wie ein Grabtuch über Landschaft und Augen legte.
Es war vielleicht dieser eine Augenblick, in dem er dem Weltgeist näher war als sonst und er eine Frage frei hatte an das Schicksal. Dass es unter seiner Motorhaube zu qualmen begann, bemerkte er nicht. Leon war ohnmächtig geworden.
2
Eine Feder. So zart und weiß, als habe sie der Steinengel an deinem Grab verloren, Mama.
Knorrige Wurzeln. Die rauhe Borke der Bäume, warmes, weiches Moos unter bloßen Füßen. Es raschelte. Vermutlich nur eine Maus, die sich durch das Laub vom Vorjahr wühlte. Johanna hatte keine Scheu vor Mäusen, Ameisen, Regenwürmern und Tausendfüßlern, damit war sie im Garten ihrer Großmutter aufgewachsen. Und Angst vor dem Wald und seinen Geräuschen kannte sie ebenso wenig. Dieses Knacken, Knistern, Summen, Schnaufen und Piepsen im Unterholz. Manchmal ging sie sogar nachts auf Erkundungsgang. Eine wichtige Erfahrung, sich nur auf das Gehör verlassen zu können. Das Schreien einer Eule, das Wispern eines Blattes, die Kontaktserenaden von Wald- und Sperlingskauz, das Schmatzen eines Wildschweins, das den Boden nach Fressbarem durchwühlt.
Hätte Johanna dieses Laubrascheln nicht in die Schublade Maus eingeordnet und sich stattdessen umgesehen, hätte sie bemerkt, dass sie verfolgt wurde. Und das wohl schon seit geraumer Zeit. Doch Johanna, sich absolut sicher fühlend, setzte ihren Weg fort. Schritt um Schritt, konzentriert die Ferse ganz langsam bis hin zum Ballen abrollend, spürte sie die lebendige Erde fest unter den Füßen. Der Schatten blieb in einiger Entfernung, aber er blieb hinter ihr. Antilopenleicht, schnell wie der Blitz und nahezu geräuschlos, huschte er von einem Baum hinter den anderen.
Johanna war viel zu sehr im Sein, wie es ihre Großmutter Marceline auszudrücken pflegte. Sie sah und schnupperte. Diese Mischung aus Erde, Tannennadeln und frischem Holz. Wenn Johanna durch den Wald streifte, sammelte sie alles ein, was sie umgab. Sie verschmolz mit dem Wald, gab sich dem Jubilieren der Vögel hin, umarmte den Baum, begrüßte die Sträucher. Und dabei strömte ihr Atem ein und aus wie Nebelschwaden, die weit über die Baumkronen hinaus aufstiegen und sich im Licht der Abendsonne wieder wie Schleier auf sie herabsenkten.
Achtsam sein. Ruhig werden. Ganz und gar im Moment sein. Großmutter Marceline hatte ihr diese, nun ja, Meditationstechnik beigebracht, von der sie behauptete, sie wirke gegen Stress.
Johanna hatte keinen Stress.
Sie war traurig.
Es war schleichend gekommen, das mit Marceline. Aber einen ehemals scharfen Verstand konnte man nun einmal nicht schleifen wie ein stumpf gewordenes Messer. Messerschleifer. Verstandesschleifer. Johanna hätte keine Sekunde gezögert, um dem fahrenden Volk die Tür zu öffnen, hätte auch nur einer von ihnen Marceline zurückgeben können, was sie zunächst fast eher beiläufig verlor. Noch tröpfelte ihr so wacher, lebendiger, neugieriger Geist wie die Milch aus der leicht beschädigten Tüte, die Johanna vor einigen Tagen im Einkaufskorb nach Hause getragen hatte.
Man merkte nichts, nahm es wahr, so wie man an einem warmen Frühlingstag den Wind wahrnimmt, dessen Brise durch das gekippte Fenster ins Zimmer weht. Erst wenn die Milch überall ihre Spuren hinterließ und der Wind zum Sturm anschwoll, begriff man – vielleicht. Und dass es schlimmer werden würde. Wesentlich schlimmer.
»Wenn du im Fluss in einen Strudel gerätst, dann kämpfe nicht, rudere nicht wie wild herum, sondern leg die Arme dicht an deinen Körper und lass dich ruhig nach unten sinken, bis du den Grund erreichst und mit den Füßen die Steine fühlen kannst. Danach tauchst du wie von selbst auf. Dein Kopf ist über Wasser, und du kannst wieder atmen.«
Nur jetzt sank sie, während Johannas Gedanken weiterhin an Marceline klebenblieben, und der Boden kam und kam nicht.
Johanna blieb stehen. Auch ihr Verfolger blieb stehen. Verschwand im Unterholz und hinterließ nicht mehr als den Hauch einer Ahnung, dass er überhaupt da gewesen war. Nur die Augen waren noch zu sehen. Groß, dunkel, die Iris um die fast schwarzen Pupillen herum strahlend weiß, irritierend weiß, ja fast beängstigend weiß, schienen sie Johanna durch das Gestrüpp zu beobachten.
»Willst du nicht ein bisschen in den Garten gehen, Marceline?« Erst heute Morgen hatte Johanna ihre Großmutter dazu aufgefordert.
»Was habe ich davon, Liebes?«, hatte Marceline geantwortet und weiter versucht, ihrem riesigen Fotoarchiv eine neue Ordnung zu geben, die mittlerweile nur sie selbst durchschaute.
»Die Frühlingssonne genießen, Marceline.« Johanna liebte es, den Namen ihrer Großmutter auszusprechen. Marceline. Wie eine Melodie aus ferner Zeit. Johanna dagegen klang profan. Johanna. So als hätte man sich um ihren Namen nicht sonderlich viele Gedanken gemacht. Sie wusste, dass es nicht stimmte. Im Gegenteil, ihre Mutter, mit dem ebenfalls klangvollen Namen Lilian, hatte nur alles getan, um sich von Marceline abzugrenzen, die für sie nie eine richtige Mutter, sondern immer nur eine One-Woman-Show gewesen war. Etwas, das Johanna wiederum jederzeit von Lilian behauptet hätte. Gerade jetzt hätte sie ihre Mutter gebraucht. Auch wenn die Demenz noch ebenso wenig greifbar war wie die Mücke im Schlafzimmer. Man hörte sie, aber man sah sie nicht. Man machte Jagd auf sie, doch sie war immer schneller, und dann, wenn man es nicht erwartete, stach sie zu.
Heute Morgen hatte sie wieder einmal zugestochen. Schlimmer als je zuvor, und Johanna trug die Schwellung noch immer mit sich herum.
»Komm, Marceline, die Luft ist so klar und rein.« Johanna hatte Marceline über den Kopf gestrichen. Über ihr wundervolles, noch immer schwarzes Haar mit nur wenigen weißen Strähnen. Sie trug es in der Mitte gescheitelt mit einem schweren, kunstvoll verschlungenen Knoten am Hinterkopf.
»Ich sollte endlich nach Hause gehen.« Statt Johanna in den Garten zu folgen, hatte sie weiter ein Foto betrachtet, das sie in Puerto Rico geschossen hatte. Die Familie hatte den Verstorbenen, einen noch jungen Mann, nicht aufgebahrt, sondern im Trainingsanzug und mit Schildmütze lebensecht an einem Tisch positioniert. Als könnte man ihn auf diese Weise noch ein wenig länger lebendig erhalten. Dass er nicht sprach, fiel nicht weiter auf. Er war ein schweigsamer Mensch gewesen. Das zumindest hatte die Familie Marceline über ihn erzählt.
Marceline war schön, wie sie so dasaß, versunken in den lebenden Toten oder Totlebendigen auf dem Foto. Mit ihren dichten, dunklen Brauen, die vom Nasenrücken wegstrebten wie zwei wundervoll geschwungene Flügel. Die Augen waren ebenfalls dunkel und mandelförmig, was sie durch einen feinen Lidstrich noch betonte. Hob sie die Augenlider, war es wie das leise Flattern zarter Schmetterlingsflügel. Sah sie Johanna obendrein mit diesem besonderen Blick an, war es, als gehe an einem anderen Himmel als diesem die Sonne auf. Marcelines Himmel war weiter als weit, schon immer gewesen. Wie gern wäre Johanna ihrer Großmutter ähnlich gewesen, vor allem äußerlich, doch sie kam wohl nach ihrem Vater, von dem sie nicht viel mehr wusste, als dass es ihn gegeben haben musste, in der Nacht, in der sie gezeugt worden war. Noch eine One-Woman-Show ihrer Mutter. Johannas Haar war rotblond und ihre Naturlocken so widerspenstig, dass sie das Haar in einem Anflug von Verzweiflung ratzfatz abgeschnitten hatte. Dementsprechend sah es auch aus. Ihr fehlten außerdem Marcelines hohe Wangenknochen, über die sich die Haut inzwischen wie ein fein gesponnenes Faltennetz spannte. Dafür hatte ihr die Natur Sommersprossen geschenkt, die sich in der Sonne sogar noch gut gelaunt vermehrten. Lilian kam nach Marceline, wusste es jedoch nicht zu schätzen, und Johanna hasste sie auch dafür.
»Wo bin ich?« Mit dieser Frage schwand die Weite in Marcelines Blick. Sie reduzierte sich auf einen schwarzen Punkt, in dem sich alles zusammendrängte, was sie in den vielen Jahren gesehen hatte, bis es sich irgendwo und irgendwann ganz verlor.
»Du bist zu Hause, Marceline.« Sanft hatte Johanna jeden einzelnen Finger ihrer Großmutter von dem Foto gelöst, das sie jetzt krampfhaft umklammert hielt.
»Und wo ist das, dieses Zuhause, Liebes?« Der schwarze Punkt wurde größer. Diese Ratlosigkeit in diesen schönen Augen. Der Schmerz mauerte ein. Stein auf Stein, bis sich auch noch der letzte Stein zwischen Johanna und die Welt draußen schob. Noch gab es genug Sauerstoff. Noch konnte sie atmen. Aber was war, wenn der Schmerz schlimmer wurde?
»Das hier, Marceline, wo du gerade bist, ist dein Zuhause.«
»Oft bin ich aber noch nicht hier gewesen, Liebes?«
Johanna hatte nachgelesen. Das Gefühl der Heimatlosigkeit gehörte zur Demenz.
»Früher, Marceline, da bist du viel herumgereist. Erst als ich bei dir eingezogen bin, hast du damit aufgehört.«
»Du warst nicht schon immer bei mir?«
»Nein, erst als Mama mich mit zwölf bei dir abgegeben hat.«
»Wie ein Paket.« Marcelines ratloser Blick war gewichen, und sie hatte sich kaputtgelacht, bis sie husten musste. Für Johanna war es das schönste Lachen der Welt. Es plätscherte nicht an der Oberfläche einfach so dahin, sondern kam tief aus ihrem Innern.
Johanna fühlte, wie ihr die Erinnerung an diesen Morgen die Beine wegzog. Rasch setzte sie sich ins Gras, unweit eines Brutbaums, von dem sie wusste, dass Dohle und Raufußkauz ihn gemeinsam nutzten. Ihr Verfolger blieb stehen, verharrte gut geschützt hinter einem Baum, regungslos, den Blick starr auf die junge Frau gerichtet.
»Wo war ich, bevor du bei mir eingezogen bist, Liebes?«
»Überall, Marceline, in der ganzen Welt.«
»Und welche Adresse hat die ganze Welt, Liebes? Nur, damit ich sie wiederfinde, falls ich verloren gehe.«
Es gab auch andere, gute Tage, in denen Marceline wieder so war wie früher. Noch überwogen sie, und an die kommenden verbot sich Johanna zu denken.
Traurigsein machte schwer. Es fiel Johanna nicht leicht, mit all der Gedanken- und Gefühlslast wieder aufzustehen, und gerade, als sie sich wieder ganz aufrichten wollte, schoss etwas lautlos auf sie zu. Johanna schrie erschrocken auf, doch da drehte das Etwas nur wenige Zentimeter vor ihrem Gesicht ab, flog davon. Kein Flügelsausen, kein Flattern, nichts, nur die Silhouette, die sich klar vom resthellen Abendhimmel abzeichnete. Ein Waldkauz, der jetzt so leise verschwand, wie er gekommen war. Johanna atmete tief durch und setzte dann ihren Weg fort, von dem sie nicht wusste, wohin er sie führte. Ihr Schatten folgte. Leicht. Behende. Lautlos.
Die Erde unter den bloßen Füßen zu fühlen beruhigte Johanna und nahm etwas von ihrer Angst, Marceline ganz an die Dunkelheit zu verlieren. Dass sie sich mehr und mehr auflöste. Mit allem, was sie ausmachte. Ihren Erinnerungen, ihrem Wissen, ihrer Freude an Musik. Ging Johanna mit ihr in ein klassisches Konzert, dann schloss sie die Augen und hörte nicht nur zu. Sie versank mit allem, was sie war, in Beethoven, Mendelssohn, Mozart, Tschaikowsky und wie sie alle hießen. Nicht selten hatte sie dabei Tränen in den Augen, als fragte sie sich, wie viele Konzerte sie noch erleben durfte, bis der Verstand gänzlich aufgebraucht sein würde. In diesen Momenten mauerte der Schmerz nicht ein, er strömte von Herz zu Herz, von Platz zweiundzwanzig zu Platz dreiundzwanzig, Reihe vier, im großen Saal des Kulturzentrums. Marceline hatte die Plätze ausgesucht: »Ich sitze gern am Rand. Wir Alten müssen öfter mal raus.«
»Du bist doch nicht alt, Marceline.«
»Ach, Johanna, egal, wie du es siehst, es bleibt dasselbe.«
Johanna kannte keinen anderen Menschen, der sich so hingeben, so lieben konnte wie Marceline.
»Ich war nicht immer so, Liebes.«
»Du meinst, du hast nicht immer geliebt?«
»Ich habe es erst gelernt, auf meinen Reisen, von den vielen wunderbaren Menschen, die ich überall getroffen habe. Im Grunde war ich eine riesengroße Egoistin. Das nehmen mir deine Mutter und ihre Schwestern immer noch übel, und dass jede von ihnen einen anderen Vater hat.«
Nicht mehr denken, Johanna, fühlen und in der Gegenwart sein.
So viele Nerven, nicht nur unter den Sohlen, auch unter der Seelenhaut. Johanna ging weiter, nahm jede Unebenheit wahr. Die Tannennadeln weich wie Moos, die winzigen Holzspäne dagegen bohrten sich in die hauchdünne Haut zwischen die Zehen. Doch für das Barfußlaufen, diesen Gefühlsflash, das sie von zu viel Denken befreite, nahm sie diese kleine Unannehmlichkeit in Kauf.
Lebendige Erde, unter der sich das Reich eines besonderen Lebewesens befand. Sein Hut spitzte unter einem abgebrochenen Zweig hervor. Johanna blieb erneut stehen. Ging wieder in die Hocke. Sie kannten einander schon, Herr Hut und Johanna. Wobei Johanna den Eindruck hatte, dass der Hut von Herrn Hut heute etwas kecker auf dem weißen Stamm saß, der krumm aus dem Waldboden wuchs.
Die hinter ihr herhuschenden Gestalt verharrte ebenfalls, diesmal jedoch ohne sich zu verstecken. Im Licht der anbrechenden Nacht waren nun deutlich die Umrisse eines männlichen Wesens zu erkennen, nicht groß, eher schmal. Dunkel. Johanna bemerkte ihn noch immer nicht, nahm nur das schwammige, leicht ablösbare Röhrengewebe des Steinpilzes mit all seinen Poren wahr. Stellte sich vor, wie der Pilz unter dem Waldboden weiterwuchs, in einem wunderschönen, vielfach verzweigten, ständig aktiven und wachsenden Geflecht. In ihrer Phantasie verband er sich mit den Wurzeln der Bäume und anderer Pflanzen, um einander zu nähren und vor Feinden zu warnen und zu schützen. Eine Symbiose, die ihr Überleben sicherte. Und in diesem Moment geschah etwas Seltsames. Vorstellung, Phantasie und Denken hörten auf, und Herr Hut bekam ein Gesicht. Oder, anders gesagt, Johanna überließ sich einem ihrer Tagträume, in denen sie sich so gern versteckte.
Es war das Gesicht eines jungen Mannes. Mit großen, dunklen Augen. Die Brauen schön geschwungen. Gerade Nase. Eine große Sanftheit ging von dem Gesicht aus. Und – Johanna fiel nur der etwas altmodische Ausdruck ein, den Marceline gelegentlich benutzte – Schalk. Schalk blitzte in seinen Augen auf. Die Wimpern waren dicht, lang und schwarz, legten sich wie ein zauberhafter Schatten über die ausgeprägten Wangenknochen. Härte und Zärtlichkeit zugleich. Johannas Herz verrutschte, hing nun irgendwie schief herum und klopfte wie verrückt gegen die Brustwand, als wolle es Johanna dazu auffordern, es wieder geradezurücken. Johanna war gern und viel verliebt, aber dieses Gesicht vor ihrem geistigen Auge schien von göttlicher Hand aus diesem gewöhnlichen Pilz nur für sie geformt worden zu sein. Deswegen ließ sie ihr Herz erst einmal hängen. Aber nun gesellte sich auch noch die Wehmut dazu, begann an beiden Herzhälften zu zerren, die ohnehin schon ihr Gleichgewicht verloren hatten. Die Zeilen eines Liedtextes der Sängerin Oonagh fielen ihr ein: Von zwei Welten zueinander und für immer vereint … la, la, la … und denk an mich, im nächsten Leben, da wart ich auf dich …
Bitte nicht erst im nächsten Leben! Sehnsucht überwältigte Johanna. Sie sehnte sich so sehr nach Liebe. Nicht nach der einer Großmutter und auch nicht danach, einfach nur verliebt zu sein. Johanna wollte die ganz große, bis in alle Ewigkeit währende Liebe zu einem Mann. Dazu viele Kinder, die Familie, die sie selbst nie gehabt hatte. Vater Mr. Nobody, Mutter Karrierefrau. Keine Geschwister. Die Tanten wie ihre Mutter emotionale Nullnummern und kaum Kontakt zu Cousin und Cousine – nur eine der Tanten hatte Familie. Immer und immer nur ihre Großmutter Marceline …
Johanna hielt ihre Gefühle nicht mehr aus, schlug die Augen auf, wollte schon nach dem vielversprechenden Märchenprinzen greifen, ihn halten, nie wieder loslassen, doch da war nichts außer Pilz und Wald, kein Hauch mehr von Phantasie, Wärme und Trost.
Johanna hatte sich wieder einmal verträumt in ihrem Sehnsuchtslabyrinth. Romantikerin, schimpfte sie sich, und das Leben ist nicht so. Sei wieder praktisch! Hob jedoch gleichzeitig den Kopf, lauschte dem Wind, hörte die Nacht kommen, auch wenn sie noch Stunden von ihr entfernt war, hörte ihr Flüstern, Wispern, den Schrei der Eule, ihren Atem, der die Seele in den unendlichen Himmel hinaufzutragen schien. Und während sie noch lauschte, träumte und so voll von Gefühl war, stand ihr Verfolger wie aus dem Boden gewachsen vor ihr.
Johanna schrie auf.
Erkannte ihn.
Atmete tief durch.
Wechselte die Farbe von Kreidebleich in ein durch Sauerstoff genährtes Wangenrot, und dann fing sie an zu schimpfen: »Kio, diese ständige Hintermirherschleicherei! Du weißt, dass ich das nicht leiden kann. Frag mich, dann gehen wir zusammen … Aber nicht, wenn ich meine Achtsamkeitsübung mache!«
»Was ist Acht … sam … keit?« Unbeeindruckt von der Heftigkeit ihres Tonfalls sah der Junge sie aufmerksam an. Er war etwa zwölf Jahre alt. Die Pupillen größer als groß. Die Iris weißer als weiß. Sein Gesichtsausdruck war so ernst, dass Johanna lächeln musste. Sie wurde sanft.
»Achtsamkeit, Kio, das ist, ach was, ich erklär’s dir ein andermal …« Sie zupfte an seinem Haar, das sich anfühlte wie etwas zu grobe Wolle. Johanna zupfte gern an seinem Haar, was Kio nicht ausstehen konnte. Wie immer drehte er den Kopf rasch zur Seite. Eine Narbe auf seiner linken Gesichtshälfte wurde sichtbar. Eine Schmucknarbe, tief und reich verziert. »Jetzt lauf heim, Kio«, forderte Johanna ihn auf, »ich möchte nicht, dass Marceline allein ist. Nicht heute.« Sie hatte sie schon viel zu lange allein gelassen, in Anbetracht dessen, wie der Morgen angefangen hatte.
Kio machte jedoch keinen Schritt. Stand einfach da mit hängenden Armen. Er war groß für sein Alter, hatte einen sportlichen, drahtigen Körper, die Haut war dunkel, fast schwarz.
»Kio!« Johanna versuchte es noch einmal, bemerkte jedoch, dass Kios Blick weit geworden war. Mehr noch, er war starr vor Entsetzen, richtete sich, an ihr vorbei, in die Ferne. Johanna drehte sich um, und jetzt sah sie es auch.
»Feuer.« Kios Stimme versagte.
Ja, da war Feuer. Es kam aus der Richtung Staatsstraße 2093, die nach Altenmarkt führte. Nein, doch kein Feuer, aber ziemlich viel Rauch.
Johanna zögerte keine Sekunde, sprang auf und lief los. Sie war schnell. Bei den Bundesjugendspielen hatte sie beim Sprint regelmäßig die schnellste Zeit erzielt und war anschließend von Marceline und ihren Freundinnen mit Kuchen vollgestopft worden, damit das Kind erst einmal Fleisch auf die Rippen bekam, so mager sei es vom vielen Laufen.
»Du bist viel zu schnell, Johanna!« Wie oft hatte Marceline das zu ihr gesagt. »Du rennst aus deinem Leben raus, bevor du überhaupt drin gewesen bist. Bleib doch einfach mal stehen, Kind.«
Kio zögerte noch. Wusste nicht, ob er Johanna folgen oder sich in Sicherheit bringen sollte. Er legte die Hand auf die Narbe. Er fühlte den Schmerz, aber auch den Stolz, als sein Vater das Skalpell angesetzt und das Muster des Familienclans in seine Haut geschnitzt hatte: »Damit du immer weißt, wer du bist. Egal, wo du bist. Kio Achebe.« Kio hatte die Tränen zurückgehalten. Nicht der Schmerzen, sondern des bevorstehenden Abschieds wegen. »Jetzt bist du ein Krieger!«
Ja, er war ein Krieger! Und Krieger haben keine Angst. Niemals Angst. Krieger. Er war ein Krieger.
Kio rannte los, wobei er mit den Füßen kaum den Boden zu berühren schien. Rannte wie eine Antilope durch die Savanne mit ihren Bäumen und Gräsern, der Trockenheit und den Feuern, die immer wieder ausbrachen, verschlangen, was die Tiere übrig gelassen hatten. An Feuer war Kio gewöhnt. Nicht aber an dieses Feuer in seinem Kopf. Das sich durch jede Gehirnwindung fraß und die Erinnerung dennoch nicht in Schutt und Asche legte. Diese Bilder. Auch vor ihnen lief Kio davon, überholte Johanna, erreichte vor ihr das qualmende Fahrzeug. Blieb abrupt stehen. Entsetzen auf seinem Gesicht. »Tot!« Eines der ersten deutschen Worte, die er gelernt hatte. Sein Körper spannte sich wie ein Bogen, um was auch immer zu erlegen, Johanna blieb neben ihm stehen, und Kio – begann das Trinklied aus La Traviata zu schmettern. Er hatte eine schöne Stimme. Etwas Besonderes lag in ihr, das Johanna noch nicht zu deuten wusste. Vermutlich hätte er sofort einen Job bei den Regensburger Domspatzen bekommen. Kio sang, während er am ganzen Leib zitterte. Johanna wollte ihn in die Arme nehmen, doch er stieß sie weg. Ging auf Abstand, sang noch schneller, noch lauter, sang die Furcht und das Entsetzen in seinem Inneren weg, während Johanna sich vorsichtig dem Wagen näherte.
3
Da kann man noch so viel Zeit und die beste Kamera und die besten Objektive haben, am Ende hilft nur eins: Glück. Nach sechs Stunden Warten: drei Schneehasen mitten auf einem Eisfeld.
Johanna stand vor dem Fahrzeug, aus dessen Kühlerhaube es qualmte. Ohne diesen Rauch hätte sie möglicherweise nur an ein verkehrswidrig geparktes Auto gedacht, so korrekt stand der Porsche auf seinen vier Reifen. »Tot«, hatte Kio gesagt. Im Gegensatz zu ihm hatte Johanna noch keinen Toten gesehen. Und so wie Kio reagiert hatte, der dem Tod schon auf so viele Arten begegnet war auf seiner langen Flucht über Agadez, durch das südliche Algerien bis nach Marokko, würde man sich wohl nie an den Tod gewöhnen. Wenn deine Seele hüpfen soll, hieß es in einem nigerianischen Sprichwort, dann lass die Beine tanzen. Und wenn dein Geist springen soll, lass deine Seele träumen. Doch bewegungslos mit sechsundachtzig anderen Flüchtlingen zusammengepfercht auf einer verrotteten Nussschale ging nicht nur der Mensch, sondern auch der letzte Traum von Bord und versank für immer in einem vom Sturm hochgepeitschten Mittelmeer.
»Tote in Meer komme wieder«, hatte Kio Johanna in der Asylbewerberunterkunft erklärt, wo sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Johanna war überrascht gewesen über sein Deutsch.
»Kinder lernen schnell«, hatte die Sozialarbeiterin erklärt.
Johanna hatte Kio weiter angesehen. »Warum werden die Toten wiederkommen?«
»Weil man muss Opfer. Niemand bringt Opfer für Tod.«
»Du meinst für die Toten?«
Kio nickte. Johanna mochte Kios Augen. In ihnen gingen Bitter und Süß miteinander spazieren, auch eine Redensart, die er aus seiner Heimat mitgebracht hatte.
»Die Deaddeads …«
»Die bösen Toten, die nicht zur Ruhe kommen«, erklärte Marceline, die mit in die Asylunterkunft gekommen war.
»… komme zurück und bringe Unglück für alle«, fuhr Kio fort. Seine Großmutter, so hatte er weitererzählt, sei mit vielen Opfergaben besänftigt worden, damit sie kein Verderben über die Lebenden brachte. Sein Vater – von seiner Mutter sprach Kio seltsamerweise nie –, die Geschwister, Onkel, Tanten, Cousins, der Großvater und auch die Nachbarn hatten die Großmutter wunderschön gekleidet und die Gliedmaßen liebevoll im Sarg geordnet, damit sie nicht brachen. Kios Großmutter sollte nicht als Behinderte wiedergeboren werden.
Die Beerdigung der Großmutter hatte die Familie viel Geld gekostet. Für Kios weite Reise in das gesegnete Europa und das heilige Land Deutschland war zu wenig übrig geblieben. Das zumindest hatte Johanna bei ihrer ersten Begegnung aus seinen Wortfetzen für sich zusammengeflickt. Über den Rest, warum und wieso, schwieg sich Kio aus.
Mein Gott, wo war sie schon wieder mit ihren Gedanken. Hier, in diesem Wagen brauchte jemand ihre Hilfe. Um ehrlich zu sein, hätte sie sich lieber neben Kio gestellt und mit ihm Opernarien gesungen. Orpheus und Eurydike zum Beispiel. Allerdings konnte sie nicht so schön singen, dass Zeus ihr erlaubt hätte, in den Hades hinabzusteigen und das Unfallopfer zu den Lebenden zurückzuführen. Sie sah sich um. Noch immer kein anderer Wagen auf der Landstraße und auch sonst alles menschenverlassen. Also gut: atmen, Johanna, atmen. Ruhig, ganz ruhig … atme …
Sie kippte den Kopf etwas zur Seite, um den Mann hinter dem Steuer genauer betrachten zu können. Eigentlich lag er ganz bequem auf einem weißen Kissen, das er wohl über das Lenkrad gebettet hatte. Johanna überlegte. Vielleicht gab es gar kein Unfallopfer. Vielleicht hielt der Fahrer nur ein Nickerchen, ohne zu ahnen, dass es unter seiner Kühlerhaube qualmte und er sich möglicherweise in einer gefährlichen Situation befand. Sie musste ihn einfach wecken. Sie nickte Kio aufmunternd zu. Alles gut! Kio verstummte. Lächelte. Er vertraute Johanna.
Aber nichts war gut. Denn gerade als Johanna die Hand hob, um vorsichtig gegen die Fensterscheibe zu klopfen –»Hallo, aufwachen, Ihr Auto brennt« –, erkannte sie, dass das Kissen ein Airbag war, auf den der Kopf wohl nicht sanft gebettet, sondern in das er mitten hineingeschleudert worden war. »Oh Gott!« Unwillkürlich fragte sie sich, wie oft sie den Herrn noch anrufen würde. Rasch schob sie Kio, der sich vorsichtig nähern wollte, wieder zurück. Sie hatte geschworen, dass er hier in Deutschland wieder Kind sein durfte. Mit Augen, die nichts mehr sehen mussten, was nicht für Kinderaugen bestimmt war, in denen nicht mehr Bitter und Süß, sondern Vertrauen und Hoffnung miteinander spazieren gingen.
»Wer bist du?«
»Kio. Unbegleiteter Jugendlicher ohne Status.« Das waren die ersten Worte, die er gesprochen hatte, nachdem sie und Marceline ihn aus einem überfüllten Tragluftzelt zu sich nach Hause geholt hatten. Kein Fenster gab es in diesem Zelt. Alles war irgendwie künstlich, sogar die Luft. Die etwa sechshundert Menschen schliefen in Stockbetten, von denen jeweils drei in Räumen wie Blechbüchsen aufgebaut worden waren. Keine Privatsphäre. Kein Augenblick der Stille. Nicht einmal nachts, denn nachts kamen die Alpträume. Und wenn es regnete, klang es, als würde ein Trommelfeuer über das Zelt hereinbrechen. Vor allem die Kinder fürchteten erneuten Krieg, fingen an zu weinen und gingen in Deckung. Hinter dem Rücken des Vaters, der Mutter, dem, der am nächsten stand. Nie wieder! Zumindest nicht für Kio. Nichts sehen, hören, riechen, schmecken müssen, was nicht für ein Kind bestimmt war!
Kio stand da, sang nicht, beobachtete Johannas Körpersprache, die mit nur einem Wort beschrieben werden konnte: Ratlosigkeit.
Johanna hatte eine Eigenschaft, die sie selbst unerhört störte. So schnell sie sonst war, in Konfliktsituationen arbeitete ihr Gehirn langsamer als sonst. Das hier war eine Konfliktsituation. Kopf in Airbag gebohrt, möglicherweise Genickbruch, Mensch dem Feuertod vermutlich nah, gleichzeitig Kühlerhaube, aus der es qualmte wie in Marcelines kleiner Whiskeybrennerei, wenn der heiße Wasserdampf die Maische zum Kochen brachte und der darin enthaltene Alkohol verdunstete.
Kio begann erneut zu singen, wie immer, wenn ihn etwas aus dem Gleichgewicht brachte. Es dauerte noch einmal den Bruchteil einer Sekunde, dann kapitulierte das Denken, und Panik schoss Johanna in den Kopf. Okay. Ich zieh den Typen raus. Nur wie? Johanna hatte noch eine Eigenschaft, wenn sie nicht weiterwusste. Sie redete mit sich selbst. »Ich darf nichts falsch machen.« Kio indessen schmetterte nicht mehr das Trinklied aus La Traviata, sondern Puccinis Nessun dorma.
Johannas Erste-Hilfe-Kurs war schon ewig her, das Unfallopfer tat ihr nicht den Gefallen, wieder zu sich zu kommen, war also immer noch nicht in der Lage, sie bei der Rettungsaktion zu unterstützen. Ein falscher Handgriff konnte mögliche Verletzungen noch verschlimmern. Kio sang sich die Kehle aus dem schmalen und doch muskulösen Leib. Die Melodie stimmte, der Text war irgendetwas Zusammengestöpseltes aus seiner Muttersprache.
Alles egal, ruhig weiteratmen, Johanna, dann die Autotür öffnen. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass der Motor noch lief. Okay, okay, weiter ruhig bleiben. Zündschlüssel umdrehen, Motor abstellen. Schneller Blick. Wie viele Personen waren im Wagen? Nur der Fahrer. Gut. Atmen, ruhig weiteratmen. Ob er schwer verletzt war? Sie fühlte seine Halsschlagader. Er lebte. Gott sei Dank. Nur – wie sollte sie ihn aus dem Wagen befördern? Ihn sitzen lassen und den Notarzt verständigen? Nein, da waren Qualm und Rauch. Sie musste ihn rausziehen. »Kio, hilf mir bitte!« Kios Gesang brach ab. »Bitte, Kio, ich brauch dich.« Kio senkte die Augenlider, so dass seine schwarzen, dichten Wimpern fast die Wangenknochen berührten. Gleichzeitig schien es, als lege eine unsichtbare Hand einen Pfeil in seinen Körperbogen, bis er von Kopf bis Fuß nur noch Spannung war, und dann kam er – stolz und aufrecht wie ein Krieger und wie sein Vater es ihn gelehrt hatte – auf Johanna zu. Packte ernst und konzentriert die Fußgelenke des Mannes, übernahm auch sonst das Kommando und wies Johanna an, die Hände unter die Achseln des Mannes zu schieben. Johanna tat es: »Eins, zwei, drei …« So zogen, hoben und zerrten sie den bewusstlosen Mann aus dem Wagen. Zerrten ihn weiter, bis er außer Reichweite einer möglichen Explosion war. Betteten ihn gemeinsam ins Gras.
Johanna wählte die Rettungsnummer, gab die nötigen Eckdaten weiter und zog ihr T-Shirt aus – Kios Augen wurden riesig, als er ihre kleinen, festen Brüste unter dem BH erahnte. Johanna hatte keine Zeit, sich darum zu kümmern, was ihr Anblick bei einem Jungen zu Beginn der Pubertät auslöste. Sie rollte das T-Shirt zusammen, hob behutsam den Kopf des Mannes, um das T-Shirt ebenso vorsichtig darunterzuschieben, und – vergaß zunächst alles. Das T-Shirt, Kio, der die Augen nicht von ihr abwenden konnte, ja, sogar den Kopf des Mannes, das heißt, sie vergaß nur den Hinterkopf, denn da war dieses Gesicht, das sie jetzt sanft in beiden Händen hielt. Das Gesicht, das sie sehr viel später in Maxi Wildgrubers Radiosendung als das Gesicht eines Botticelli-Engels bezeichnen würde. Jetzt aber legte erst einmal das Atemzentrum seine Tätigkeit nieder, das sich selbst nachts um seinen Menschen kümmert.
Johanna glaubte nicht an Vorhersehung. Aber ihn, der jetzt vor ihr lag, hatte sie vorhergesehen … und zwar erst vor wenigen Minuten, als sich Herr Hut vor ihrem inneren Auge in einen Prinzen verwandelt hatte. In diesem Moment schlug der Botticelli-Prinz die Augen auf.
4
Lachen, bis der Bauch weh tut und die Augen tränen.
Zuerst sah Leon nur zwei sanfte Wölbungen in zwei blütenweißen Körbchen, die er aufgrund vielfacher Erfahrung als einem BH zugehörig identifizierte. 85 B. Diese richtige Einschätzung hatte er Kio voraus. Er schnupperte. Erdig, gewürzt mit viel frischer Luft und dem Geruch von Moos. Er wollte schon den Kopf in das versenken, was er neben dem etwas tiefer gelegenen Bereich unter dem Bauchnabel ebenfalls als Himmelreich bezeichnete, als ihn drei Dinge von seinem Tun abhielten. Ein messerscharfer Stich, der ihn aufschreien ließ. Und die Frau, deren Gesicht er streifte, roch zwar nach seinem Typ Frau, war es aber nicht. Das Haar rotgolden, das hätte man ja noch durchgehen lassen können, aber es war kurz und stand wie die Borsten eines alten Besens in alle Windrichtungen. Dazu Sommersprossen, wenn auch nur vereinzelt und nur auf der Nase, tiefblaue Augen. Die Augen waren schön. Wie das Meer, in dem sich die Sonne spiegelt. Verdammt! Dieser Scheißschmerz, was war überhaupt los mit ihm? Diese Lippen, mit Mundwinkeln, die sich ganz leicht nach oben wölbten, wie ein sanftes, immerwährendes Lächeln. Egal. Frau bleibt Frau. Offenbar hatte er sie irgendwo aufgerissen, und, da er offensichtlich nüchtern war – weder Alkohol noch Koks –, trotz ihrer unmöglichen Frisur wohl nicht ohne Grund.
Sein Gehirn war zwar vernebelt, doch Gelegenheit macht Sex, er wollte sie schon küssen, da schob sich etwas zwischen ihn und die Frau. Es war ein Blick ohne jede Freundlichkeit. Aus großen, dunklen Augen ohne jede Scheu. Augen, die ihn einzuverleiben schienen, um ihn danach zu verdauen und wieder auszuscheiden. Wo war er da nur hineingeraten? Und in seiner Position war er eindeutig der Unterlegene.
Obwohl Gesichter aus der Perspektive, die er gerade innehatte, immer irgendwie verschoben wirkten und Leon mittlerweile der ganze Körper weh tat, erkannte er nun, dass der Blick ohne Freundlichkeit und Scheu zu einem Jungen gehörte. Sein Gesicht war schwarz wie – Leon fiel kein anderer Vergleich ein – wie das Ebenholz der Intarsien in seinem chinesischen Sekretär, den er und Sarah auf einem Trödelmarkt gefunden hatten und auf den er besonders stolz war.
Leon wollte sich den Jungen näher ansehen, doch da hatte ihn die Frau mit dem rotblonden Besenhaar schon weggezogen. Er spürte noch ihren Atem und bemerkte jetzt, dass sie Knoblauch gegessen hatte. Ganz bestimmt nicht mit ihm. Leon stöhnte auf. Er hasste Knoblauch und untersagte seinen Begleiterinnen, Knoblauch zu sich zu nehmen, falls sie mehr von ihm wollten, und diese Scheißschmerzen im Fuß hasste er noch mehr. Gleichzeitig presste er zwischen den Lippen hervor: »Und wer bist du?« Die Frage war an den Jungen gerichtet.
»Unbegleiteter Minderjähriger ohne Status«, antwortete er wie aus der Pistole geschossen, baute sich im Licht der untergehenden Sonne vor Leon auf und fügte mit dem ganzen Stolz, zu dem er fähig war, hinzu: »Mein Name ist Kio Achebe vom Stamm der Igbo.«
»Er ist ein Krieger«, ergänzte Johanna sanft, nahm Leons Handgelenk und fühlte ihm mit dem Daumen den Puls.
War dies alles schon seltsam gewesen, wurde es jetzt noch seltsamer. Er hatte etwas zugelassen, daran erinnerte er sich dunkel. Nur mit wem? Und wo? Irgendetwas war mit seinem Kopf. Diese verfluchte Leere. So sehr er es auch versuchte, in seiner Vorstellung durch jede einzelne Gehirnwindung tappte er auf der Suche nach irgendetwas, an dem er sich orientieren konnte. Da war nichts. Nur ein riesiges Durcheinander mit ganz viel Watte drum herum. Er erinnerte sich nicht mehr. Hatte keine Ahnung, was geschehen war. Warum er im Gras lag mit diesen merkwürdigen Menschen über sich, dieser Frau, dem farbigen Jungen, und der Wagen … Verdammt noch mal, wo war sein Wagen? Leon versuchte, den Kopf zu wenden, doch ihm wurde schwindlig. Die Sonne verschwamm, und der Mond ging ebenso verschwommen auf.