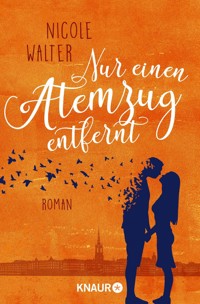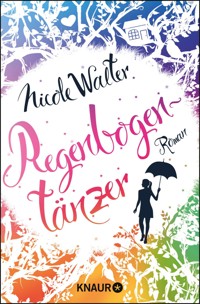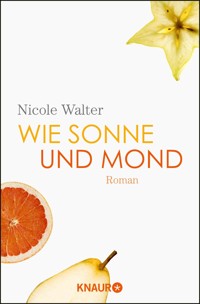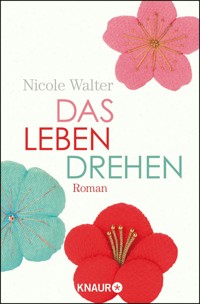6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit den Alpakas kommt das Glück Ein bewegender Roman um eine Frau, die doch noch ihren Platz im Leben findet – auch mithilfe von Alpakas Wirklich glücklich war Maria Popp eigentlich noch nie in in ihrem Leben, das aus Pflichterfüllung und Alltag besteht. Als sie einen Arche-Hof besucht, um als Sachbearbeiterin einer großen Bank über einen dringend benötigten Kredit zu entscheiden, sieht Maria sofort, dass sie das Geld nicht gewähren kann. Die bunt zusammengewürfelte Schar der Bewohner ist zwar überaus kreativ in ihren Bemühungen und liebenswert noch dazu – trotzdem geht die Rendite des Hofes gegen null, seit Henri, der Gründer der Arche, vor lauter Trauer um seine kürzlich verstorbene Frau wie gelähmt ist. Da helfen auch die Umarmungen von Henris Sohn Bobby nicht weiter, der das Down Syndrom hat. Oder etwa doch? Die menschliche Wärme und der Zusammenhalt auf dem Hof wecken etwas in Maria, das sie längst verloren geglaubt hat – und bringen sie schließlich auf die rettende Idee, bei der Alpakas keine unerhebliche Rolle spielen. Nicole Walter, die Bestseller-Autorin von »Das Leben drehen«, hat erneut einen einfühlsamen, Mut machenden Roman darüber geschrieben, was das Leben ausmacht. Von Nicole Walter ebenfalls lieferbar sind die Romane »Wie Sonne und Mond« und »Regenbogentänzer«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Nicole Walter
Ein Blick in deine Augen
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Mit den Alpakas kommt das Glück
Ein bewegender Roman um eine Frau, die doch noch ihren Platz im Leben findet – auch mithilfe von Alpakas.
Wirklich glücklich war Maria Popp eigentlich noch nie in in ihrem Leben, das aus Pflichterfüllung und Alltag besteht.
Als sie nun einen Arche-Hof besucht, um als Sachbearbeiterin einer großen Bank über einen dringend benötigten Kredit zu entscheiden, sieht Maria sofort, dass sie das Geld nicht gewähren kann. Die bunt zusammengewürfelte Schar der Bewohner ist zwar überaus kreativ in ihren Bemühungen und liebenswert noch dazu – trotzdem geht die Rendite des Hofes gegen null, seit Henri, der Gründer der Arche, vor lauter Trauer um seine kürzlich verstorbene Frau wie gelähmt ist. Da helfen auch die Umarmungen von Henris Sohn Bobby nicht weiter, der das Down Syndrom hat.
Oder etwa doch? Die menschliche Wärme und der Zusammenhalt auf dem Hof wecken etwas in Maria, das sie längst verloren geglaubt hat – und bringen sie schließlich auf die rettende Idee, bei der Alpakas keine unerhebliche Rolle spielen.
Inhaltsübersicht
Für
Christine,
Manfred
und
all die Menschen,
durch die die Welt bunter und wärmer wird
Wer seinen Gegner umarmt, macht ihn bewegungsunfähig.
Aus Tunesien
Für BobbyGeschichten werden wahr, sobald wir an sie glauben.
Als die Menschen ihr Lächeln verloren
Es war zu jener Zeit, als das Volk der Inkas im Land des Kondors und der sprechenden Berge lebte. Der Reichtum der Inkas war das Gold, auch die Perlen der Sonne genannt. Sonnengott Inti hatte es seinem Volk im fernen Peru geschenkt. Nicht, um sich etwas zu kaufen oder darum zu streiten oder gar dafür zu töten. Nein, in seinem Glanz sollte sich die Schönheit des Menschen widerspiegeln. Seine Klugheit, seine Fähigkeit zu Mitgefühl und Liebe und vor allem sein Lächeln. Dieses wunderschöne Lächeln war noch wertvoller als Gold. Es war das Lächeln, das Inti seinen Söhnen und Töchtern mitgab. Nicht, um über sein Volk auf Erden zu herrschen, sondern, um es zu besseren Menschen zu machen.
Doch was glitzert, bleibt nicht verborgen. So erreichte eines Tages die Kunde über das sagenhafte Goldland »Biru« auch Europa, das zu jener Zeit bereits von einer zerstörerischen Krankheit befallen war, der Gier. Hat sie den Menschen einmal erfasst, ist er für immer verloren.
Es waren die Spanier, die »Biru« nach langer Suche schließlich fanden. Vielleicht auch, weil Inti nicht damit zufrieden war, wie seine Söhne sein Reich verwalteten. Die Inkas waren nicht zu besseren Menschen geworden, sie fühlten sich als die besseren Menschen und machten andere Völker zu Untertanen. Das Volk Intis – des Vaters der Sonne, der Quelle des Lichts und der Wärme, des Beschützers der Menschen – war hochmütig geworden. Dennoch empfing es die Spanier mit Geschenken und natürlich mit einem Lächeln. Doch die Spanier raubten ihr Gold und brachten ihnen Krankheiten, die töteten. Das Schlimmste aber war, dass das Volk der Inkas sein Lächeln verlor.
Du, Bobby, der du lächeln kannst wie kein anderer, du, der du mit deinem Lächeln jedes Herz erreichst, weißt, was das heißt – ein Leben ohne Lächeln. Es ist ein einsames Leben. Ein Leben ohne Bedeutung, ein trauriges Leben und – vor allem – ein Leben ohne Liebe.
So kam der Tag, an dem Inti seinen Söhnen verzieh und dem Volk der Inkas Gnade zukommen ließ. Er machte ihnen etwas zum Geschenk, das viel wertvoller ist als Gold. Er gab ihnen ihr Lächeln zurück. Er schenkte ihnen das Alpaka. Ein Geschöpf Gottes und des ewigen Lächelns: Ein Blick in seine Augen, so heißt es, und man ist für immer an es verloren.
Und jetzt sind wir es, die unser Lächeln verloren haben, weil wir gebeutelt sind von Gier und nur noch an uns denken und nicht mehr an den anderen. Weil Zeit etwas ist, hinter dem wir ständig herlaufen, obwohl wir niemals in der Lage sind, sie einzuholen. Weil das Leben für uns kein Geschenk mehr, sondern selbstverständlich geworden ist.
Aber wir haben Glück, denn das Alpaka hat sich auf den weiten Weg von Südamerika nach Europa gemacht. Um uns zu heilen mit seinem Lächeln, das es uns jeden Tag schenkt, und auch, um uns daran zu erinnern, wer wir vielleicht noch nicht sind, aber wer wir sein können. Auf dem Archehof und wo immer wir dem Alpaka begegnen.
In ewigem Lächeln.
Deine Maria Popp, deine Frau Bank und vor allem deine Mary Poppins
1.
Mehr lieben und dafür mehr leiden?
Weniger lieben und dafür weniger leiden?
Möglicherweise war das die Frage, die sich der erste Sonnenstrahl auch an diesem Montagmorgen stellte, während er vorsichtig, aber doch neugierig durch den Spalt der heruntergelassenen Jalousie kroch.
Erst einmal sah er sich um, der durchaus erbetene Gast, und entdeckte nichts, das auf mangelnden Ordnungssinn hätte hinweisen können.
Kein Stäubchen, das erst durch Sonnenlicht offenbar wurde. Die Hausschuhe mit den rosafarbenen Puscheln standen ordentlich neben dem Bett. Die Bürokleidung war zurechtgelegt beziehungsweise hing akkurat an der Schranktür auf einem Bügel. Für den heutigen Tag war ein knielanger Bleistiftrock mit weiß-schwarzem Karomuster ausgewählt worden. Dazu passend eine weiße Bluse mit Stehkragen und Schleife, und falls das Unerwartete geschah und das Wetter trotz der angekündigten dreißig Grad umschlagen sollte, lag ein graues Wolljäckchen bereit. Offenbar gehörte es zum Charakter der Bewohnerin der Zweizimmerwohnung im Münchner Norden, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.
Blitzblank polierte Schuhe mit hohen Absätzen und ein knallroter Melonenhut rundeten das Bild ab. Das Dessous allerdings, das auf einem geblümten Lehnstuhl wie hingegossen bereitlag, war von der Art, die der Sonne die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätte, wäre sie dazu in der Lage gewesen. So aber ließ sie die Strahlen weiter über das gepflegte Parkett gleiten bis hin zu den tadellos geputzten Bodenfliesen im Bad, über das Waschbecken mit seinem auf Hochglanz polierten Wasserhahn, hinauf zum Spiegelschrank, auf dessen freier Fläche unter dem glasklaren Spiegel acht Zahnbürsten wie kleine Soldaten vor Dienstbeginn schon einmal strammstanden. Für jeden Tag eine Zahnbürste. Und ein Ersatz, falls, ja, falls doch irgendwann das Unerwartete geschah und …
… das Geräusch klirrender Münzen riss Maria aus dem Tiefschlaf. Durch ihre Schlafmaske noch blind, tastete sie nach dem Wecker, stellte ihn ab, obwohl nicht er es war, der geläutet hatte, nahm die Stöpsel aus den Ohren, tastete weiter nach dem Smartphone mit dem Klingelton einer alten Registrierkasse, den Aaron originell gefunden und den sie seitdem nicht verändert hatte, zögerte einen Augenblick, während das Herz bis zum Hals klopfte. Atmete tief durch, nahm die Schlafmaske ab, wagte den Blick auf die WhatsApp, und das Herz stellte sein Klopfen ein.
Da stand es schwarz auf weiß: Passt nicht! Ohne auch nur den Hauch von sorry. Kein Wiedersehen also, aber daran war sie inzwischen gewöhnt, und an männliche Absagen, von denen es offenbar nur drei Kategorien gab, sowieso.
Kategorie 1, sie nannte es auch klare Kante: Es hat nicht klick gemacht.
Kategorie 2, die sanfte Tour: Ich will dich nicht verletzen, aber … und danach die Litanei, weshalb derjenige einfach nicht gut genug für diejenige, also sie, sei.
Kategorie 3 war die unangenehmste. Vor allem, wenn man das Gefühl hatte – so wie Maria am vergangenen Abend –, dass es durchaus hätte passen können. »Kein Interesse«, stand kurz und knapp auf ihrem Display, und damit war sie ausgeknockt, k.o. in der ersten Runde. Keine Tränen, aber die Frage, warum? Und warum immer wieder ich?
Sie hatten sich gut unterhalten bei Kerzenlicht, einer hervorragenden Pasta und exklusivem Wein. Und auch sonst mit allem, was für einen gelungenen Abend nötig war.
Zumindest bis zu dem Augenblick, als ihre Perlenkette riss, weil sie etwas zu heftig daran herumgespielt hatte. Okay, es war schon ein wenig peinlich gewesen, wie sie in ihrem engen Rock auf Knien über den glatten Boden des nicht gerade günstigen Restaurants gerutscht war, um die Perlen, eine Hinterlassenschaft ihrer Mutter, aufzusammeln. Und Aufmerksamkeit erregt hatte es auch bei den eher noblen Gästen. Doch er hatte wie ein Kavalier reagiert, war sogar mit ihr auf dem Boden herumgerutscht, bis sie gemeinsam alle Perlen eingesammelt hatten. Danach hatten sie erst einmal zusammen gelacht. Und wie sehr sie gelacht hatten. Hieß es nicht, gemeinsames Lachen sei das Wichtigste außer gutem Sex?
Auch deshalb hatte sie gehofft und, nachdem sie zwar allein, aber beschwingt nach Hause gekommen war, das passende Dessous für eine nächste Verabredung zurechtgelegt. Passt nicht. Fini. Vorbei. Ausgeträumt.
Vielleicht, so überlegte Maria, als sie jetzt mit beiden Füßen, von denen Aaron immer geschwärmt hatte, sie seien so wunderbar zierlich, nach ihren Puschelpommelpantoffeln, kurz Ppps, angelte, vielleicht hatte sie auch zu viel über Digitalisierung und den FinRech-Boom gesprochen? Darüber, dass beides zum Wandel des Geschäftsmodells und am Ende durchaus zu Filialschließungen der Banken führen konnte.
Wenn sie es jedoch, die Jalousien schnellten hoch, recht bedachte, hatte im Grunde nur sie geredet, während er immer stiller geworden war und sich ein Glas Wein nach dem anderen eingeschenkt hatte.
Maria blinzelte ins Sonnenlicht, das sich ihr sanft übers Gesicht legte, einem Gesicht von fast nostalgisch anmutendem Zauber. Große, dunkelbraune Augen unter perfekt geschwungenen Brauen. Am schönsten war ihr Mund in dem immer etwas zu blassen Bürogesicht.
Aaron hatte ihn als rosenblütengleich beschrieben, bevor er sie vor acht Jahren zum ersten Mal geküsst hatte. Sie waren am Meer gewesen. Auf seinem Segelboot. Das Segel hatte im Wind geflattert wie ein aufgeregt schlagendes Herz.
Ihr Herz, so unbeschreiblich glücklich. Ein »Nein« undenkbar. »Ja, ja, ja«, das hatte sie hinausrufen wollen. Ein immerwährendes Ja zum Leben. Doch sie hatte geschwiegen, lieber Kursänderung, weg vom Wind, von dem man nie weiß, wohin er einen trägt.
»Wir brauchen vier Umarmungen am Tag zum Überleben, acht Umarmungen zum Leben und zwölf Umarmungen zum inneren Wachstum«, das hatte Maria erst kürzlich in einer Anzeige gelesen. Sie kam von einer Frau namens Pusca, angeblich mit Talent für das mütterliche Auffangen von Menschen, die ein wenig Liebe benötigten. Aufmerksamkeit und Geborgenheit durch Umarmen, auch das stand in Puscas Anzeige. Und das für den sensationell geringen Stundenlohn von neunundachtzig Euro.
Maria hatte nachgerechnet. Falls Puscas einstündige Kuschel- und Gefühlstankstelle den Tagesbedarf an Umarmungen decken sollte, würde ein auf diese Weise gesund gehaltener Körper im Monat 2620 Euro kosten. Andererseits war Marias letzte Umarmung schon einige Zeit her. Um genau zu sein: Das letzte Mal war sie am 21. April 2017 umarmt worden, als Aaron ihre Verlobung gelöst hatte und sie vor Schreck ohnmächtig in seine Arme gesunken war.
Erinnerungen sind Versprechen, die nicht eingehalten werden, hatte sie irgendwo gelesen. Der Satz hatte ihr gefallen.
Also dann vielleicht doch Pusca, Hund, Katze oder – die nächste Verabredung mit einem Unbekannten, vermittelt durch die Partneragentur mit dem Slogan: Alle zehn Minuten beendet ein Single durch uns sein einsames, weil ohne Partner, sinnloses Dasein. Warum kam ausgerechnet sie immer erst in der elften Minute an?
Mit einem Seufzen dachte Maria an ihren letzten No-go-Typen. Einem Mann, mit dem es nirgendwo hinging, und schon gar nicht hinauf zu Wolke sieben oder über das Meer mit flatterndem Herzen und Segel zur Insel der Glückseligkeit. Es hatte alles gepasst, Alter, Job, Aussehen, nur nicht – die Zähne.
»Mach dir keine Sorgen, ich lasse sie mir bleichen«, hatte er sie gleich beim ersten Date beruhigt.
»Warum, deine Zähne sehen doch gut aus«, hatte wiederum sie ihn beruhigt.
»Aber nein, schau mal …« – Mund auf, Mund zu – »gelb, aber sobald sie gebleicht sind, sind sie wunderbar weiß. Dann lach ich auch wieder. Ich lache gern, weißt du?«
»Das freut mich.« Maria hatte gelächelt und das Thema gewechselt. Sie hatten einen angenehmen Nachmittag miteinander verbracht, waren erneut verabredet gewesen, bis er sie angerufen hatte.
»Maria.« Er, düstere Stimme, sie, alarmiert.
»Ja?«
»Ich muss unsere Verabredung absagen.«
Kategorie eins, zwei oder drei?
»Die Zähne, Maria. Sie sind durch das Bleichen komplett unnatürlich …«
Gleich darauf eine WhatsApp mit einem in die Kamera zähnefletschenden Foto und der Nachricht: Mach dir keine Sorgen, die Zähne dunkeln nach.
Sie hatte ihn getröstet, dass es nicht so schlimm sei, er hatte geantwortet, aber nur, weil der Zahnarzt erst die beiden Vorderzähne gemacht habe, sie hatte ihm vorgeschlagen, die Zähne dann eben so zu lassen, da die Zähne von selbst wieder nachdunkeln würden, sobald man genügend Rotwein und Tee zu sich nahm.
Diese Aussage wiederum hatte zu ihrem ersten Missverständnis geführt, er hatte sich von ihr unverstanden gefühlt und sie als herzlos tituliert. Seine Zähne sollten nicht nachdunkeln, sondern weiß erstrahlen. Mit denen liefe er aber Gefahr, hatte Maria zu bedenken gegeben, dass sie dann eher unnatürlich seien. Er hatte nachgedacht, eingelenkt, sich für das »herzlos« entschuldigt und sich entschieden, doch nichts mehr an den Zähnen machen zu lassen.
»Dann bist du jetzt zufrieden?«, hatte sie bei einem Isarspaziergang Hoffnung geschöpft, dass die Matchpoints zwischen ihnen nicht nur theoretisch waren, sondern auch dem realen Leben standhielten.
Er hatte genickt. »Weil mich der ganze Mist jetzt keine zweitausend Euro, sondern nur vierhundert Euro kostet.«
Maria hatte kein Wort mehr verloren. Sie war gegangen. Mehr noch, sie war geflohen vor alldem, was sie von so einem Mann noch zu erwarten hatte.
»Was ist los?«, hatte er ihr eine WhatsApp hinterhergeschickt.
Sie hatte sich für die Absage der Kategorie 1, klare Kante, entschieden. »Es hat nicht klick gemacht!«
Einsamkeit war eine Bitch. Maria verzichtete auf das Dessous, das ohnehin nur zwischen den Pobacken gekniffen und gezwickt hätte, wählte Unterhosen- und BH-technisch die bequeme Variante, zwängte sich in Bleistiftrock, frisch gebügelte weiße Stehkragenbluse und High Heels. Hinfallen, aufstehen – oh nein, nicht Krone geraderücken, sondern den von ihr heiß und innig geliebten roten Melonenhut aufsetzen, weitermachen und – erneutes Münzgeklingel – einen neuen Partnervorschlag annehmen. Nicht jetzt. Sie musste los.
2.
Eine Brücke aus Gras mitten im Chiemgau.
Während Maria Popp im neunzig Kilometer entfernten München das Haus verließ, um sich in den morgendlichen Berufsverkehr zu stürzen, dachte Bobby inmitten einer Herde von Alpakas sitzend über Grasbrücken nach.
Oma Hartmann hatte ihm am vergangenen Abend davon erzählt. Mit Oma Hartmann, die nicht wirklich seine Oma war, verheiratet mit ihrem Ehemann, dem Alten Paul, der nicht wirklich alt war, den Sesay-Kumaras aus Sierra Leone und seinem Vater Henri und seiner Schwester Stephanie lebte er seit fünf Jahren auf dem Archehof, von dem seine Mutter Ella einmal gesagt hatte, dass mit so einem Hof alle Märchen begännen.
Die Grasbrücke war jedoch kein Märchen. Es gab sie wirklich in einem fernen Land namens Peru, und jetzt rätselte Bobby, während Alpakastute Suri erneut unverrichteter Dinge vom Kotplatz zurückkam, wie diese Brücke wohl zustande kam. Wie sie aussah, vor allem aber, was Menschen bewog, so etwas Außerordentliches in Angriff zu nehmen.
Die kräftigsten Grashalme wurden dafür benötigt, die dann miteinander zu starken Seilen verflochten wurden, so zumindest hatte es Oma Hartmann ihm erklärt. Mit dem leichten Summen in der Stimme, von der der Alte Paul behauptete, sie habe es von den Alpakas übernommen, als sie einige Monate mit den Q’eros, den Nachfahren der Inkas, im Hochland der Anden gelebt hatten.
Diesem So-weit-weg-Land, wie Bobby es nannte, wenn er wieder einmal den Namen vergessen hatte. Dieses ferne Land mit seinen glitzernden Lagunen, eisigen Nächten, schneebedeckten Gipfeln und Terrassenlandschaften, die sich hinter den Dörfern so zauberhaft grün in die Höhe schraubten.
Nicht nur Bobby war von der Brücke aus Gras fasziniert, sondern auch Steph, wie Bobby seine Schwester nannte, nicht immer ganz sicher, ob sie ein richtiges Mädchen war. Zumindest sah sie nur ganz selten so aus in ihren viel zu weiten Hosen und den kurz gesäbelten Haaren.
Auch Oma Hartmann sagte immer, Steph sei ein Wildfang, der schon immer lieber auf Bäume geklettert war, als unter ihrem Blattwerk mit Puppen zu spielen.
Die drei Töchter von Mariama und Abubakar aus Sierra Leone waren dagegen genau das, was sich Bobby unter richtigen Mädchen vorstellte. Sie trugen Kleider, und Mariama stand jeden Sonntag vor der Messe extra früh auf, um ihren Töchtern die ausgefallensten Frisuren zu flechten. Abubakar sang mit Stephanies Freund Kio im Gospelchor, und die Familie Sesay-Kumara ließ, obwohl sie Muslime waren, keinen katholischen Gottesdienst aus, denn, wie Mariama zu sagen pflegte: Gott ist überall!
Oft sah Bobby Mariama, das Kinn auf seinen gefalteten Händen mit den etwas zu kurzen Fingern aufgestützt, beim Flechten zu und wunderte sich, was man mit krausen Haaren so alles anfangen konnte. Vor allem die Frisur gefiel ihm, die Mariama »Cornrows« nannte. Manchmal lief das, was tatsächlich aussah wie die Reihen von Getreidefeldern, von vorn nach hinten. Manchmal waren sie leicht gekrümmt, und auch ihre Abstände waren verschieden.
Zuerst feuchtete Mariama das Haar an, kämmte es so gut es ging durch, band den Teil, der nicht bearbeitet wurde, zu zwei Rattenschwänzen und begann zu flechten, indem sie das Haar fest von der Kopfhaut wegzog. Am Ende wurde das kleine Kunstwerk mit bunten Perlen verschönt.
Auch der Alte Paul sah gelegentlich zu, wenn Mariama ihren Töchtern die Zöpfe flocht. Offenbar hatte Oma Hartmann die Haare, die jetzt kurz, grau und struppig wie Borsten waren, früher auch so getragen. Damals, als sie und der Alte Paul noch im VW-Bus um die Welt gereist waren. Dann war ihnen das Geld ausgegangen, und so hatten auch sie auf dem Archehof ein neues Zuhause gefunden.
Diesem Platz an der Sonne, wie Bobbys und Stephanies Vater Henri den Hof auch gelegentlich nannte, weil sie die Familie Sonnenschein waren, für die die Sonne niemals unterging.
Doch sein Vater hatte sich getäuscht. Sie alle hatten sich getäuscht.
Seit genau einem Jahr war die Sonne fort und ging vor allem für Henri nicht mehr auf. Obwohl Bobby jeden Morgen als Erstes in sein Zimmer lief, die Vorhänge zurückzog, die Fensterläden aufklappte und rief: »Schau, Papa, das Leben ist schön!« Egal, ob die Sonne schien oder es in Strömen regnete.
Doch Henri Sonnenschein antwortete bloß: »Nur noch fünf Minuten, Bobby«, drehte sich zur Wand und zog die Decke über den Kopf.
Danach saß Bobby jeden Morgen bei Mariama in der Küche mit den vielen bunten Kissen auf der gemütlichen Eckbank und den lustig im Wind flatternden Vorhängen, starrte auf die Küchenuhr, und sobald der große Zeiger auf die letzte der fünf Minuten rutschte, sprang er auf, lief zu seinem Vater.
»Die fünf Minuten sind vorbei!«
Doch wieder antwortete Henri, die Stimme noch schleppender als zuvor. »Noch fünf Minuten, Bobby!«
Und so vergingen an manchen Tagen fünf Minuten um fünf Minuten, und Bobby wartete und wartete bis zum Abend auf seinen Vater; dass er wenigstens ein Mal aufstand, ehe er sich wieder schlafen legte.
Er hatte wieder einmal vergeblich gewartet, als ihn der Alte Paul an die Hand nahm und in sein Zimmer führte. Zu seinem magischen Globus, der so wunderbar von innen heraus leuchten konnte.
»Schau mal, Bobby«, hatte er gesagt, »diese vielen Farben und Formen, die sich mit jedem bisschen Drehen verändern. Das passiert auch, wenn du die Perspektive wechselst …«
»Perspektive?«
»Die Stelle, Bobby, an der du stehst. Was ich dir sagen will, ist, alles verändert sich, bewegt sich. Manchmal, weil sich die Dinge bewegen, manchmal aber auch, weil du dich bewegst. Wie auch immer. Nichts bleibt, wie es ist.«
»Deshalb ist Papa auch nicht mehr so, wie er war?«
»Viel wichtiger ist, dass auch dein Papa nicht so bleiben wird, wie er jetzt ist. Hab Vertrauen, Bobby.«
Bobby hatte einen Augenblick gebraucht, um zu begreifen, was der Alte Paul ihm damit sagen wollte, und noch schwerer fiel es ihm, dem Alten Paul zu glauben. Deshalb hatte er sich lieber zeigen lassen, wo der Archehof lag und woher die Alpakas kamen und Mariama mit ihrer Familie. Paul hatte den Globus um die eigene Achse gedreht und ihn dabei immer wieder gestoppt.
»Von so weit weg? Die Alpakas und die Kumaras?« Bobbys leicht schräg stehende Augen waren groß geworden, und er hatte nach und nach seinen etwas zu kurzen rechten Zeigefinger auf das Chiemgau, Peru und Sierra Leone gelegt. »Nur«, seine Stimme war nicht mehr als ein Hauch gewesen, »nur, um bei uns zu sein?«
»Weil der Archehof der schönste Fleck auf Gottes Erdboden ist und alle hier in Frieden miteinander leben können«, hatte der Alte Paul geantwortet.
Wenn es jemand wusste, dann der Alte Paul. Und so hatte sich Bobby entschieden, vertrauensvoll auf die Veränderung zu warten, von der Paul gesprochen hatte, war erneut zu seinem Vater gelaufen und hatte ihn beschworen, dass auch er, trotz allem, auf dem Archehof in Sicherheit war.
Es hatte nichts geholfen.
Sein Vater ließ noch immer weder Licht noch Leben in den dunklen Raum, den er nur hin und wieder verließ, um das Nötigste an Körperpflege zu verrichten.
Jetzt, inmitten der Alpakas im Gras liegend, den alten Baumbestand mit dem Brunnen vor, die endlosen Wälder und Getreidefelder hinter sich, die schneeweiße Suri beobachtend, an einem Grashalm kauend, über die Brücke aus Gras nachdenkend und darüber, was Paul über das Leben und den Archehof gesagt hatte, wusste Bobby auf einmal, was der Archehof und die Brücke gemeinsam hatten. Beides war erbaut worden, um Menschen und Tiere über weite Wege und tiefe Schluchten hinweg zu verbinden. Und warum tat der Mensch so etwas? Aus Liebe.
Außer sich vor Freude über diese Erkenntnis sprang Bobby auf, hätte am liebsten alle umarmt, die schneeweiße Suri, die eitle Bella Donna, die brave Happy, den frechen Jason …
Am liebsten hätte er die ganze Alpakaherde in den Arm genommen. Doch Alpakas mochten es nicht, umarmt zu werden, das hatte ihm Oma Hartmann erklärt, als er sich gleich auf Suri, das erste Alpaka, das auf dem Archehof angekommen war, hatte stürzen wollen.
Alpakas bespuckten zwar keine Menschen, sondern nur sich selbst, wenn sie sich belästigt fühlten, aber sie liefen davon. Suri war vor ihm weggelaufen.
Auch das hatte Oma Hartmann ihm erklärt: »Kommt man einem Alpaka zu nahe, denkt es nicht mehr, sondern handelt instinktiv, also nur aus einem Gefühl heraus. Entweder ist es wie gelähmt, oder es flüchtet, manchmal kämpft es sogar.«
»Oh!«
»Deshalb musst du immer dafür sorgen, dass sich ein Alpaka in deiner Nähe sicher fühlt, Bobby. So kann es seinen Verstand benutzen und herausfinden, was du von ihm willst.«
Als Belohnung, weil er von Anfang an alles tat, um bei den Alpakas alles richtig zu machen, hatte Oma Hartmann nicht die anderen Kinder, sondern ihn gefragt, ob er der Pate des ersten Alpakafohlens auf dem Archehof werden wolle, so wie es auch bei den Hirtenkindern der Q’eros üblich war.
»Was muss ich tun?«
Mit diesem so besonderen Lächeln, dem Bobby-Lächeln, wie es die anderen nannten – einem Lächeln, mit dem er schon als Baby den Eindruck erweckt hatte, er lege mit ihm auch sein kleines, oft so wild pochendes Herz vertrauensvoll in die Hände der anderen –, mit eben diesem Lächeln hatte er Oma Hartmann angesehen und atemlos wiederholt. »Was, Oma Hartmann, muss ich tun?«
»Zunächst darfst du Suri nicht mehr aus den Augen lassen, Bobby«, hatte Oma Hartmann geantwortet. »Denn das Fohlen kann morgen, vielleicht aber auch erst nächste Woche kommen! Und du wirst ihm seinen Namen geben.«
»Misti, ich will, dass es Misti heißt.«
Außer sich vor Vergnügen war er wie Happy, die junge Alpakastute, auf der Weide herumgesprungen, hatte sich erschöpft wieder zurück ins Gras plumpsen lassen. Suri und die Alpakas hatten sich ihm neugierig genähert und beobachtet, wie er mit andächtig gefalteten Händen dasaß und auf Oma Hartmanns weitere Anweisungen wartete.
»Du musst ihm außerdem deinen Atem einhauchen, Bobby.«
»Meinen Atem einhauchen?«
»Richtig. Du legst den Mund auf die Nase des Fohlens und bläst deinen Atem ganz behutsam in seine Nüstern. Es ist dein Versprechen, dass du Misti beschützen wirst, egal, was passiert. Wirst du das tun, Bobby? Misti beschützen und für es da sein, wenn es in Not ist? Solange es lebt.«
»Solange es lebt?«
»Solange es lebt, Bobby!«
Bobby hob den rechten Arm, der wie seine Finger kürzer war als bei anderen Kindern, schwor feierlich, lächelte Oma Hartmann an, Oma Hartmann lächelte zurück, wobei sich um ihre Augen ein engmaschiges Faltennetz bildete. Bobby senkte den Arm wieder, nahm ihr Gesicht in beide Hände und strich ihr sanft übers Gesicht.
»Glättest du jetzt meine Falten, Bobby?«
»Das sind keine Falten, Oma Hartmann.«
»Was sind sie dann, Bobby?«
»Sonnenstrahlen«, hatte Bobby geantwortet, »von jetzt an bist du nicht nur die Oma der Familie Sonnenschein, sondern meine ganz persönliche Frau Sonnenstrahl.«
Bobby, zukünftiger Alpakapate, Grasbrückenbauer, weltbester Umarmer, Lächler, Herzverschenker, vor allem aber auch der Junge, von dem seine Eltern erzählt hatten, er habe sie gleich nach der Geburt mit diesem besonderen Blick angesehen, als wolle er sagen: »Was sagt ihr zu mir? Und was machen wir jetzt draus?«
Suri lief wieder in den Stall, Bobby folgte ihr erneut, doch es war dasselbe Spiel. Kaum hatte er den Stall erreicht, lief Suri schon wieder heraus. So ging es jetzt schon eine ganze Weile, und Bobby überlegte, ob er die anderen zu Hilfe holen sollte.
Die Anzeichen, dass es jeden Moment so weit sein konnte, verdichteten sich. Suris Euter war geschwollen, Oma Hartmann hatte ihm erklärt, dass er darauf achten solle. Ebenso wie die prallen Zitzen und die weichen Geburtsbänder im Beckenbereich, so Oma Hartmann, waren sie deutliche Anzeichen, dass die Geburt des Cria, so nannte man die Alpakafohlen, kurz bevorstand. Kaum hatte Bobby das alles zu Ende gedacht, legte sich Suri hin, streckte die Glieder und gab einen Laut von sich, den Bobby noch nicht von ihr kannte, stand wieder auf und hob den Schwanz.
Bobby begriff nicht sofort, nur, dass keine Zeit mehr war, um die anderen zu holen, dann tauchte schon das winzige Näschen des Fohlens auf und schob sich nach und nach unter Suris Schwanz nach draußen.
Das erste Beinchen, Bobby kicherte, weil es ihn an einen langen Zahnstocher erinnerte, und danach das zweite. Jetzt das ganze Köpfchen. Bobby hielt den Atem an, und der Körper, von dem Bobby später zu seiner Schwester sagen würde, er sei einfach so herausgeglitscht, rutschte aus der Mutter und blieb wie leblos auf dem Boden liegen. Es dauerte einen Augenblick, bis Bobby begriff: Das Baby war tot. So wie seine Mutter tot gewesen war. Auf dem Boden der Waschküche.
Bobby begann nach seiner Schwester zu rufen. »Steph, wo bist du, Steph!« So wie damals vor einem Jahr. Und mit jedem Rufen nach Stephanie, Steph, wurde seine Stimme lauter, schriller, verzweifelter, gipfelte in einem langen, markerschütternden Schrei, aufgefangen vom Wind, der ihn rasch mit sich forttrug, den Schrei, weit über den Archehof hinaus, als wolle er nicht zulassen, dass die Idylle erneut gestört wurde. Dieser Frieden inmitten vom Blühen und Duften. Der Archehof mit seinen ungezähmten Georginen, die Blüten kräftig und rund, dem honigbraunen Goldlack. Still und brütend die steifen Balsaminen, schlank und verträumt die Schwertlinien, fröhlich hellrot die verwildernden Rosenbüsche.
Bobby schrie erneut, der Wind gab auf, nicht aber die Alpakas, die sich jetzt von dem Neugeborenen ab- und Bobby zuwandten. Auf ihn zuliefen, ihn umrundeten, ihm ihren sanften Blick schenkten, als verstünden sie seine Not. Leises Summen. Behutsames Stupsen, ein leichtes Lächeln, und da fiel es Bobby wieder ein.
Leben kam nicht einfach so.
Man musste etwas dafür tun.
Atem einhauchen, damit es erwacht.
Und ihm, Bobby, hatte Oma Hartmann diese Aufgabe übertragen. Eine große Aufgabe, bei der er alles richtig machen musste.
Bobby atmete tief ein, beugte sich über das Fohlen, umschloss die Nüstern des Alpakas mit den Lippen, ließ den Atem ruhig entweichen, die Nüstern des Cria fingen leicht an zu beben, und Bobby stellte sich vor, wie der Atem seine Reise begann, bis hin zum Herzen. Dem Herzen, in dem, seiner Vorstellung nach, Gut und Böse gemeinsam an einem Tisch saßen und man sehr genau darauf achten musste, wen von den beiden man fütterte.
Sein Atem floss weiter, warm und lebendig durch den noch immer schlaffen Körper des Fohlens, doch jetzt, jetzt begann sich noch etwas anderes zu regen als die Nüstern. Bobby ging etwas auf Abstand. Zuerst war es der Kopf, der sich irgendwie versuchte, auf dem langen Hals zu halten, danach kamen die langen Beinen an die Reihe, wobei es für das Cria gar nicht so einfach war, mit ihnen zurechtzukommen. Bobby hätte gern geholfen, doch er wusste nicht, wie. Und es war auch nicht nötig. Das Alpakajunge faltete die Beine unter sich, um sie dort wiederum, wenn auch noch etwas wacklig, so zu sortieren, dass es aufstehen konnte, ohne umzufallen. Das Fohlen stand. Noch einmal ein vorsichtiges Bewegen der Beine, und jetzt, Bobby hielt den Atem an, die ersten Schritte zu Suri, die sich beim Grasfressen von der Geburt erholte.
Das Wunder war geschehen.
Bobby Sonnenschein konnte Leben erwecken.
Und in diesem Moment wünschte sich Bobby mehr als alles andere, mehr als viele Geschenke zum Geburtstag oder unter dem Weihnachtsbaum, er hätte das schon vor einem Jahr gewusst. Und mit dieser Erkenntnis stieß Bobby erneut einen Schrei aus. Es war eine Mischung aus Glück und Verzweiflung.
3.
Stephanie war verunsichert. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte sie geglaubt, Bobbys Stimme zu hören. Als rufe er nach ihr, so wie er immer nach ihr rief, wenn er Angst hatte oder sich freute. Wenn ihn etwas aus dem Konzept brachte. Doch da war kein Bobby. Nur der Flug lärmender Spatzen. Der Schatten hoher Bäume. Etwas weiter entfernt ein Haus mit blitzenden Scheiben und gelb-weißen Markisen. Eine Villa mit Pool und großem Garten, die immer ein wenig verlassen wirkte. Ganz nah an überwucherten Gleisen.
»Ist was?«
»Nein, nichts, wieso?« Die Ellbogen und Unterarme hinter sich aufgestützt, hockte Stephanie, halb sitzend, halb liegend, neben Lena, ihrer besten Freundin, und suchte weiter die Umgebung nach ihrem Bruder ab.
»Weil du so g’schaut hast.«
»Ich hab nicht g’schaut.«
»Dann halt nicht.«
Die Dunkelheit war weg und auch die fast unerträgliche Anspannung, die sie schon beim geringsten Anlass beschlich. Oma Bärbel nannte sie Herzensangst.
»Stephanie, alles okay?«
»Hab ich doch g’rade g’sagt, dass alles okay ist.«
Stephanie lachte, fast übertrieben laut. Sie hatte sich diese Art von lautem Lachen angewöhnt, wenn sie vom Schweigen ablenken wollte. Schweigen war zu ihrem Freund geworden. Das Reden noch immer nicht.
An diesem frühen Morgen gab sich Lena nicht wie sonst mit dem Lachen zufrieden. Der Blick blieb fragend, und Stephanie fügte hinzu: »Alles gut, echt, total super!« Sie wandte Lena den Rücken zu und beobachtete die Libellen.
Bunt schillernd sausten sie elfengleich übers Wasser und versuchten mit tollkühnem Balzflug ihre Auserwählte zu beeindrucken. Ebenso wie die männliche Dorfjugend auf der Alzbrücke. Nicht Lena mit ihren langen blonden Haaren oder Stephanie, sie waren noch zu jung. Stephanie wäre ohnehin lieber mit den Jungs von der Brücke gesprungen. Sie fand Mädchen albern, die kicherten und gleichgültig taten, obwohl sie ihre Körper mit jedem Drehen und Wenden neu in Szene setzten. Am Alzufer gab es genug davon.
Bei den Jungs wiederum waren Mumie, Arschbombe oder Hammer der Ausdruck ihrer Körpersprache. Egal wie, aber immer drei Meter tief von der Brücke, an der Stelle, wo die Alz Fahrt aufnahm und die Strömung tückisch wurde.
»Preißen versenken« hieß das Spiel, eine seit vielen Generationen von den Truchtlachingern ausgeübte Tradition. Man wartete auf der Brücke auf ein heranpaddelndes Schlauchboot, checkte, ob Bayerisch oder Hochdeutsch gesprochen wurde, Urlauber hatten auch eher kein Bier dabei, dafür aber einen Sonnenhut auf. War der »Preiß dann endgültig ausg’macht«, wurde unter Johlen und Kriegsgeheul gesprungen, mit dem Ziel, das Paddelboot mit einer möglichst hohen Wasserfontäne zu versenken. Der größte Spaß in diesen sich träge dahinräkelnden, scheinbar nicht enden wollenden Sommertagen, erfüllt von goldenem Licht.
»Jetz is er gleich dran …« Lena, kurz im Fluss abgetaucht, ließ sich tropfnass neben Stephanie fallen.
»Na und?« Stephanie gab sich gleichgültig.
Lena ließ sich jedoch nicht täuschen und grinste: »Dein Kio.« »Er ist nicht ›mein‹ Kio, dumme Kuh!«
Lena boxte Stephanie in die Seite und lachte: »Gib’s doch zu, du bist verliebt!«
»Schmarrn!« Genervt boxte Stephanie zurück. Wenn sie jedoch ganz ehrlich mit sich selbst war, dann musste sie zumindest ganz tief in sich drin zugeben – wäre Kio nicht gewesen, sein Lächeln quer über den Schulhof, manchmal nur eine Momentaufnahme, oder das Wegballern von zehn Blechbüchsen in der Wurfbude, um ihr als Trost einen kleinen Stoffbären zu schenken, weil er wusste, wie es ohne Mutter war –, sie hätte nicht gewusst, wie sie das vergangene Jahr überstanden hätte.
Stephanie versuchte, das Bild der toten Mutter aus sich herauszuschütteln.
»Wenn eine Mama stirbt«, Stephanie hatte sich eine Geschichte ausgedacht, um ihren Bruder zu trösten, »dann kommt ein Engel, Bobby, und breitet seine Flügel ganz weit aus, hebt die Mama auf und fliegt mit ihr an ihren Lieblingsplatz.«
»Wo ist Mamas Lieblingsplatz, Steph?«
»Auf der Wiese mit den vielen Obstbäumen.«
»Da, wo jetzt die Alpakas sind?«
»Richtig, Bobby.«
»Und was macht Mama da?«
»Sie pflückt einen wunderschönen Strauß und bringt ihn mit zum lieben Gott.«
Oma Bärbel sagte immer, wünschen sei wie beten ohne Gott. Stephanie jedoch konnte sich keinen einzigen Wunsch vorstellen, der ohne Gott in Erfüllung gehen würde. Und so wünschte sie und betete jeden Tag, dass ihr Vater endlich wieder so wäre wie früher. Vielleicht etwas trauriger, das waren sie alle, aber nicht so, so … Hunderte von Bildern waren auf einmal in ihrem Kopf. Momentaufnahmen. Wie es gewesen war – früher. Und mit diesen Bildern war auch Heulibold wieder da.
Heulibold, die Traurigkeit unter den Kistenkobolden, mit denen Erzieherin Susi Gefühle erklärt hatte, als Stephanie noch im Kindergarten gewesen war. Es gab noch Zornibold, Bibberbold und Freudibold. Heulibold war der Hartnäckigste. Er saß im Nacken. Krallte sich fest. Ließ sie immer und immer wieder an den einen Moment denken.
Bobbys verzweifelte Rufe: »Stephanie, Steph!«
Wie sie die Schultasche in die Ecke geworfen hatte und die vielen Stufen hinuntergerannt war, von denen immer wieder welche dazuzukommen schienen, anstatt weniger zu werden. Stufen endlos. Der Keller mit dem schwachen Licht durch die wenigen kleinen Fenster. Eine Ewigkeit bis zum Erreichen der Waschküche, und dann Bobby noch immer schreiend auf Knien die Mutter umarmend, die halb gelegen hatte und halb gesessen, den Kopf auf die Dachziegel gebetet, die der Vater der Einfachheit halber erst einmal in der Waschküche gestapelt hatte.
Stephanie hatte an Bobby gezogen, doch Bobby hatte nicht losgelassen. Wenn er wollte, war er stark wie Supermann.
»So wie Mama? Ist sie jetzt auch ein Märchen?«
Die Mutter so still. Auch Bobby verstummt. Kein Zwitschern der Vögel mehr, nur das Geräusch der Waschmaschine. Die Wäsche immer und immer wieder bunt durcheinandergewirbelt. Stephanie hatte die Mutter angefasst, war zurückgezuckt und hatte die Waschmaschine abgestellt. Die Waschmaschine still. Die Mutter still. Die Waschmaschine heiß. Die Mutter kalt. Den Kopf noch immer gebettet auf den Dachziegeln, mit denen der Vater eine schadhafte Stelle hatte reparieren wollen, damit es nicht mehr in den Dachboden tropfte.
»Die Ziegel nicht in meiner Waschküche!« Die Mutter mit ihrem Schwung. Tür auf, entschlossener Schritt und da war sie – immer gewesen.
»Ist ja nur, weil ich da mit dem Wagen ganz nah ranfahren kann, Schatz, ich bring sie schon noch rauf, versprochen!«
»Aber noch heute, Henri!«
»Ich hab doch gerade gesagt, versprochen.«
Aus dem Heute war ein Morgen und ein Übermorgen geworden. Und dann lag die Mutter auf einmal da, ganz ruhig, als ob sie schliefe, in Bobbys Armen.
Stephanie hatte ihren Bruder weggeschoben, die Mutter geschüttelt. Nichts. Trotz der offenen Augen, die so warm sein konnten, manchmal auch streng, vor allem aber lustig. Die Augen ihrer Mutter waren die lustigsten gewesen, die sie kannte, jetzt waren sie leer. Starrten sie an. Ohne Blick. Kein Erkennen. Kein Funken Leben, sosehr sie auch versuchte, das Leben in ihre Mutter wieder hinein-, in sie zurückzuschütteln. Irgendwann hatte sie aufgegeben, hatte Bobby angesehen, der sich mit zugehaltenen Ohren völlig in sich hineingekauert hatte.
»Bobby, was ist passiert, bitte sag mir, was passiert ist?«
»Ich weiß es nicht, Steph.«
Wie unglücklich er dagesessen hatte. So verloren. Am liebsten hätte sie ihren Bruder in den Arm genommen. Tat es nicht. Forschte weiter…
»Ist die Mama ausgerutscht, Bobby?«
»Ich hätte sie doch aufgefangen, aber ich war nicht da, Steph, wirklich nicht!« Bobby sah sie ungläubig an. »Weißt du das denn nicht, dass ich sie aufgefangen hätte?«
Er begann zu weinen. »Ich bin stark, Steph. Weißt du nicht, dass ich stark bin?«
Sie hatte nicht weiter gefragt. Nie wieder gefragt. Vielleicht, weil es manchmal auch besser war, nicht alles zu wissen.
Die Jungs sprangen. Die Mädchen räkelten sich. Lena biss genüsslich in die Wurstsemmel, die ihr die Mutter als Proviant mitgegeben hatte. Stephanies Blick wanderte zum Himmel. Diesem herrlich blauen Etwas, auf dem, so Bobby, die Sonne wohnte, der Mond, die Wolken, die Sterne, der Regen und seit über einem Jahr nun auch die Mutter.
Stephanies Herz wurde ganz eng von dem vielen Vermissen, den vielen Fragen und dem immer und immer wiederkehrenden Warum? Niemand hatte sie davor gewarnt, dass Mütter einen verließen, auch wenn man noch lange nicht erwachsen war – und noch dazu auf so eine saudumme Art und Weise. Ausgerutscht. Ohne Dachziegel vielleicht nicht tot.
Sie war zwölf, und Bobby mit seinem Kuschelgesicht und dem ewigen Lächeln erinnerte sie oft an die Alpakas, die kurz nach dem Tod der Mutter auf dem Hof eingezogen waren, weil von der Mutter gemeinsam mit Bärbel schon lange vorher ausgesucht und gekauft. Die Mama mit den immer für alle geöffneten Armen. »Kommt vorbei, kommt, wir machen zusammen Musik, singen, spielen, kommt zum Essen, es ist für alle was da!«
Trotz seiner sechzehn Jahre würde Bobby nie ganz erwachsen sein. Auch deshalb hatte Stephanie nichts gesagt, als die Polizei gekommen war, um den Tod der Mutter zu untersuchen. Nur Bobby war an diesem Vormittag auf dem Hof gewesen. Mariama hatte die Kinder in Schule, Kindergarten und Kita gebracht. Ihr Mann Abubakar hatte auf dem Bau gearbeitet, Paul und Bärbel waren mit den Bienen unterwegs gewesen, um sie an Bauern zu verleihen, sie selbst in der Schule und ihr Vater in der Whiskeybrennerei Schmidtbauer, um Whiskey für den Hofladen mitzunehmen.
Die Polizei hatte den Tod der Mutter nach einer ausgiebigen Untersuchung zum Unfall erklärt, und niemand hatte daran gezweifelt. Also zweifelte auch Stephanie nicht. Und wenn sie eines über ihren Bruder wusste, dann – Bobby log nicht.
Im Gegenteil, er war der ehrlichste Mensch, den Stephanie kannte. Viel ehrlicher als sie selbst.
Das Johlen und kriegerische Geheul wurde lauter. Das nächste Opferboot näherte sich, eine Familie, Vater, Mutter, Kind. Stephanie stand auf, wollte zur Brücke.
»Was machst du, Steph?« Lena erwischte sie gerade noch am Fuß.
»Ich will auch!« Der paddelnde Vater legte sich ins Zeug, und auf der Brücke machte sich Kio zum Sprung bereit.
»Das ist nur was für Jungs, Steph!«
Kio mit einem Körper, der muskulöser war als der anderer Vierzehnjähriger, und einem breiten, schönen Lachen in dem ebenmäßig dunklen Gesicht. Der Vater paddelte. Kio setzte zum Sprung an. Stephanie ließ sich mit einem Seufzer wieder neben Lena fallen. Wer von den beiden würde gewinnen?
Stephanie vergaß für einen Moment Heulibold im Nacken, war ganz bei Kio, der noch immer auf der Brücke stand, jetzt aber jeden Muskel und jede Sehne anspannte, sprang, die Wasserfontäne zischte, das Schlauchboot kippte, die Kids auf der Brücke klatschten, Kio winkte – Stephanies Herzschlag stockte – in ihre Richtung.
Doch gerade, als sie schüchtern zurückwinken wollte, läutete ihr Handy. Bobby. Ihr Herzschlag setzte aus. Angst. Sie hatte sich vorhin doch nicht getäuscht. Ihre Hände zitterten, als sie ans Handy ging. Sie hörte, was Bobby ihr zu sagen hatte, schnappte sich das Fahrrad und fuhr, so schnell sie nur konnte, zurück zum Archehof.
Sie kam genau in dem Augenblick an, als Bobby auf der Wiese hinter Stall und Obstgarten anfing, alle vor Glück zu umarmen, Mariama, Baby Tidanke mit lustig abstehenden Zöpfen und kunterbunten Haarspangen, Bärbel und Paul, und dann war auch schon sie selbst an der Reihe.
»Misti«, schrie Bobby ihr ins Ohr, »es heißt Misti, Steph, Misti bedeutet weißes Alpaka, es ist ein Junge, und ich hab gedacht, es ist tot, und der Engel breitet die Arme aus und nimmt es mit.«
Das war es gewesen. Dieser eine Moment, in dem Bobby geglaubt hatte, das Alpaka sei tot. Auch das machte Stephanie manchmal Angst. Dass sie ihren Bruder fühlen konnte.
Bobby klammerte sich jetzt so fest an ihren Hals, dass Stephanie sich sanft befreien musste, um wieder Luft zu bekommen.
Er baute sich stolz vor ihr auf. »Ich hab es wieder lebendig gemacht, Steph.«
»Niemand kann Tote lebendig machen, Bobby.«
Bobby sah sie fassungslos an. Tränen in den Augen.
Jetzt war es Stephanie, die ihren Bruder festhielt. »Nicht weinen, Bobby. Schsch, Bobby, alles gut, alles okay.« Sie wiegte sich mit ihm wie das Schilf, das sie beide stundenlang am Ufer der Alz beobachten konnten, vom Wind gestreichelt, berührt, zerzaust, bis es sich wieder aufrichtete, sehr gerade, in seiner ganzen Haltung dem Himmel zugewandt. So wie Bobby jetzt. Kein Schsch, kein Wiegen mehr, stolz, gerade und würdevoll stand Bobby da.
»Ich bin Mistis Pate, Steph, ich hab ihm das Leben eingehaucht, und jetzt beschütze ich ihn. Sein ganzes Leben lang.«
Stephanie widersprach nicht mehr. War Bobby von etwas überzeugt, dann gab es daran nichts mehr zu rütteln. Sie stieg auf ihr Fahrrad, fuhr quer über die Wiese vorbei an den Obstbäumen und dem Haus mit seinen Sprossenfenstern, bunten Blumenkästen und himmelblauen Fensterläden.
So schnell wie möglich wollte sie zurück zur Alz, um vor allem Kio von der Geburt des Cria zu berichten. Nicht nur für Bobby, auch für sie war Mistis Geburt zu etwas ganz Besonderem geworden. So etwas wie ein Zeichen. Dass es weiterging, immer weiter, Schritt für Schritt und mit ganz viel Vertrauen in das Leben, Worte, die ihr die Mutter an ihrem zehnten Geburtstag in die Geburtstagskarte geschrieben hatte.
Was auch immer kommt, vielleicht auch Schweres, weitermachen und dem Leben vertrauen.
Stephanie legte den Kopf in den Nacken, sah den Himmel ohne Wolken, bemerkte, wie Heulibold, sich wie gewohnt im Nacken festkrallend, in Schieflage kam, sein Gleichgewicht verlor, über den Rücken rutschend auf den Boden plumpste, etwas verdutzt zurückblieb, bis Egon – den häufig über sie kreisenden Fischreiher hatte sie so getauft – ihn aufhob und davontrug, an einen Ort, so fern, dass Heulibold sicher ein paar Stunden, vielleicht auch Tage benötigen würde, um zu Stephanie zurückzufinden.
Manchmal, ja manchmal war das Leben auch wieder schön. Stephanie juchzte und trat so kräftig sie konnte in die Pedale …
Nicht nur Kios wegen, sondern auch, weil sie sich schon darauf freute, von der Alzbrücke zu springen und den nächsten ahnungslosen Preußen zu versenken!
Hätte sie geahnt, welchen Brief der Alte Paul in diesem Moment im Schreibtischchaos ihres Vaters fand, wäre sie nicht mehr ganz so glücklich gewesen. Vor allem hätte sie dem am Eingangstor zum Archehof angebrachten Holzschild, unter dem sie gerade hindurchgeradelt war, eine andere Bedeutung zugemessen.
Die Aufschrift auf dem Holzschild war: Schee war’s!
4.
Trotz der WhatsApp, in der sie wieder einmal zurück in die Singlewüste geschickt worden war, und trotz des fehlenden Kaffees mangels Kaffeebohnen kämpfte Maria sich durch die Münchner Rushhour.
»Dichter Verkehr auf der A8 Richtung München«, verkündete im Radio Bayern 3.
»Nicht möglich«, antwortete Maria, und weiter ging es, vom Münchner Norden nach Nymphenburg. Normalerweise hatte sie in der Bank einen Tiefgaragenplatz, heute jedoch wollte sie noch ein paar Schritte gehen. Sie fand einen Parkplatz, etwa zehn Minuten von ihrem Arbeitsplatz entfernt.
Die Luft war so, wie es der Sonnenaufgang mit rotem Alpenglühen versprochen hatte. Heiß, heiß und noch mal heiß. Mit Bedauern dachte Maria an ihr Büro, hatte den Impuls, sich in das nächste Straßencafé zu setzen und bei Espresso und Dampfnudel mit Vanillesoße in Wohlgefühl zu baden.
Warum konnte man nie genau das tun, was man gerade empfand, dachte sie noch und stolperte fast über den Mann, der ihr seinen Pappbecher entgegenhielt. Armer Kerl! Was jammerte sie. Es gab Menschen, die hatten es eindeutig schwerer als sie.
Doch kaum hatte sie einen Euro in den Becher geworfen, als seine Stimme hinter ihr laut, sehr laut wurde. Er schrie ihren Rücken förmlich an. »Ver…daaaa…mmmmm…teee Bitch!«
Die Einsamkeit war eine Bitch, aber doch nicht sie, Maria Popp, die gerade nur Gutes hatte tun wollen. Langsam, fast im Zeitlupentempo, wandte sie sich um, das Gesicht von ihrem tiefroten Melonenhut beschattet.
»Wie meinen?«
»Mich so zu verarschen!«
Der Mann, der alles andere als vertrauenerweckend aussah, tobte. Für den Bruchteil einer Sekunde überlegte Maria, ob Flucht eine Option war, doch High Heels und Bleistiftrock ließen nur eines zu – den Stier verbal bei den Hörnern zu packen, nach dem Motto, dass Angriff noch immer die beste Verteidigung war. Hoffentlich.
»Wenn Sie meinen Euro nicht haben wollen«, sie konnte sehr von oben herabschauen, wenn sie wollte, und von oben herabreden auch, »dann geben Sie mir den Euro eben zurück.«
»Sehr gern«, antwortete der Mann, und ehe sichs Maria versah, hatte er schon den Inhalt seines Bechers in ihre Richtung geschüttet. Der Euro fiel klirrend zu Boden. Über ihre frisch gewaschene und gebügelte weiße Bluse dagegen lief ein braunes Rinnsal. Der heiß ersehnte Kaffee, den sie allerdings lieber aus einer Tasse getrunken hätte.
Sie wollte ihn schon anschreien, ihn beschimpfen, dann jedoch begriff sie … Die Röte kroch aus ihrer hochgeschlossenen, jetzt nicht mehr ganz weißen Bluse verräterisch über den Hals, überzog schamhaft ihr Gesicht, und es dauerte einen Moment, bis sie den Blick wieder hob und ihm in die Augen sah. Wider Erwarten waren sie nicht mehr wütend. Sie waren – tieftraurig.
Marias Herz zog sich zusammen. »Das mit dem Euro tut mir aufrichtig leid!«
»Mir tut es nicht leid«, antwortete der Mann, meinte damit wohl nicht die Tatsache, dass sie ihm den Euro mitten in seinen Kaffee geworfen hatte, sondern eher den Fleck auf ihrer Bluse.
»Verstehe!«
»Glaub ich kaum.« Mit diesem doppeldeutigen Satz wollte er sich schon zurückziehen, doch Maria packte ihn spontan am Ärmel seiner, nun ja, durchaus schäbigen Jacke.
»Bitte warten Sie einen Moment, bin gleich wieder da!«
Ohne ein weiteres Wort betrat sie das kleine Café an der Ecke mit dem Versprechen Coffee to go, besorgte dem armen Mann, von dem sie vermutete, dass er ohne festen Wohnsitz war, nicht nur einen frischen Kaffee, sondern machte mit dem Cafébesitzer auch gleich den Deal, den Mann von nun an jeden Tag mit einer Tasse Kaffee zu versorgen, die sie wöchentlich im Voraus bezahlen würde.
»Passen Sie beim Fliegen auf«, rief der nicht unattraktive Mann hinter der Kaffeetheke.
»Weil ich ein Engel bin?« Sie lächelte leicht kokett.
»Weil Sie aussehen wie die, die mit dem Regenschirm vom Himmel schwebt.«
Maria lächelte nicht mehr, bedankte sich, informierte den Mann, der tatsächlich auf sie gewartet hatte, dass zumindest sein Kaffee, falls er bereit sei, sich öfter in der Gegend aufzuhalten, bis auf Weiteres gesichert sei, verabschiedete sich, auch mit der Hoffnung, ihn damit losgeworden zu sein, ging weiter, und dann fielen ihr zwei Dinge auf: Der Mann hatte jetzt seinen Kaffee, sie jedoch noch immer nicht, und – er war noch immer da. Zuerst dicht hinter, jetzt dicht neben ihr.
Sie trippelte schneller.
Er hielt mit ihr Schritt.
Sie blieb stehen.
Er blieb stehen.
»Kann ich noch etwas für Sie tun?«
»Sie erinnern mich an wen.«
»Wie supercalifragilisticexpialigetisch, bin beeindruckt.« Sie konnte den spöttischen Klang ihrer Stimme nicht verhindern.
»Hä?«
»Mary Poppins, sagt Ihnen nichts?«
Sie seufzte, nicht, weil er das Märchen offenbar nicht kannte, sondern, weil sie die Assoziation zu dieser Frau immer und immer wieder bei anderen auslöste.
»Du siehst ihr ähnlich.« Das hatte schon ihre Großmutter immer behauptet.
»Wem?«
»Na, Julie Andrews, wenn sie Mary Poppins ist.«
Julie Andrews sah sie tatsächlich ein klein wenig ähnlich, aber sie war keine Gouvernante, und sie konnte auch nicht fliegen. Ihr Outfit? Kostüm und Hosenanzug waren nun einmal ihre Businessuniform. Außerdem hatte das mit Mary schon im Kindergarten begonnen, sich über ihre Schulzeit fortgesetzt und war nun auch im Erwachsenenleben angekommen.
Maria Popp, Mary Poppins, okay, das lag nahe, aber nicht dass man sie aufgrund ihres Äußeren mit ihr verglich. Oder doch?
»Mary Poppins habe ich meinen Kindern vorgelesen, und im Film war ich mit ihnen auch.«
»Oh, tut mir leid!«
»Warum?«
»Weil …« Sie wusste nicht weiter und reichte ihm die Hand, sah, wie schmutzig seine war, atmete tief und tapfer durch und – zuckte nicht zurück, als er sie nahm.
»Franz!«
»Angenehm.«
»Magst mit mir einen kleinen Spaziergang machen, Frau Angenehm?« Er lächelte leicht, und mit diesem Lächeln verschwand alles, was Maria Unbehagen verursacht hatte. Der wilde Blick. Das ungepflegte Aussehen. Die schlechten Zähne. Jetzt sah sie hinter die Fassade. Den Mann – und hinter dem Mann den Menschen, der offenbar eine Familie gehabt hatte, vermutlich noch immer eine hatte, wo immer sie auch war.
Nicht nur die Einsamkeit war eine Bitch, das Schicksal war es offenbar auch. Und sie bedauerte in diesem Moment aufrichtig, seine Einladung ablehnen zu müssen. »Ich würde gern, aber ich muss zur Arbeit.«
»Wo ist sie denn, deine Arbeit?« Sein Interesse wirkte aufrichtig.
Sie zögerte kurz, ob sie so viel von sich preisgeben sollte, doch ein Ausweichen, eine Lüge, hätte ihn mit einem Fußtritt wieder dahin katapultiert, wo sie ihn für sich gerade herausgezogen hatte. In den Sumpf der Ausgegrenzten und der Unberührbaren. Derjenigen, denen man zwar einen Euro in den Hut warf oder für die man den Kaffee für eine ganze Woche klarmachte, aber die man auf keinen Fall zu nah an sich heranließ. Vielleicht einfach nur aus Angst, dass Obdachlosigkeit ansteckend war.
»Schon gut, ich wollt nicht neugierig sein.« Es war die Resignation in seinem Blick.
»Da drüben arbeite ich.«
Mit den jetzt warmen, freundlichen Augen folgte er ihrer ausgestreckten rechten Hand bis hin zu dem Gebäude mit den zwanzig Stockwerken, das durch seine Glasverkleidung nicht nur in der Sonne glänzte, sondern auch all das widerzuspiegeln schien, was sich auf den Straßen um das Gebäude herum abspielte.
Maria wollte den Mann gerade über ihren Aufgabenbereich aufklären, als sich die Freundlichkeit in seinen Augen zurückzog und wieder dem Zorn Platz machte.