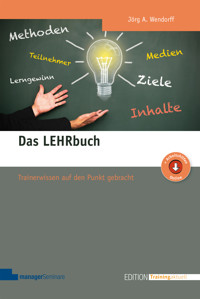
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: managerSeminare Verlags GmbH
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Grundlagenwerk für Business-Trainer und andere lehrende Berufe. Wertvoller Input zu Planung, Gestaltung, Evaluation und Nachbereitung von Seminaren. Mit diesem Buch können Sie einschätzen, wie effektiv Ihre Lehrangebote überhaupt sind.
Gute Lehre ist oft Glückssache. Die meisten Seminarleiter erarbeiten sich ihre Didaktik und Methodik durch „Learning by Doing“. Zu Beginn ihrer Lehrtätigkeit nehmen sich viele von ihnen gewöhnlich nicht die Zeit, sich tief in die Planung und Gestaltung ihrer Fortbildungsveranstaltungen einzuarbeiten - meist, weil sie diese Tätigkeit neben ihrer eigentlichen Arbeit durchführen. Zudem fehlt es in vielen Berufsfeldern an geeigneten didaktischen Fortbildungsangeboten. Lehren zu lernen wird damit zu einem langwierigen Prozess von Versuch und Erfolg beziehungsweise auch Misserfolg. Und selbst nach vielen Jahren der Praxis sind Trainer oftmals noch unsicher, wie effektiv ihre Lehrangebote überhaupt sind. Wenn Sie sich in einer ähnlichen Lage befinden, erwarten Sie sicherlich von einem Lehrbuch direkt anwendbare Praxistipps, die Ihnen die notwendige Sicherheit für die Ausübung Ihrer anspruchsvollen Tätigkeit geben. Dieses LEHRbuch bietet Ihnen deshalb eine Fülle konkreter, theoretisch fundierter Handlungsempfehlungen für die Planung, Durchführung und Nachbereitung von Fortbildungsveranstaltungen. Das Buch ist in einem veranschaulichenden Sprachstil geschrieben und verzichtet für ein besseres Leseverständnis, soweit wie möglich, auf pädagogische Fachsprache.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg A. Wendorff
Das LEHRbuch
Trainerwissen auf den Punkt gebracht
© 2009 managerSeminare Verlags GmbH
4. überarb. Aufl. 2021
Endenicher Str. 41, D-53115 Bonn
Tel: 0228–977 91-0
www.managerseminare.de/shop
Der Verlag hat sich bemüht, die Copyright-Inhaber aller verwendeten Zitate, Texte, Abbildungen und Illustrationen zu ermitteln. Sollten wir jemanden übersehen haben, so bitten wir den Copyright-Inhaber, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
ISBN 978-3-98856-057-5
Herausgeber der Edition Training aktuell:
Ralf Muskatewitz, Jürgen Graf, Nicole Bußmann
Lektorat: Ralf Muskatewitz
Fotos: Eva Geithner, Georg Stippler, Jörg A. Wendorff, istockphoto
Cover: david-w-/Photocase
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Ihre Download-Ressourcen
Begleitend zum Buch stehen Ihnen Arbeitshilfen für die persönliche Verwendung zum Download im Internet zur Verfügung. Sie können die Vorlagen jederzeit in hoher Qualität abrufen und einsetzen.
www.managerseminare.de/tmdl/k,254861
Inhalt
Cover
Impressum
Einleitung
I. Der Seminarleiter
1 Wichtige Kompetenzen
2 Lehrstile
3 Angst in der Lehre – Der selbstsichere Umgang mit Lampenfieber und Kritik
3.1 Mit Lampenfieber sinnvoll umgehen
3.2 Mit Kritik selbstsicher umgehen
4 Effektiv präsentieren im Seminar
II. Die Teilnehmer
1 Das Lernen Erwachsener unterstützen
2 Motivation der Teilnehmer fördern
3 Mit den Teilnehmern kommunizieren
3.1 Eine gute Beziehung zu den Teilnehmern haben
3.2 Die Mitteilungsbereitschaft der Teilnehmer fördern
3.3 Gegenseitiges Verstehen absichern und Kommunikationsproblemen vorbeugen
3.4 Teilnehmern Feedback geben
4 Gruppen leiten in Abhängigkeit von der Gruppendynamik
5 Stolpersteine im Seminar überwinden
5.1 Grundsätzliches zu Problemen in der Lehre
5.2 Schwierigen Situationen vorbeugen
5.3 Schwierige Situationen meistern
III. Zielgerichtete Planung einer Veranstaltung
1 Eine Lehreinheit planen
2 Was zur Vorbereitung noch dazugehört
2.1 Pausen gestalten
2.2 Den Seminarraum vorbereiten
2.3 Teilnehmerunterlagen erstellen
2.4 Übungssaufgaben erstellen und durchführen
IV. Die Durchführung einer Veranstaltung
1 Phasen einer Seminardurchführung
1.1 Warm-up-Phase: Begrüßung und gegenseitiges Kennenlernen
1.2 Transparenzphase: Organisatorisches und Ablauf vorstellen, Erwartungen erfragen, Seminarregeln vereinbaren
1.3 Phase der Hinführung zum Thema: Das Interesse der Teilnehmer für das Thema fördern
1.4 Informationsphase: Inhalte vermitteln oder von den Teilnehmern erarbeiten lassen
1.5 Verarbeitungsphase: Inhalte aktiv verarbeiten
1.6 Cool-down-Phase: Feedback einholen und den Ausstieg aus dem Seminar gestalten
2 Methoden für die Lehre
2.1 Standardlehrmethoden
2.2 Aktivierende Methoden für die unterschiedlichen Seminarphasen
2.3 Aktivierungsübungen
3 Großgruppen aktivieren
4 Medien gestalten und einsetzen
5 Onlinelernen
V. Qualitätssicherung und Seminarnachbereitung
1 Transferfördernde Maßnahmen
2 Zwischenfeedback, Seminar-Evaluation und Transfer-Evaluation
2.1 Zwischenfeedback
2.2 Schriftliche Seminar-Evaluation
2.3 Transfer-Evaluation
3 Das Seminar nachbereiten
Anhang
Danksagung
Stichwortverzeichnis
Feedback-Bogen
Über den Autor
Für den besseren Lesefluss wurde in diesem Werk die männliche Sprachform genutzt, selbstverständlich sind damit stets aber beide Geschlechter gemeint.
Einleitung
Gute Lehre ist oft Glückssache. Die meisten Seminarleiter erarbeiten sich ihre Didaktik und Methodik durch „Learning by Doing“. Zu Beginn ihrer Lehrtätigkeit nehmen sich viele von ihnen gewöhnlich nicht die Zeit, sich tief in die Thematik der Planung und Gestaltung ihrer Fortbildungsveranstaltungen einzuarbeiten – meist, weil sie diese Tätigkeit neben ihrer eigentlichen Arbeit durchführen. Zudem fehlt es in vielen Berufsfeldern an geeigneten didaktischen Fortbildungsangeboten. Lehren zu lernen wird damit zu einem langwierigen Prozess von Versuch und Erfolg beziehungsweise auch Misserfolg. Und selbst nach vielen Jahren der Praxis sind Trainer oftmals noch unsicher, wie effektiv ihre Lehrangebote überhaupt sind.
Wenn Sie sich in einer ähnlichen Lage befinden, erwarten Sie sicherlich von einem Lehrbuch direkt anwendbare Praxistipps, die Ihnen die notwendige Sicherheit für die Ausübung Ihrer anspruchsvollen Tätigkeit geben. Dieses LEHRbuch bietet Ihnen deshalb eine Fülle konkreter und fundierter Handlungsempfehlungen für die Planung, Durchführung und Nachbereitung von Weiterbildungsveranstaltungen. Das Buch ist in einem veranschaulichenden Sprachstil geschrieben und verzichtet für ein besseres Leseverständnis, so weit wie möglich, auf pädagogische Fachsprache.
Für wen wird dieses Buch interessant sein?
Für Lehranfänger
Sie sind erfolgreich in Ihrem Beruf und wurden im Laufe der Zeit zu einem Spezialist in Ihrem Fachgebiet. Ihre Vorgesetzten oder Sie selbst wünschen sich, dass Sie Ihr Wissen an andere Personen weitergeben, indem Sie dazu Seminare anbieten. Sie möchten sich vorher fundiert informieren, wie Sie diese Veranstaltungen zielgerichtet planen und effektiv durchführen können. In diesem Fall ist das Buch für Sie geeignet, denn Sie erhalten einen Leitfaden für die Planung, Durchführung und Nachbereitung von Seminarveranstaltungen.
Für Lehrende mit einiger Praxiserfahrung
Sie haben bereits Lehrerfahrung, und in der Regel verlaufen Ihre Veranstaltungen erfolgreich. Da Sie sich Ihr didaktisch-methodisches Wissen überwiegend in Form von Praxiserfahrung selbst erarbeitet haben, verspüren Sie eine gewisse Unsicherheit, ob Sie alles richtig machen. In diesem Fall ist das Buch für Sie geeignet, einerseits als Bestätigung Ihres im Laufe der Zeit gewachsenen Erfahrungsschatzes und andererseits als Anregung für weitere Verbesserungen Ihrer Lehre.
Was können Sie erwarten?
Ihr roter Faden durch die Thematik des Lehrens
Die präsentierten Themen geben Ihnen einen guten Überblick über die Gesamtthematik der Lehre. Gleichzeitig ermöglicht Ihnen der systematische Aufbau des Buches, schnell spezielle Informationen zu den unterschiedlichen Lehrthemen zu finden. Das LEHRbuch dient Ihnen auf diese Weise als „Roter Faden“ durch die Thematik des professionellen Lehrens und ermöglicht Ihnen, Ihre Veranstaltungen zielgerichtet zu planen und strukturiert durchzuführen.
Optimierung Ihrer eigenen Lehrfertigkeiten
Das LEHRbuch regt zu einer kreativen und methodisch vielseitigen Lehre an. Sie finden hierfür eine Vielfalt von Praxistipps und Beispielen. Die Vielfalt der vorgestellten Lehrtipps unterstützt Sie bei der fachlichen Weiterentwicklung und Professionalisierung Ihrer Lehrtätigkeiten.
Durchgängiger Aufbau aller Kapitel
Alle Kapitel sind zur besseren Orientierung thematisch eingeleitet. Dabei wird Ihnen jeweils vorgestellt, was Sie inhaltlich erwartet. Die anschließend präsentierten theoretischen Informationen sind verbunden mit zahlreichen Praxistipps. Diese Vorgehensweise ermöglicht Ihnen einen leichten Zugang in und einen guten Überblick über das jeweilige Thema und bietet Ihnen zudem konkrete Hinweise für die eigene Seminarplanung und -durchführung. Am Ende eines Kapitelabschnitts wird Ihnen jeweils eine Reflexionsaufgabe gestellt, die Ihnen hilft, das Vermittelte praktisch umsetzen zu können. Außerdem sind die in dem betreffenden Abschnitt behandelten Informationen noch einmal „auf den Punkt“ gebracht dargestellt. Ausgewählte Literaturhinweise ermöglichen Ihnen schließlich, sich bei Interesse tiefer mit dem jeweiligen Themengebiet auseinanderzusetzen.
Einige Piktogramme sollen Ihnen eine weitere Möglichkeit der Orientierung bieten:
Dieses Pictogramm finden Sie stets zu Beginn größerer Input-Einheiten. Viele davon sind in Phasen oder Prozess-Schritten dargestellt.
Im Kapitel IV. tauchen zahlreiche Methoden und Übungen auf. Sie sind mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.
Wo immer dieses Zeichen auftaucht, laden wir Sie ein, das bisher Gelesene in Ihren Erfahrungsalltag zu übertragen. Die Reflexionsaufgaben helfen Ihnen dabei.
Die wichtigsten Aussagen sind überall dort auf den Punkt gebracht, wo Sie dieses Zeichen vorfinden.
In dieser Auflage wird an geeigneten Stellen auf das Thema der Onlinelehre eingegangen und Sie finden hierzu ergänzende Informationen. Zudem wurde das Kapitel „Online lernen” (siehe ab S. 291) für diese vierte Auflage komplett aktualisiert.
Viel Freude beim Lesen und einen hohen Erkenntnisgewinn wünscht Ihnen
Jörg Wendorff
I. Der Seminarleiter
Als Trainer sind Sie vielseitig gefordert. Sie wollen Ihre Seminare zielgruppenorientiert planen und fachkompetent durchführen. Sie müssen in einen guten Kontakt mit Ihren Teilnehmern kommen und gleichzeitig eine klare Leitungsposition einnehmen. Viele weitere Aufgaben rund um die Planung, Durchführung und Nachbereitung Ihrer Veranstaltungen stehen für Sie an. So stellt sich die Frage, welche Kompetenzen Sie benötigen, um erfolgreich als Seminarleiter arbeiten zu können. Hierauf gibt gleich der erste Abschnitt dieses Kapitels, in dem Sie in der Rolle des Seminarleiters im Mittelpunkt stehen, Antworten.
An die Fragen zum eigenen Kompetenz-Mix schließt sich die Frage des passenden Leitungsstils an. Ist für die Seminarleitung der Stil des Dozenten angesagt, der Ihnen ermöglicht, Ihren Teilnehmern viele Informationen zu präsentieren? Oder ist der Stil des Trainers zeitgemäßer, der den Teilnehmern ermöglicht, selbst aktiv zu werden und sich die Inhalte selbst zu erarbeiten? Die Antworten zu dieser grundlegenden Frage präsentiert Ihnen der zweite Teil dieses Kapitels.
Gewisse Ängste, vor die Seminargruppen zu treten und Unbehagen über schlechte Rückmeldungen zur eigenen Seminardurchführung verspüren auch noch Trainer, die bereits länger im Geschäft sind. Wie diese Ängste entstehen, und wie Sie möglichst souverän mit diesen umgehen, wird Ihnen anschließend erläutert.
Sie präsentieren in Ihren Veranstaltungen nicht nur Informationen, sondern immer auch sich selbst. Ihr Präsentationsverhalten hat wiederum Einfluss darauf, wie gut Ihre Teilnehmer den Lehrstoff aufnehmen können und außerdem, wie gut Sie selber in der Wahrnehmung Ihrer Teilnehmer und letztlich auch Ihrer Auftraggeber abschneiden. Deswegen runden Tipps für ein effektives Präsentationsverhalten dieses Kapitel ab.
Schnellfinder
I. Der Seminarleiter
1 Wichtige Kompetenzen
2 Lehrstile
3 Angst in der Lehre – Der selbstsichere Umgang mit Lampenfieber und Kritik
3.1 Mit Lampenfieber sinnvoll umgehen
3.2 Mit Kritik selbstsicher umgehen
4 Effektiv präsentieren im Seminar
Eins Wichtige Kompetenzen
Talent hatte ich gestern, heute bin ich kompetent.
Jedem Trainer ist es ein großes Anliegen, andere Menschen weiterzubringen, ihre berufliche oder persönliche Entwicklung ein Stück weit zu fördern und ihnen die hierfür erforderliche Unterstützung zu bieten. Dabei bringen manche Menschen von Natur aus ein gewisses Lehrtalent mit, das ihnen den Einstieg in die Trainertätigkeit erleichtert. Andere Menschen, denen es vielleicht zunächst schwerfällt, vor einer größeren Gruppe zu bestehen, benötigen zu Beginn ihrer Lehrtätigkeit etwas mehr Unterstützung. Aber ganz gleich, ob Naturtalent oder zurückhaltende Persönlichkeit, jeder kann mit Fleiß und Übung lernen, ein erfolgreiches Training zu gestalten und jeder kann sich dabei verbessern, indem er die notwendigen Kompetenzen erlangt und erweitert.
Der richtige Kompetenz-Mix
Der richtige Mix aus Kompetenzen, aus unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erworben und erlernt – aber auch vermittelt – werden können, macht unseren Beruf ebenso spannend wie anspruchsvoll. Deshalb beginnt das Buch auch mit dem Thema der Kompetenzen. Sie erhalten zunächst einen Überblick über die wichtigsten Kompetenzen Ihres Berufsstands. Nachfolgende Buchkapitel, die sich vertiefend mit einzelnen Kompetenzbereichen auseinandersetzen, bieten Ihnen Unterstützung, Ihre Lehrfertigkeiten gezielt zu optimieren.
Diese wichtige Frage beantwortet dieser Kapitelabschnitt
Welche wichtigsten Kompetenzen helfen Ihnen bei der Seminarplanung und Veranstaltungsdurchführung?
Unterschiedliche Bereiche von Kompetenzen in der Lehre
Sie sollen hier nicht mit allen denkbaren Lehrkompetenzen überhäuft werden. Vielmehr lohnt es sich, Ihre Aufmerksamkeit auf die wichtigsten zu fokussieren. Lernen Sie diese kennen und prüfen Sie sich, welche Lehrkompetenzen Sie für sich bereits als Stärke verbuchen können und an welchen Punkten Sie an sich arbeiten möchten.
Fünf übergeordnete Kategorien
Die relevanten Kompetenzen lehrender Berufe lassen sich in fünf übergeordnete Kategorien einordnen:
Fachkompetenz
Didaktisch-methodische Kompetenz
Präsentationskompetenz
Sozialkompetenz
Selbstkompetenz
In ein von mir erstelltes Modell gefasst, bildet der Lern- bzw. der Lehrerfolg das Dach eines Gebäudes. Es ruht auf starken Kompetenz-Säulen, die wiederum auf dem Fundament der eigenen Fachkompetenz stehen. Bleibt man in diesem Bild, wird offensichtlich, dass dieses Gebäude ohne Fundament oder ohne gleichgewichtig entwickelte Einzelkompetenzen rasch einsturzgefährdet wäre. Stimmt dagegen das Verhältnis der Komponenten, haben Sie ein stabiles, verlässliches Gebilde.
Abb.: Kompetenzmodell des Lehrerfolgs
Fachkompetenz
Die Basis
Um (Fach-)Wissen weitergeben zu können, ist selbstverständlich, dass Sie dieses selber besitzen. Die Fachkompetenz bildet Ihre notwendige Basis, das Fundament Ihrer Lehrtätigkeit. Es ist Bestandteil Ihrer Glaubwürdigkeit gegenüber Ihren Teilnehmern. Verkaufstrainings können Sie nur dann glaubwürdig halten, wenn Sie selbst praktisch als Verkäufer tätig waren. Führungsthemen werden Sie erst dann authentisch vermitteln können, wenn Sie selber bereits geführt haben. Ähnliches gilt für die Bearbeitung von Fachthemen. Sie sollten sich gut auskennen in fachspezifischen Fragestellungen und thematischen Zusammenhängen – dies wird von Ihnen erwartet. Größere Wissenslücken sollten Sie dringend schließen, bevor Sie die entsprechende Veranstaltung das erste Mal durchführen.
Aber selbst bei der besten Vorbereitung auf ein neues Thema wird es vorkommen, dass Sie bei der ersten Seminardurchführung nicht alle Fachfragen der Teilnehmer beantworten können. Dies ist normal und sollte Sie nicht beunruhigen. Geben Sie es zu, dass Sie nicht auf alle Fragen Antworten haben, notieren Sie sich die Fragen und reichen Sie die Antworten nach. Dadurch erweitert sich Ihr eigener fachlicher Wissenshorizont und Ihre Glaubwürdigkeit nimmt keinen Schaden.
Didaktisch-methodische Kompetenz
Das Handwerkszeug für die Seminardurchführung
Die didaktisch-methodischen Kompetenzen sind das Grundhandwerkszeug für die Planung und Durchführung einer Veranstaltung. Die in Klammern angegebenen Querverweise leiten Sie an die Stellen im Buch, an denen Sie die Themen vertiefen können.
Die Planungskompetenz ermöglicht Ihnen unter anderem, die Lernziele zu bestimmen sowie die Veranstaltung inhaltlich und zeitlich zu strukturieren (mehr hierzu ab Seite 129).
Die Kompetenzen zur Didaktischen Reduktion und zielgruppengerechten Inhaltsaufbereitung sind ein Unterbereich der Planungskompetenzen. Sie helfen Ihnen, entlang der Lernziele die passende Inhaltsauswahl zu treffen und den Schwierigkeitsgrad der Informationsvermittlung an das Vorwissen der Zielgruppe anzupassen (mehr davon ab Seite 152).
Durch Methodenkompetenz wählen Sie zielgerichtet für den jeweiligen Lehrzweck die geeigneten Methoden aus und setzen diese kompetent ein (ab Seite 203).
Die Medienkompetenz betrifft den Bereich der Gestaltung und des zielgerichteten Einsatzes medialer Hilfsmittel (ab Seite 278).
Evaluierungskompetenz ist die Fertigkeit, sich Rückmeldungen über die eigenen Lehraktivitäten einzuholen (mehr ab Seite 309).
Präsentationskompetenz
Lerninhalte verständlich darstellen
Präsentationskompetenz ermöglicht Ihnen, selbstsicher vor der Gruppe zu stehen und Ihre Lerninhalte verständlich darzustellen. Dazu gehört auch der Bereich der Rhetorik (mehr ab Seite 37).
Sozialkompetenz (Umgang mit den Teilnehmern)
Zu dem Bereich der Sozialkompetenzen gehören:
die Förderung der Motivation der Teilnehmer (ab Seite 58);
das angemessene Verhalten gegenüber den Teilnehmern, wozu der freundliche und wertschätzende Umgang mit diesen zählt (siehe auch ab Seite 68);
die kommunikativen Kompetenzen, um die Mitteilungsbereitschaft der Teilnehmer zu fördern (ab Seite 72) und um kommunikativen Missverständnissen im Seminar vorzubeugen (siehe Seite 82 ff.);
die Kompetenz, den Teilnehmern Rückmeldungen zu geben, die sie nicht verletzen, sondern durch die sie etwas lernen (ab Seite 88 ff.);
die Kenntnisse gruppendynamischer Prozesse sowie das Anpassen des eigenen Leitungsstils darauf (ab Seite 97 ff.);
das Erkennen der Bedürfnisse der Teilnehmer und das Eingehen auf berechtigte Wünsche an seminarorganisatorische und inhaltliche Aspekte (siehe hierzu das Thema „Erwartungen erfragen“ auf den Seiten 132 f. und 135 f.).
Voraussetzung: eine grundsätzlich positive Einstellung gegenüber den Teilnehmern
Sozialkompetenzen lassen sich gewöhnlich schwerer erlernen als die Kompetenzen der anderen Kategorien. Dieser Kompetenzbereich hat zum großen Teil mit einer grundsätzlich positiven Einstellung gegenüber den Teilnehmern Ihrer Veranstaltungen zu tun. Wenn Sie diese mitbringen, entsteht fast von alleine ein emotional anregendes und lernförderliches Lernklima.
Selbstkompetenz
Dem Bereich der Selbstkompetenzen schenken die meisten Trainer die wenigste Beachtung. Wenn Sie aber längerfristig lehren wollen und nicht in Gefahr geraten möchten, sich nach einer gewissen Zeit zu verausgaben – „auszubrennen“ – sollten Sie einen angemessenen Umgangmit Frustration beherrschen, mit Kritik umgehen können und allgemein eigene Bedürfnisse erkennen und wenn notwendig, auch der Gruppe gegenüber artikulieren können. Auf diese wichtigen Aspekte wird ausführlich auf den Seiten 32 ff. und 82 ff. eingegangen.
Die eigenen Bedürfnisse erkennen können
Weitere wesentliche Selbstkompetenzen sind:
Ein ausreichendes Maß an Selbstvertrauen, das sich durch Erfolge bei Ihren Lehrtätigkeiten nach und nach verstärkt.
Ganz entscheidend Freude und Spaß am Lehren. Wer dieses nicht verspürt, wird auf Dauer nicht erfolgreich Seminare durchführen können.
Ein gewisses Maß an Spontaneität und Flexibilität, um auf trotz guter Planung immer wieder unvorhersehbar auftretende Ereignisse angemessen reagieren zu können (siehe Seite 107 ff.). Je größer die Berufspraxis, desto gelassener können Sie mit ähnlichen Ereignissen umgehen. Machen Sie sich bewusst, dass Sie nicht alle Herausforderungen, die Ihnen bei einer Seminardurchführung begegnen können, vorhersehen können. Seien Sie deswegen bereit, kreativ auf Unvorhersehbares zu reagieren.
Praxistipps
Verlangen Sie, wenn Sie an einzelnen Lehrkompetenzen arbeiten möchten, nicht zu viel auf einmal von sich. Nehmen Sie sich pro Seminarveranstaltung nicht mehr als zwei Aspekte vor, auf die Sie besonders achten. Wenn Sie hierbei erfolgreich waren, wagen Sie sich an die nächsten Herausforderungen. Der Autor freut sich, wenn Sie dieses Buch immer wieder zur Hand nehmen und sich mit bestimmten Kapiteln wiederholt beschäftigen.
Stellen Sie nicht den Anspruch an sich, perfekt sein zu müssen. Den perfekten Trainer gibt es nicht. Besondere Eigenarten zu haben und zu diesen zu stehen, gehört natürlich zum Menschsein dazu. Zeigen Sie ruhig kleine Schwächen, es macht Sie als Seminarleiter für Ihre Teilnehmer menschlicher und dadurch sympathischer. Es baut Distanz zu den Teilnehmern ab und erhöht deren Bereitschaft, sich auf das, was Sie anbieten, einzulassen.
Machen Sie sich auch ohne falsche Bescheidenheit bewusst, welche Kompetenzen Sie bereits in ausreichendem Maß besitzen. Das gibt Ihnen „positive Energie“, sich um die zu kümmern, in denen Sie sich noch verbessern können.
Reflexionsaufgaben zu Wichtige Kompetenzen
Entscheidende Kompetenzen für Ihren Lehrerfolg haben Sie in diesem Kapitel kennengelernt. Überlegen Sie sich bitte, in welchen Kompetenzbereichen Sie sich bereits sicher fühlen und mit welchen Kompetenzen Sie sich vertiefend beschäftigen möchten. Kreuzen Sie die entsprechende Stelle jeweils an. Sie können sich auch von Teilnehmern, mit denen Sie im guten Kontakt stehen, im Anschluss an einer Veranstaltung Rückmeldungen geben lassen.
Der Bereich der Fachkompetenz wird in diesem Fragenraster ausgeklammert, da Ihnen hierfür dieses LEHRbuch keine Unterstützung bietet, und Sie sich eines fachthematischen Buches bedienen sollten.
Didaktisch-methodische Kompetenz
Bereich Kompetenzen
Fühle mich sicher
Hierzu möchte ich noch etwas lernen
Planungskompetenz
❏
❏
Kompetenzen zur „Didaktischen Reduktion und zielgruppengerechten Inhaltsaufbereitung“
❏
❏
Methodenkompetenz
❏
❏
Medienkompetenz
❏
❏
Evaluierungskompetenz
❏
❏
Präsentationskompetenz
Bereich Kompetenzen
Fühle mich sicher
Hierzu möchte ich noch etwas lernen
Präsentationskompetenz
❏
❏
Sozialkompetenz
Bereich Kompetenzen
Fühle mich sicher
Hierzu möchte ich noch etwas lernen
Motivation der Teilnehmer fördern
❏
❏
Angemessenes Verhalten gegenüber den Teilnehmern
❏
❏
Kommunikative Kompetenzen
❏
❏
Kompetenz, den Teilnehmern Rückmeldungen zu geben
❏
❏
Die Kenntnisse gruppendynamischer Prozesse sowie das Anpassen des eigenen Leitungsstils darauf
❏
❏
Selbstkompetenz
Bereich Kompetenzen
Fühle mich sicher
Hierzu möchte ich noch etwas lernen
Angemessener Umgang mit Frustration
❏
❏
Mit Kritik umgehen können
❏
❏
Eigene Bedürfnisse erkennen – und wenn notwendig, auch der Gruppe gegenüber artikulieren
❏
❏
Mit welchen drei Kompetenzen möchte ich mich zunächst auseinandersetzen?
………
………
………
Wichtige Kompetenzen auf den Punkt gebracht
Es gibt fünf übergeordnete Kompetenzbereiche.
Fachkompetenz: die Kenntnis der Fachbegriffe, der fachspezifischen Fragestellungen sowie der thematischen Zusammenhänge.
Didaktisch-methodische Kompetenzen: die Grundhandwerkszeuge für die Planung und Durchführung einer Veranstaltung.
Präsentationskompetenz: die Fertigkeit, selbstsicher vor der Gruppe zu stehen und die Lerninhalte verständlich darzustellen.
Sozialkompetenzen: der angemessene Umgang mit den Teilnehmern.
Selbstkompetenzen: der angemessene Umgang mit sich selbst.
Am schwersten lassen sich Sozialkompetenzen erlernen.
Kein Lehrender muss und kann in allen Bereichen perfekt sein, sollte aber den Anspruch an sich haben, sich stets verbessern zu wollen.
Literatur zum Vertiefen des Themas
Kießling-Sonntag, Jochem: Handbuch Trainings- und Seminarpraxis. Berlin 2004 Der Autor zählt fünf Kompetenzfelder auf, die er zum Teil anders benennt als dieses LEHRbuch. Er erläutert die dazugehörigen Einzelkompetenzen ausführlich.
Scarbath, Horst/von Beyer-Stiepani, Thomas (Hrsg.): Handbuch Trainingskompetenz: Multiplikatorenkonzept für die betriebliche Weiterbildung. Bielefeld 2012 Die Autoren beschreiben „Kompetenzbausteine“ und verknüpfen die theoretischen Basics zum Thema direkt mit der konkreten praktischen Umsetzung.
Zwei Lehrstile
Die Teilnehmer müssen ein- und ausatmen können.
Die Vorgehensweisen und ihre Kombinationsmöglichkeiten
Sie möchten ein Seminar durchführen und haben dafür viele inhaltliche Ideen. Für Sie stellt sich nun die Frage, wie Sie die Informationen Ihren Teilnehmern anbieten möchten. Ist es sinnvoll, dies auf die Art zu machen, die Sie überwiegend in der Schule und Ausbildung beziehungsweise Studium kennengelernt haben? Die Inhalte zu dozieren und darauf vertrauen, dass die Teilnehmer diese schon irgendwie lernen. Oder ist es sinnvoller, die Inhalte von den Beteiligten selbst erarbeiten zu lassen und ihnen zu ermöglichen, diese praktisch zu trainieren?
In diesem Kapitel werden die zu den beiden vorgestellten Vorgehensweisen gehörenden Lehrstile des Dozenten und des Trainers vorgestellt und verdeutlicht, wie Sie diese sinnvoll miteinander kombinieren können.
Diese wichtige Frage beantwortet dieser Kapitelabschnitt
Wie setzen Sie sinnvoll die Lehrstile des Dozenten und des Trainers ein?
Je nach Aktivitäten des Trainers und der Teilnehmer können wir zwei typische Lehrstilarten unterscheiden.
Der Dozent
Lehrstil Dozieren
Der Dozent bereitet die Fachinformationen anschaulich auf und präsentiert diese, um sie zu vermitteln. Eine aktive Beschäftigung der Lernenden mit den Informationen ist hierbei nicht vorgesehen. Mit der Methode Lehrvortrag (siehe Seite 205) können auf diese Weise viele Lerninhalte innerhalb einer Unterrichtsstunde präsentiert und fachliche Zusammenhänge verdeutlicht werden. Dabei sollte der Dozent darauf achten, die Geschwindigkeit der Informationsdarbietung an die Aufnahmekapazität der Teilnehmer anzupassen. Scherzhaft wird diese Art der Wissensaufnahme als „Nürnberger Trichter“ bezeichnet.
Die Teilnehmer müssen sich in der Regel nach dem Ende der Veranstaltung mit dem vermittelten Lernstoff noch einmal intensiv auseinandersetzen, um diesen wirklich beherrschen zu können. Geschieht dies nicht, ist der Lerneffekt durch den Besuch der Veranstaltung sehr gering, denn nicht wiederholter Stoff wird schnell vergessen.
Das Beispiel aus der Seminarpraxis
Wenn ich Seminarteilnehmern in einem Präsentationsseminar die wichtigsten Präsentationsgrundregeln vermitteln möchte, hänge ich sechs Überschriftenkarten mit den Aspekten „Aufbau der Präsentation“, „Stand und Bewegung“, „Mimik und Gestik“, „Sprache“, „Medieneinsatz“ und „Sonstiges“ an eine Pinnwand. Unter jede Überschrift bringe ich dann nach und nach jeweils circa drei Karten mit den wichtigsten Tipps an und erläutere diese ausführlich. Für die Präsentation der 18 Tipps benötige ich ungefähr 20 Minuten.
Der Trainer
Lehrstil Trainieren
Der Trainer setzt teilnehmeraktivierende Methoden ein (mehr ab Seite 221). Entweder lässt er die Teilnehmer die Lerninhalte selbstständig erarbeiten, oder er gibt ihnen im Anschluss an eine kurze Präsentationseinheit die Aufgabe, sich mit dem Lehrstoff praktisch auseinanderzusetzen. Werden dabei Gruppenarbeiten präsentiert, gibt der Trainer Rückmeldungen dazu. Er stellt dabei gegebenenfalls falsch Dargestelltes richtig und ergänzt fehlende Informationen.
Abb.: Teilnehmerinnen erarbeiten sich ein Thema selbstständig
Selbsterlerntes Wissen festigt sich
Durch praktische Tätigkeiten erarbeitetes und „antrainiertes“ Wissen können die Teilnehmer in der Regel besser in der Alltags- und Berufspraxis nutzen als rein theoretisch vermittelte Informationen. Selbsterlerntes Wissen festigt sich zudem besser. Allerdings ist der Zeitaufwand bei dieser Vorgehensweise viel höher als bei einer reinen Stoffvermittlung.
Das Beispiel aus der Seminarpraxis
Nachdem ich in dem Präsentationsseminar den Teilnehmern die Grundregeln für wirkungsvolles Präsentieren vorgestellt habe, erhalten diese die Aufgabe, eine circa dreiminütige Präsentation zu einem vorgegebenen Thema zu erstellen. Sie sollen bei der anschließenden Durchführung auf einen selbst gewählten Aspekt des Präsentationsverhaltens achten. Anschließend gebe ich ihnen eine persönliche Rückmeldung. Empfehlungen zum Präsentationsverhalten, die für alle relevant sind, notiere ich auf Karten und hänge diese zu den bereits an der Pinnwand aufgehängten Empfehlungen hinzu.
Gegenüberstellung der Aktivitäten des Leiters und der Teilnehmer
Lehrstil
Aktivitäten des Leiters
Aktivitäten der Teilnehmer
Dozent
Bereitet den Lehrstoff auf und agiert als Informationsvermittler.
Nehmen Informationen durch Zuhören relativ passiv auf.
Trainer
Präsentiert nur kurz Informationen. Gibt den Teilnehmern Aufgaben, steht bei Fragen während des Arbeitsprozesses zur Verfügung. Gibt Rückmeldung zur Ergebnispräsentation und ergänzt diese gegebenenfalls inhaltlich.
Erarbeiten sich Lerninhalte bzw. bearbeiten Aufgaben selbstständig und präsentieren Ergebnisse.
Die sinnvolle Kombination der Lehrstile
Informationspräsentation und Training im Wechsel
Die neuen Lerntheorien, die sich am so genannten Konstruktivismus orientieren, betonen, dass die Informationsaufnahme und -abspeicherung im Gehirn ein aktiver Prozess ist und nicht passiv abläuft. Anstatt Informationen den Teilnehmern „einzutrichtern“, ist es lerneffektiver, die Teilnehmer immer wieder selbst in die Stofferarbeitung mit einzubeziehen (siehe Seite 50 f.). Dies spricht aber nicht grundsätzlich gegen kurze Informationsphasen durch Sie. Wenn Sie den Lernstoff gut strukturiert und anschaulich vermitteln, so dass die Teilnehmer motiviert sind, sich gedanklich damit auseinanderzusetzen, trägt dies wesentlich zum Erkenntnisgewinn bei. Besonders lerneffektiv ist dies, wenn die Teilnehmer anschließend die Möglichkeit erhalten, sich aktiv mit dem Vermittelten auseinanderzusetzen (siehe hierzu die Hinweise ab Seite 199).
Der Prozess des Aufnehmens und des aktiven Umgangs mit Informationen ist vergleichbar mit dem physiologischen Prozess des Atmens. Phasen, in denen die Teilnehmer einatmen, also Informationen aufnehmen, sollten sich sinnvollerweise abwechseln mit Phasen, in denen sie ausatmen können, in denen sie sich also aktiv mit den Informationen beschäftigen. Werden ihnen zu viele Informationen am Stück präsentiert, so dass sie zu viel einatmen müssen, ist die Aufnahmekapazität schnell erreicht, und sie können keine neuen Informationen mehr aufnehmen.
Trainer und Teilnehmer profitieren gleichermaßen von einer abwechslungsreichen Lehre
Für Sie als Seminarleiter gilt dieses Prinzip des Ein- und Ausatmens in ähnlicher Weise. Ein Seminar ist für Sie weniger anstrengend und gleichzeitig interessanter, wenn Sie nicht die ganze Zeit vor der Gruppe stehen und Informationen präsentieren, sondern auch die Teilnehmer regelmäßig aktiv werden lassen. Durch die Beiträge der Teilnehmer können Sie unter Umständen auch etwas lernen. So profitieren beide Seiten von einer abwechslungsreich gestalteten Lehre.
Auf dieses Thema wird noch einmal ab Seite 197 eingegangen.
Praxistipp
Wenn Sie bei einer Seminardurchführung anstelle der Rolle des Dozenten die des Trainers einnehmen, verlassen Sie die Position des „allwissenden“ Informationsanbieters und haben weniger Kontrolle über den Ablauf der Veranstaltung. Es können zum Beispiel Probleme zwischen den Teilnehmern in den Gruppenarbeiten auftreten oder andere Arbeitsergebnisse herauskommen, als von Ihnen erwartet. Dennoch ermutige ich Sie, sich immer wieder in die Rolle des lernunterstützenden Trainers zu begeben. Wenn Sie beide Lehrstile abwechslungsreich einsetzen, ist das für die Teilnehmer interessanter und verspricht einen höheren Lerngewinn. In der Regel lösen die Teilnehmer die an sie gestellten Aufgaben kompetent, und es kommen gute Arbeitsergebnisse heraus, aus denen auch Sie lernen werden. Zusätzlich ermöglicht Ihnen der Einsatz teilnehmeraktivierender Methoden, Ihre Lehre viel abwechslungsreicher zu gestalten. Damit wird Ihnen Ihre Tätigkeit noch mehr Freude machen.
Reflexionsaufgaben zu Lehrstile
Überlegen Sie sich bitte für einen konkreten Fachinhalt aus Ihrem Lehrkontext, wie Sie diesen Ihren Teilnehmern durch eine Kombination der Lehrstile des Dozenten und des Trainers nahebringen können.
Fachinhalt:
………
Praktisches Vorgehen in der Lehreinheit:
………
Lehrstile auf den Punkt gebracht
Es gibt zwei verschiedene Lehrstile:
Lehrstil des Dozenten. Er bereitet Fachinformationen anschaulich auf und stellt diese den Teilnehmern vor. In einer Unterrichtseinheit kann mit diesem Vorgehen viel Lehrstoff präsentiert werden. Dieser ist jedoch schnell wieder vergessen, wenn er nicht intensiv wiederholt wird.
Lehrstil des Trainers: Der Trainer lässt die Lerninhalte durch die Teilnehmer selbstständig erarbeiten, oder die Teilnehmer beschäftigen sich im Anschluss an eine kurze Präsentationseinheit aktiv in praktischen Übungen mit dem Lehrstoff. Zu Gruppenarbeitsergebnissen gibt der Trainer Rückmeldungen. Die Teilnehmer können das Gelernte gut auf die Alltags- und Berufspraxis übertragen. Zudem festigt sich Selbsterlerntes besser.
Die Kombination aus beiden Lehrstilen ist für den Lernerfolg der Teilnehmer am erfolgversprechendsten. Dem Lehrenden ermöglicht dies, seine Veranstaltungen abwechslungsreicher zu gestalten.
Literatur zum Vertiefen des Themas
Döring, Klaus: Handbuch Lehren und Trainieren in der Weiterbildung. Weinheim 2008 Der Autor setzt sich in seinem Buch auch ausführlich mit der Dozenten- und Trainerrolle auseinander.
Lienhart, Andrea: Seminare, Trainings und Workshops lebendig gestalten. 3. Aufl., Freiburg 2019 Der kleine, aber inhaltsreiche Taschenguide setzt sich mit der Trainerrolle und den Traineraufgaben in zwei Kapiteln auseinander.
Drei Angst in der Lehre – Der selbstsichere Umgang mit Lampenfieber und Kritik
Erst, als ich mich ganz sicher fühlte, lief alles schief.
Das Gefühl der Angst, das einen überkommen kann, wenn man vor einer Gruppe steht und vor dieser spricht, wird wie im Theater als Lampenfieber bezeichnet. Dieses Angstgefühl ist bei den meisten Lehrenden zu Seminarbeginn vorhanden und wird verstärkt durch Gedanken wie zum Beispiel: „Was passiert, wenn ich vergesse, was ich eigentlich sagen möchte?“, oder „Sind die Zuschauer mit dem, was ich ihnen biete, zufrieden?“ Weil Lampenfieber mit unangenehmen körperlichen Empfindungen verbunden ist, wird es als belastende Begleiterscheinung des Lehrens angesehen. Warum es für eine Seminardurchführung sogar förderlich ist, wenn es sich auf ein normales Maß beschränkt, beschreibt der erste Teil dieses Kapitels.
Ein weiterer mit Ängsten verbundener Aspekt in der Lehre ist die Kritik von Teilnehmern an der Seminardurchführung. Diese Art von Kritik wird zumeist als belastend empfunden. „Ich habe mir so viel Mühe gegeben und alles so gut vorbereitet, dennoch waren nicht alle Teilnehmer zufrieden. Ich glaube, ich werde nie einen guten Unterricht machen“, dies sind Gedanken, die schnell entstehen, wenn Kritik am eigenen Unterricht geäußert wird. Lehrende fühlen sich dann schnell in ihrer ganzen Persönlichkeit infrage gestellt. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns im zweiten Teil damit, warum Kritik Ihnen helfen kann und wie Sie konstruktive Rückmeldungen von Ihren Teilnehmern erhalten.
Diese wichtigen Fragen beantwortet dieser Kapitelabschnitt
Warum ist Lampenfieber etwas Natürliches und Nützliches?
Wie können Sie Lampenfieber auf ein verträgliches Maß reduzieren?
Wie können Sie konstruktiv mit Kritik umgehen und diese zur Verbesserung Ihrer Lehre nutzen?
3.1 Mit Lampenfieber sinnvoll umgehen
Die Entstehung des Begriffs Lampenfieber
Wenn wir ein Seminar leiten, stehen wir wie auf einer Bühne. Wir agieren vor einer Gruppe, deren Mitglieder sich über uns und unsere Tätigkeit ein Urteil bilden. So betrachtet, spielen wir als Trainer eine Rolle wie Schauspieler in einer Theateraufführung.
Theaterbühnen werden durch Scheinwerfer ausgeleuchtet. Durch diese Lampen steigt die Temperatur auf der Bühne stark an. Schauspieler sind auch zumeist zum Beginn ihres Theaterstückes aufgeregt und empfinden diese Hitze beim Betreten der Bühne als Lampenfieber.
Physiologische Gründe für Lampenfieber
Evolutionsbedingtes Verhalten: Durch Stress wird das Hormon Adrenalin ausgeschüttet
Wenn etwas Überraschendes, für uns Unvorhersehbares geschieht, müssen wir hellwach sein, um sofort darauf reagieren zu können, denn im schlimmsten Fall kann dies unser Leben bedrohen. Der Körper besitzt einen Mechanismus, der ihm bei Bedrohung ermöglicht, sofort zu reagieren und ihm zusätzliche Energie zum Wegzulaufen oder Kämpfen bereitstellt. Die Substanz, die der Körper in solchen Fällen aus den Nebennieren in den Körper ausschüttet, ist das Hormon Adrenalin. Dieser physiologische Vorgang ermöglichte unseren Vorfahren zu Urzeiten blitzschnell zu reagieren, wenn ihnen plötzlich auf der Jagd ein gefährliches Tier begegnete.
Eine bevorstehende Seminardurchführung ist zwar nichts Lebensbedrohliches, führt aber im Körper oft zu der beschriebenen Alarmreaktion. Verstärkt wird diese, wenn wir uns Gedanken über mögliche auftretende Probleme während des Seminarverlaufs machen. Dies erzeugt Stress für uns, und auf natürliche Weise wird das Hormon Adrenalin ausgeschüttet. Da es in der Seminarsituation weder günstig ist, wegzurennen, noch sinnvoll, gegen jemanden zu kämpfen, müssen wir einen anderen Weg finden, mit den Stress-Symptomen zurechtzukommen. Die unangenehmen Empfindungen bleiben so lange bestehen, bis wir das Gefühl bekommen, dass die Veranstaltung gut läuft.
Diese Hormonausschüttung in der Stress-Situation eines Seminarbeginns hat auch positive Seiten. Das Adrenalin fördert bei einer leicht erhöhten Konzentration in unserem Körper unsere geistige Konzentration und gibt uns zusätzlich Energie, über mehrere Stunden oder länger eine Gruppe engagiert unterrichten zu können, ohne zu ermüden.
Ein normales Maß an Aufregung ist positiv
Eine gewisse Aufregung im Vorfeld des Seminars gibt uns zusätzliche Energie und ermahnt uns, die Veranstaltung gewissenhaft vorzubereiten. Man kann es mit dem Rotsignal einer Ampel vergleichen, das unsere Wachsamkeit wecken will. Beides trägt zu einer gelungenen Seminardurchführung bei.
Verspüren wir dagegen keine Aufregung, ist dies ein Problem. Es besteht dann die Gefahr, dass wir uns zu sicher fühlen. Wenn das dazu führt, dass wir die Veranstaltungsvorbereitung auf die leichte Schulter nehmen und die Veranstaltung zu „locker“ angehen, gefährdet dies den Seminarerfolg. Teilnehmer, die spüren, dass der Seminarleiter nicht gut vorbereitet und nicht mit voller Konzentration bei der Sache ist, sind schnell unzufrieden. Dann besteht die Gefahr, dass das Seminar ganz anders als von uns erwartet verläuft. So lässt sich das Phänomen erklären, dass bei einer Veranstaltung, die man mehrfach souverän durchgeführt hat, und von deren Erfolg man vor der nächsten Durchführung fest überzeugt war, genau das gerade Beschriebene passiert: „Erst, als ich mich ganz sicher fühlte, lief alles schief.“
Wenn Sie ein normales Maß an Aufregung empfinden, fördert dies eine gute Seminarvorbereitung und -durchführung. Ein zu hohes Maß an Anspannung ist dagegen unangenehm und wirkt konzentrationshemmend. Wichtig ist es deshalb, dass Sie Ihre Aufregung auf ein verträgliches Maß reduzieren. Aber wie gelingt Ihnen dies? Hierfür erhalten Sie zunächst allgemeine und danach spezielle Tipps.
Allgemeine Tipps gegen Lampenfieber
Machen Sie sich bewusst, dass Lampenfieber evolutionsbedingt tief und fest in uns verankert ist. Es ist also etwas völlig Natürliches und für den Seminarerfolg sogar hilfreich. Im Lampenfieber liegt eine Kraft, die wir nutzen können.
Durch unsere Angst, dass die Teilnehmer unser Lampenfieber mitbekommen, steigern wir selbst dieses Gefühl. Dabei wird nur ein Bruchteil von dem, was Sie innerlich spüren, von den anderen anwesenden Personen überhaupt wahrgenommen. Weder Herzrasen, Harndrang, Bauchschmerzen oder feuchte Hände – wenn Sie nicht gerade anderen Personen die Hand geben – sind äußerlich erkennbar, und selbst ein etwas schnelles Sprechen bemerken nur diejenigen, die Sie besser kennen. Nur sehr wenig von dem, was Sie selbst innerlich als Zeichen von Nervosität verspüren, zeigt sich auch nach außen. Das sollte Sie beruhigen. Im Übrigen kann dies durchaus sympathisch wirken.
Sie sind nicht allein
Nicht nur Sie haben Lampenfieber, sondern alle, die sich der Herausforderung stellen, anderen etwas beizubringen. Ich selber verspüre nach über 15 Jahren Lehrtätigkeit vor jeder Veranstaltung noch immer eine innerliche Grundanspannung. Ich akzeptiere diese als natürliche und für den Seminarerfolg sogar wichtige körperliche Reaktion. Mir dies bewusst zu machen, vermindert meine Nervosität auf ein verträgliches Maß.
Abb.: Einschätzung der Intensität des Lampenfiebers erfahrener Hochschullehrer, wenn ihr Seminar beginnt
Relativieren Sie die „Gefahren“ einer Seminardurchführung: Es geht nur um ein Seminar und nicht um Ihr Leben. Machen Sie sich zusätzlich bewusst, dass Sie schon viel bedeutendere Aufgaben in Ihrem Leben gemeistert haben.
Freuen Sie sich bewusst darauf, Ihr interessantes Thema den Teilnehmern präsentieren zu dürfen. Bemühen Sie sich um eine positive Einstellung zu Ihren Zuhörern. Diese wollen Ihnen in aller Regel nicht schaden, sondern möchten von Ihnen etwas lernen.
Mit der Routine kommt die SicherheitJe häufiger Sie sich einer angsterzeugenden Situation aussetzen, umso mehr Sicherheit gewinnen Sie in dieser. Vielleicht denken Sie noch wie ich mit Graus an die allerersten Autobahnfahrten zurück, bei denen Sie am Steuer saßen. Da ich nun in meinem Leben schon sehr viele Stunden im Auto verbracht habe, nähere ich mich heutzutage ohne Aufregung Autobahnauffahrten. Es hat sich ein Gewöhnungseffekt eingestellt. Das gilt genauso für den Bereich der Lehre, wenn Sie regelmäßig Seminare durchführen.
Spezielle Tipps gegen Lampenfieber
Eine gute Vorbereitung gibt Sicherheit
Eine gute inhaltliche und organisatorische Vorbereitung gibt Ihnen Sicherheit. Dazu kann eine Probedurchführung mit dem gedanklichen Durchspielen aller Präsentationseinheiten Ihres Seminars gehören. Stellen Sie sich vor, das Auditorium bestünde aus Freunden und Bekannten.
Notieren Sie sich den Ablauf Ihrer Veranstaltung in Stichworten auf Karten oder Zetteln, und legen Sie sich diese während der Veranstaltung gut erreichbar hin. Auf diese Notizen können Sie, sollte ein Blackout drohen, zurückgreifen.
Treiben Sie Ausdauersport am Abend vor der Veranstaltung oder direkt davor am Morgen. Ein circa 30-minütiger Lauf vermindert den Adrenalinspiegel in Ihrem Körper und sorgt zusätzlich dafür, dass Sie sich frisch und konzentriert fühlen. Übertreiben Sie die sportliche Leistung aber nicht. Laufen Sie nicht unmittelbar vor der Veranstaltung Ihren ersten Marathon, sondern starten Sie Ihre Ausdaueraktivitäten möglichst schon eine gewisse Zeit vorher, damit sich der Körper an dieses Entspannungsgefühl erinnert.
Belohnen Sie sichÜberlegen Sie sich vor Seminarbeginn, wie Sie sich nach der erfolgreichen Durchführung belohnen werden, zum Beispiel mit einem Aufenthalt in einem Wellness-Bad, dem Kauf eines interessanten Spielfilms auf DVD oder der Anschaffung eines weiteren informativen Buches. Dies fördert die positiven Gedanken an die Seminardurchführung.
Auch ein kleiner Talisman oder das Foto eines Ihnen sehr nahe stehenden Menschen, das Sie bei der Seminardurchführung bei sich tragen, verringert Ihre Aufregung. Ich habe früher oft einen kleinen Steiff-Teddybär in meiner Tasche mit zu den Seminaren genommen, den ich von meiner Großmutter geschenkt bekommen hatte.
Suchen Sie zu Beginn Ihrer Veranstaltung Blickkontakt mit Teilnehmern, die Ihnen sympathisch sind. Wenn diese Ihren Ausführungen sichtbar konzentriert folgen und sogar ab und zu ein Lächeln auf dem Gesicht haben, gibt Ihnen das Sicherheit und zaubert vielleicht auch Ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Dies wirkt sich dann positiv auf Ihre Stimmung und auch die der Zuschauer aus.
VideoanalyseNehmen Sie eine eigene Seminarsequenz auf Video auf. Die mitlaufende Kamera kann zunächst ein weiterer Stressor sein, Sie werden diese aber schon nach kurzer Zeit nicht mehr wahrnehmen. Wenn Sie sich danach die Videoaufzeichnung ansehen, werden Sie feststellen, dass Sie viel ruhiger und souveräner nach außen wirken, als Sie dies selbst von sich gedacht haben. Die Selbst- und die Fremdwahrnehmung unterscheiden sich hierbei sehr. Sollten Sie das nicht glauben, probieren Sie es einfach aus.
3.2 Mit Kritik selbstsicher umgehen
Psychologie des Kritisiertwerdens
Wir alle reagieren empfindlich auf Kritik
Aufgrund der durch Verbote und Einschärfungen gemachten Erfahrungen aus dem Kindes- und Jugendalter reagieren wir als Erwachsene oft empfindlich gegenüber Kritik an unserer Person. Als Trainer gehören kritische Rückmeldungen der Teilnehmer zu Ihrem Praxisalltag, sie sind Teil Ihres Berufs. Zum einen ist es üblich, in den Seminaren am Ende Rückmeldebögen auszuteilen, die die Teilnehmer sogar dazu auffordern, Kritik zu äußern (ab Seite 309). Zum anderen halten Teilnehmer, die mit einem Kursverlauf unzufrieden sind, sich mit kritischen Äußerungen oft nicht zurück. Diese äußern sie in den Pausen oder am Seminarende. Ganz schnell befindet sich der Leiter so wieder in einer aus der Kindheit bekannten Situation, sein Gegenüber bewertet sein Verhalten und kritisiert ihn. Dies ist dann oft wieder mit negativen Gefühlen verbunden.
Da wir es, wie die Praxis zeigt, in der Regel nie allen Teilnehmern recht machen können, da deren Erwartungen und Ansprüche oft sehr verschieden sind, muss man in jeder Veranstaltung auf Kritik gefasst sein. Empfindet man diese als persönliche Bedrohung, ist Lehre schnell mit Angstgefühlen verbunden und anstatt Freude zu machen, wird sie dann als Belastung empfunden.
Das Beispiel aus der Seminarpraxis
Bei einem Seminar, das ich zumeist mit einem Kollegen durchführe, nutzen wir für den Einstieg die Fishbowl-Methode (siehe Seite 239 f.). Wir beide stehen uns vor der Gruppe gegenüber und schauspielern, dass außer uns niemand im Raum ist und der Seminarbeginn noch bevorstünde. Wir tauschen uns über die geplanten Inhalte aus, über das methodische Vorgehen und erzählen uns nebenbei etwas über unsere Hobbys. So lernen die Teilnehmer zum einen eine originelle Möglichkeit für einen Seminareinstieg kennen und bekommen schon erste Informationen zum Ablauf der Veranstaltung und zu uns Trainern.
Oft erhalten wir von unseren Teilnehmern Rückmeldungen zu dieser Art von Seminareinstieg. Einige finden ihn sehr interessant und aktivierend, andere wiederum mögen ihn nicht. Und genau das wird Ihnen in Ihren Seminaren auch so ergehen. Dass, was einige Personen als besonders positiv empfinden, wird von anderen gleichzeitig negativ bewertet. Auch in der Lehre kann man es oft nicht allen recht machen.
Hilfreiche Rückmeldungen
Kritik kann konstruktiv sein
Kritik im Training muss nichts Negatives und Belastendes sein. Konstruktiv formuliert und auf etwas Konkretes bezogen, ermöglicht sie uns, unser Lehrverhalten zu verbessern. Voraussetzung dafür ist, dass die Rückmeldungen sachgerecht durchgeführt werden und von uns Lehrenden eine prinzipielle Offenheit gegenüber Kritik besteht, mit der grundsätzlichen Bereitschaft, sich damit konstruktiv auseinanderzusetzen.
Wie erreichen Sie es in der Veranstaltung, dass konstruktive Kritik gegeben wird?
Den Teilnehmern die Chance geben, systematisch Kritik zu äußern
Steuern Sie kritische Rückmeldungen
Ermöglichen Sie den Teilnehmern, Ihnen nicht nur am Seminarende, sondern auch zwischendurch Rückmeldung zu geben, bei einer mehrtägigen Veranstaltung zum Beispiel am Ende des zweiten Tages. Dadurch vermindern sich kritische Pausengespräche und Sie haben die Möglichkeit, auf die Rückmeldungen zu reagieren. Damit kein einseitig negatives Bild Ihres Seminars entsteht, sollten Sie beim Einsatz von Feedback-Verfahren auch die Aspekte erfragen, die den Teilnehmern gut gefallen haben. Drei Methoden, mit denen Sie denen Sie sich ein Zwischenfeedback Ihrer Teilnehmer einholen können, werden Ihnen ab Seite 304 vorgestellt.
Wenn Sie für die Rückmeldung die Regel vorgeben, dass sich die Kritik auf etwas Konkretes beziehen und Verbesserungswünsche beinhalten soll, wie zum Beispiel: „Die Lehreinheiten sind mir zu lang, ich wünsche mir nach 60 Minuten jeweils eine Pause“, ist der entscheidende Schritt von einer allgemeinen Frustrationsäußerung hin zu einer hilfreichen Rückmeldung getan. Wenn Ihnen die geäußerte Kritik zu unkonkret ist, können Sie um Konkretisierung bitten: „Wieso haben Sie das Gefühl, dass die Einheiten zu lang sind?“
Unterscheiden zwischen Einzel- und Mehrheitsmeinung
Wie viele Personen betrifft es?
Wichtig ist es, dass Sie herausbekommen, ob es sich bei den Kritikpunkten um eine Einzelmeinung oder die der Mehrheit der Gruppe handelt. Wenn Sie wissen möchten, wie die Mehrheit zu einer Kritik steht, fragen Sie direkt nach: „Wer von Ihnen wünscht sich kürzere Informationseinheiten und mehr Pause? Diejenigen sollen sich bitte melden.“ Sie können auch gleichzeitig die Konsequenzen der gewünschten Änderung verdeutlichen: „Wer möchte, dass wir mehr Pausen machen und dafür auf bestimmte Inhalte verzichten sollen, bitte melden.“ Dieser Dialog mit der Gruppe zeigt, dass Sie an deren Meinung interessiert sind und wird Ihnen nicht als Schwäche ausgelegt.
Angemessen auf Kritik reagieren
Die richtige Reaktion auf Feedback
Wenn die Aspekte, die von Teilnehmern kritisiert werden, von Ihnen nicht zu beeinflussen sind, teilen Sie dies den Teilnehmern freundlich mit. „Ich kann mir vorstellen, dass die Einheiten für Sie anstrengend sind. Da ich gemäß Vorgabe bis morgen Abend mit dem Stoff durchkommen muss, kann ich nicht mehr Pausen anbieten. Ich gebe Ihre Rückmeldung gerne weiter, so dass die Planung zukünftig besser auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann.“ Ihre Reaktion sollte aber nie die Funktion einer Rechtfertigung haben. Die Aussage: „Ich habe bisher die Einheiten immer so lange gestaltet, und es hat sich bisher noch nie jemand beschwert. Es muss wohl an Ihnen liegen …“, verstößt gegen die Regeln des Annehmens von Feedback (siehe Seite 91 f.) und zeugt nicht von einem souveränen Lehrverhalten. Anstatt zu spontan mit einem „Gegenangriff“ zu reagieren, ist es sinnvoller, eine Kritik erst einmal anzunehmen.
Der gesunde Umgang mit Kritik
Nehmen Sie kritische Rückmeldungen nicht persönlich
Wer über viele Jahre lang lehrend tätig sein möchte, darf Kritik nicht zu sehr an sich heranlassen. Kritische Rückmeldungen der Teilnehmer stellen in der Regel nicht Sie als Person in Frage, sondern bestimmte Aspekte Ihrer Seminardurchführung. Nehmen Sie konstruktive Kritik zunächst in Ruhe an, beschäftigen Sie sich gedanklich mit dieser und entscheiden Sie dann, ob sie für Sie hilfreich ist und welche Konsequenzen Sie gegebenenfalls daraus ziehen.
Sollte der Fall auftreten, dass eine Kritik als persönlicher Angriff gegen Sie formuliert ist, sollten Sie besonnen, aber bestimmt reagieren. Versuchen Sie, auf der Sachebene zu bleiben. Solange Sie Ruhe bewahren und sachlich bleiben, werden Sie die Mehrheit der Teilnehmer auf Ihrer Seite haben. Wenn Sie aber die sachliche Ebene verlassen und persönliche Angriffe gegen die betreffende Person starten, wie zum Beispiel „Sie haben ja selbst überhaupt keine Ahnung vom Thema“, besteht die Gefahr, dass Sie nicht nur die betreffende Person, sondern die ganze Gruppe gegen sich aufbringen. Versuchen Sie, in einem Krisenfall ruhig durchzuatmen und mit ruhiger Stimme auf die Kritik zu antworten. Wie Sie sinnvoll auf mögliche Probleme in Ihrer Veranstaltung reagieren, verdeutlicht Ihnen der Abschnitt ab Seite 112.
Reflexionsaufgaben zu Lampenfieber
Sollten Sie eine starke Aufregung vor Ihren Seminardurchführungen verspüren, überlegen Sie sich bitte ein bis zwei Maßnahmen, wie Sie diese reduzieren können. Betrachten Sie hierzu noch einmal den Abschnitt „Spezielle Tipps gegen Lampenfieber“ auf Seite 31.
Wählen Sie nun die beiden Hinweise aus, die Sie vor der nächsten Seminardurchführung beachten werden:
………
………
Welche Möglichkeit fällt Ihnen zusätzlich ein, um Ihre Aufregung zu reduzieren?
………
Reflexionsaufgaben zu Umgang mit Kritik
Denken Sie bitte darüber nach, welche Kritik Ihnen zuletzt begegnet ist (wenn möglich im Trainingsbereich, sonst auch in einem anderen Kontext). Überprüfen Sie, ob diese konkret und konstruktiv formuliert war. Wenn dies nicht der Fall war, überlegen Sie, mit welcher Frage Sie die Person, die diese Kritik ausgesprochen hat, dazu hätten bringen können, Ihnen konkrete Hinweise zur Verbesserung zu geben.
………
Der selbstsichere Umgang mit Lampenfieber auf den Punkt gebracht
Lampenfieber vor einer Seminardurchführung zu haben, ist ein natürlicher physiologischer Vorgang. Die dabei bereitgestellte Energie können Sie nutzen, um Ihre Veranstaltung gut vorzubereiten und sie konzentriert durchzuführen.
Die meisten der Symptome, die wir bei Aufregung verspüren, bekommen unsere Teilnehmer nicht mit. Wir wirken nach außen viel ruhiger, als wir uns dies selber vorstellen.
Anspannung zu Seminarbeginn verspüren auch erfahrene Trainer noch und akzeptieren dies.
Eine gute Vorbereitung und Ausdauersport vor der Seminardurchführung vermindern das Gefühl von Aufgeregtheit.
Mit zunehmender Erfahrung im Durchführen von Seminaren nimmt auch die Aufregung ab.
Der selbstsichere Umgang mit Kritik auf den Punkt gebracht
Durch unsere Erziehung ist für uns das Thema Kritik überwiegend negativ besetzt.
Setzen Sie Feedback-Verfahren bei einer über mehrere Tage andauernden Veranstaltung bereits am Abend des ersten oder zweiten Seminartags ein, um rechtzeitig auf Kritik reagieren zu können.
Um durch die Rückmeldungen kein einseitig negatives Bild über das Seminar zu erhalten, lassen Sie sich auch Rückmeldungen zu den positiven Aspekten geben.
Geben Sie Ihren Teilnehmern die Feedback-Regel vor, dass sich ihre Kritik auf etwas Konkretes beziehen und Verbesserungswünsche beinhalten soll.
Bevor Sie auf eine Kritik reagieren, bringen Sie in Erfahrung, ob es sich um eine Einzelmeinung oder die der Gruppenmehrheit handelt.
Literatur zum Vertiefen der Themen
Morschitzky, Hans: Die Angst zu versagen und wie man sie besiegt. 6. Aufl., Düsseldorf 2011 Dieser Ratgeber des Psychotherapeuten Hans Morschitzky erläutert die Hintergründe für das Entstehen von Versagensängsten und gibt konkrete Hilfestellungen, wie Betroffene die Ängste überwinden können.
Holzheu, Harry: Natürliche Rhetorik ohne Lampenfieber – Der Weg zum freien Reden. München 2010 Das Buch bezieht sich primär auf die Thematik des Präsentierens. Es erläutert aber auch, wie die Ängste beim freien Reden vor einer Gruppe bewältigt werden können.
Vier Effektiv präsentieren im Seminar
Bleiben Sie authentisch, das ist die wichtigste Präsentationsregel!
Lehrstoff vermitteln und sich selbst präsentieren
Wenn Sie im Seminar vorne stehen und Informationen vermitteln, haben Sie viele Konkurrenten, die auch um die Aufmerksamkeit Ihrer Teilnehmer buhlen. Ihre Zuschauer entscheiden selbst, ob sie Ihnen die volle Aufmerksamkeit zukommen lassen oder zum Beispiel einem anderen Teilnehmer, den sie interessant finden oder auch einem Geschehen, das außerhalb des Seminarraums stattfindet. Diesen Wettbewerb gewinnen Sie durch eine ausreichende Präsenz im Seminarraum. Hierzu gehört unmittelbar die Art, wie Sie verbal und nonverbal Ihren Lehrstoff vermitteln, was direkten Einfluss darauf hat, wie gut Ihre Teilnehmer Ihren zuhören und den Lehrstoff aufnehmen können.
Diese wichtige Frage beantwortet dieser Kapitelabschnitt
Welches sind die wichtigsten Grundregeln für effektives Präsentieren in der Lehre?





























