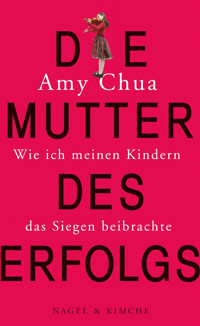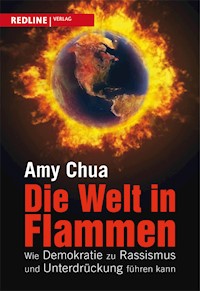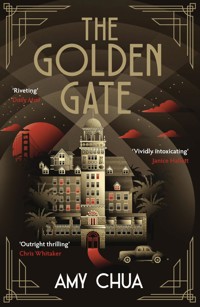8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hinter der glänzenden Fassade der feinen Gesellschaft lauern die dunkelsten Geheimnisse …
Berkeley 1944: Detective Al Sullivan hat nach einer Verabredung kaum das glamouröse Claremont Hotel verlassen, als er dorthin zurückgerufen wird. Der Präsidentschaftskandidat Walter Wilkinson wurde in seinem Zimmer erschossen. Unter den Hotelgästen stößt Al auf zahlreiche Verdächtige: Steckt die chinesische Schönheit Chiang Kai-shek, mit der Wilkinson eine Affäre hatte, hinter dem Mord? Fiel Wilkinson einem politisch motivierten Attentat zum Opfer? Und was verschweigen die mysteriösen Bainbridge-Töchter, Erbinnen einer der reichsten Familien ganz San Franciscos, die in der Nähe des Tatorts gesehen wurden? Auf der Suche nach der Wahrheit gerät Al in ein Netz aus dunklen Geheimnissen, Intrigen und Schuld …
»Klug, geistreich und absolut spannend.« Chris Whitaker
»Ein sensationell fesselnder Krimi …« Booklist
»Ein grandioses Lesevergnügen.« Kirkus Reviews
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Berkeley 1944: Imposant thront das luxuriöse Claremont Hotel in den Hügeln über der Bucht von San Francisco. Hier residieren die vornehmsten Gäste der Stadt, so auch der Präsidentschaftskandidat Walter Wilkinson. Doch dann der Schock: In der Nacht wird Wilkinson in seinem Zimmer erschossen. Detective Al Sullivan steht unter großem Druck, den Fall schnellstmöglich aufzuklären, und stößt unter den glamourösen Gästen wie auch den Bediensteten auf zahlreiche Verdächtige: Steckt die chinesische Schönheit Chiang Kai-shek, mit der Wilkinson eine Affäre hatte, hinter dem Mord? Verstecken sich Kommunisten in den Reihen des Personals? Und was verschweigen die mysteriösen Bainbridge-Töchter, die einer der reichsten Familien ganz San Franciscos angehören und in der Nähe des Tatorts gesehen wurden? Auf der Suche nach der Wahrheit muss Al erkennen, dass in der elegantesten Gesellschaft die dunkelsten Geheimnisse lauern …
Autorin
Amy Chua hat in Harvard Jura studiert und unterrichtet heute als Professorin an der Yale Law School. Sie hat erfolgreich Sachbücher veröffentlicht, darunter den internationalen Bestseller »Die Mutter des Erfolgs«, der in über dreißig Sprachen übersetzt wurde. »Das letzte Geständnis« ist ihr erster Kriminalroman.
Amy Chua
Das letzte Geständnis
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Kristina Lake-Zapp.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »The Golden Gate« bei Minotaur Books, an imprint of St. Martin’s Publishing Group, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe August 2024
Copyright © by Amy Chua 2023
Copyright © dieser Ausgabe 2024
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © FinePic®, München; gettyimages/MoreISO
Redaktion: Susanne Bartel
ES · Herstellung: ik
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-31102-5V002
www.goldmann-verlag.de
Editorische Notiz
Dieser Roman spielt in einer Zeit, in der Vorurteile und Anfeindungen gegen Menschen anderer Ethnien, Hautfarbe und Religion zum Alltag gehörten sowie der Irrglaube bestand, man könne Menschen in unterschiedliche »Rassen« einteilen. Dem Verlag ist bewusst, dass es sich bei einigen verwendeten Ausdrücken um Diffamierungen und Stereotypen handelt. Die Verwendung der Begriffe dient jedoch dazu, durch die ausdrückliche Benennung den Leser*innen die Geschichte und die Wirkung von Rassismus gezielt vor Augen zu führen.
Für Mom und Dad
und für meine Schwestern Michelle, Katrin und Cynthia
Prolog
AUSSAGEVONMRSGENEVIEVEBAINBRIDGE,
ORDNUNGSGEMÄSSALSZEUGINVEREIDIGT,
AUFGENOMMENVONBEZIRKSSTAATSANWALTDOOGAN
AM 15. MÄRZ 1944,
BEGINNENDUM 10:00 UHR
F: Guten Morgen, Mrs Bainbridge. Würden Sie bitte für das Protokoll Ihren vollen Namen und Ihre Adresse nennen?
A: Genevieve Hopkins Bainbridge, 2907 Avalon Avenue, Berkeley, Kalifornien.
F: Wie alt sind Sie?
A: Zweiundsechzig.
F: Danke. Verstehen Sie, warum wir Sie zu dem heutigen Gespräch gebeten haben, Mrs Bainbridge?
A: Ich wurde nicht gebeten, Mr Doogan. Ich wurde vorgeladen.
F: Das ist korrekt. Weil Sie sich geweigert haben, mit uns zu reden, als wir Sie darum gebeten haben. Mrs Bainbridge, verstehen Sie, warum Sie hier sind?
A: Ja. Sie möchten, dass ich Ihnen mein eigen Fleisch und Blut ans Messer liefere.
F: Bitte bleiben Sie bei den Fakten, Mrs Bainbridge.
A: Genau das tue ich, Mr Doogan.
F: Mrs Bainbridge, ich gebe Ihnen eine Chance, Ihrer Familie zu helfen. Wir wissen, dass eine Ihrer drei Enkelinnen eine Mörderin ist. Ich kann alle drei als Mitverschwörerinnen verurteilen, oder Sie sagen mir, wer es war, und ich werde die anderen beiden verschonen.
[KEINEANTWORTDERZEUGIN]
F: Haben Sie mich gehört, Mrs Bainbridge?
A: Ich habe Sie gehört, Mr Doogan.
Teil eins
Kapitel eins
1930
An einem Januarnachmittag im Jahr 1930 fühlte sich ein sechsjähriges Mädchen, das sich in einem Alabasterpalast in einem geschlossenen Schrank versteckte, zum ersten Mal im Leben richtig allein.
Nur Sekunden zuvor hatte sich Issy, die Kurzform von Isabella, in diesem ganz besonderen Zustand befunden, halb aufgeregt, halb ängstlich, voller Erwartung und Vorfreude auf den prickelnden Moment, in dem die Tür aufgerissen werden und ihre Schwester Iris sie entdecken würde.
Issy liebte diese speziellen Sonntage, an denen Iris, sie und Mommy ihre schönsten Kleider trugen und zum Weißen Palast spazierten, wo Mommy sich umzog und in schneeweißem Rock und mit schneeweißen Strümpfen und schneeweißem Stirnband mit ihrer besten Freundin, Mrs von Urban, Tennis spielte. An diesen besonderen Tagen war Mommy stets wunderschön und kicherte nervös, sie roch auch etwas anders. Sie überließ die Mädchen den ganzen Nachmittag über sich selbst, und während ihres Tennismatchs mit Mrs von Urban konnten Issy und Iris sich nach Belieben im Hotel vergnügen, das Iris, die achtzehn Monate älter war als Issy, in- und auswendig kannte, wenngleich es immer noch mehr zu entdecken gab – geheime Treppen, die sich über sieben Stockwerke erstreckende Wendelrutsche, versteckte Türmchen, Ballsäle, die aus dem Nichts auftauchten.
Iris mit ihren rabenschwarzen und Issy mit ihren blonden Locken machten alles gemeinsam. Issy konnte sich nicht an einen einzigen Tag ihres Lebens erinnern, den sie nicht mit ihrer großen Schwester verbracht hatte, und deshalb hatte sie sich bis zu ebendiesem Moment auch nie allein gefühlt.
Doch jetzt plötzlich war genau das der Fall. Eng zusammengerollt, die Arme um die Knie geschlungen, kauerte sie im untersten Fach eines dekorativen Schranks in einem der langen Flure. Es war ein klug gewähltes Versteck, aber nicht das beste. Eigentlich hätte Iris sie längst finden müssen. Issy hätte längst den leicht hinkenden Schritt ihrer Schwester hören müssen, die einen Fuß etwas fester aufsetzte als den anderen, oder ihren leisen Singsang: »Gleich hab ich dich! Ich weiß, wo du steckst!« Aber alles blieb still. Langsam wurden Issys Beine steif. Sie wusste es nicht, aber sie verharrte schon fast dreißig Minuten in dem Schrank.
Schließlich stieß sie eine der Türen auf, spähte hinaus, und als sie feststellte, dass der Flur leer war, verließ sie ihr Versteck. Irgendetwas in dem Alabasterpalast war anders als sonst. Sogar die Stille klang anders als die, die sie kannte.
Sie kehrte in die Hotellobby zurück und schlenderte zu der Palme – hier war ihr Treffpunkt, sollten sie sich verlieren. In der Lobby war genauso viel los wie immer: elegant gekleidete Herren mit Fedoras, mit Koffern beladene Pagen, Frauen mit Perlen und Pelzkragen – aber Iris war nicht zu sehen.
Issy ging zur Tennisanlage, auch wenn sie wusste, dass ihre Mutter dort nicht sein würde. Sie hielt auf sämtlichen Plätzen mit dem weichen roten Sand nach ihr Ausschau. Bälle flogen durch die Luft, Erwachsene rannten hin und her. Keine Spur von Mommy, und Issy fühlte sich noch einsamer.
Das kleine Mädchen kehrte in die Lobby zurück, sah noch einmal bei der Palme nach und beschloss dann, einen Abstecher in den riesigen Küchenbereich im Untergeschoss zu machen. Sie wusste, dass Iris die Küche liebte, die chaotische Ordnung, die dampfenden Suppenkessel auf dem Herd, die Brotlaibe auf den Blechen, die in die Öfen geschoben oder herausgezogen wurden, die frenetische Brigade, die all die Arbeit bewältigte – Chefkoch, Souschef, Konditor, Brotbäcker und Kartoffelschäler, Kellner, Hilfskellner, Tellerwäscher. Issy sah sie alle an diesem Tag, außerdem den Eiermann, der Kartons mit Eiern lieferte, den Milchmann mit seinen Kannen und den Mann mit der Kapuze, der den Honig brachte. Sie wusste nicht, warum, aber plötzlich spürte sie, wie ein Schrei ihre Kehle hochkroch.
Und in dem Augenblick hörte sie tatsächlich einen Schrei – den entsetzten Schrei einer Frau.
Für einen Moment erstarrte alles um sie herum. Lippen und Hände verharrten reglos; niemand holte Luft. Dann rannte das gesamte Personal gleichzeitig los, in Richtung des grässlichen Schreis, stieß Servierwagen um und fegte Teller zu Boden, ohne das Geschepper wahrzunehmen. Issy folgte ihnen, in ihr stieg Furcht auf.
In einem Raum mit niedriger Decke hatte sich eine Menschenmenge vor den Wäschekörben versammelt. Die Luft dort war stickig, dampfig, drückend. Wie betäubt und ohne nachzudenken, schlängelte sich Issy zwischen Knien und Händen hindurch nach vorn; sie war so klein, dass niemand sie bemerkte. Endlich durchbrach sie die vorderste Reihe, wo sich ein Kreis von Menschen um einen Haufen benutzter Laken und Handtücher auf dem Boden gebildet hatte, die Schmutzwäsche aus den Wäscheschächten von acht Etagen. Es stank nach Fleischeslust, nach Schweiß und anderen menschlichen Ausscheidungen.
Die Erwachsenen, paralysiert, starrten voller Grauen auf den Wäschehaufen, zu entsetzt, um einen Schritt nach vorn zu machen. Obendrauf lag Iris, wie eine kaputte Puppe, das Gesicht nach oben gewandt, die dunklen Locken ausgebreitet, ein Auge geöffnet, der nackte Hals in einem seltsamen Winkel abgeknickt. Entsetzlich. Meine Babypuppe starb zweimal. Einmal, als ich ihr den Kopf abriss … und einmal unter der Rotlichtlampe. Sie schmolz, als ich versuchte, sie zu wärmen.
Um Iris’ grotesk verrenkten Hals zog sich eine Schnittwunde, frisch und dünn und rot und böse.
Kapitel zwei
1944
FREITAG, 10. MÄRZ
1
Als ich ein Kind war – bevor man mir 1931 meinen Dad nahm –, spielten wir oft Baseball auf einem unebenen Feld neben der örtlichen Müllkippe. Das Schlagmal befand sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite des drei Meilen langen Berkeley Pier, wo Lastkraftwagen und Autos für die Fähre nach San Francisco anstanden. Ich hielt stets Ausschau nach Fahrzeugen mit Nummernschildern aus New York, schmutzig und teils schlammverkrustet, weil sie wochenlang unterwegs gewesen waren. Die Menschen hinter ihren Lenkrädern waren auf dem Lincoln Highway einmal quer durchs Land gefahren.
Der Lincoln Highway war die erste Straße in Amerika, die von Küste zu Küste führte. Sie begann in New York, an der Ecke Broadway und 42nd Street am Times Square, und von dort aus machten sich unerschrockene Autofahrer in ihren Fords und Studebakers auf die dreitausend Meilen lange Reise nach San Francisco, geleitet von ungenauen Karten und roten, weißen und blauen Schildern an der Strecke. Der Highway – in Wirklichkeit eine Reihe aufeinanderfolgender Landstraßen – verband die Nation auf dem kürzesten Weg und mied Großstädte wie Chicago oder Denver zugunsten kleinerer Städte wie Fort Wayne und Cedar Rapids, Omaha und Cheyenne. Die Leute mussten aus ihren Autos aussteigen und durch das Wasser waten, wenn sie an eine Bach- oder Flussfurt gelangten, um sicherzugehen, dass es nicht zu tief war. Außerdem war es wichtig, dass sie Campingausrüstung bei sich hatten, denn sie würden in den Wüsten von Wyoming, Utah und Nevada mehr als nur ein, zwei Nächte ohne ein Dach über dem Kopf verbringen müssen. Mein Dad sagte oft, dass er eines Tages mit uns den Lincoln Highway entlangfahren würde, in die entgegengesetzte Richtung, damit wir uns New York City und die Freiheitsstatue ansehen konnten. Doch dazu ist es nie gekommen.
Bevor Brücken gebaut wurden, die die Bucht von San Francisco überspannten, endete der Lincoln Highway im zurückgewonnenen Marschland der Lower East Bay und führte zuvor an einigen der hässlichsten Orte der gesamten Reise vorbei, zum Beispiel an der Industriestadt Richmond und durch das sumpfige Tiefland von El Cerrito, die Lowlands, wo ich in einem Mietshaus aufwuchs, gegenüber von einer Gerberei und einem Schlachthof. Das über der Bucht aufragende San Francisco lag gleich auf der anderen Seite des Wassers, aber es hätte genauso gut ein ganzes Universum entfernt sein können.
Ich schaute den zu gut gekleideten Oststaatlern dabei zu, wie sie aus ihren Fahrzeugen stiegen, sich die Beine vertraten und eine Grimasse schnitten, wenn ihnen der strenge Geruch von Fabriken und stinkendem Fisch in die Nase stieg. Manchmal deuteten sie auf die barfüßigen, braunhäutigen kleinen Jungs, die mit nacktem Oberkörper ihre armseligen Angelschnüre auswarfen. Ich sah ihnen an, dass sie den Eindruck hatten, in ein fremdes Land geraten zu sein. Englisch wurde unten am Pier kaum gesprochen, denn in den East Bay Lowlands traf man nur wenige weiße Amerikaner an. Stattdessen lebten dort Italiener und Griechen und Portugiesen (die bald schon zu den »Weißen« gehören würden), Chinesen und Japaner, Mexikaner und Schwarze, alle arm, alle in ihren eigenen, separaten Enklaven, und alle träumten sie von einem besseren Leben.
Sobald sie herausfanden, dass die nächste Fähre erst Stunden später übersetzte, stiegen die Oststaatler wieder in ihre Autos, scherten aus der Warteschlange für die Fähre aus und kurvten ein bisschen durch die Gegend. Wenn sie Richtung Oakland fuhren, kamen sie für gewöhnlich an Miseryville vorbei, wo nach dem Börsencrash Hunderte obdachloser Männer in überzähligen Abwasserrohren aus Beton lebten, je ein Mann in einem knapp zwei Meter langen Rohrabschnitt. Die Männer ernährten sich von den Abfällen der regionalen Gemüsegroßhändler, aus denen sie Eintopf kochten, versetzt mit Papierstaub oder Sägemehl, damit er besser sättigte.
Manchmal fühlte auch ich mich wie ein Fremder. Aber nicht am Pier, sondern wenn ich den Key Train nach Berkeley Hills nahm, was ich so oft tat, wie es eben ging. Der Zug brachte die Menschen in die Stadtviertel der Weißen, gespickt mit Mittelklassehäusern und kleinen Einkaufsstraßen. Die Strecke führte vorbei an der Universität mit ihrem berühmten Campanile und immer höher und höher, bis die Luft nach Salbei und Eukalyptus duftete, durchsetzt mit einem Hauch Honig, Minze und süßem Oleander. Ganz oben in den Hügeln, in Claremont, war Endstation; der Zug hielt vor dem prachtvollen Claremont Hotel mit seinen zahlreichen Flügeln. Das Claremont war das größte Hotel an der Westküste, und die gesamte Fassade – nicht nur die Wände und Fensterläden, sondern auch Turm, Giebel und sogar das Dach – war blendend weiß gestrichen, sodass das Gebäude wie eine Wolke in der frischen, duftenden Luft zu schweben schien, ein Alabasterpalast im Himmel.
Der Börsencrash von 1929 war keine Abrissbirne gewesen, die keinen Unterschied zwischen den Menschen machte. Genau wie die Spanische Grippe nur zehn Jahre früher traf er diejenigen auf den unteren Sprossen der sozialen Leiter um ein Vielfaches härter als die an der Spitze. Ganz unten hungerten Millionen, Kinder durchwühlten Mülltonnen nach Kartoffelschalen, Fleischabfällen oder anderen Glücksfunden, die der Familie ein Abendessen bescherten, das nicht wie meist nur aus Sandwiches mit Ketchup oder einem Laib Brot und einer Dose Bohnen bestand. Geschwister wechselten sich tageweise mit dem Essen ab, unzählige Familien landeten auf der Straße, weil sie ihre Miete oder Hypothek nicht bezahlen konnten, und binnen weniger Jahre nach dem Crash war die Hälfte aller schwarzen Amerikaner arbeitslos.
Ganz oben auf der Leiter dagegen wurde eine völlig andere Geschichte erzählt. Obwohl so manch ein Vermögen verloren ging, besaßen die meisten, die eine Million auf der Bank liegen hatten, diese auch noch danach.
Für sie war die Depression eine Zeit verschwenderischer Ausgaben. Vielleicht sogar noch verschwenderischer als zuvor, wenn sie sie nur von all dem Unerfreulichen ablenkten, was auf den Straßen zu sehen war: Bettler, Obdachlose, Massenproteste der Arbeiter. Nach dem schlimmsten Finanzkollaps in der Geschichte der Nation warfen die Reichen von Kalifornien mit Geld um sich, als gäbe es kein Morgen. Sie feierten noch extravagantere Partys. Sie speisten russischen Kaviar und ungarische Gänseleber. Und sie strömten in Luxushotels wie das glänzend weiße Claremont, verkehrten mit Barrymore und Garbo, tanzten zu dem Sound des Count Basie Orchestra und von Louis Armstrongs Trompete.
Als ich ein Junge war, hätte ich es niemals gewagt, einen Fuß ins Claremont Hotel zu setzen. Ich war bereits bei der Polizei – noch kein Detective, nur ein Streifenpolizist –, als ich das erste Mal die Schwelle übertrat. Man hatte mich herbeordert, weil irgendein reicher, junger Mann abgereist war, ohne zuvor die Rechnung zu bezahlen. Nachdem ich ihn ausfindig gemacht und dazu gebracht hatte, die offene Summe zu begleichen, wurde ich zu einer Art Stammgast. Ich lernte eine Menge im Claremont Hotel. Ich lernte, wie die Reichen ihre Cocktails trinken, wie sie sitzen – ein reicher Mann auf einem Sofa oder Sessel schlägt stets die Beine übereinander –, worüber sie sprechen, wie sie rauchen. Für mich war das wie ein zweiter Schulabschluss.
Und jetzt, aus reinem Zufall, war ich erneut im Claremont, und zwar ausgerechnet an dem Abend, an dem Walter Wilkinson gleich zweimal ermordet wurde.
2
Der Maître d’, Julie, mit seiner affektierten französischen Arroganz – die Arroganz war echt, »französisch« war das, was nicht authentisch war –, schwebte zu meinem Tisch und bat mich leise, ob ich bei einer »Angelegenheit« in einem der Hotelzimmer »behilflich« sein könne. Ich wusste, dass Julie niemals einen Gast bei einem Drink stören würde, wäre es nicht wirklich wichtig, daher bat ich die junge Dame, die meine Begleitung war, mich für einen Moment zu entschuldigen, und folgte ihm.
Julie gab mich an den Nachtmanager des Claremont weiter – ein junger Mann mit aschfahlem Gesicht, den ich nicht kannte. Ihm fehlte die Souveränität des Maître d’, außerdem sah er so aus, als würde er sich vor Nervosität jeden Moment übergeben.
»Es geht um Walter Wilkinson«, flüsterte er mir zu, während wir auf einen der Aufzüge warteten. »Sie wissen, wer das ist?«
»Wie könnte ich nicht wissen, wer Wilkinson ist?«, beantwortete ich seine Frage mit einer Gegenfrage. »Was ist denn mit ihm?«
Eine der Aufzugtüren öffnete sich, und der Manager legte einen Finger auf seine Lippen, um mir zu verstehen zu geben, dass er darüber nicht in Gegenwart von Pounds, dem Fahrstuhlführer, reden wollte. Pounds und ich sagten Hallo.
Alle wussten, dass Wilkinson in der Stadt war. Ein Industrieller, der im Mittleren Westen ein Vermögen mit Strom und Licht gemacht hatte und bei der Präsidentschaftswahl 1940 gegen Franklin Delano Roosevelt verloren hatte. Manche Leute waren davon überzeugt, dass er FDR diesmal schlagen würde. Sollten sie weiterträumen.
»Vor einer halben Stunde wurde in seinem Zimmer ein Schuss abgefeuert«, wisperte der Manager, während wir einen langen Korridor im sechsten Stock entlangeilten. Er war so aufgeregt, dass sich seine Lippen bewegten, auch wenn er nicht sprach. »Seitdem hat er nicht die Tür aufgemacht.«
»Wer behauptet, dass ein Schuss abgefeuert wurde?«, fragte ich.
»Gäste. Drei verschiedene Gäste. Sie haben den Schuss gehört und unten am Empfang angerufen.«
Wir blieben vor Zimmer 602 stehen. Der Manager klopfte zögernd an. »Mr Wilkinson? Sind Sie da, Mr Wilkinson?«
Niemand antwortete. Der Manager drehte sich verzweifelt zu mir um.
»Öffnen Sie die Tür«, wies ich ihn an.
»Das geht nicht. Mr Wilkinson hat uns ausdrücklich angewiesen, ihn unter keinen Umständen zu stören. Sollte ihm etwas zugestoßen sein, wäre das eine Katastrophe.«
Ich ging davon aus, dass dies keine politische Meinungsäußerung war – der nervöse Nachtmanager bezog sich auf eine mögliche Katastrophe für das Hotel, wenn nicht gar für ihn persönlich. »Ich sage Ihnen, was eine Katastrophe wäre«, entgegnete ich. »Es wäre eine Katastrophe, wenn der Mann in seinem Zimmer verblutet, weil Sie so besorgt um seine Privatsphäre sind. Öffnen Sie die verdammte Tür!«
Der Manager nickte, schluckte angestrengt und sperrte mit einem Generalschlüssel die Tür auf.
Walter Wilkinson saß auf der Bettkante, reglos, aber unverletzt. Er war für ein festliches Dinner gekleidet: dreiteiliger schwarzer Anzug, Fliege, die Schuhe auf Hochglanz poliert, die Haare tadellos frisiert, doch sein Gesicht war so weiß wie seine Manschetten. Ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor einen so bleichen Mann gesehen hatte. Er sagte kein Wort, sah uns nicht einmal an. Ich konnte sein teures Eau de Cologne riechen – Penhaligon’s. Das Bett, auf dem er saß, war ordentlich gemacht, im Zimmer gab es keinerlei Anzeichen für einen Tumult – außer einem Einschussloch in einer Wand neben einer Stehlampe.
»Bitte entschuldigen Sie die Störung, Mr Wilkinson«, sagte der Manager unterwürfig. »Der Detective hat mir befohlen, die Tür zu öffnen. Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Wir dachten, man hätte Sie ermordet.«
»Man hat mich ermordet«, erwiderte Wilkinson mit tiefer, leiser Stimme, noch immer, ohne sich zu bewegen.
Ich stellte mich vor und erkundigte mich, was passiert war.
Er antwortete, indem er aufstand, ins Bad ging und Wasser ins Waschbecken laufen ließ. Es klang, als würde er es sich ins Gesicht spritzen. Der Manager starrte mich an, genauso nervös wie zuvor.
Nachdem er uns mehrere Minuten lang hatte warten lassen, kehrte Wilkinson zurück, geschäftig, sich die Wangen mit einem Handtuch abtrocknend, als hätten wir ihn schlicht und einfach beim Rasieren überrascht. Er war nicht länger leichenblass, sondern sah jetzt wieder mehr aus wie der Mann, den man von Fotos kannte. Viele behaupteten, er wäre der attraktivste Gentleman, der je für das Amt des Präsidenten kandidiert hatte. Wilkinson, neunundfünfzig Jahre jung, hatte ein gebieterisches Auftreten, war über eins achtzig groß und kräftig gebaut. Seine Haare waren grau meliert und mit Brylcreem frisiert, die Augenbrauen dunkel.
»Es war ein Kommunist«, behauptete er. »Ein junger Mann. Schäbig gekleidet. Ausländischer Akzent.« Wilkinson warf dem Manager einen zornigen Blick zu. »Wie gelangt ein solcher Rüpel in eines Ihrer Gästezimmer?«
Der Manager wand sich gequält: »Das ist ein furchtbares Missgeschick unsererseits, Mr Wilkinson. Es tut uns wirklich leid.«
»Er hat auf mich gewartet. Ich kam herein, schloss die Tür und ging auf die Stehlampe zu. Bevor ich sie erreichte, spürte ich eine Pistole zwischen meinen Schulterblättern. Er befahl mir, mich an die Wand zu stellen. Hat mich einen blutsaugenden Kapitalisten geschimpft – einen Feind des arbeitenden Mannes –, der übliche Blödsinn.«
»Wie hat er ausgesehen?«, fragte ich ihn.
»Ich konnte ihn nicht besonders gut erkennen. Es war dunkel, und er hat mir mit einer Taschenlampe in die Augen geleuchtet. Er hat gezittert, konnte kaum den Lichtstrahl auf mich gerichtet halten. Möglicherweise war er betrunken.«
»Größe, Gewicht, Haarfarbe, Alter, Gesichtszüge – alles, woran Sie sich erinnern können, wäre hilfreich, Mr Wilkinson.«
»Wie ich schon sagte: Ich konnte ihn nicht sehen. Wegen der Taschenlampe.«
»Okay. Was ist dann passiert?«
»Ich ging zur Wand, wie er es mir befohlen hatte. Er machte ein paar Schritte zurück, bis er direkt an der Tür war. Er sagte, ich hätte es verdient zu sterben, und feuerte auf mich. Dann floh er. Das ist alles.«
»Sie haben Glück gehabt, Mr Wilkinson«, stellte ich fest.
»Das glaube ich kaum«, entgegnete er. »Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.«
Ich nickte, um ihm nicht widersprechen zu müssen. »Sie haben einen ausländischen Akzent erwähnt. Können Sie dazu genauere Angaben machen?«
»Wenn ich eine Vermutung anstellen müsste, würde ich tippen, dass er russisch war.«
Ich wandte mich an den Manager. »Bringen Sie Mr Wilkinson in einem anderen Zimmer unter und sagen Sie niemandem, wo er sich befindet. Niemandem, haben Sie mich verstanden?«
»Jawohl«, antwortete der Manager.
Ich teilte den beiden noch mit, dass ich über Nacht einen Polizisten vor Wilkinsons Zimmer postieren und morgen früh einige Jungs von der Spurensicherung vorbeischicken würde, die die Kugel aus der Wand holen und das Zimmer auf Fingerabdrücke untersuchen sollten. Unterdessen würde ich das Personal und die anderen auf dieser Etage einquartierten Gäste befragen, ob ihnen irgendetwas aufgefallen war.
Und das tat ich, aber erst, nachdem ich an die Hotelbar zurückgekehrt war, um meine Begleiterin darüber zu informieren, dass sie nicht länger auf mich warten sollte. Was ich mir hätte sparen können, denn sie war bereits gegangen. Als Nächstes rief ich Chief Greening an, um ihn über alles in Kenntnis zu setzen. Er forderte mich auf, zu ihm nach Hause zu kommen und Bericht zu erstatten, sobald ich fertig wäre, ganz gleich, wie spät es dann sein würde.
3
Drei Stunden später fuhr ich zu Chief Greenings Haus, ohne irgendetwas herausgefunden zu haben. Das Einzige, was noch im Radio lief, waren die Nachrichten, und die waren schlecht. Die Japaner waren in Indien eingefallen und wollten angeblich weiter Richtung Australien. Die Deutschen bombardierten Anzio. Ein weiteres ramponiertes Lazarettschiff mit dreihundert verstümmelten amerikanischen Jungs an Bord war in den Hafen von San Francisco eingelaufen. Unterdessen hatte die Küstenwache in Tenderloin versucht, mehrere betrunkene, zügellose Marines zu verhaften, was zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Polizisten und Soldaten mit einem Dutzend Verletzten führte. Doppelt so viele landeten im Militärgefängnis.
Es war fast Mitternacht, als ich bei Greenings Haus in der Shasta Road eintraf, doch der Chief trug seinen üblichen zweireihigen Anzug. Er war ein kleiner, korpulenter, freundlicher Mann mit einer glänzenden Glatze und Brille. Aus der Brusttasche seines Sakkos ragten stets zwei Kugelschreiber. Er hatte das Pech gehabt, den Posten vom legendären August Vollmer zu übernehmen, der schon vor meiner Geburt Chief vom Police Department in Berkeley gewesen war. Vollmer hatte die Forensik quasi erfunden, genau wie er quasi den Lügendetektor erfunden hatte, und seine Methoden wurden im ganzen Land übernommen. Die Leute nannten ihn bereits »den Vater der modernen Polizeiarbeit«. Man bekam unweigerlich Mitleid mit Greening, denn niemand hätte Vollmers Rolle ausfüllen können.
Greening schenkte mir eine Tasse Kaffee ein und bot mir ein Stück von dem Lazy Daisy Cake an, ein Kuchen mit Vanille, Kokos und braunem Zucker, den seine Frau gebacken hatte. Ich nahm das Angebot an, obwohl mir nicht nach Essen zumute war. Ich mochte den Geruch in seinem Haus nicht – nach Katzenstreu und hart gewordenem Süßkram. Wir setzten uns an den Küchentisch, und ich erstattete ihm umfassend Bericht.
»Ein Kommunist mit russischem Akzent – offenbar ein Jude«, stellte Greening voller Abscheu fest. »Sagen Sie mir, wie eine einzelne Rasse die Banken kontrollieren und gleichzeitig die Roten unterstützen kann. Natürlich verachte ich Hitler und alles, wofür er steht, aber mitunter kann man die Empörung nachvollziehen.«
Wie viele hochrangige Offiziere, sowohl beim Militär als auch bei der Polizei, war Greening ein Bewunderer der deutschen Effizienz und deshalb dagegen gewesen, Krieg mit den Deutschen zu führen. Er war der Ansicht, jüdische Bankiers würden Franklin Delano Roosevelt in einen Krieg treiben, der uns nichts anging; erst als Hitler anfing, London zu bombardieren, änderte er seine Meinung. Er wusste nicht, dass ich selbst zu einem Viertel Jude war, und das war gut so, wenn man bedenkt, welche Angriffsflächen ich sonst noch bot. Mein Dad stammte aus Mexiko, meine Mom kam von ganz unten aus der »Dust Bowl« – der »Staubschüssel« –, wie der Teil der Great Plains, einer trockenen, staubigen Prärielandschaft östlich der Rocky Mountains, genannt wird. Am Ende hatte ich den Nachnamen meiner Mutter angenommen, aber das ist eine lange Geschichte.
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm das mit dem russischen Kommunisten abkaufe, Sir«, gab ich zu bedenken.
»Wie meinen Sie das?«
»Wilkinson sagte, der Mann, der auf ihn geschossen habe, wäre ›schäbig gekleidet‹ gewesen«, antwortete ich. »Dann allerdings behauptete er, er hätte ihn nicht erkennen können. Er konnte nicht eine einzige konkrete Angabe zur äußeren Erscheinung des Schützen machen, nicht einmal, wie groß er war. Wie will er dann gesehen haben, dass der Mann ›schäbig gekleidet‹ war?«
»Warum sollte er ein Detail zur Kleidung des Attentäters erfinden?«, gab Greening zurück.
»Vielleicht weil die gesamte Geschichte nicht stimmt.«
»Sie glauben, er hat sich das Ganze nur ausgedacht? Aus welchem Grund?«
»Wer weiß? Vielleicht hatte er ein Mädchen bei sich im Zimmer, irgendetwas ist passiert, und sie hat auf ihn geschossen. Oder er auf sie. Wilkinson ist verheiratet. Er kandidiert erneut für das Präsidentenamt. Da ist es besser, er behauptet, ein Roter habe versucht, ihn umzubringen, als eine Prostituierte.«
Chief Greening schüttelte betrübt den Kopf. Trotz all der Jahre bei der Polizei erwartete er immer noch ernsthaft, dass die bessere Sorte Menschen, nun ja, die bessere Sorte Menschen war.
»Er sagte, er wäre ermordet worden?«, fragte der Chief. »Er hat tatsächlich dieses Wort benutzt?«
»Ja, Sir.«
»Warum?«
»Das habe ich mich auch gefragt.«
Das Telefon klingelte. Greening ging ins Wohnzimmer, um das Gespräch anzunehmen.
»Jaja«, hörte ich ihn sagen, »das weiß ich bereits. Nein, Mr Wilkinson ist nicht tot. Sollten Sie dieses Gerücht weiterverbreiten, ziehe ich morgen Ihre Dienstmarke ein. – Wie bitte? Sind Sie sicher?«
Er hörte noch eine Minute länger zu, dann kehrte er in die Küche zurück.
»Man hat ein weiteres Mal versucht, Wilkinson umzubringen«, teilte er mir mit. »Diesmal mit Erfolg.«
»Was?«
»Wilkinson ist tot.«
»Das muss ein Irrtum sein«, sagte ich. »Da hat wohl jemand etwas missverstanden.«
»Das dachte ich auch, aber ein Missverständnis ist ausgeschlossen. Er ist tot – Kopfschuss.«
»Wann?«, fragte ich. »Wo?«
»Vor ein paar Minuten«, antwortete Greening. »Im Claremont Hotel.«
»Das kann nicht sein. Ich hatte einen Wachposten vor seine Tür stellen lassen.«
»Vor dem neuen Zimmer, in das er umziehen sollte«, stellte Greening klar. »Anscheinend wurde er in dem Raum erschossen, in dem schon der erste Mordversuch stattgefunden hatte.«
»Heiliger Strohsack!« Ich nahm Mantel und Hut und war fast zur Tür hinaus, als Greening mich aufhielt.
»Übrigens, Sullivan«, sagte er, »was hatten Sie dort zu suchen – im Claremont, meine ich?«
»Ich? Ich war auf einen Drink dort.«
»Verstehe. Übersteigt das nicht ein bisschen Ihre … Sie wissen schon?«
»Meine Kragenweite?«, fragte ich.
»Ihre finanziellen Mittel.«
Ich verließ Greenings Haus und fuhr zurück zum Hotel.
4
Dort angekommen kehrte ich zu Zimmer 602 zurück und blieb wie angewurzelt stehen. Ja, Wilkinson war tot – aber nicht nur das.
Er lag ausgestreckt auf dem breiten Doppelbett, das Gesicht nach oben, ein Einschussloch mitten in der Stirn. Noch vor wenigen Stunden mit dem Habitus eines Staatsmanns ausgestattet, war er jetzt von der Taille abwärts entblößt, das Genital ruhte schlaff auf der behaarten Nacktheit. Die schwarze Hose bauschte sich zerknittert um seine Knöchel. Seine Beine, die Knie gebeugt, lagen halb auf dem Bett, halb hingen sie über die Kante, die auf Hochglanz polierten schwarzen Schuhe baumelten wenige Zentimeter über dem Fußboden. Er trug nach wie vor sein weißes Anzughemd, Fliege und Weste, was den Anblick noch verstörender machte. Ich konnte sein nach Lavendel und Moschus duftendes Eau de Cologne riechen, jetzt allerdings vermischt mit dem Geruch nach Schwefel und Metall.
Das war noch nicht alles. Sein Mund war weit aufgerissen zu einem stummen Schrei, eingefroren in dieser Position blanken Entsetzens durch mehrere Gegenstände, die daraus hervorquollen.
Hinter mir blitzte eine Kamera auf, blendete mich und brannte das Bild des toten Mannes mit dem vollgestopften Mund auf meiner Retina ein. Das Blitzlicht hatte Johnny, der Polizeifotograf vom Berkeley PD, ausgelöst. Neben ihm stand Dicky O’Gar, der Officer, der auf Wilkinson hätte aufpassen sollen.
»Tun Sie mir einen Gefallen, Johnny«, bat ich. »Gehen Sie raus, bis ich mich hier drinnen umgesehen habe. Am besten, Sie warten im Flur und sorgen dafür, dass niemand sonst das Zimmer betritt. Dicky, Sie bleiben bei mir.«
Ich ging zu dem Leichnam. Wilkinsons Lippen waren blutig, die Mundwinkel eingerissen, weil sie so überdehnt waren. Ohne einen der Gegenstände zu entfernen oder auch nur mit den Fingern zu berühren, schob ich sie vorsichtig mit der Klinge meines Taschenmessers hin und her, um nachzusehen, was genau sich in seinem Mund befand. Es handelte sich um Dinge aus dem Hotelzimmer: ein Stift, eine ungerauchte Zigarette, ein Stück Seife, ein Zierdeckchen aus Papier, zusammengeknülltes Briefpapier und zwei Pralinen.
Es war tatsächlich nur ein Schuss auf ihn abgegeben worden, Wilkinsons Körper war unversehrt. Blut und Gehirn klebten auf dem Kissen, genau wie auf dem Kopfteil und der Wand darüber.
»Was zur Hölle hat er hier gemacht?«, fragte ich Dicky, der genauso lange bei der Polizei war wie ich, es aber nie über den Rang eines Streifenpolizisten hinausgebracht hatte. »Ich hatte doch gesagt, dass man ihn anderswo unterbringen soll.«
»Das hat man auch«, versicherte mir Dicky, »allerdings hatte er wohl etwas in seinem alten Zimmer vergessen und musste noch einmal zurück, um es zu holen.«
»Haben Sie ihn nicht begleitet?«
»Nein, Sir«, antwortete Dicky, stolz auf sich selbst. »Sie hatten mir doch befohlen, mich nicht vom Fleck zu rühren, unter keinen Umständen, nicht einmal, wenn ich aufs Klo muss.«
Ich sage so etwas nur ungern über einen Kollegen vom Berkeley PD, aber Dicky O’Gar war zu dämlich, um einen Eimer Wasser umzustoßen. Und Dummheit und Stolz gingen häufig Hand in Hand.
»Herrgott noch mal«, murmelte ich genervt.
Langsam dämmerte es ihm. »Ach herrje, ich hätte ihn begleiten sollen, nicht wahr?«
»Wer hat die Leiche gefunden, Dicky?«
»Ich. Der Manager und ich, wir waren als Erste vor Ort.«
»Hat irgendwer etwas angefasst oder verändert?«
»Nein, Sir. Aber als ich die Tür geöffnet habe, ist die Zeitungsseite von ihm heruntergeweht, die seinen Intimbereich bedeckt hat.«
Auf dem Fußboden neben dem Bett entdeckte ich ein Doppelblatt, die Vorder- und Rückseite des heutigen Chronicle. Der Rest der Zeitung lag auf einer Kommode.
»Irgendein Hinweis auf ein gewaltsames Eindringen?«, fragte ich.
»Nein, Sir.«
»Was ist das dort drüben?«
Auf dem Boden vor der Kommode lag eine kleine schwarze Schatulle mit aufgeklapptem Deckel. Ich ging hinüber und betrachtete sie genauer: Vermutlich für Schmuck gedacht, war sie ungefähr fünf mal fünf Zentimeter groß, außen mit schwarzem Samt bezogen und innen mit weißem Satin ausgekleidet. Was immer sich darin befunden hatte, war verschwunden.
»Ich hab nichts angefasst, Boss«, versicherte mir Dicky. »Ich hab nichts weggenommen.«
»Das weiß ich, Dicky.«
Ich stand auf und betrachtete noch einmal den toten Mann. Seine Position ließ vermuten, dass er am Fußende des Bettes gestanden und seinem Mörder ins Gesicht geblickt hatte, als der Schuss abgefeuert wurde. Die Kugel war aus seinem Hinterkopf ausgetreten und hatte die Spritzer auf dem Kissen und dem Kopfteil verursacht. Er musste rücklings aufs Bett gefallen und auf der Stelle tot gewesen sein. Vielleicht hatte er gerade die Hose heruntergelassen, als der Schuss fiel, vielleicht hatte man ihm das danach angetan.
»Also, was denken Sie? War es ein Raubüberfall?«, fragte Dicky. »Könnte doch sein, dass jemand ihn umgebracht hat, weil er das, was in der Schatulle war, haben wollte – einen Diamantring oder etwas Ähnliches.«
»Möglich. Allerdings stopfen Räuber ihrem Opfer für gewöhnlich nicht so viel Zeug zwischen die Lippen, dass die Mundwinkel einreißen. Haben Sie schon einen Blick ins Badezimmer geworfen?«
»Ja, Sir.«
»Kleiderschrank?«
»Ähm – noch nicht, Boss.«
Ich öffnete die Schranktür, wobei ich meinen Fuß benutzte für den Fall, dass sich Fingerabdrücke auf dem Knauf befanden, und leuchtete mit meiner Stiftlampe das Regalfach und die Stange mit den Kleiderbügeln ab. Der Schrank war leer. Alle Habseligkeiten von Wilkinson waren in das neue Zimmer gebracht worden. Die verdammte Lampe flackerte – ich musste sie schütteln, damit sie überhaupt funktionierte –, weshalb ich beinahe die beiden glitzernden Punkte auf dem Schrankboden übersehen hätte. Ich kniete mich hin, schüttelte die Stiftlampe kräftig und leuchtete erneut – und hätte vor Schreck fast einen Herzinfarkt erlitten.
Ein totes Baby starrte mich an.
Ich schickte einen lautstarken Fluch zum Himmel.
»Was ist los, Boss?«, fragte Dicky, der hinter mich getreten war.
»Nichts«, sagte ich und stieß die Luft aus.
»O Gott, ein Baby!«
Es war kein totes Baby. Es war bloß eine Puppe, eine Puppe mit Glasaugen, dunklen Ringellocken, einem Porzellangesicht, das schon Risse aufwies, und einem winzigen roten Mund, zu einem O geformt. Ein Augenlid war halb geschlossen. Die Puppe streckte die Hände nach mir aus.
»Es hat sich bewegt!«, schrie Dicky.
»Es hat sich nicht bewegt. Der Strahl meiner Taschenlampe bewegt sich.«
»Es hat sich bewegt!«, beharrte Dicky.
Ich schlug die Stiftlampe in meine Handfläche, und endlich hörte das Licht auf zu flackern. Ich richtete den Strahl auf die Puppe. »Nun, es ist eine Puppe, und jetzt bewegt sie sich nicht«, sagte ich.
Die Puppe starrte mich mit dem offenen Auge an. Sie trug ein verblichenes, altmodisches Kleid, hatte Altersflecken in ihrem aufgemalten Gesicht und Gummiarme. Was hatte eine alte Puppe in Wilkinsons Schrank zu suchen? Wahrscheinlich hatte sie nichts mit ihm zu tun. Gut möglich, dass sie schon Jahre dort unten in der Ecke gesessen hatte.
Ich wies Dicky an, dafür zu sorgen, dass die Puppe markiert und eingetütet wurde, sobald die Spurensicherung eintraf, dann holte ich Johnny herein, damit dieser seine Fotos machen konnte. Zuvor ermahnte ich die beiden, ja nichts anzufassen, bis der Raum auf Fingerabdrücke untersucht worden war. Gerade als ich mich zum Gehen wandte, erweckte etwas am Türpfosten meine Aufmerksamkeit, ein gutes Stück über dem Boden. Es war ein gelber Faden, der an einem Holzsplitter hing, nicht länger als einen Zentimeter. Ich zupfte ihn ab und steckte ihn in einen Umschlag.
Unten am Empfang teilten mir die Rezeptionisten mit, dass ihnen niemand aufgefallen war, der das Hotel nach Mitternacht aufgeregt oder auch nur in Eile verlassen hatte. Was bedeutete, dass der Mörder entweder ziemlich kaltblütig war – oder aber das Hotel nicht verlassen hatte.
In einem Büro hinter dem Empfang fand ich den Nachtmanager, der gerade ein Telefonat mit dem Hotelbesitzer beendete. Hatte er zuvor schon nervös gewirkt, so schien er jetzt unmittelbar vor einem Zusammenbruch zu stehen. Ich erinnerte ihn daran, dass auch Wilkinsons anderes Zimmer – das, in das ich ihn hatte verfrachten lassen – in die Tatortuntersuchungen miteinbezogen wurde. Nichts darin durfte verändert werden, niemand außer der Polizei durfte es betreten.
»Ist es möglich, die Presse rauszuhalten?«, fragte er mich flehentlich.
»Keine Chance.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich brauche eine vollständige Gästeliste, Namen, Adressen.«
»Wofür?«
»Weil einer der Gäste der Mörder sein könnte.«
»Einer unserer Gäste? Sie haben doch gehört, was Mr Wilkinson gesagt hat: Der Angreifer war ein Unruhestifter, ein Kommunist!«
»Ich möchte außerdem die Namen von allen haben, die am Abend im Restaurant gegessen haben. Fragen Sie Julie – er wird es wissen. Und sollten irgendwelche Versammlungen oder Konferenzen stattgefunden haben, benötige ich eine vollständige Teilnehmerliste.«
»Wir haben zweihundertsechsundsiebzig Gästezimmer, das beste Restaurant der East Bay und mehrere Konferenzräume. Sie reden hier von über fünfhundert Personen, womöglich sogar tausend.«
»Besorgen Sie mir einfach die Listen.« Ich wünschte ihm eine gute Nacht und warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Es war halb vier, und ich hatte vor, die Ermittlungen um sechs fortzusetzen. »Ich möchte Ihnen keine Umstände machen, aber wäre es möglich, dass Sie mir ein Zimmer zur Verfügung stellen, in dem ich zwei Stunden schlafen und anschließend weiterarbeiten kann? Ich brauche ohnehin einen Ort, an dem ich mich mit meinen Officers austauschen kann, eine Art Einsatzzentrale – Sie wollen doch sicher nicht, dass wir die Lobby belagern.«
»Nein, gewiss nicht«, pflichtete er mir bei. »Allerdings sind wir leider ausgebucht.«
»Na schön. Dann muss ich mir etwas einfallen lassen.«
»Nun, da wäre noch Zimmer 422. Vorausgesetzt, Sie haben nichts dagegen.«
»Warum sollte ich etwas dagegen haben?«
»Nun, es … ähm … es wird schon seit einigen Jahren nicht mehr bewohnt.«
Ich hatte keine Ahnung, wovon er redete, aber es war mir auch gleich. »Wenn es ein Bett hat, nehme ich es.«
Kapitel drei
1944
SAMSTAG, 11. MÄRZ
1
»So werden Sie vorgehen, meine Herren«, sagte ich am frühen Morgen in einem Hotelzimmer, das so gesteckt voll mit Polizisten war, dass es nur noch Stehplätze gab. Die meisten arbeiteten beim Berkeley PD, aber einige Officers aus Oakland und Richmond waren zu unserer Unterstützung abgestellt worden – die Einsatzkräfte der Bay Area wissen, wie sie sich im Bedarfsfall gegenseitig helfen können. Draußen begann es, zu dämmern. »Sie werden sich jeden einzelnen Hotelgast vornehmen. Niemand checkt aus, ohne dass er befragt wurde.«
Die Männer murrten. »Das müssen ja Hunderte sein«, stellte McRae fest, der clever, aber faul war.
»Und es gibt ein Dutzend von euch Jungs, die mit ihnen reden«, entgegnete ich. »Eine Befragung sollte maximal fünfzehn Minuten dauern. Wenn Sie sich gleich an die Arbeit machen, werden Sie nicht einmal das Mittagessen verpassen.«
»Was, wenn die Leute beschäftigt sind, Detective?«, beharrte McRae. »Die Gäste hier sind keine kleinen Wichte, das sind hohe Tiere! Was, wenn sie nicht mit uns reden?«
»Es ist mir gleich, auch wenn sie Eleanor Roosevelt heißen und zum Tee im Weißen Haus sein müssen. Das ist das größte Verbrechen, das je in der Bay Area stattgefunden hat – vielleicht je stattfinden wird. Und das wiederum bedeutet, dass unsere Jobs auf dem Spiel stehen, jeder einzelne. Sollte sich jemand weigern, mit Ihnen zu reden, notieren Sie den Namen und erstatten Sie mir umgehend Bericht.«
Ich fragte mich, ob sich das FBI einschalten und uns den Fall wegnehmen würde. Unwahrscheinlich. Erstens verfügte das FBI hier draußen nicht über genügend Personal – im Osten ja, aber nicht bei uns im Westen. Zweitens war es nicht wirklich zuständig. Mord galt als Verbrechen, auf Staatsebene, nicht auf Bundesebene. Es machte keinen Unterschied, dass das Opfer ein Präsidentschaftskandidat war. Selbst wenn man versuchte, den designierten Präsidenten der Vereinigten Staaten zu töten, würde man kein Bundesverbrechen begehen. Das hatten wir 1933 gelernt, als dieser Hurensohn Zangara fünf Schüsse auf FDR abgab, ihn jedoch verfehlte und stattdessen den Bürgermeister von Chicago tötete. Selbst den amtierenden Präsidenten zu töten, war kein Bundesverbrechen, obwohl es hieß, der Kongress plane, etwas daran zu ändern. Der Punkt war jedoch, dass wir für den Mord an Wilkinson zuständig waren. Zweifelsohne würden uns die Feds im Nacken sitzen, doch entweder lösten wir diesen Mordfall oder keiner.
»Okay, aber mal angenommen, die Gäste reden tatsächlich mit uns«, sagte Dicky O’Gar.
Weitere Worte kamen nicht aus seinem Mund. Anscheinend ging er davon aus, eine Frage gestellt zu haben.
»Okay, nehmen wir das mal an«, sagte ich.
»Was sollen wir sie fragen?«
Am liebsten hätte ich geflucht, aber ich riss mich zusammen. Das war eine gute Frage. »Gute Frage, Dicky«, sagte ich daher. »Am besten, Sie fragen sie nach fünf Dingen: ihrem Namen, woher sie kommen, warum sie hier sind, was sie um Mitternacht getan haben und ob ihnen gestern Abend irgendetwas Außergewöhnliches aufgefallen ist. Sie dagegen beantworten keine Fragen, Sie stellen sie, haben Sie mich verstanden? Okay … Die Geschichte wird jeden Moment durchsickern. Wenn es so weit ist, werden sich die Reporter auf uns stürzen wie die Fliegen auf eine Kloake. Reden Sie nicht mit ihnen. Bestätigen Sie nichts – das ist Aufgabe des Chiefs. Und jetzt los. Sie beide nicht, Tankersley und Polk, Sie befragen das Hotelpersonal. Vergessen Sie nicht Pounds, den alten Fahrstuhlführer – er sieht und hört alles. Sie suchen nach etwas, was von der üblichen Routine abweicht. Vielleicht wurde in der vergangenen Woche neues Personal eingestellt, oder irgendetwas war gestern Abend anders als sonst.«
2
Eine strafrechtliche Untersuchung besteht aus drei Komponenten: Befragung, Auswertung der physischen Beweise – das elegantere Wort dafür ist »Forensik« – und Nachdenken. Das ist alles. Ich ließ die Jungs die Befragungen durchführen, während ich mich um die Forensik kümmerte, angefangen mit der Obduktion der Leiche.
Zu diesem Zweck fuhr ich zum Institut für Gerichtsmedizin von Alameda County in Oakland. Dort teilte man mir mit, dass sich Gerichtsmediziner Emerson unten im Untersuchungssaal befand. In Kalifornien haben wir Gerichtsmediziner für die jeweiligen Countys. Sie werden gewählt, was nicht unbedingt ein Garant für Kompetenz ist. Aber Dr. Emerson zählte zu den Guten. Er war ein alter Knabe, und er redete gern, aber er wusste, wovon er sprach.
Wilkinson lag auf dem Obduktionstisch. Die Farbe ist das, was sich bei kürzlich Verstorbenen am drastischsten ändert. Wilkinsons Farbe war nicht mehr menschlich. Er wirkte jetzt grau, mit bläulichen Streifen dort, wo früher das Blut geflossen war. Er sah weder friedlich aus, noch als würde er schlafen – nicht so, wie immer behauptet wurde. Eher wie gefrorenes, sauerstoffarmes Fleisch.
»Der Schütze hat in unmittelbarer Nähe frontal vor dem Verstorbenen gestanden, keinen Meter entfernt, als der tödliche Schuss abgegeben wurde«, teilte Emerson mir mit. »Das belegen die Nitritrückstände in den Haaren und im Gesicht. Natürlich kann ich das Kaliber nicht aufgrund der Eintritts- oder Austrittswunde bestimmen, aber ich wette mit Ihnen, dass es sich um .38 oder größer handelt.«
»Was führt Sie zu dieser Annahme, Doc?«
»Weil sein Gehirn so hübsch und großteils unversehrt war, dass die Kugel nicht kleiner gewesen sein kann. Kleinere Dinge richten mehr Schaden an als größere. Merken Sie sich das, mein Sohn – es ist ein Axiom der Medizin, allen Lebens, wenn Sie mich fragen. Die Mikroorganismen sind es, die uns umbringen, dabei wussten wir, als ich ein Junge war, noch nicht einmal, dass es sie gibt. Wenn ein kleineres Projektil, sagen wir ein .22 Kaliber, in die Stirn eindringt und von innen auf den Hinterkopf trifft, prallt es ab oder wandert durch das Schädelinnere und verwandelt das Gehirn in Brei. In diesem Fall jedoch ist die Kugel sauber ausgetreten. Ergo: Es handelte sich um ein mittleres oder großes Kaliber.«
Ich mochte Emerson – von ihm lernte ich immer etwas.
»Da ist noch etwas anderes, was Sie sich anschauen sollten«, sagte er. »Hier, sehen Sie.«
Mit einer Pinzette nahm er ein kleines dunkelgrünes Objekt in Form eines Würfels auf. Ich konnte winzige Zeichen darauf erkennen.
»Das habe ich aus dem Mund des Toten. Es befand sich unter den Gegenständen, die Sie zweifelsohne gesehen haben. Sieht aus wie Stein, vermutlich Jade, aber ich bin kein Geologe. Darin sind asiatische Schriftzeichen eingraviert. Es war weit hinten, im Rachen des Opfers. Der Mörder wird es ihm als Erstes in den Mund gesteckt haben.«
»Müssen Sie das behalten, oder darf ich es mitnehmen?«, fragte ich.
»Nehmen Sie nur«, erwiderte Emerson. »Ich hoffe, es hilft Ihnen weiter.«
3
Mein nächster Halt war unser Forensiklabor beim Berkeley PD. Ein weiterer Verdienst Vollmers – bereits 1923 hatte er das erste kriminaltechnische Labor des Landes eingerichtet, außerdem das erste System zur Archivierung von Fingerabdrücken. Wir Detectives durchliefen in unserem ersten Jahr bei der Truppe eine gesonderte Ausbildung, in der uns die Grundlagen der Forensik vermittelt wurden.
»Ein Geschenk vom Gerichtsmediziner«, sagte ich zu Jim Archimbault, der das Labor leitete, als ich eine Beweismittelkiste mit allen Gegenständen, die im Mund des Toten gefunden worden waren, vor ihn auf eine Ablage stellte. Ich angelte die verschlossene Tüte mit dem grünen Würfel heraus. »Das wurde in Wilkinsons Rachen gefunden – irgendwelche asiatischen Schriftzeichen sind drauf. Kümmern Sie sich darum?«
»Selbstverständlich«, sagte Archimbault, der gerade in ein Mikroskop blickte. Er war der beste Forensiker westlich der Appalachen.
»Sagen Sie mir, dass Sie schon etwas für mich haben, Archie.«
»Das habe ich, in der Tat. Zunächst einmal hat Ihre Puppe einen Klumpfuß.«
Die Puppe lag auf dem Rücken auf einem Edelstahltisch, jetzt beide Augen weit geöffnet. Archimbault hatte sie ausgezogen. Ich sah, was er meinte. Während der rechte Fuß ganz normale Zehen hatte, war der linke eine unförmige, hässliche Masse. »Was ist damit passiert?«
»Der Fuß war enormer Hitze ausgesetzt«, erklärte Archimbault. »Er ist geschmolzen.«
Ich schaute die Puppe an. In dem Augenblick schloss sie träge das linke Auge, dann öffnete sie es wieder. »Wollen Sie mich veräppeln?«, fragte ich.
»Wieso?«
»Ist da vielleicht ein Mechanismus im Innern der Puppe – etwas, was dazu führt, dass sie sich bewegt?«
»Abgesehen von einem Schlauch, der Mund und Schritt verbindet, ist sie innen hohl. Eine Innovation, die der Hersteller anscheinend hat patentieren lassen. Eine Babypuppe mit dem Namen Dy-Dee Baby. Drehen Sie sie mal um.«
Das tat ich. Auf dem Rücken der Puppe stand »EFFAN BEE DY DEE BABY«, darunter Patentnummern aus den Vereinigten Staaten, England und Frankreich. »Sind Fingerabdrücke drauf?«
»Ganz ausgezeichnete sogar. Noch nicht zugeordnet, aber von exzellenter Güte. Außerdem bin ich auf etwas Merkwürdiges gestoßen. Da ist eine Kerbe in der Puppe, dort, im linken Arm – sehen Sie selbst.«
Direkt unterhalb der linken Schulter der Puppe war eine Kerbe in das Gummi geritzt worden, etwa einen halben Zentimeter lang. »Irgendeine Idee, womit das gemacht wurde?«, erkundigte ich mich.
»Auf alle Fälle mit etwas Scharfem – einem Skalpell oder der Spitze einer Schere –, aber es wird einige Mühe gekostet haben, denn es waren viele kleine Schnitte nötig.«
»Könnte es sich vielleicht um eine … Voodoo-Puppe handeln?«
»Keine Ahnung. Nach Motiven zu suchen, ist Ihre Aufgabe. Kommen Sie, werfen Sie einen Blick ins Mikroskop.«
Er überließ mir seinen Platz. Ich musste an den Fokuslinsen drehen, bevor ich sie entdeckte: drei hauchdünne, geflochtene Fasern, zitronengelb.
»Ist das der Faden, den ich gefunden habe?«, fragte ich.
»Korrekt.«
»Seide.«
»Sehr gut. Seide von allerfeinster Qualität – ist heutzutage übrigens selten. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er stammt von einem Rock oder Kleid einer sehr vermögenden Dame.«
»Was ist mit den Kugeln?«, erkundigte ich mich. »Stammen sie aus ein und derselben Waffe?«
»Ja, es sieht so aus. Revolver. Colt .38 Special. Beide. Allerdings kann ich das erst mit Bestimmtheit sagen, wenn ich die ballistischen Untersuchungen abgeschlossen habe. Die Kugel, die dort in der Wand eingeschlagen ist, hat einen Stahlbolzen getroffen. Eine schöne Bescherung.«
Auf einer Edelstahlablage entdeckte ich die kleine schwarze Samtschatulle, die wir auf dem Fußboden von Wilkinsons Hotelzimmer gefunden hatten.
»Haben Sie an ihr irgendwelche Fingerabdrücke sicherstellen können?«, erkundigte ich mich und nickte in Richtung der Schatulle.
»Leider nicht. Stoff ist eine für Fingerabdrücke ungeeignete Oberfläche, und Samt ist am schlimmsten. Nehmen Sie sie ruhig mit – ich bin damit fertig. Den Händler kann man mit bloßem Auge erkennen.«
Ich hielt die Samtschatulle ins Licht. In ihrem Innern, auf dem weißen Satin, stand in schwer lesbaren Lettern: Shreve & Co. – der exquisiteste Juwelier in ganz San Francisco. Ich würde ihm einen Besuch abstatten müssen.
AUSSAGEVONMRSGENEVIEVEBAINBRIDGE,
ORDNUNGSGEMÄSSALSZEUGINVEREIDIGT,
AUFGENOMMENVONBEZIRKSSTAATSANWALTDOOGAN
AM 15. MÄRZ 1944,
BEGINNENDUM 10:00 UHR
FORTSETZUNG
F: Mrs Bainbridge, ich habe Ihnen eine simple Frage gestellt. Anstatt zu antworten, haben Sie uns eine Geschichte über Ihre Familie aufgetischt. Allerdings sind wir heute hier, um über die Gegenwart zu reden, nicht über die Vergangenheit. Ich frage Sie daher noch einmal: Wo waren Ihre Enkelinnen in der Nacht des 10. März?
[PAUSE]
A: Ist Ihnen bewusst, Mr Doogan, dass meine Enkelinnen alle drei innerhalb einer Woche zur Welt kamen?
F: Nein, Mrs Bainbridge, das war mir nicht bewusst.
A: Ja. Cassie und Nicole sind Zwillinge. Sie wurden beide im Januar 1924 geboren, und ihre Cousine Isabella kam sechs Tage später zur Welt.
F: Es tut mir leid, Mrs Bainbridge, aber ist das relevant?
A: Es kommt darauf an, was Sie für relevant halten. Ihr diesbezüglicher Blick scheint ziemlich begrenzt zu sein.
F: Mrs Bainbridge, ich weiß, dass Sie denken, Ihren Enkelinnen zu helfen, indem Sie meinen Fragen ausweichen, aber ich versichere Ihnen, dass dies ein Irrtum ist. Ein schwerwiegender Irrtum. Ich brauche Ihre Aussage nicht, um Ihre Enkelinnen zu verurteilen. Ich brauche sie, um sie zu verschonen.
A: Um zwei von ihnen zu verschonen, das meinen Sie doch.
F: Ja. Um zwei von ihnen zu verschonen.
A: Mr Doogan, Sie haben mich gebeten – mich unter Druck gesetzt –, Ihnen zu helfen, meine Enkelinnen zu verstehen. Sie können meine Enkelinnen aber nicht verstehen, wenn Sie nicht ihre Kindheit kennen.
F: [KAUMHÖRBAR] Na schön, Mrs Bainbridge, fahren Sie fort. Aber versuchen Sie bitte, sich kurzzufassen.
Kapitel vier
1930
1
Ganze drei Monate nach der Tragödie sprach Issy mit niemandem ein Wort. Auch andere Veränderungen trugen sich zu, der ungewöhnlichen, beängstigenden Art.
Ihre Lehrerin berichtete, dass das kleine Mädchen neuerdings während des Unterrichts einschlief – obwohl es aufrecht dasaß, die Augen geöffnet. Wenn man sie ansprach, schreckte Issy auf. Offenbar wusste sie nicht, dass sie weggetreten gewesen war.
Dann kam das unerklärliche Alphabet-Übungsblatt. Issy hatte Schwierigkeiten, das Schreiben zu erlernen, und verlor völlig den Überblick, wenn sich der Großbuchstabe vom Kleinbuchstaben unterschied. Doch dann entdeckte die Lehrerin eines Tages ein perfektes Alphabet auf Issys Pult, sechsundzwanzig makellose Buchstaben, Majuskeln und Minuskeln, allesamt in anmutig geschwungener Schönschrift. Die Handschrift war völlig neu. Außerdem bestritt Issy, die Buchstaben geschrieben zu haben. Die Lehrerin war ratlos, genau wie alle anderen auch. Es war die Großmutter des kleinen Mädchens – welche die Grafologie als eine Art Hobby betrieb –, die darauf hinwies, dass das Alphabet eindeutig von einer Linkshänderin geschrieben worden war. Und während Issy mit der rechten Hand schrieb, hatte Iris die manus sinistra bevorzugt.
All dies hätte bei den Eltern des kleinen Mädchens, Roger Stafford und seiner Frau, der für ihre Schönheit berühmten Sadie Bainbridge-Stafford, besondere Fürsorge und Besorgnis hervorrufen sollen. Aber das tat es nicht.
Iris’ Tod hatte Sadie in undurchdringliche Düsterkeit gestürzt. Ein Teil davon war Trauer, ein weiterer quälende Schuldgefühle, weil sie ihre Mädchen an jenem Tag unbeaufsichtigt gelassen hatte. Aber da war noch etwas anderes.
Vor allem sehnte Sadie sich danach, begehrt zu werden – sie brauchte das Gefühl, begehrenswert zu sein, so wie andere Luft und Wasser brauchen –, und Kinder zu bekommen, hatte sie diesem Ziel nicht näher gebracht. Vor der Tragödie hatte sie sich oft darüber beschwert, dass sie durch die Geburten ihre Figur verloren habe, was nicht stimmte, und ebenso oft gereizt reagiert, wenn ihre bezaubernden kleinen Mädchen – wie zum Leben erwachte Puppen, eine mit dunklen Löckchen, die andere mit blonden – sämtliche Blicke auf sich zogen und laute Ohs und Ahs ernteten, sogar von Männern. Die Wahrheit war, dass Sadie die zwei beneidete – Isabella mit ihren gazellengleichen Gliedmaßen, Iris mit ihrem koketten Lächeln –, weil sie weder Lippenstift noch Rouge oder ein Korsett benötigten und eine natürliche Schönheit ausstrahlten, die Sadie einst selbst eigen gewesen war. Und jetzt ärgerte sich Sadie über Iris, weil sie mit ihrem Tod noch mehr Aufmerksamkeit bekam und gleichzeitig einen Schatten auf die Familie warf.
Sadie begann, exzessiv zu trinken. Sie hatte hysterische Anfälle. Fünf Wochen nach Iris’ Tod unternahm sie ihren ersten Suizidversuch. Roger, der spät von der Arbeit kam, fand Sadie bewusstlos auf dem Schlafzimmerboden, ein leeres Fläschchen Schlaftabletten in der Hand. Er brachte sie in ein Krankenhaus, wo man ihr den Magen auspumpte. Der Arzt teilte ihm mit finsterem Gesichtsausdruck mit, dass dabei keine Pillen zum Vorschein gekommen waren – was nahelegte, dass das Medikament bereits verdaut und es daher eigentlich zu spät war. Aber sie überlebte.
Nach ihrer Entlassung nahm Sadies Hysterie nur noch mehr zu, uferte aus, vor allem wenn sie getrunken hatte. Eine Reihe von Ärzten wurde konsultiert, eine Reihe von Rezepten folgte. Man versuchte es mit kalten Bädern, dann mit Fieberkuren und Schlafsalben. Nichts half.
Roger verbrachte mehr und mehr Nächte außer Haus. Er war Juniorpartner im Büro der renommierten Architektin Julia Morgan, die Mr Hearsts spektakuläres Schloss in der Nähe von San Simeon baute. In dem verzweifelten Versuch, zu vergessen, stürzte sich Roger in die Konstruktion dieser einhundertfünfzehn Räume umfassenden Kathedrale des Kapitalismus, die George Bernard Shaw als »den Ort, den Gott erschaffen hätte, hätte er nur das nötige Geld dafür besessen« bezeichnen sollte. Roger ging dazu über, ganze Wochen in einem Hotel in der Nähe der Baustelle zu verbringen. Auch er veränderte sich. Genau wie bei Sadie kam noch etwas anderes zu seiner Trauer hinzu: in seinem Fall eine zunehmende Wut auf seine Frau. Er fing an, misstrauisch zu werden. Unterstellte ihr Täuschung, Manipulation und das schlimmste aller Laster.
Sadies erster Sanatoriumsaufenthalt – gleich nach Iris’ Tod – erfolgte freiwillig, der zweite nicht. Roger rief im Krankenhaus an, behauptete, seine Frau würde erneut mit Selbstmord drohen, und kurz darauf erschienen Männer in weißen Kitteln. Sie steckten die schreiende Sadie in eine Zwangsjacke und nahmen sie mit. Roger begleitete sie nicht. Aus dem Wohnzimmerfenster beobachtete er ungerührt, wie der Krankenwagen davonfuhr.
Isabella hatte Sadies Schreie gehört und verängstigt Zuflucht in ihrem Zimmer gesucht, aber Roger verschwendete keinen Gedanken an sie oder daran, welche Auswirkungen die gewaltsame Trennung von ihrer Mutter auf sie haben mochte. Einst der Augenstern ihres Vaters, war sie nun praktisch eine Waise.
Nachdem Sadie fort war, zog Roger sich in sein Arbeitszimmer zurück und kam nicht wieder heraus. Eine Etage über ihm befand sich ein Raum mit hoher Decke und einer Tapete mit einem Muster aus kleinen roten Rosen, die aussahen wie Blutgerinnsel. In diesem Raum standen Seite an Seite zwei Kinderbetten mit zueinanderpassenden Himmeln und geblümten Steppdecken. In einem davon lag Issy. Das andere hatte ihrer Schwester Iris gehört, mit der Issy nun sprach.
2
Issy?
Hör auf, mit mir zu reden, Iris! Du bist tot.
Hab keine Angst, Issy. Ich bin hier.
Die Toten liegen da wie Babys aus Eis.
Gefroren. Wie Eis am Stiel.
Issy?
Was ist?
Weißt du noch, was ich an jenem Tag anhatte?
Dein blaues Kleid mit den weißen Blumen.
Ja, aber was trug ich noch?
Ich kann mich nicht erinnern.
Gib dir mehr Mühe. Fällt dir denn ein, welches Spiel wir gespielt haben?
Verstecken.
Ja, das ist richtig.
Das war wirklich lustig!
Du vergisst etwas, Issy.
Nein, tu ich nicht.
Rotkäppchen.
Was sagst du da?
Rotkäppchen. Nur dass der Umhang nicht rot war.
Ich möchte nicht mehr mit dir reden, Iris. Wir hatten an jenem Tag so viel Spaß. Wir haben Verstecken gespielt. Ich habe mich versteckt, und du solltest mich suchen. Aber du hast mich nicht gefunden.
Das stimmt nicht, Issy.
Doch. Ich hatte mich versteckt.
Ja, Issy. Du hattest dich versteckt. Aber nicht vor mir.
Kapitel fünf
1944
SAMSTAG, 11. MÄRZ
1
Nachdem ich Archimbault im kriminaltechnischen Labor wieder seiner Arbeit überlassen hatte, stieg ich die Treppen zu meinem Büro hinauf. Es war klein, aber zumindest hatte es ein Fenster, auf dessen Bank eine Reihe aus Töpfen mit Weihnachtsnarzissen stand, weil sie die Luft erfrischten. Überall auf meinem Schreibtisch und sogar auf dem Fußboden türmten sich Papierstapel, aber ich wusste genau, was jeder einzelne beinhaltete und wo sich was befand. In der Mitte meines Schreibtischs lagen die Ausschnitte aus Zeitungen und Zeitschriften über Wilkinson, die ich Holly – die Sekretärin, die ich mir mit sechs anderen Officers teilte – hatte sammeln lassen. Ich hatte eine Meinung über den Mann, aber wenn man die eigenen politischen Ansichten genauer unter die Lupe nimmt, wird einem schnell klar, dass man in neunzig Prozent der Fälle nicht weiß, wovon man eigentlich redet. Die Wahrheit ist – ich wusste nichts über Wilkinson. Und wenn man einen Mordfall aufklären will, sollte man das Opfer besser kennen.
Vor allem bei einem Mordfall wie diesem. Für mich sah es so aus, als hätte der Mörder Wilkinson gehasst. Die Frage war also, wer ihn gehasst hatte. Man kann den Zeitungen nicht vertrauen, aber wenn es um ein Thema geht, sind sie wirklich gut: Hass. Zuerst schüren sie ihn, dann berichten sie darüber.
Ich legte meine Füße auf den Schreibtisch und fing an zu lesen. Wilkinson war in Indiana geboren worden, und es stellte sich heraus, dass sein Vater ein überzeugter Progressiver war. Wilkinson selbst war Demokrat, bis zum Wahlkampf um die Präsidentschaft 1940, als er – je nachdem, wem man glaubte – entweder eine radikale Kehrtwende vollzog oder eine Gelegenheit sah und sie beim Schopf packte. Er wurde ein kriegs- und wirtschaftsaffiner Republikaner, der durchs Land reiste und den New Deal als sozialistische Großmachtpolitik verurteilte. Außerdem kritisierte er FDR scharf wegen seiner neutralen Haltung gegenüber Hitler. »Ich habe meine Partei nicht verlassen«, kommentierte er seinen Austritt bei den Demokraten, »meine Partei hat mich verlassen.« Im ganzen Land brach das Wilkinson-Fieber aus. Er schaffte es aufs Titelblatt des Nachrichtenmagazins Time sowie des Wirtschaftsmagazins Fortune.
Siebzigtausend Menschen versammelten sich, als er in Los Angeles eine seiner Reden hielt – siebzigtausend. Es störte niemanden, dass er ein verheirateter Mann war, der sich nahezu unverschämt offen mit einer geschiedenen Frau aus den literarischen Kreisen New York Citys zeigte. Als er sich 1940 um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner bemühte, versuchten die republikanischen Mistkerle, die er dabei aus dem Weg räumte, ihm Steine in den Weg zu legen. Ein Senator sagte, es sei für ihn in Ordnung, wenn die Stadthure der Kirche beitreten würde, aber sie solle nicht gleich in der ersten Woche den Chor leiten. Für die meisten Kandidaten hätte das den Untergang bedeutet, aber Wilkinsons Fans schien es nicht zu interessieren, was die republikanischen Mistkerle sagten. Als er den Kampf um die Nominierung gewann, kamen in Indiana einhundertfünfzigtausend Menschen bei Gluthitze zusammen, um seine Dankesrede zu hören. So etwas hatte man bis dahin noch nie erlebt.
Im Wahlkampf aber rieten ihm seine Berater, einen Gang zurückzuschalten und sich als Kandidat für alle zu präsentieren – für beide politische Lager. Später sagte er, er sei wütend, dass er auf sie gehört hatte. Auf alle Fälle war Roosevelt entweder zu beliebt oder zu schlau, denn er brachte ihm eine ordentliche Niederlage bei.
Nachdem Wilkinson 1940 die Wahl zum Präsidenten verloren hatte, blieb er im Fokus der Öffentlichkeit und publizierte ein Buch, in dem er Amerika dazu aufrief, sich rund um den Globus für Freiheit einzusetzen – schon im ersten Monat verkauften sich von ihm eine Million Exemplare. Japan gegenüber war er besonders hart und argumentierte lange vor Pearl Harbor, dass wir den Japanern kein Öl mehr liefern sollten. Er war aber bei Weitem kein Aufwiegler – eher das Gegenteil. Er verurteilte Charles Lindberghs antisemitische Beschimpfungen als unamerikanisch. Er führte einen Kampf gegen den Ku-Klux-Klan in Ohio, er verlangte die Aufhebung der Rassentrennung bei den bewaffneten Streitkräften und in Washington, D. C. Als Vorsitzender von Twentieth Century Fox hatte Wilkinson ganz Hollywood dazu gedrängt, schwarzen Schauspielern bessere Rollen zu geben. Die National Association for the Advancement of Colored People – NAACP – liebte ihn. Der Ku-Klux-Klan nicht.
Fazit: Wilkinson war eine seltsame Kombination aus Frauenheld und Flammenwerfer, ein leidenschaftlicher Mann und ein Opportunist, ein Mann mit Prinzipien, was bedeutete, dass ihm Hass aus den unterschiedlichsten Richtungen hätte entgegenschlagen können.
In diesem Moment ertönte ein vertrautes Klopfen an meiner Bürotür: tappeldi-tapp, tapp-tapp. Die Tür ging auf, und Miriam trat ein.
»Hi«, begrüßte ich sie. »Oh, Mist! Ich habe vergessen, dich abzuholen!«
»Kein Problem, Al. Ich bin getrampt. Ein Rollerfahrer hat mich mitgenommen.«
Miriam sah aus wie ein Mädchen, das an der Grenze zu Mexiko aufgewachsen war, was keinen Sinn ergab, denn sie hatte praktisch ihr ganzes Leben in Albany verbracht, einer Stadt in den East Bay Lowlands, wo die reichen Bewohner von Berkeley ihren Müll abluden. Sie war dürr, hatte Sommersprossen und einen unbändigen dunklen Lockenkopf. Jeden Tag trug sie dieselbe Latzhose. Sie rauchte und konnte höllisch gut fluchen.