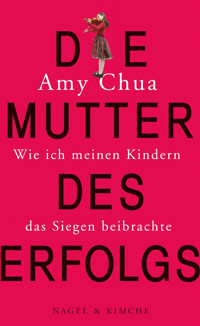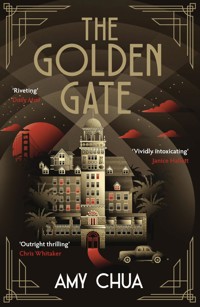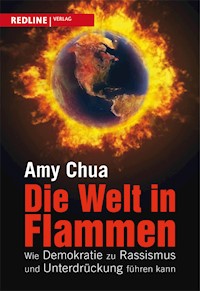
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn Schwellenländer oder Dritte-Welt-Staaten Demokratie und eine freie Marktwirtschaft einführen, gehen die meisten davon aus, dass dies einen großen Fortschritt für das jeweilige Land darstellt. So schauen auch wir mit Wohlwollen auf die Entwicklungen in Nordafrika und im Nahen Osten. Doch führt die vom Westen immer wieder betonte Formel "Demokratie und Marktwirtschaft für alle" wirklich zu einer gerechteren Welt? Amy Chua, "Tigermutter" und Yale-Professorin, belegt, warum Demokratisierung und Marktwirtschaft ganz im Gegenteil sogar Hass und ethnische Verfolgung von Minderheiten schürten. Sie zeigt, dass Ethnien, die einst die Wirtschaft dominierten, durch die Veränderungen im Zentrum von Verfolgung und Konflikten stehen: Chinesen in Südostasien, die "Weißen" in Lateinamerika, Südafrika und Simbabwe, die jüdischen Oligarchen in Russland oder auch die Inder in Ostafrika. Chua zeigt die zerstörerische Schattenseite der Globalisierung auf, die viele nicht wahrhaben wollen: Vom Hass auf die USA und Europa bis hin zu den katastrophalen Konsequenzen für die Regionen selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Anmerkung des Verlags
Das vorliegende Buch beleuchtet Demokratie und Globalisierung aus einer völlig neuen Perspektive und liefert Erklärungen für manche Fehlentwicklungen in vielen Ländern.
Da das Original jedoch aus dem Jahr 2004 ist, wurden spätere Vorkommnisse nicht berücksichtigt. Einige Passagen und Inhalte sind daher nicht auf dem aktuellsten Stand. So ist beispielsweise Michail Chodorkowski inzwischen seit Jahren inhaftiert. Seit zehn Jahren hat dieser Klassiker jedoch nichts an Bedeutung eingebüßt, ganz im Gegenteil belegen aktuelle Entwicklungen die Stimmigkeit der Thesen.
Ihr Redline-Team
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2011
© 2011 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH, München,
Nymphenburger Straße 86 D-80636 München Tel.: 089 651285-0 Fax: 089 652096
© der Originalausgabe 2003, 2004 by Amy Chua
Die englische Originalausgabe erschien 2004 bei Doubleday, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Random House, Inc. unter dem Titel World on Fire.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Silvia Kinkel Redaktion: Jordan T. A. Wegberg Lektorat: Ulrike Kroneck
Umschlagabbildung: unter Verwendung von Bildern aus istockphoto.com
Satz: Jürgen Echter, HJR, Landsberg am Lech
Epub: Grafikstudio Foerster, Belgern
ISBN Epub 978-3-86414-300-7
Weitere Infos zum Thema
www.redline-verlag.de
Inhalt
Einleitung: Globalisierung und ethnischer Hass
Teil eins: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Globalisierung
Kapitel 1: Rubine und Reisfelder
Die Vorherrschaft der chinesischen Minderheit in Südostasien
Kapitel 2: Lamaföten, Latifundios und »la Blue Chip numero uno«
»Weißer« Reichtum in Lateinamerika
Kapitel 3: Der siebte Oligarch
Jüdische Milliardäre des postkommunistischen Russland
Kapitel 4: Die »Ibos von Kamerun«
Marktdominierende Minderheiten in Afrika
Teil zwei: Die politischen Auswirkungen der Globalisierung
Kapitel 5: Eine Gegenreaktion auf die Märkte
Gezielte ethnische Beschlagnahmungen und Verstaatlichungen
Kapitel 6: Eine Gegenreaktion auf die Demokratie
Vetternwirtschaftskapitalismus und Minderheitenherrschaft
Kapitel 7: Eine Gegenreaktion auf marktdominierende Minderheiten
Vertreibung und Völkermord
Kapitel 8: Das Vermischen von Blut
Assimilation, Globalisierung und der Fall Thailand
Teil drei: Ethnonationalismus und der Westen
Kapitel 9: Die Kehrseite der westlichen freien Marktwirtschaft
Von Jim Crow zum Holocaust
Kapitel 10: Der Hexenkessel im Nahen Osten
Israelische Juden als regionale marktdominierende Minderheit
Kapitel 11: Warum sie uns hassen
Amerika als globale marktdominierende Minderheit
Kapitel 12: Die Zukunft der marktwirtschaftlichen Demokratie
Nachwort zur ursprünglichen Ausgabe
Anmerkungen
Danksagung
Einleitung: Globalisierung und ethnischer Hass
An einem strahlend schönen Morgen im September 1994 erhielt ich einen Anruf von meiner Mutter aus Kalifornien. Mit gedämpfter Stimme teilte sie mir mit, dass meine Tante Leona, die Zwillingsschwester meines Vaters, in ihrem Haus auf den Philippinen ermordet worden war − ihr Chauffeur hatte ihr die Kehle durchgeschnitten. Meine Mutter überbrachte mir die Nachricht in unserem chinesischen Heimatdialekt Hokkien. Aber »Mord« sagte sie auf Englisch, als wollte sie zwischen der Familie und der Tat einen sprachlichen Schutzwall errichten.
Die Ermordung eines Verwandten ist für jeden schrecklich. Mein Vater hat sich hinter seinem Kummer verschanzt; bis heute weigert er sich, darüber zu sprechen. Die übrige Familie aber kämpfte mit dem Moment der Schande. Für Chinesen ist Glück eine moralische Eigenschaft, und ein glücklicher Mensch würde niemals ermordet werden. Ermordet zu werden war genauso beschämend wie ein Geburtsfehler oder die Heirat mit einem Filipino.
Meine drei jüngeren Schwestern und ich mochten Tante Leona sehr, sie war eine zierliche, schrullige Person und hatte nie geheiratet. Wie viele wohlhabende philippinische Chinesen hatte auch sie Bankkonten in Honolulu, San Francisco und Chicago. Sie besuchte uns regelmäßig in den Vereinigten Staaten. Sie und mein Vater − Leona und Leon – standen sich so nahe, wie es nur Zwillinge können. Sie hatte keine eigenen Kinder, war vernarrt in ihre Nichten und überschüttete uns mit Nippes. Als wir heranwuchsen, wurden aus dem Tand Schätze. An meinem zehnten Geburtstag schenkte sie mir zehn kleine Diamanten, die in Toilettenpapier eingewickelt waren. Meine Tante liebte Diamanten und kaufte sie gleich zu Dutzenden. Sie bewahrte sie in leeren Cremedosen von Elizabeth Arden auf, manche ließ sie einfach auf der Ablage in ihrem Badezimmer stehen. Leona hortete alles, was kostenlos war. Wenn wir bei McDonald’s aßen, stopfte sie ihre Gucci-Handtasche mit Ketchuptüten voll.
Laut Polizeibericht wurde meine Tante Leona, »eine alleinstehende Frau von 58 Jahren«, am 12. September 1994 gegen 20 Uhr in ihrem Wohnzimmer mit einem Fleischermesser getötet. Zwei ihrer Dienstmädchen wurden verhört und gestanden, dass Nilo Abique, der Chauffeur meiner Tante, den Mord mit ihrem Wissen und ihrer Unterstützung geplant und durchgeführt hatte. »Ein paar Stunden vor dem eigentlichen Verbrechen wurde der Beschuldigte gesehen, wie er das vermutlich beim Mord benutzte Messer schärfte.« Nach der Tat »gesellte sich der Verdächtige zu den beiden Zeuginnen und sagte ihnen, dass ihre Arbeitgeberin tot sei. Dabei trug er ein Paar blutbefleckte weiße Handschuhe und hielt ein Messer mit Blutspuren in der Hand.« Aber Abique, so fuhr der Bericht fort, sei trotz Haftbefehl »verschwunden«. Die beiden Dienstmädchen wurden auf freien Fuß gesetzt.
Inzwischen organisierten meine Verwandten für meine Tante ein Begräbnis im engsten Familienkreis auf dem renommierten chinesischen Friedhof in Manila, wo viele meiner Vorfahren in einer großen Familiengrabstätte aus weißem Marmor liegen. Auf Anraten der Feng-Shui-Experten, die wegen der gewaltsamen Natur ihres Todes befragt wurden, konnte meine Tante nicht in der Familiengruft bestattet werden, sonst würde ihre noch lebende Verwandtschaft weiteres Pech erleiden. Also wurde sie daneben in ein eigenes kleines Gewölbe gelegt – das die Familiengrabstätte nicht berührte.
Nach dem Begräbnis fragte ich einen meiner Onkel, ob es Fortschritte bei den Ermittlungen gäbe. Er antwortete knapp, dass der Mörder nicht gefunden worden sei. Und seine Frau fügte hinzu, die Polizei von Manila habe den Fall mehr oder weniger abgeschlossen.
Ich konnte die fast schon gleichgültige Einstellung meiner Verwandten nicht verstehen. Warum erschütterte es sie nicht, dass meine Tante kaltblütig von Menschen getötet worden war, die für sie arbeiteten, mit ihr lebten und sie jeden Tag sahen? Warum waren sie nicht empört über die Freilassung der Dienstmädchen? Ich bedrängte meinen Onkel, mir Antworten zu geben, aber er blieb einsilbig. »So sind die Dinge hier eben«, sagte er. »Wir sind auf den Philippinen − nicht in Amerika.«
Mein Onkel war nicht etwa herzlos. Wie sich herausstellte, ist der Tod meiner Tante kein Einzelfall. Jedes Jahr werden auf den Philippinen Hunderte von Chinesen entführt, fast ausnahmslos von Filipinos. Viele von ihnen, häufig Kinder, werden trotz der Zahlung von Lösegeld brutal ermordet. Andere Chinesen, wie meine Tante, werden Opfer von Raubmord. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass der Mörder meiner Tante nie verhaftet wurde. Die Polizisten auf den Philippinen, selber arme Filipinos, sind in solchen Fällen bekanntermaßen wenig motiviert. Auf die Frage eines westlichen Journalisten, warum so oft die Chinesen ins Visier genommen werden, erklärte ein grinsender philippinischer Polizist: »Weil sie mehr Geld haben.«1
Meine Familie gehört zu der kleinen, aber unternehmerisch und wirtschaftlich bedeutenden chinesischen Minderheit auf den Philippinen. Sie machen gerade mal 1 Prozent der Bevölkerung aus, kontrollieren jedoch etwa 60 Prozent der privaten Wirtschaft, einschließlich der vier großen Luftfahrtgesellschaften, vieler Hotels, Einkaufszentren und großer Konzerne sowie fast aller Banken des Landes.2 Meine eigene Familie leitet in Manila eine Unternehmensgruppe für Kunststoffprodukte. Anders als die Tai-Pans Lucio Tan, Henry Sy oder John Gokongwei sind meine Verwandten nur chinesische Industriemagnaten »dritten Ranges«. Und doch gehören ihnen ganze Landstriche mit erstklassigen Immobilien sowie etliche Ferienhäuser. In ihren Bankschließfächern lagern Goldbarren in der Größe von Schokoriegeln. Ich besitze selbst solch einen Barren: Meine Tante Leona schickte ihn mir per Federal Express als Geschenk zu meinem Examen an der juristischen Fakultät − ein paar Jahre vor ihrem Tod.
Seit der Ermordung meiner Tante lässt mich eine Kindheitserinnerung nicht mehr los. Ich war acht Jahre alt und zu Besuch auf dem herrlichen Landsitz meiner Familie in Manila. Noch vor Anbruch der Morgendämmerung war ich bereits hellwach und beschloss, mir in der Küche etwas zu trinken zu holen. Ich muss ein anderes Treppenhaus benutzt haben, denn plötzlich stolperte ich über sechs männliche Körper.
Ich war in die Unterkunft der männlichen Dienstboten geraten. Die Boys, Gärtner und Chauffeure meiner Familie − manchmal stelle ich mir vor, dass Nilo Abique unter ihnen war – schliefen auf Matten auf dem dreckigen Boden. Es stank nach Schweiß und Urin. Ich war entsetzt.
Später an diesem Tag sprach ich Tante Leona darauf an. Sie lächelte mich nachsichtig an und erklärte, dass sich die Diener − vielleicht zwanzig an der Zahl und alle Filipinos – glücklich schätzen konnten, für unsere Familie zu arbeiten. Ansonsten würden sie mit Ratten in der Kloake leben und hätten nicht einmal ein Dach über dem Kopf.
In dem Moment kam ein philippinisches Dienstmädchen ins Zimmer. Ich erinnere mich noch daran, dass sie eine Schüssel mit Futter für den Pekinesen meiner Tante trug. Meine Tante nahm die Schüssel und redete unbeirrt weiter. Die Filipinos, fuhr sie auf Chinesisch fort und kümmerte sich nicht darum, ob das Dienstmädchen sie verstehen konnte, seien faul und dumm. Wenn es ihnen bei uns nicht gefalle, könnten sie jederzeit gehen. Schließlich seien sie Angestellte und keine Sklaven, sagte meine Tante.
Fast zwei Drittel der etwa 80 Million Filipinos auf den Philippinen leben von weniger als 2 Dollar pro Tag. Vierzig Prozent verbringen ihr ganzes Leben in provisorischen Unterkünften. Siebzig Prozent der auf dem Land lebenden Filipinos besitzen kein Land. Fast ein Drittel hat keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen.3
Aber das ist nicht das Schlimmste. Armut allein lässt Menschen nicht zu Mördern werden. Zu der Armut müssen Entwürdigung, Hoffnungslosigkeit und Kränkung kommen.
Auf den Philippinen arbeiten Millionen von Filipinos für Chinesen; praktisch kein Chinese arbeitet für Filipinos. Die Chinesen beherrschen Industrie und Handel auf jeder Ebene der Gesellschaft. Globale Märkte verstärken diese Dominanz: Wenn ausländische Investoren Geschäfte auf den Philippinen tätigen, verhandeln sie fast ausschließlich mit Chinesen. Abgesehen von einer Handvoll korrupter Politiker und einigen aristokratischen spanischen Mestizen-Familien sind alle philippinischen Milliardäre chinesischer Abstammung. Im Gegensatz dazu werden alle minderwertigen Jobs auf den Philippinen von Filipinos ausgeführt. Alle Landarbeiter sind Filipinos. Alle Hausangestellten und Bewohner von Hüttenvierteln sind Filipinos. In Manila leben Tausende Filipinos nicht nur neben, sondern auch von der Müllkippe Payatas, einem zwölf Straßenblocks umfassenden Berg gärender Abfälle, bekannt als das »Gelobte Land«. Die Slumbewohner durchsuchen täglich das faulende Essen und die Tierkadaver nach wiederverwertbaren Materialien wie Glas, Plastik und Blechdosen. Mit dem Verkauf finanzieren sie ihr Leben. Im Juli 2000 implodierte der Müllberg aufgrund von Methangasansammlungen und geriet ins Rutschen. Mehr als 100 Menschen einschließlich vieler kleiner Kinder wurden unter den Massen begraben und erstickten.
Als ich einen meiner Onkel nach der Payatas-Explosion fragte, reagierte er verärgert. »Warum will jeder darüber sprechen? Das schreckt nur ausländische Investoren ab.« Ich war nicht überrascht. Meine Verwandten leben abgeschottet von den philippinischen Massen in einer piekfeinen, rein chinesischen Wohnenklave, deren Straßen nach Harvard, Yale, Stanford und Princeton benannt sind. Die Zufahrten werden von privaten bewaffneten Sicherheitskräften bewacht.
Jedes Mal, wenn ich an Nilo Abique denke − er war fast 1,80 Meter groß und ein Riese gegenüber meiner Tante –, werde ich von solchem Hass und solcher Abscheu erfasst, dass es fast schon tröstlich wirkt. Im Laufe der Zeit habe ich jedoch auch einen Eindruck davon gewonnen, wie die Chinesen auf die Mehrheit von Filipinos − und jemanden wie Abique − wirken müssen: Sie sind Ausbeuter; ausländische Eindringlinge, deren Reichtum nicht nachvollziehbar und deren Überlegenheit unerträglich ist. Ich werde niemals den Eintrag im Polizeibericht über das »Mordmotiv« von Abique vergessen. Das angegebene Motiv war nicht etwa Raub, obwohl der Chauffeur angeblich Juwelen und Geld an sich genommen hatte. Stattdessen stand dort nur ein Wort: »Rache«.
In einer Welt, die gewaltsamer ist, als die meisten von uns sich vorstellen können, hatte die Ermordung meiner Tante in etwa die Bedeutung eines Mückenstichs. In Amerika konnten wir lesen, dass Menschen massenhaft und auf grausamste Weise abgeschlachtet werden. Anfangs passierten diese Dinge an weit entfernten Orten, aber sie kommen ständig näher. Wir verstehen nicht, was diese Taten miteinander verbindet und inwiefern wir zu ihrer Entstehung beigetragen haben.
In den serbischen Konzentrationslagern Anfang der 1990er-Jahre wurden weibliche Gefangene immer wieder vergewaltigt, mehrmals am Tag, oft mit zerbrochenen Flaschen und häufig zusammen mit ihren Töchtern. Die Männer wurden, wenn sie Glück hatten, zu Tode geprügelt, während ihre serbischen Wächter die Nationalhymne sangen; wenn sie nicht so glücklich waren, wurden sie kastriert oder mit vorgehaltener Waffe gezwungen, ihre Mitgefangenen zu kastrieren − manchmal mit ihren eigenen Zähnen. Insgesamt wurden Tausende gefoltert und getötet.4
In Ruanda töteten 1994 Hutu in einem Zeitraum von drei Monaten 800.000 Tutsi, meistens indem sie sie mit Macheten zerstückelten. Kinder kamen nach Hause und fanden ihre Mütter, Väter, Schwestern und Brüder mit abgetrennten Köpfen und Gliedern auf dem Wohnzimmerboden.5
Bei schweren Unruhen in Jakarta 1998 verwüsteten, plünderten und verbrannten indonesische Randalierer Hunderte von chinesischen Geschäften und Häusern und ließen mehr als 2.000 Tote zurück. Eine Überlebende – ein 14-jähriges chinesisches Mädchen – beging später Selbstmord, indem sie Rattengift nahm. Sie war von einer Bande vergewaltigt und vor den Augen ihrer Eltern im Genitalbereich verstümmelt worden.6
In Israel rammte 1998 ein Selbstmordattentäter mit seinem mit Sprengstoff beladenen Auto einen Schulbus, in dem 34 jüdische Kinder im Alter zwischen sechs und acht Jahren saßen. Im Laufe der nächsten paar Jahre nahmen solche Ereignisse zu. Sie wurden zu täglichen Ereignissen und einem starken kollektiven Ausdruck des palästinensischen Hasses. »Wir hassen euch«, drückte es ein führender offizieller Arafat-Anhänger im April 2002 aus. »Die Luft hasst euch, das Land hasst euch, die Bäume hassen euch, es hat keinen Sinn, dass ihr länger in diesem Land bleibt.«7
Am 11. September 2001 entführten Terroristen aus dem Nahen Osten vier amerikanische Flugzeuge. Sie zerstörten das World Trade Center und den Südwestflügel des Pentagons. Etwa 3.000 Menschen kamen dabei ums Leben. »Amerikaner, denkt nach! Warum werden ihr überall auf der Welt gehasst?«, proklamierte ein von arabischen Demonstranten gehaltenes Spruchband öffentlich.8
Abgesehen von der Brutalität, was ist die Verbindung zwischen diesen Ereignissen? Die Antwort liegt in der Beziehung – der zunehmend explosiven Kollision − der drei stärksten Kräfte, die in der heutigen Welt wirken: Märkte, Demokratie und ethnischer Hass.
Dieses Buch handelt von einem Phänomen, das außerhalb des Westens um sich greift, aber selten zur Kenntnis genommen, ja sogar tabuisiert wird und das die demokratische freie Marktwirtschaft in Zündstoff für einen ethnischen Flächenbrand verwandelt. Gemeint ist das Phänomen der marktdominierenden Minderheiten: ethnische Minderheiten, die aus ganz unterschiedlichen Gründen die »eingeborene« Mehrheit in einem häufig erschreckenden Ausmaß wirtschaftlich beherrschen.
Marktdominierende Minderheiten finden sich überall auf der Welt. Die Chinesen sind nicht nur auf den Philippinen eine marktdominierende Minderheit, sondern überall in Südostasien. 1998 kontrollierten chinesische Indonesier, nur 3 Prozent der Bevölkerung, ungefähr 70 Prozent von Indonesiens Privatwirtschaft, insbesondere alle großen Unternehmensgruppen des Landes. In jüngerer Zeit haben chinesische Unternehmer in Birma die Volkswirtschaften von Mandalay und Rangun regelrecht übernommen. Weiße sind eine marktdominierende Minderheit in Südafrika sowie − in einem wesentlich komplexeren Zusammenhang − in Brasilien, Ecuador, Guatemala und weiten Teilen von Lateinamerika. Libanesen sind die marktdominierende Minderheit in Westafrika. Die Ibo sind es in Nigeria. Kroaten waren die marktdominierende Minderheit im früheren Jugoslawien. Und mit großer Wahrscheinlichkeit sind die Juden eine marktdominierende Minderheit im postkommunistischen Russland.
Marktdominierende Minderheiten sind die Achillesferse der demokratischen freien Marktwirtschaft. In Gesellschaften mit einer marktdominierenden ethnischen Minderheit fördern Märkte und Demokratie nicht nur verschiedene Menschen oder Klassen, sondern ethnische Gruppen. Märkte konzentrieren Reichtum in oftmals astronomischen Ausmaßen in den Händen der marktdominierenden Minderheit, während die Demokratie die politische Macht der verarmten Mehrheit vergrößert. Unter diesen Bedingungen wird die demokratische freie Marktwirtschaft zur Triebkraft eines potenziell katastrophalen Ethnonationalismus. Sie spielt eine frustrierte »eingeborene« Mehrheit, die leicht von opportunistischen Politikern auf Stimmenjagd aufgebracht werden kann, gegen eine ungeliebte, wohlhabende ethnische Minderheit aus. Zu dieser Konfrontation kommt es jetzt in einem Land nach dem anderen, von Indonesien bis Sierra Leone, von Simbabwe bis Venezuela, von Russland bis zum Nahen Osten.
Seit dem 11. September 2001 hat diese Konfrontation auch die Vereinigten Staaten erreicht. Amerikaner sind keine ethnische Minderheit (wenn auch eine Minderheit im Sinne des nationalen Ursprungs). Es gibt auch keine weltweite Demokratie. Dennoch werden Amerikaner heute überall als die weltweit marktdominierende Minderheit wahrgenommen, die im Vergleich zu ihrer Größe und Anzahl eine inakzeptable unverhältnismäßige Wirtschaftsmacht ausübt. Infolgedessen sind sie zum Ziel derselben Feindseligkeit und Antipathie geworden, die sich gegen so viele marktdominierende Minderheiten auf der ganzen Welt richtet.
Der weltweite Antiamerikanismus hat viele Ursachen. Eine davon ist ironischerweise die globale Ausbreitung von freier Marktwirtschaft und Demokratie. Überall werden globale Märkte verbittert als Verstärkung des amerikanischen Reichtums und amerikanischer Überlegenheit wahrgenommen. Gleichzeitig verleihen populistische und demokratische Bewegungen den verarmten, frustrierten und ausgeschlossenen Massen der ganzen Welt Kraft, Legitimität und Stimme − also genau jenen Menschen, die am empfänglichsten für antiamerikanische Demagogie sind. In mehr nichtwestlichen Ländern, als die Amerikaner zugeben möchten, würden freie und gerechte Wahlen antimarktwirtschaftliche und antiamerikanische Führer an die Macht bringen. In den letzten Jahren haben Amerikaner sowohl die Ausweitung der Märkte als auch die Demokratisierung weltweit gefördert. Mit diesem Prozess machten sie sich selbst zur Zielscheibe der Wut.9
Die Beziehungen zwischen demokratischer freier Marktwirtschaft und ethnischer Gewalt sind rund um die Welt untrennbar mit der Globalisierung verbunden. Aber das Phänomen der marktdominierenden Minderheiten führt zu Komplikationen, die sowohl von den Anhängern der Globalisierung als auch von ihren Kritikern übersehen wurden.
Globalisierung besteht nicht nur in hohem Maße aus der weltweiten Ausbreitung von Märkten und Demokratie, sondern wird auch durch diese angetrieben. Die amerikanische Regierung hat die demokratische freie Marktwirtschaft in Entwicklungsländern und postsozialistischen Ländern, gemeinsam mit amerikanischen Beratern, Unternehmern und Stiftungen, energisch gefördert. Zuweilen grenzten diese Anstrengungen ans Absurde. So gibt es zum Beispiel die traurige Geschichte einer Delegation von amerikanischen Beratern für freie Marktwirtschaft in der Mongolei. Die Amerikaner waren begeistert, als ein mongolischer Beamter sie kurz vor ihrer Abreise bat, ihm weitere einseitige Kopien der umfangreichen amerikanischen Wertpapiergesetze zu senden. Leider stellte sich heraus, dass der Mongole sich nicht für den Inhalt der Dokumente interessierte, sondern für die leere Rückseite jedes Blattes, die helfen sollte, die chronische Papierknappheit der Regierung zu mildern.10
Es gab auch eine Zeit, als die amerikanische Regierung die größte Public-Relations-Firma der Welt, Burson-Marsteller aus New York, zur Unterstützung engagierte, um den freien Marktkapitalismus an die Menschen in Kasachstan zu verkaufen. Neben anderen Ideen entwickelte Burson-Marsteller eine kleine Soap Opera für die Fernsehausstrahlung, welche die Privatisierung verherrlichte. In einer Episode wünschen sich zwei glücklose Familien verzweifelt ein neues Haus, wissen aber nicht, wie sie den Bau bewerkstelligen sollen. Da schwebt ein Heißluftballon vom Himmel herab, auf dem in riesigen Buchstaben »Soros Foundation« steht. Amerikaner springen heraus, bauen die Häuser und schweben wieder davon, die ehrfurchtsvollen Kasachen in begeistertem Jubel zurücklassend.11
Geschichten über die amerikanische Naivität und Unfähigkeit sind jedoch nur eine Begleiterscheinung. Tatsache ist, dass in den letzten Jahrzehnten die von Amerika angeführte globale Ausbreitung von Märkten und Demokratie die Welt radikal umgestaltet hat. Sowohl direkt als auch durch mächtige internationale Einrichtungen wie die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Welthandelsorganisation (WTO) brachte die US-Regierung Milliarden Menschen den Kapitalismus und demokratische Wahlen. Gleichzeitig fegten amerikanische multinationale Konzerne, Stiftungen und Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) über die Welt hinweg und hinterließen Wahlurnen, Burger Kings, Hip-Hop und Hollywood sowie von Amerikanern entworfene Verfassungen.
Die vorherrschende Ansicht bei den Unterstützern der Globalisierung ist, dass Märkte und Demokratie eine Allheilmittel gegen die zahlreichen Krankheiten der Unterentwicklung seien. Marktkapitalismus ist das effizienteste Wirtschaftssystem, das die Welt je gekannt hat. Demokratie ist das gerechteste politische System, das die Welt bisher erlebt hat, und erweist der individuellen Freiheit den größten Respekt. Gemeinsam werden Märkte und Demokratie die Welt allmählich in eine Gemeinschaft von wohlhabenden, Krieg vermeidenden Nationen verwandeln und die Menschen in liberale, solidarische Bürger und Verbraucher. Dabei werden ethnischer Hass, religiöser Fanatismus und andere »rückwärtsgerichtete« Aspekte der Unterentwicklung beseitigt.
Thomas Friedman, ein Vertreter dieser vorherrschenden Ansicht, zitierte in seinem Bestseller The Lexus and the Olive Tree eine Anzeige von Merrill Lynch: »Die Ausbreitung von freien Märkten und Demokratie rund um die Welt erlaubt mehr Menschen, ihre Sehnsüchte in Ergebnisse zu verwandeln«, und beseitigt »nicht nur geografische Grenzen, sondern auch menschliche«. Globalisierung, so führt Friedman aus, »verwandelt Freunde und Feinde in ›Mitbewerber‹«. Friedman erklärt auch seine »Goldener-Bogen-Theorie der Konfliktverhinderung«, wonach »Länder, in denen es McDonald’s gibt, niemals in einem Krieg gegeneinander kämpften …«12 (Leider, so merkt Yale-Geschichtsprofessor John Gaddis an, »wählten die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten ausgerechnet den ungünstigen Moment, um mit dem Bombardement von Belgrad zu beginnen, als es dort eine beschämende Anzahl goldener Bögen gab«.)13
Für die Anhänger der Globalisierung ist das Heilmittel gegen Gruppenhass und ethnische Gewalt rund um die Welt eindeutig: mehr Märkte und mehr Demokratie. Deshalb veröffentlichte Friedman nach dem 11. September eine Kolumne, die Indien und Bangladesch als »Vorbilder« für den Nahen Osten hinstellt und diese Lösung gegen Terrorismus und militanten Islamismus anbietet: »Hallo? Hallo? Hier kommt eine Botschaft. Wir haben Demokratie, Schluss, aus!« – »Multi-ethnischer, pluralistischer, demokratischer freier Markt.«14
Im Gegensatz dazu steht die ernüchternde These dieses Buches, dass die globale Ausbreitung von Märkten und Demokratie eine der grundlegenden Ursachen für Gruppenhass und ethnische Gewalt in der nichtwestlichen Welt ist. In den zahlreichen Gesellschaften rund um den Globus, die eine marktdominierende Minderheit aufweisen, verstärken sich Märkte und Demokratie nicht gegenseitig. Weil Märkte und Demokratie in solchen Gesellschaften verschiedene ethnische Gruppen begünstigen, bringt das Bestreben nach demokratischen freien Märkten hochgradig instabile und explosive Bedingungen hervor. Die Märkte konzentrieren enormen Reichtum in den Händen einer »Außenseiterminderheit« und entfachen ethnischen Neid und Hass unter der häufig dauerhaft armen Mehrheit. In absoluten Zahlen kann es der Mehrheit besser gehen oder nicht − ein Streit, auf den sich die Globalisierungsdebatte stark fixiert −, aber jedes Gefühl der Verbesserung wird durch die chronische Armut und den außergewöhnlichen Wirtschaftserfolg der verhassten Minderheit überkompensiert. Noch demütigender ist zudem, dass die marktdominierenden Minderheiten, zusammen mit ihren ausländischen Investorenpartnern, fast ausnahmslos die Kronjuwelen der Wirtschaft kontrollieren, die häufig symbolisch für Nationalstolz und Identität stehen, wie zum Beispiel Öl in Russland und Venezuela, Diamanten in Südafrika, Silber und Zinn in Bolivien oder Jade, Teakholz und Rubine in Birma.
Die Einführung der Demokratie unter diesen Umständen verwandelt Wähler nicht in aufgeschlossene Mitbürger einer nationalen Gemeinschaft. Eher fördert die Konkurrenz um Stimmen das Auftreten von Demagogen, welche die verhasste Minderheit zum Sündenbock stempeln und ethnonationalistische Bewegungen schüren, die fordern, dass der Reichtum des Landes und die Identität den »wahren Eigentümern der Nation« zurückgegeben werden. Als Amerika in den 1990er-Jahren die globale Ausbreitung der Demokratie feierte, kam es zu einer rasanten Zunahme ethnisch geprägter politischer Slogans: »Georgien den Georgiern«, »Eritreer raus aus Äthiopien«, »Kenia den Kenianern«, »Weiße sollen Bolivien verlassen«, »Kasachstan den Kasachen«, »Serbien für Serben«, »Kroatien den Kroaten«, »Hutu an die Macht«, »Assam ist assamesisch«, »Juden raus aus Russland«. Vadim Tudor, der Präsidentschaftskandidat Rumäniens von 2001, formulierte es etwas anschaulicher. »Ich bin Vlad der Pfähler«, verkündete er mit Blick auf die wirtschaftlich dominierende ungarische Minderheit und versprach: »Wir werden sie an ihren ungarischen Zungen aufhängen!« 15
Wenn die demokratische freie Marktwirtschaft in Gegenwart einer marktdominierenden Minderheit betrieben wird, ist eine Gegenreaktion nahezu unvermeidlich. Diese Gegenbewegung nimmt normalerweise eine von drei Formen an. Die erste ist eine Gegenreaktion auf Märkte und nimmt den Reichtum der marktdominierenden Minderheit ins Visier. Die zweite ist eine Gegenreaktion auf die Demokratie durch Kräfte, welche die marktdominierende Minderheit unterstützen. Die dritte ist Gewalt, manchmal fast in Völkermorddimensionen, die sich gegen die marktdominierende Minderheit richtet.
Das heutige Simbabwe ist ein lebendiges Beispiel für die erste Art der Gegenbewegung − ein ethnisch motivierter Widerstand gegen den Markt. Mehrere Jahren lang förderte Präsident Robert Mugabe die gewaltsame Beschlagnahmung von 10 Millionen Hektar genutzten Ackerbodens, der bislang im Besitz von Weißen gewesen war. Wie ein Simbabwer es formuliert: »Das Land gehört uns. Die Ausländer dürfen hier kein Land besitzen. Es gibt keinen schwarzen Simbabwer, der Land in England besitzt. Warum sollte ein Europäer hier Land besitzen?«16 Mugabe wird noch deutlicher: »Weckt Furcht in den Herzen der Weißen, unserer wahren Feinde!«17 Die meisten weißen »Ausländer« im Land sind in der dritten Generation Simbabwer. Sie machen gerade mal 1 Prozent der Bevölkerung aus, kontrollieren jedoch seit Generationen 70 Prozent der besten Bodenflächen des Landes, größtenteils in Form hoch produktiver, 3.000 Hektar großer Tabak- und Zuckerfarmen.
Nach dem Absturz der Wirtschaft Simbabwes infolge des Landraubs drängten die Vereinigten Staaten und Großbritannien zusammen mit Dutzenden von Menschenrechtsgruppen Präsident Mugabe zum Rücktritt und forderten lautstark »freie und gerechte Wahlen«. Aber der Glaube, dass Demokratie die Antwort auf Simbabwes Probleme wäre, ist absolut naiv. Vielleicht hätte Mugabe die Wahlen 2002 ohne Wahlbetrug verloren. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass Mugabe selbst ein Produkt der Demokratie ist. Der Held der schwarzen Befreiungsbewegung Simbabwes und Meister der Massenmanipulation errang seinen Sieg in den streng überwachten Wahlen von 1980 mit dem Versprechen, »gestohlenes« weißes Land zu enteignen. Die Wiederholung dieses Versprechens half ihm auch danach, jede Wahl zu gewinnen. Außerdem war Mugabes Kampagne der Landbeschlagnahmung ein weiteres Produkt des demokratischen Prozesses. Sie wurde zeitlich geschickt vor den Wahlen 2000 und 2002 durchgeführt und war darauf ausgerichtet, eine breite Unterstützung für das angeschlagene Regime Mugabes zu mobilisieren.18
Im Wettstreit zwischen einer wirtschaftlich mächtigen ethnischen Minderheit und einer zahlenmäßig starken, verarmten Mehrheit setzt sich nicht immer die Mehrheit durch. Statt eines Rückschlags für den Markt kann es durchaus auch zu einer Gegenreaktion auf die Demokratie kommen, bei der die marktdominierende Minderheit auf Kosten der Mehrheit begünstigt wird. Beispiele dieser Dynamik sind äußerst zahlreich. Dieses Buch wird zeigen, dass an den weltweit berüchtigtsten Fälle von »Vetternwirtschaftskapitalismus« immer eine marktdominierende ethnische Minderheit beteiligt war − von Ferdinand Marcos’ chinesenfreundlicher Diktatur auf den Philippinen über die Schattenallianz von Präsident Siaka Stevens mit fünf libanesischen Diamanthändlern in Sierra Leone bis zu den »Geschäftsverbindungen« von Präsident Daniel Arap Moi mit einer Handvoll indischer Industriemagnaten in Kenia.
Die dritte und grausamste Art der Gegenreaktion ist von der Mehrheit getragene Gewalt, die darauf abzielt, die marktdominierende Minderheit auszulöschen. Zwei aktuelle Beispiele sind das Massenschlachten von Tutsi in Ruanda und − in einem geringeren Ausmaß − die ethnische Säuberung von Kroaten im früheren Jugoslawien. In beiden Fällen wurde eine ungeliebte und unverhältnismäßig wohlhabende ethnische Minderheit von Mitgliedern der relativ verarmten Mehrheit angegriffen, die von einer ethnonationalistischen Regierung aufgehetzt wurde. Mit anderen Worten: Märkte und Demokratie gehörten zu den Ursachen sowohl für den ruandischen als auch für den jugoslawischen Völkermord. Das ist eine schwerwiegende Behauptung, die dieses Buch jedoch belegen will.
Den Globalisierungskritikern muss zugutegehalten werden, dass sie die Aufmerksamkeit auf die grotesken Ungerechtigkeiten gelenkt haben, die freie Märkte erzeugen. In den 1990ern schrieb Thomas Frank in One Market under God, dass globale Märkte »Unternehmen zur mächtigsten Einrichtung auf dieser Erde gemacht haben«, »die Gruppe der CEOs in eine der wohlhabendsten Eliten aller Zeiten« verwandelt haben und von Amerika bis Indonesien »die Armen mit einer Entschlossenheit ignorierten, wie wir sie seit den 1920ern nicht mehr erlebt haben«.19 Zahlreiche Gruppen unterstützen Frank in seiner Kritik »des allmächtigen Marktes«: amerikanische Bauern und Fabrikarbeiter, die der NAFTA ablehnend gegenüberstehen, Umweltexperten, die AFL-CIO, Menschenrechtsvertreter der Dritten Welt und diverse andere Gruppen, aus denen sich die Demonstranten in Seattle, Davos, Genua und New York zusammensetzten. Die Verteidiger der Globalisierung rechtfertigen sich damit, dass die Armen dieser Welt ohne globale Marktorientierung noch schlechter dran wären. Mit einigen wichtigen Ausnahmen, insbesondere des größten Teils von Afrika, zeigen neue Weltbank-Studien, dass das »Durchsickern der Globalisierung nach unten« für die Armen wie für die Reichen in Entwicklungsländern Vorteile gebracht hat.20
Viel wichtiger allerdings ist, dass westliche Globalisierungskritiker genauso wie ihre Gegenspieler die ethnische Dimension von Marktverschiedenheiten übersehen. Sie neigen dazu, Wohlstand und Armut als Klassenkonflikt und nicht als ethnischen Konflikt anzusehen. Diese Perspektive mag in den weit entwickelten westlichen Gesellschaften sinnvoll sein, aber die ethnischen Realitäten der Entwicklungsländer unterscheiden sich gänzlich von denen des Westens. Infolgedessen sind die von Kritikern der Globalisierung vorgeschlagenen Lösungen häufig kurzsichtig oder sogar gefährlich, wenn sie auf nichtwestliche Gesellschaften angewandt werden.
Im Wesentlichen fordert die Antiglobalisierungsbewegung eines: mehr Demokratie. So hat Noam Chomsky, einer der Hohepriester der Bewegung, deutlich gemacht, dass es keinen Kampf gegen »die Globalisierung« als solche gibt, sondern einen Kampf gegen den globalen »Neoliberalismus«, der von einigen »Masters of the Universe« auf Kosten einer demokratischen Gemeinschaft betrieben wird. In ähnlicher Weise wies Lori Wallach von Public Citizen auf dem Weltsozialforum in Brasilien 2002 das Etikett »Antiglobalisierung« zurück und erklärte, dass »unsere Bewegung in Wirklichkeit generell für Demokratie, Gleichheit, Vielfalt, Gerechtigkeit und Lebensqualität steht«. Wallach warnte auch, dass sich die Welthandelsorganisation entweder dem Willen der Menschen weltweit »beugen muss oder zerbrechen wird«. Dutzende von NGOs schlagen einen ähnlichen Ton an und verlangen eine »demokratische Stärkung der armen Mehrheit dieser Welt«.21
In Anbetracht der ethnischen Dynamik der Entwicklungsländer und insbesondere des Phänomens der marktdominierenden Minderheiten reicht eine bloße »Stärkung der armen Mehrheit« nicht aus. Die Stärkung der Hutu-Mehrheit in Ruanda brachte keine wünschenswerten Resultate. Genauso wenig tat dies die Stärkung der serbischen Mehrheit in Serbien.
Die Kritiker der Globalisierung haben recht mit der Forderung, den enormen Wohlstandsunterschieden, die durch globale Märkte geschaffen werden, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aber es ist genauso gefährlich, Märkte als das Allheilmittel gegen Armut und Konflikte in der Welt anzusehen, wie die Demokratie für ein Wundermittel zu halten. Märkte und Demokratie können auf lange Sicht eine wirtschaftliche und politische Hoffnung für Entwicklungsländer und postkommunistische Gesellschaften darstellen. Kurzfristig sind sie jedoch Teil des Problems.
»Märkte«, »Demokratie« und »Ethnizität« sind schwer zu definierende Konzepte. Zum Teil deshalb, weil es nicht nur eine richtige Interpretation für jeden dieser Begriffe gibt. Tatsächlich hoffe ich in diesem Buch aufzuzeigen, dass die »Marktsysteme«, die derzeit den Entwicklungsländern und postkommunistischen Länder aufgedrängt werden, sich von jenen in den westlichen Nationen stark unterscheiden; dass der in der nicht-westlichen Welt geförderte Prozess der Demokratisierung nicht derselbe ist, den die westlichen Länder selbst durchlaufen haben, und dass »Ethnizität« ein ungenaues, künstliches und gefährlich manipulierbares Konzept ist.
Dennoch ist eine Klarstellung meines Gebrauchs dieser Begrifflichkeiten angebracht. Im Westen beziehen sich Begriffe wie »Marktwirtschaft« oder »Marktsystem« auf ein breites Spektrum an Wirtschaftssystemen, die in erster Linie auf Privateigentum und Wettbewerb beruhen, mit einer Regulierung durch Regierungen und einer Neuverteilung, deren Bandbreite von maßgeblich (wie in den Vereinigten Staaten) bis zu umfassend (wie in den skandinavischen Ländern) reicht. Paradoxerweise haben die Vereinigten Staaten jedoch in den letzten Jahren überall in der nichtwestlichen Welt den ursprünglichen Kapitalismus in der Laisser-faire-Form gefördert – eine Marktform, die der Westen schon vor langer Zeit aufgegeben hat. In diesem Buch beziehen sich – wenn nicht anders vermerkt − Begriffe wie »Marktorientierung«, »Märkte« und »Marktreformen« auf diejenigen prokapitalistischen Maßnahmen, die außerhalb des Westens heute aktuell eingeführt werden. Diese Maßnahmen umfassen charakteristischerweise Privatisierung, Aufhebung von Staatssubventionen und -kontrolle sowie freien Handel und Initiativen zur Förderung von ausländischen Investitionen. Als konkrete Umsetzung beinhalten sie selten, falls überhaupt, grundlegende Umverteilungsmaßnahmen.
In vergleichbarer Art werde ich den Begriff »Demokratisierung« gebrauchen, wenn ich mich auf die politischen Reformen beziehe, die in der nichtwestlichen Welt heute gefördert und umgesetzt werden, auch wenn »Demokratie« viele Formen annehmen kann.22 So wird sich »Demokratisierung« hauptsächlich auf die − vor allem von den USA gesteuerten − konzertierten Anstrengungen beziehen, sofortige Wahlen mit allgemeinem Wahlrecht durchzuführen. Selbstverständlich würde eine ideale demokratische Gesellschaft sicher mehr bedeutende Grundsätze wie gesetzliche Gleichbehandlung oder Minderheitenschutz einschließen, aber solche Grundsätze in die Definition der Demokratie einzubauen würde Anspruch mit Wirklichkeit verwechseln. Tatsächlich hat keine westliche Nation in ihrer Geschichte jemals Laisser-faire-Kapitalismus und allgemeines Wahlrecht über Nacht gleichzeitig eingeführt – genau die Formel der freien Marktdemokratie, die zurzeit den Entwicklungsländern rund um die Welt aufgezwungen wird.
Ethnizität ist ein weiteres umstrittenes Konzept, das eine breite Debatte ausgelöst hat. In diesem Buch gehe ich davon aus, dass »Ethnizität« kein wissenschaftlich bestimmbarer Zustand ist. Stattdessen bezieht sich »Ethnizität« auf eine Art Gruppenidentifikation, ein Zugehörigkeitsgefühl von Menschen, das »als erweiterte Form der Blutsverwandtschaft erfahren wird«.23 Diese Definition von Ethnizität ist bewusst breit angelegt, um der Bedeutung der subjektiven Wahrnehmung Rechnung zu tragen. Sie umfasst Unterschiede zwischen Rassengrenzen (zum Beispiel Schwarze und Weiße in den Vereinigten Staaten), Grenzen geografischen Ursprungs (zum Beispiel Malaysier, Chinesen und Inder in Malaysia) sowie sprachliche, religiöse, Stammes- oder andere kulturelle Grenzen (zum Beispiel Kikuyu- und Kalenjin-Stämme in Kenia oder Juden und Muslime im Nahen Osten).
Ethnische Identität ist nicht statisch, sondern veränderlich und stark formbar. In Ruanda zum Beispiel beherrschte die Tutsi-Minderheit von 14 Prozent als eine Art Vieh besitzende Aristokratie die Hutu-Mehrheit wirtschaftlich und politisch über vier Jahrhunderte. Aber während der meisten Zeit waren die Grenzen zwischen Hutu und Tutsi durchlässig. Die beiden Gruppen sprachen dieselbe Sprache, Mischehen wurden geschlossen, und erfolgreiche Hutu konnten Tutsi »werden«. Das galt nicht mehr, nachdem die Belgier mit trügerischen Theorien von Rassenüberlegenheit ins Land kamen und ethnische Personalausweise auf der Grundlage von Nasenlänge und Schädelumfang ausgaben. Die daraus resultierenden viel schärferen ethnischen Abgrenzungen wurden später von Hutu-Anführern ausgenutzt.24 Auf einer ähnlichen Basis wird heute überall in Lateinamerika − wo die Existenz »ethnischer Gruppen« häufig bestritten wird, weil jeder ein »Mischling« sei − einer Vielzahl verarmter Bolivianer, Chilenen und Peruaner plötzlich gesagt, dass sie Aymaras, Inkas oder einfach Indios seien, je nachdem, welche Identität am besten klingt und am meisten mobil macht. Diese Indigenisierungsbewegungen sind nicht zwangsläufig gut oder schlecht, aber sie sind hochansteckend.
Gleichzeit wird eine ethnische Identität selten aus der Luft gegriffen. Subjektive Wahrnehmungen der Identität hängen häufig von »objektiveren« Charakterzügen ab, die Menschen zugeschrieben werden und beispielsweise auf vermeintlichen morphologischen Eigenschaften, Sprachunterschieden oder Herkunft beruhen. Versuchen Sie, schwarzen und weißen Simbabwern zu erzählen, dass sie sich ihre ethnischen Unterschiede nur einbilden, dass Ethnizität eine soziale Konstruktion sei − und sie werden sich mindestens über eine Sache einig sein: dass Sie nicht gerade hilfreich sind. Viel relevanter ist die Tatsache, dass es in Simbabwe praktisch keine Mischehen zwischen Schwarzen und Weißen gibt, genauso wie es eigentlich keine Mischehen zwischen Chinesen und Malaysiern in Malaysia oder zwischen Arabern und Israelis im Nahen Osten gibt. Die Ethnizität kann ein Produkt menschlicher Einbildungskraft und zugleich tief in der Geschichte verwurzelt sein – veränderlich und manipulierbar und dennoch wichtig genug, um dafür zu töten –, und das macht es so furchtbar schwer, ethnische Konflikte zu verstehen und einzudämmen.
Es gibt eine Reihe von Missverständnissen hinsichtlich meiner These, denen ich oft begegne. Ich werde mein Bestes tun, einige von ihnen in diesem Buch zu beheben, indem ich erkläre, was ich nicht vertrete. Erstens propagiert dieses Buch keine universale Theorie, die auf jedes Entwicklungsland anwendbar ist. Es gibt sicher Entwicklungsländer ohne eine marktdominierende Minderheit: China und Argentinien sind die besten Beispiele. Zweitens behaupte ich nicht, dass ein ethnischer Konflikt nur bei Vorhandensein einer marktdominierenden Minderheit entsteht. Es gibt unzählige Einzelfälle von ethnischem Hass auf wirtschaftlich unterdrückte Gruppen. Und schließlich versuche ich nicht, die Schuld für jeden einzelnen Fall ethnischer Gewalt − seien es die Massentötungen, die von allen Seiten im früheren Jugoslawien betrieben wurden, oder die Anschläge auf Amerika − auf Wirtschaftsressentiments, Märkte, Demokratie, Globalisierung oder irgendeine andere einzelne Ursache zurückzuführen. Zahlreiche einander überlagernde Faktoren und komplexe Dynamiken wie Religion, historisch begründete Feindseligkeit, Landstreitigkeiten oder die Außenpolitik einer bestimmten Nation sind immer mit von der Partie.
Der Punkt ist vielmehr folgender. In zahlreichen Ländern rund um die Welt, in denen Armut und eine marktdominierende Minderheit vorherrschen, können Demokratie und Märkte − zumindest in der Form, in der sie zurzeit gefördert werden – nur in einem Spannungsverhältnis existieren. Unter solchen Umständen hat das gemeinsame Vorantreiben von freien Märkten und Demokratisierung wiederholt ethnische Konflikte herbeigeführt − mit katastrophalen Folgen, einschließlich Völkermord und dem Umsturz von Märkten und Demokratie selbst. Das ist die ernüchternde Lehre der Globalisierung aus den letzten Jahrzehnten.
Teil eins dieses Buches erörtert den wirtschaftlichen Einfluss der Globalisierung. Im Gegensatz zu dem, was ihre Befürworter annehmen, verteilen freie Märkte außerhalb des Westens Reichtum nicht gleichmäßig und sind kein Segen für sämtliche Entwicklungsländer. Stattdessen neigen sie dazu, extremen Reichtum in den Händen einer »Außenseiterminderheit« zu konzentrieren, und erzeugen ethnischen Neid und Hass bei der frustrierten, verarmten Mehrheit.
Was geschieht, wenn Demokratie zu dieser volatilen Mischung hinzugefügt wird? Teil zwei behandelt die politischen Folgen der Globalisierung. In Ländern mit einer marktdominierenden Minderheit verstärkt Demokratisierung nicht etwa die Leistungsfähigkeit des Marktes und die wohlstandsfördernden Effekte, sondern führt zu starkem Ethnonationalismus und Druck auf die Märkte. Sie läuft regelmäßig auf Beschlagnahmungen, Instabilität, Rückfall in den Totalitarismus und Gewalt hinaus.
Teil drei untersucht die Phänomene der marktdominierenden Minderheiten und des Ethnonationalismus im Westen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Auch die Zukunft wird angesprochen: Wie sollte mit der explosiven Instabilität umgegangen werden, die marktdominierende Minderheiten zur demokratischen, freien Marktwirtschaft beitragen? Ich empfehle, dass die Vereinigten Staaten Märkte nicht in einer ungezügelten, wirtschaftsliberalen Form exportieren sollten, die der Westen selbst abgelehnt hat, genauso wenig, wie über Nacht unkontrollierte Mehrheitsregierungen eingeführt werden sollten – eine Art der Demokratie, die der Westen selber zurückgewiesen hat. Schlussendlich jedoch behaupte ich, dass die größte Hoffnung für demokratischen Kapitalismus in der nichtwestlichen Welt auf den marktdominierenden Minderheiten selbst ruht.
Teil eins Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Globalisierung
Seit der Entstehung von Microsoft hat die Softwareindustrie die bislang größte Anzahl an Milliardären und Multimilliardären in der amerikanischen Geschichte hervorgebracht. Stellen Sie sich einmal vor, alle diese Milliardäre wären ethnische Chinesen, und chinesische Amerikaner würden, obwohl sie nur 2 Prozent der Bevölkerung ausmachen, auch Time Warner, General Electric, Chase Manhattan, United Airlines, Exxon Mobil und alle anderen größten Unternehmen und Banken Amerikas sowie das Rockefeller-Zentrum und zwei Drittel der wichtigsten Immobilien des Landes kontrollieren. Stellen Sie sich nun vor, dass die ungefähr 75 Prozent der US-Bevölkerung, die sich als »weiß« betrachten, arm wären, kein Land besäßen und − als Gruppe − keine Aufstiegsmöglichkeiten erfahren hätten, so weit sie sich zurückerinnern können.
Wenn Sie sich das vorstellen können, sind Sie dem Kern der sozialen Dynamik in der nichtwestlichen Welt nähergekommen. Überall im Süden und Südosten Asiens, in Afrika, der Karibik und auf den Westindischen Inseln, im größten Teil Lateinamerikas sowie in Teilen Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion haben freie Märkte zur schnellen Anhäufung eines gewaltigen, häufig erschreckenden Reichtums durch »Außenseiter« oder Angehörige einer »nicht eingeborenen« ethnischen Minderheit geführt.
Amerikaner hassen Bill Gates nicht, obwohl er so viel besitzt wie 40 Prozent der amerikanischen Bevölkerung insgesamt.1 Sie fühlen sich nicht von ihm betrogen oder ausgenutzt oder denken, dass er Amerikaner erniedrigt habe, indem er Milliarden »auf ihrem Grund und Boden« verdient hat. Anders in Gesellschaften mit einer marktdominierenden Minderheit. In diesen Gesellschaften überlappen sich Klassen und Ethnizität auf gefährliche Weise. Die äußerst Wohlhabenden heben sich ab – sei es aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion, Sprache oder »Blutsbande« − von den verarmten Massen um sie herum. Sie werden von dieser Mehrheit als Mitglieder einer anderen Ethnizität angesehen − als »Außenseiter«, die anders aussehen, anders sprechen oder, wie der nationalistische Anführer George Speight auf den Fidschiinseln kürzlich über die marktdominierende indische Minderheit seines Landes sagte, »anders riechen«.2
Als das amerikanische Justizministerium Microsoft verklagte, weil es bei dem Versuch, seine Mitbewerber auszuschalten, monopolistische Methoden anwende, wollten Amerikaner nicht etwa Bill Gates lynchen oder ihn seines Vermögens berauben. Im Gegenteil, laut Meinungsumfragen wollten die meisten Amerikaner, dass die Regierung Gates in Ruhe ließ, damit er sich wieder auf »das Geldverdienen konzentrieren« könne.3 In den zahlreichen nichtwestlichen Ländern mit einer marktdominierenden Minderheit sind die Plutokraten jedoch ethnische Außenseiter. Und während Bill Gates in den Vereinigten Staaten kein ethnisches Massenressentiment hervorruft, tun dies die indischen Industriemagnaten in Uganda, die eritreischen Unternehmer in Äthiopien und die jüdischen Oligarchen in Russland sehr wohl.
Die meisten Amerikaner − ob normale Bürger, Kommentatoren der Globalisierung oder politische Entscheidungsträger – sind sich dieses Problems nicht bewusst. Infolgedessen exportieren sie den Kapitalismus des freien Markts munter in den Rest der Welt und blenden den ethnischen Hass sowie die Instabilität, die sie systematisch fördern, dabei aus.
Die heutige Weltwirtschaft hat sich nicht über Nacht entwickelt, sondern stellt zu einem großen Teil den Erfolg von sechs Jahrzehnten amerikanischer Außenpolitik dar. Nach dem Zweiten Weltkrieg trieb Amerika − um den Kapitalismus bewusst zu fördern und den Kommunismus einzuschränken − die Entwicklung der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds, der Organisation für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit sowie der Freihandelsorganisation GATT voran. In den 1960er-Jahren pumpten die U.S. Agency for International Development und private Organisationen wie die Ford-Stiftung Millionen in »Modernisierungsprojekte«, die darauf abzielten, durch den Export kapitalistischer Einrichtungen einen wirtschaftlichen und gesetzlichen Fortschritt in die Entwicklungsländer zu bringen. Mit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion 1989 wurde der Kapitalismus weltweit als überlegen und unaufhaltsam angesehen. In den Entwicklungsländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas setzten der IWF und die Weltbank Privatisierungsprogramme und Auslandsinvestitionen sowie eine Handelsliberalisierung durch, indem sie dringend erforderliche Darlehen von diesen Marktreformen abhängig machten.
Gegen Ende der 1990er-Jahre hatten mehr als 80 Entwicklungs- und postsozialistische Länder Privatisierungen vorgenommen. Marktfreundliche Steuergesetze, Investitionsreglements und Wertpapiervorschriften, häufig von amerikanischen Rechtsanwälten und Akademikern entworfen, wucherten von Peru über Bulgarien bis nach Vietnam. Bis 1996 hatte allein Kasachstan mehr als 130 marktfreundliche Gesetze verabschiedet. In Argentinien führte Präsident Carlos Menem eine Welle von Kapitalismusförderungsgesetzen durch »Notverordnungen« ein. Börsen – manche manuell betrieben – entstanden überall, sogar in Mosambik und in Swasiland.4
Im neuen Jahrtausend setzen sich die Globalisierung und die weltweite Ausbreitung von freien Märkten beschleunigt fort, mit Amerika am Ruder. Gleichzeitig können wir zurückblicken und einschätzen, wie sich der wirtschaftliche Einfluss der Globalisierung ausgewirkt hat, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt. Wie die folgenden vier Kapitel zeigen werden, besteht die bestürzende Wirklichkeit darin, dass globale Märkte − selbst wenn sie in einem geringen Maß allen nutzen − die wirtschaftliche Überlegenheit von »Außenseiterminderheiten« gestärkt und explosiven Zündstoff für ethnischen Neid und Hass bei der verarmten Mehrheit geliefert haben.
Kapitel 1: Rubine und Reisfelder –Die Vorherrschaft der chinesischen Minderheit in Südostasien
In Birma* werden Tätowierungen traditionell gestochen, um vor Schlangenbissen zu schützen. 1930 und dann wieder 1938 ließen sich aufgebrachte Birmanen diese Tätowierungen als Schutz gegen Kugeln stechen und schlachteten in einer Orgie der Gewalt zahllose Inder ab. Angeblich beteiligten sich sogar Mönche daran. Zu der Zeit waren Inder, zusammen mit britischen Kolonisten, eine wirtschaftlich dominierende ethnische Minderheit in Birma und Ziel des kollektiven Hasses. Das Töten von Indern war gleichzeitig eine Racheaktion und Ausdruck des nationalistischen Stolzes lang unterdrückter Menschen. Wie ein zeitgenössischer Beobachter sagte: »Der Birmane auf der Straße hatte das Gefühl, dass er wenigstens ein Mal seine Überlegenheit gegenüber den Indern bewiesen hatte.«1
Heute ist nur noch eine kleine Gemeinschaft von Indern in Birma geblieben. Als Reaktion auf eine weitere Welle der ethnischen Gewalt flohen in den 1960er-Jahren Hunderttausende. Aber eine neue marktdominierende Minderheit hat ihren Platz eingenommen, die noch viel reicher ist, als die Inder es jemals waren.
Märkte, Junta-Stil und die chinesische Übernahme
Birma hat eines der brutalsten Militärregimes der Welt − den State Law and Order Restoration Council oder SLORC.** Er kam im September 1988 an die Macht, nachdem er Tausende unbewaffneter Demonstranten hatte niederschießen lassen. 1990 führte der SLORC Mehrparteienwahlen durch, weigerte sich dann jedoch, den erdrutschartigen Wahlsieg von Aung San Suu Kyi, der Friedensnobelpreisträgerin von 1991, anzuerkennen, sondern stellte sie stattdessen unter Hausarrest und erntete damit den Hass der Birmanen.2
Der SLORC war von Anfang an auf aggressive Weise promarktwirtschaftlich orientiert. In der Umkehrung von drei Jahrzehnten katastrophaler sozialistischer Zentralplanung schlug der SLORC 1989 »den burmesischen Weg zum Kapitalismus« ein. Abgesehen von der Bereicherung korrupter SLORC-Generäle, allesamt Birmanen, brachte das darauf folgende Jahrzehnt der Marktorientierung für die einheimische Bevölkerung, deren große Mehrheit sich weiter in der traditionellen Landwirtschaft betätigte, eigentlich keine Vorteile. Eine Gruppe allerdings profitierte exorbitant.
Seit Birmas Umschwung zu einer marktorientierten, frei zugänglichen Wirtschaft wurden sowohl Rangun, die moderne Hauptstadt, als auch Mandalay, die alte Edelstein-Stadt und Sitz der letzten beiden birmanischen Könige, von ethnischen Chinesen übernommen. Einige dieser Chinesen stammen aus Familien, die seit Generationen in Birma gelebt haben. Wie die Inder, aber in einem geringeren Ausmaß, waren die Chinesen während der Kolonialperiode (1886−1948) unverhältnismäßig wohlhabend, was im Wesentlichen auf eine wirtschaftsliberale Politik zurückzuführen war, die Birmas traditionell landwirtschaftlich geprägte Wirtschaft verdrängte. Obwohl viel von ihrem Reichtum während der sozialistischen Zeitspanne (1962−1988) beschlagnahmt wurde, blieben die Chinesen auf Birmas Schwarzmärkten und teilweise auch im Opiumschmuggel aktiv.
In Birmas neuer Marktwirtschaft verwandelte sich die chinesisch-birmanische Minderheit fast über Nacht in eine wohlhabende Wirtschaftsgemeinschaft. Zusätzlich kauften mehrere Zehntausend armer, aber unternehmerisch geschickter Einwanderer aus China, die aus dem nahe gelegenen Yunnan ins Land strömten, für weniger als 300 Dollar die Ausweispapiere toter Birmanen auf und wurden damit im Handumdrehen zu birmanischen Staatsangehörigen. Heute gehören den chinesischen Birmanen – die sich in Longyis, den traditionellen birmanischen Unisex-Sarongs, unwohl zu fühlen scheinen − fast alle Geschäfte, Hotels und Restaurants in Mandalay sowie die wichtigsten Geschäfts- und Wohnimmobilien. Für Rangun gilt mehr oder weniger dasselbe. Nur einige wenige Unternehmen sind noch in birmanischer Hand (hauptsächlich Druckereien und Zigarrenfabriken) und werden ringsum von Hochhäusern überragt, die von Chinesen gebaut wurden und Chinesen gehören.
Wie es für Südostasien typisch ist, beherrschen die Chinesen den birmanischen Handel auf jeder Ebene der Gesellschaft. Joint-Ventures wie das Shangri-La-Hotel-Geschäft zwischen Lo Hsing-Han, dem chinesisch-birmanischen Präsidenten des Asia-World-Konzerns, und dem chinesisch-malaysischen Industriemagnaten Robert Kuok verwandelten Mandalay und Rangun in blühende Stützpunkte für Festlandchinesen und chinesische Geschäftsnetze in Südostasien. (Nichtbirmanische chinesische Investoren sind leicht auszumachen. Sie tragen keine Longyis, sondern Cowboystiefel, Sonnenbrille und eine Flasche Johnnie Walker Red.) Am bescheideneren Ende des Spektrums leben chinesische Straßenhändler nicht schlecht davon, dass sie preiswerte Fahrradreifen aus China − häufig mehr als 30.000 pro Monat − für Rikschas in Birma verkaufen. Die chinesische Überlegenheit ist auch kein städtisches Phänomen. Nach zwei Jahren schwerer Überschwemmungen im südlichen China strömte eine große Anzahl chinesischer Bauern – manche schätzen sie auf mehr als 1 Million − ins nördliche Birma. Diese neuen birmanischen »Bürger« bauen jetzt Reis auf dem gerodeten Hügelland an, das sie übernommen haben. Ganze chinesische Dörfer sind auf diese Weise entstanden.3
Durch den Boykott der USA aus Menschenrechtsgründen hat die Globalisierung für Birma ein unverhältnismäßig chinesisches Gesicht bekommen, obwohl die Anwesenheit französischer und deutscher Investoren ebenso spürbar ist. »Nennen Sie ein großes Infrastrukturprojekt irgendwo in Myanmar, und die Wahrscheinlichkeit, dass es in den Händen chinesischer Auftragnehmer liegt, ist sehr hoch«, beobachtete The Economist vor ein paar Jahren.
Chinesische Ingenieure arbeiten an dem Ausbau der Autobahn von Mandalay bis Yangon. Chinesische Unternehmen planen die Eisenbahnstrecke von Mandalay bis Myitkyina nahe der chinesischen Grenze und die Strecke von Mandalay bis zur Hauptstadt. Mit der Hilfe von Sträflingstrupps in Ketten aus Myanmars Gefängnissen bauen sie auch eine Linie von Ye bis Tavoy in Myanmars entferntem Südosten … Gegen internationale Konkurrenz konnten sich chinesische Auftragnehmer durchsetzen und bekamen den Auftrag, eine große Brücke über den Chindwin-Fluss zu bauen.
Andere chinesische Unternehmungen reichen von einem neuen internationalen Flughafen für Mandalay über Unterkünfte für die Streitkräfte bis hin zu 30 Staudämmen. Es waren die Chinesen, die in Zusammenarbeit mit Siemens eine Bodensatellitenstation für die Hauptstadt errichteten.4
Die Chinesen in Birma beherrschen nicht nur den legalen Handel, sondern auch dubiose Schwarzmarktaktivitäten. Tatsächlich ist die Grenze zwischen der legalen und illegalen Handelstätigkeit in Birma wie in vielen Entwicklungsländern fließend. Einige der einflussreichsten Unternehmer des Landes sind ehemalige − vielleicht auch immer noch aktive – Drahtzieher des Drogenhandels. »Drogendealer, die einst mit Mauleseltrecks über Dschungelpfade zogen, sind jetzt führende Gestalten in Birmas neuer Marktwirtschaft«, klagte die ehemalige amerikanische Außenministerin Madeline Albright.5
Der in Birma geborene chinesische Industriemagnat Lo Hsing-han war zum Beispiel in den 1960er-Jahren ein berüchtigter Opiumkönig und vermutlich für einen Großteil des Heroins verantwortlich, das in amerikanischen Venen landete. Laut dem Birma-Experten Bertil Lintner begann Lo in seiner Geburtsprovinz Kokang als Leutnant der pistolenschwingenden lesbischen Opiumkönigin Olive Yang. 1989 schloss Lo ein Geschäft mit dem SLORC ab und überzeugte die anderen chinesischen Drogenbosse, eine Waffenruhe mit der Junta als Entgelt für wertvolle Bauholz- und Mineralkonzessionen zu akzeptieren. Heute umfasst Los kommerzielles Reich »Asia World« ein Containerschifffahrtsgeschäft, die Hafengebäude in Rangun und Mautstellen auf der wiedereröffneten Burma Road. Lo besteht darauf, dass er jetzt ein legitimer Unternehmer ist. »Seit in Myanmar die Marktwirtschaft eingeführt wurde«, erklärt er, »ist es leichter, Geld mit dem Handel von Fahrzeugen über die chinesische Grenze zu verdienen.«6 Ungeachtet dessen, ob Lo eine weiße Weste hat oder nicht − und die meisten westlichen Offiziellen glauben nicht daran –, bleibt Birmas »chinesische Unterwelt« weiterhin dominierend im Rauschgifthandel und der Geldwäsche, solange chinesische Händler auf den blühenden gesetzlichen Märkten von Mandalay agieren.
Chinesische Plutokraten, birmanisches Elend
Seit der SLORC die Märkte öffnete, betreibt Birma Raubbau an seinen Rohstoffen, besonders Teakholz, Jade und Rubine. Abgesehen von SLORC-Generälen sind die Begünstigten fast ausschließlich Chinesen und eine Handvoll Schmuggler des Bergvolks.
Birmas Wälder umfassen mehr als 70 Prozent des Teakholzbestandes der Welt. Der birmanische Teakbaum mit seinen großen eiförmigen Blättern und den weißen Blüten kann über 40 Meter hoch werden. Sein Holz ist dunkel, schwer und harzhaltig sowie extrem hart und haltbar. Teakholz war lange das Holz der birmanischen Königsdynastie und wurde durch Rudyard Kipling unsterblich gemacht (»Elephints a-pilin’ teak/ in the sludgy, squdgy creek, / Where the silence ’ung that ’eavy you was ’arf afraid to speak! / On the road to Mandalay …«), heute ist es Amerikas bevorzugtes Holz für Bootsdecks und Salatschüsseln.
Seit mehr als einem Jahrzehnt verkaufen Birmas Bergvölker, besonders die Shan, enorme Mengen an Teakholz zu Schleuderpreisen an chinesische Händler. Offiziell sind diese Verkäufe Schmuggelware und verletzen das Monopol des SLORC auf Holzexporte. In Wirklichkeit haben SLORC-Generäle einen Handel mit aufständischen Bergvölkern geschlossen und ihnen wirtschaftliche Freiheit im Gegenzug für Waffenruhe gewährt. Infolgedessen schlängeln sich seit 1989 täglich Lastwagenkonvois mit Teakholzstämmen − manchmal mehr als drei Meter dick und von Bäumen, die Hunderte von Jahren alt waren − entlang der gebirgigen alten Burma Road über die Grenze in Chinas Provinz Yunnan.
Währenddessen gestaltete sich die offizielle Holzpolitik des SLORC als aggressive, global orientierte Marktöffnung mit Regierungskonzessionen. Darauf beharrend, dass das Fällen von Teakbäumen Birmas Wirtschaftsentwicklung unterstütze, forderte der SLORC die Privatwirtschaft zum vollen Einsatz bei der Förderung der »Forstwirtschaft« auf (was hier Abholzung bedeutet) und befreite Forstwirtschaftsexporte sogar von Steuern. Neben europäischen und chinesischen Investoren sind die meisten Geschäftspartner des SLORC chinesisch-birmanische Industriemagnaten, die enge Verbindungen zu thailändisch-chinesischen Holzfirmen haben. Ein prominentes Beispiel ist der führende Industrielle »May Flower« Kyaw Win, der als Sohn einer armen chinesischen Familie im Norden des Shan-Staats auf die Welt kam. Seit seinem Einstieg ins Bauholzgeschäft im Jahr 1990 ist Kyaw Win − der auch als Managing Director der Yangon Airlines fungiert und häufig mit hochrangigen Generälen gesehen wird − einer der wohlhabendsten Männer in Birma.7
Im Gegensatz dazu haben Birmanen kaum von der marktgetriebenen Abholzung des Landes profitiert. Shan verdienen weiterhin Geld mit dem Schmuggel von Teakholz nach Yunnan, aber um das Ganze noch schlimmer zu machen, geben die Shan, ebenso wie die bestochenen birmanischen Grenzbeamten, fast ihre gesamten Einnahmen für begehrte Konsumgüter aus, die aus China importiert und von birmanischen Chinesen verkauft werden. Infolgedessen haben die Chinesen am Ende sowohl das Teakholz als auch das Geld, während die Shan und die Birmanen mit billigen Gettoblastern, Michael-Jackson-T-Shirts, Sportschuhen, Präservativen und Bier aus chinesischer Produktion abgespeist werden.8
Neben dem Teakholz ist Birma berühmt für seine Edelsteine: Taubenblutrubine, leuchtend blaue Saphire und Imperial-Jade. Vor 1989, unter der sozialistischen Herrschaft im birmanischen Stil, war es nur dem Staat erlaubt, den Abbau und Verkauf von Edelsteinen zu betreiben. Als 1980 ein Privatmann in einer Mine einen Rohrubin von unglaublichen 469,5 Karat entdeckte und auf dem Schwarzmarkt verkaufte, wurde er verhaftet und eingesperrt. Der SLORC eignete sich den Rubin 1990 wieder an und proklamierte ihn stolz als Staatseigentum. Als Na Wa Ta oder »SLORC-Rubin« wurde sein Bild im ganzen Land in der staatlichen Working People’s Daily gezeigt (nahezu zeitgleich gab die Regierung auch die Entdeckung von zwei Rohsaphiren bekannt, von denen der eine 979 Karat wog, der andere ungefähr 1.300 Karat). Während der sozialistischen Periode, als die gesamte Industrie verstaatlicht war, verkaufte die birmanische Regierung Edelsteine an ausländische Unternehmen, indem sie jährliche »Edelsteinmessen« abhielt. Private Edelsteinverkäufe wurden von Hunderten Händlern im Untergrund durchgeführt, größtenteils auf den Schwarzmärkten an der 34. und 35. Straße von Mandalay.9
Bei einer 180-Grad-Kehrtwende in Richtung Marktwirtschaft privatisierte die birmanische Regierung Anfang der 1990er-Jahre große Teile der Edelsteinindustrie. Seit 1995 wurden private Bergwerkskonzessionen über Ausschreibungen vergeben und kosteten bis zu 83.000 Dollar pro Morgen Land für unerschlossene Edelsteingruben. Wieder einmal waren praktisch alle Konzessionäre chinesisch-birmanische Unternehmer. Von einem Edelsteinunternehmen in chinesischem Besitz wurde berichtet, dass es 100 Edelsteinminen kontrollierte und über 2.000 Kilogramm Rohrubine pro Jahr förderte. Das sichtbare Vermögen von Lo Hsing-Han, das auf ungefähr 600 Millionen Dollar geschätzt wird, schließt wertvolle Rubinkonzessionen sowie »einen Bergwerksanteil in der nördlichen gelegenen ›Jaderausch-Stadt‹ Phakent ein − von der erzählt wird, dass sie einen 300-Tonnen-Jadeblock birgt, der so tief im Dschungel begraben ist, dass er nicht bewegt werden kann«. Die Asia World von Lo ist jetzt der beliebteste Partner für Ausländer, die in Birma investieren. Zusammen mit dem privaten Bergbau legalisierte der SLORC auch private Edelsteinverkäufe. Heute wird Birmas Edelsteinindustrie auf jeder Stufe von erfolgreichen birmanischen Chinesen beherrscht, von den Finanzgebern über die Konzessionsbetreiber bis zu den Eigentümern Hunderter neuer Schmuckgeschäfte, die überall in Mandalay und Rangun gedeihen.10 Selbstverständlich werden SLORC-Beamte auf jeder Ebene angemessen beteiligt.
Dass sich im Hinblick auf das finanzielle und menschliche Kapital die große Mehrheit der einheimischen Birmanen von ungefähr 69 Prozent der Bevölkerung mit der chinesischen 5-Prozent-Minderheit des Landes nicht messen kann, ist eine Untertreibung. Drei Viertel der Birmanen leben in ländlichen Gebieten am Existenzminimum und sind meist in der Reisproduktion oder Landwirtschaft tätig. Trotz der Bodenreformen während des sozialistischen Zeitalters haben vermutlich 40 Prozent der birmanischen Bauern keinen Grundbesitz. Für auf dem Land lebende Birmanen ist es praktisch unmöglich, Geld zu sparen. Sie geben ihren gesamten Verdienst sofort aus, um am Leben zu bleiben. Infolgedessen haben die meisten Birmanen wenig oder kein Kapital und profitieren nicht von der Wirtschaftsliberalisierung.11
Der Mangel an Finanzkapital ist nicht das einzige Problem. Seit der Abkehr vom Sozialismus im Jahr 1988 hat der SLORC die Ausgaben für Gesundheit und Ausbildung zusammengestrichen. Laut den Vereinten Nationen besuchen fast 40 Prozent der birmanischen Kinder keine Schule, und bis zu 75 Prozent gehen vor der fünften Klasse ab. Außerdem wurden Birmas Universitäten wegen der Angst der herrschenden Junta vor studentengeführten Aufständen von Dezember 1996 bis Juli 2000 geschlossen. Alle diese Faktoren, zusammen mit möglichen kulturellen Hindernissen wie einem eventuellen Vorurteil gegenüber »gierigem« Gewinnstreben, machen es für Birmanen äußerst schwierig, sich in einer Marktwirtschaft zu behaupten.12
In städtischen Gebieten haben Birmanen unter der Marktöffnung gelitten. Die meisten gebürtigen Einwohner von Mandalay waren von jeher Handwerker, die ihren Lebensunterhalt mit dem Weben von Teppichen, dem Schnitzen von Blattgold, dem Fertigen von Möbeln oder dem Polieren von Edelsteinen verdienten. In den letzten Jahren haben die niedrigen Löhne in diesen traditionellen Industrien sowie die sprunghaft ansteigenden Preise von Konsumgütern den Lebensstandard Tausender Menschen unter das Existenzminimum getrieben. Seit 1989 ist der Preis von Reis in Mandalay ständig gestiegen – einmal um über 1.000 Prozent in sieben Jahren −, ohne dass ein Ende in Sicht wäre. Viele Birmanen, deren durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen nur ungefähr 300 Dollar pro Jahr beträgt, bewegen sich dadurch an der Grenze zum Verhungern.
Zudem wurden birmanische Einwohner von Mandalay aus ihrer Heimat vertrieben, als chinesische Projektentwickler in den 1990er-Jahren alle bedeutenden Immobilien in der Stadt ergatterten – und ein schnelles Vermögen machten, weil sich die Eigentumswerte in den chaotischen neuen Märkten verdoppelten und verdreifachten. (Im Jahre 1990 hatte der SLORC bereits Dissidenten und Mönche gewaltsam umgesiedelt.) Heute leben Tausende armer, vertriebener Birmanen in Satelliten-Elendsvierteln am Stadtrand von Mandalay, in Sichtweite der farbenprächtigen, eingezäunten Prunkvillen der SLORC-Generäle, von denen sich viele ganz offen von chinesischen Unternehmern aushalten lassen.13
Freie Märkte sollen den Wohlstand insgesamt erhöhen und tun das tatsächlich häufig. Aber Birmas eingeborene Mehrheit, die ungefähr 30 Millionen Menschen umfasst, kann das nicht bestätigen. In ihrer Wahrnehmung haben Märkte und Wirtschaftsliberalisierung zur Dominierung und Plünderung ihres Landes durch eine Handvoll »Außenseiter« geführt, hauptsächlich Chinesen in symbiotischer Verbindung mit dem SLORC. Der Hauptgeschäftsbezirk von Mandalay wird jetzt von chinesischen Zeichen und chinesischer Musik geprägt, die aus chinesischen Geschäften tönt. Produkte birmanischer Herkunft wurden fast vollständig durch preiswertere chinesische Importe ersetzt. Chinesische Restaurants, die gegrilltes Fleisch und Fisch anbieten, sind voller Menschen, die Mandarin sprechen. »Wenn du nach Mandalay willst«, mokiert sich eine Figur in einem lokalen Cartoon, »musst du Chinesisch können.« Bei Sonnenuntergang strömt das neue Geld von Mandalay in chinesisch geführte Karaoke-Bars, in denen junge chinesische Animierdamen die neuesten Lieder von in Hongkong produzierten CDs mitsingen. An den Wochenenden entspannen sich wohlhabende Chinesen im Gebirgsort Maymyo, dessen von britischen Kolonisten zurückgelassene viktorianische Villen sie als Ferienhäuser erworben haben.14
Inzwischen brodeln bei der birmanischen Mehrheit unter der Oberfläche antichinesische Ressentiments. So wie der Hass auf den SLORC zunimmt, wächst auch der Hass auf die Chinesen, und das nicht ohne Grund: Die engen kapitalistischen Beziehungen zwischen SLORC-Generälen und chinesischen Unternehmern, ganz zu schweigen von den Waffenkäufen in China, waren entscheidend für die Unterstützung der verachteten herrschenden Junta Birmas. Aber in der gegenwärtigen Schreckensherrschaft gibt es keine Möglichkeit, um Ressentiments abzureagieren, sei es gegen den SLORC, die reichen Chinesen oder die marktorientierte Politik, die diesen beiden Gruppen erlaubt hat, Millionen einzustreichen, während eingeborene Birmanen in ihrem eigenen Land zur zunehmend unterjochten Unterklasse werden. Alkoholismus nimmt unter Birmanen stark zu. Das ist noch erschreckender vor dem Hintergrund, dass der Genuss hochprozentiger Getränke als Verstoß gegen die Fünf Gebote des birmanischen Buddhismus betrachtet wird. Passenderweise ist das meistkonsumierte alkoholische Getränk chinesisches Tiger-Bier, das aus China importiert wird.15
Heute sprechen gewöhnliche Birmanen verbittert von »der chinesischen Invasion« oder »Wiederkolonisation durch die Chinesen«. »Die Menschen, die diese neuen Gebäude errichten, sagen, dass sie Birmanen seien, aber wir wissen, dass sie in Wahrheit aus China stammen«, erklärte ein birmanischer Ladenbesitzer verärgert. »Sie übernehmen unsere Geschäfte und vertreiben uns aus unseren Häusern.«16 Trotz massiver Repressionen seitens der Regierung − das Internet und alle Formen politischer Organisationen und freier Meinungsäußerung sind verboten – ist die Feindschaft der Einheimischen gegenüber den birmanischen Chinesen greifbar, und sie wächst.
Chinesische Marktbeherrschung im historischen Kontext
Kein anderes Land besitzt Birmas schreckliche Kombination einer Orwell’schen Regierung, eines Überflusses an Rubinen und riesengroßer Felder mit Opiummohn (welche die gegenwärtige Junta durch Limetten und Sojabohnen ersetzen lassen will). Dennoch ist die zugrunde liegende Dynamik in Birma − chinesische Marktüberlegenheit und starke Ressentiments bei der einheimischen Mehrheit – charakteristisch für nahezu jedes Land in Südostasien.
Chinesen spielten schon lange vor dem Kolonialzeitalter eine unverhältnismäßig große Rolle im kommerziellen Leben Südostasiens. Im frühen 15. Jahrhundert, als Admiral Cheng Ho im Auftrag der Ming-Dynastie eine Flotte von 300 Schiffen um Südostasien führte, entdeckte er auf Java, heute zur Republik Indonesien gehörend, eine blühende Enklave chinesischer Gefährten. Der Admiral bemerkte, dass die Chinesen über feines Essen und gute Kleidung verfügten, im Gegensatz zu »den Eingeborenen des Landes, die sehr schmutzig waren, eine Vorliebe für Schlangen, Insekten und Würmer hatten und zusammen mit den Hunden schliefen und aßen«.17
Um dieselbe Zeit war in einem anderen Teil des heutigen Indonesien das wesentlich fortschrittlichere Tabanan der Sitz eines der mächtigsten und kultiviertesten Königshöfe von Bali. Das Königreich Tabanan, so erzählt Clifford Geertz, strotzte vor »rebellischen Komplotten, strategischen Ehen, bewussten Beleidigungen und geschickten Schmeicheleien, die in ein feines Muster der machiavellistischen Staatskunst eingewebt waren«. Tabanan war auch das Zentrum der heute weltberühmten balinesischen Musik und Theaterkünste. Dennoch wurde selbst vor 600 Jahren der ganze Außenhandel im Königreich von einem einzelnen wohlhabenden Chinesen gesteuert, während die übrigen Mitglieder der winzigen chinesischen Gemeinschaft als seine Agenten handelten. Einheimischer Handel existierte praktisch nicht. Ein halbes Jahrtausend später hat sich in dieser Hinsicht wenig geändert. Auch 1950 waren alle Geschäfte und Fabriken in Tabanan in chinesischem Besitz.18
Als die Spanier 1571 auf der philippinischen Insel Luzon die Stadt Manila gründeten, stießen sie auf chinesische Ansiedlungen, die mehr als ein Jahrhundert vor ihnen errichtet worden waren, sowie auf streitlustige chinesische Händler, die in ihren Dschunken segelten und Kanonen abfeuerten. Die Feindseligkeit zwischen den Chinesen und den Spaniern ist ein Dauerthema in der philippinischen Kolonialgeschichte. Die Spanier legten den Chinesen massive Steuern und Beschränkungen auf und sonderten sie in dem eingezäunten Getto Parián ab. Gleichzeitig waren die Spanier sehr abhängig von den Chinesen, die als Händler, Schneider, Schlosser, Bäcker und so weiter jede wichtige Wirtschaftsnische zu besetzen schienen.
Am 23. Mai 1603 kamen drei chinesische Mandarine auf den Philippinen an, ihre sämtlichen offiziellen Abzeichen und einen Kasten voller Siegel tragend, als ob sie noch in China wären. Nachdem sie die Huldigungen der chinesischen Einwohner Manilas entgegengenommen hatten,