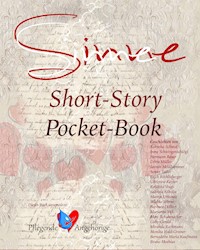Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Die gefährlichste Waffe, die der Mensch auf sich richten kann, ist der Mensch selbst." Lichtgeister überall in der Landschaft. Endlose Schlachtfelder. Ermüdete Armeen. Und ein Zauber, der die Welt in Brand setzt. Prinzessin Serta Kahragon wächst inmitten von Kriegen und unsicheren Allianzen auf. Immer neue Waffen werden entwickelt, um die entscheidende Wende im Kampfgeschehen zu bringen. Doch mit jeder Schlacht, die sie erlebt, spürt Serta die wachsende Gefahr durch die magischen Experimente. Und sie erkennt: Längst sind ihre Feinde nicht mehr das einzige Problem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Kornelia Schmid wurde 1993 in Regensburg geboren und hat dort Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Geschichten hat sie schon in der Grundschule geschrieben – und nicht damit aufgehört. Im Alter von zwölf Jahren entstand ihr erster Roman über ein magisches Schwert, der seitdem ein Schattendasein auf der Festplatte fristet. Seit 2016 veröffentlicht sie in Anthologien regelmäßig Kurzgeschichten unterschiedlicher Genres der Fantastik, wobei sie am liebsten in magische Welten eintaucht. Inzwischen hat sie sich das Schreiben zum Beruf gemacht und arbeitet als Redakteurin in München. Mit »Das Licht im Sand« ist der zweite Teil ihrer Romantrilogie »Herrscher des Lichts« erschienen.
Inhalt
Kapitel 1 8
Kapitel 2 11
Kapitel 3 17
Kapitel 4 20
Kapitel 5 26
Kapitel 6 32
Kapitel 7 35
Kapitel 8 39
Kapitel 9 43
Kapitel 10 48
Kapitel 11 53
Kapitel 12 57
Kapitel 13 61
Kapitel 14 65
Kapitel 15 70
Kapitel 16 73
Kapitel 17 77
Kapitel 18 78
Kapitel 19 83
Kapitel 20 84
Kapitel 21 86
Kapitel 22 87
Kapitel 23 90
Kapitel 24 97
Kapitel 25 101
Kapitel 26 106
Kapitel 27 110
Kapitel 28 111
Kapitel 29 115
Kapitel 30 119
Kapitel 31 123
Kapitel 32 128
Kapitel 33 132
Kapitel 34 138
Kapitel 35 149
Kapitel 36 153
Kapitel 37 156
Kapitel 38 162
Kapitel 39 165
Kapitel 40 166
Kapitel 41 171
Kapitel 42 172
Kapitel 43 175
Kapitel 44 178
Kapitel 45 181
Kapitel 46 182
Kapitel 47 185
Kapitel 48 188
Kapitel 49 191
Kapitel 50 192
Kapitel 51 193
Kapitel 52 198
Kapitel 53 199
Kapitel 54 203
Kapitel 55 208
Kapitel 56 211
Kapitel 57 212
Kapitel 58 216
Kapitel 59 221
Kapitel 60 222
Kapitel 61 226
Kapitel 62 228
Kapitel 63 233
Kapitel 64 236
Kapitel 65 239
Kapitel 66 243
Kapitel 67 247
Kapitel 68 251
Kapitel 69 256
Kapitel 70 260
Kapitel 71 265
Kapitel 72 269
Kapitel 73 274
Kapitel 74 277
Kapitel 75 280
Kapitel 76 283
Kapitel 77 288
Kapitel 78 292
Kapitel 79 295
Kapitel 80 298
Kapitel 81 302
Kapitel 82 306
Kapitel 83 310
Kapitel 84 315
Kapitel 85 321
Kapitel 86 325
Kapitel 87 328
Kapitel 88 332
Danksagung 336
WREADERS E-BOOK
Band 249
Dieser Titel ist auch als Taschenbuch erschienen
Vollständige E-Book-Ausgabe
Copyright © 2024 by Wreaders Verlag, Sassenberg
Verlagsleitung: Lena Weinert
Druck: BoD – Books on Demand, Norderstedt
Umschlaggestaltung: Saskia Ziegenbalg
Illustrationen: Julia C. Albrecht
Lektorat: Alina Lindecke, Magische Tintenwelt, Maria Klippert
Satz: Annina Anderhalden
www.wreaders.de
Das Jahr 684 kraburgischer Zeitrechnung
Kapitel 1
Sasberg, 11. Tag des Taumondes – Lorror Kahragon
Heute hörte er zum ersten Mal die körperlosen Stimmen. Sie trieben um ihn herum wie Stoffbahnen im Wind und wisperten ihm ins Ohr. Hin und wieder kitzelten sie seine Wangen oder zogen an seinem Bart. Tun sie das wirklich? Oder bilde ich es mir ein? Lorror strich sich durchs Haar. Seine Stirn juckte. Er kratzte sich wild und beobachtete das Spiel aus Licht und Schatten, das ihn umgab. Dieser Ort atmete Magie. Deswegen passte Lorror so gut zu ihm.
Er setzte sich auf den Felsboden. Glänzende Linien durchzogen ihn und nahmen den gelbgrünen Schein aus der Umgebung auf. Wenn die Farben wechselten, pulsierten sie noch einen Moment lang im Gedenken an die Vergangenheit, bevor sie sich anpassten. Über Lorrors Kopf war die ursprüngliche Steindecke entfernt worden. Stattdessen verzweigte sich dort ein gläsernes Gewölbe aus Spitzbögen, das sich mit den Felssäulen der Höhle verband, als wäre es in sie verwachsen. Auch in den glatten Kreuzrippen verfingen sich die Zauber. An vielen Stellen war deutlich zu erkennen, dass das Glas ein paarmal zu oft geschmolzen war. Und doch war es noch intakt. Die Kraft hier unten zerstörte es genauso, wie sie es erhielt.
Lorror ließ die Beine über den Abgrund direkt vor sich baumeln. Eine Felskante fiel senkrecht in die Tiefe und endete in einem gleißenden Strom aus Magie. Er wogte unruhig durch die Spalte und stieß dabei Töne aus, die klangen, als würde sich der Fluss selbst unter Schmerzen winden. Jetzt färbte sich sein Schein giftgrün. Feine Sprenkel tanzten um Lorror herum. Im Moment waren sie nicht größer als Glühwürmchen, doch er hatte oft genug beobachtet, wie sie sich aufbäumten und mit feurigen Klauen nach ihm griffen.
»Ihr kennt mich«, sagte Lorror. »Und ich kenne euch.«
Zugegeben war er sich nicht ganz sicher. Alles hier fühlte sich vertraut an und doch war etwas anders als früher. In seiner Kindheit war er oft hierhergekommen. Der Feuerfluss, ein Ort voll von berstender Spannung. Man wusste nie, wann sie explodierte. Sein Lieblingsplatz. Dass es hier irgendeine Form von geisterhaftem Leben gab, daran hatte er nie gezweifelt. Doch ist es dasselbe? Warum wirkt es nun so präsent?
Lorror legte den Glasstab quer auf seine Oberschenkel. Variante Nummer sieben, selbst gefertigt. Es war nicht das Zepter der Glasprinzessin, aber diesmal war er optimistisch, dass er einen guten Ersatz hinbekommen hatte. Konnte ja auch nicht so schwer sein, Nalia Trembesant hatte es damals schließlich auch irgendwie geschafft. Verrückte Frau. Ja, das war sie wirklich. Jetzt umso mehr.
Du hörst mich also, wisperte die Stimme.
»Bin ich der Erste?«, fragte er.
Nein.
»Ich bin Lorror.«
Ich weiß.
»Hast du einen Namen?«
Der ist nicht mehr wichtig. Es ist schon zu lange her.
Es war schwer, jedes Wort zu verstehen. Der Feuerfluss wütete nun und spie dabei Klänge aus, als würden dort hohle Metallrohre aneinander reiben. Die Stimme hingegen war nur ein sanfter Hauch. Lorror schloss die Augen.
Du bist auf einem Irrweg. Lass ab von deinem Vorhaben.
»Du bist nicht die Erste, die mich irre nennt und sicher nicht die Letzte.«
Und das gibt dir nicht zu denken?
»Ich nehme es als Kompliment.« Lorror grinste. »Durch Angepasstheit geht man nicht in die Geschichte ein.«
Die Stimme antwortete nicht. Oder vielleicht tat sie das, aber er konnte es nicht mehr hören. Zu laut knirschte der Feuerfluss unter ihm. Das Grün schlug in Türkisblau um. Zackige Lichtfetzen wirbelten durch die Luft.
Also gut, dachte Lorror. »Ich tue es.« Er nahm den Glasstab in seine verbliebene Hand und umschloss ihn fest mit den Fingern. Noch war er kalt. Lorror atmete aus. Einfach strömen lassen und auf Erfahrung und Intuition vertrauen – so ging er seine Zauber normalerweise an. Heute würde er sich mit diesem Vorgehen umbringen. Also ging er in Gedanken noch einmal jeden Schritt, jede Abzweigung, jede Verbindung durch … und setzte die Magie präzise frei.
Licht. Es schoss aus der Spalte hervor, so grell, dass es seine Sicht auslöschte. Hitze brannte sich in seinen Körper, fraß sich durch seine Adern. Lorror holte tief Luft, atmete Feuer ein. Es toste in seiner Brust, zuckte durch seinen Körper, als wäre es lebendig. Lorror schrie auf. Blut benetzte seine Lippen.
Als er stürzte, hätte er den Glasstab fast fallen lassen. Doch Lorror hielt ihn fest, während er langsam schmolz und zäh auf den Boden tropfte. Es tat so weh. Dieser verdammte Körper war zu alt. So oft hatte er ihn mit Magie vollgepumpt, hatte alle Gebrechen geheilt, wieder und wieder. Doch trotz allem ließ sich das Alter nicht aufhalten. Es kitzelte ihn immer dann, wenn er gerade dabei war zu vergessen, dass er sterblich war.
Die Welt um ihn herum bestand nur noch aus wogenden Farben. Die Hitze hielt Lorror fest in ihren Klauen und er konnte nichts tun, um sich daraus zu befreien. Das Blut, das er spuckte, vermischte sich mit den wütenden Wirbeln des Feuerflusses. Und er selbst lag nicht einmal eine Handbreit entfernt vom Abgrund.
Und nach einer Unendlichkeit war es dann vorbei. Lorror blinzelte, löste das zerlaufene und inzwischen wieder erstarrte Glas von seinen Fingern und setzte sich auf. Vorsichtig betrachtete er seine Hand. Keine Verbrennungen, auch wenn es sich so anfühlte, als müsse sich seine Haut abschälen. Stattdessen befand sich eine kristalline Kruste auf seinem Handrücken. Lorror hob den Arm, bis der Ärmel zurückrutschte. Auch hier war seine Haut ähnlich fleckig. Lorror presste die Lippen darauf. Nichts. Also biss er zu. Seine Zähne stießen auf harten Widerstand. Und auch jetzt spürte er nichts dabei. Fast, als wären ihm Hornschuppen gewachsen. Doch es war etwas anderes. Es war Magie in festem Zustand. Zumindest glaubte er das.
Und es reichte nicht aus. Er war immer noch ein Mensch. Lorror sackte zurück auf den Boden und schloss die Augen. Dieses ganze Leben … wofür war es gut gewesen, wenn er jetzt scheiterte? Daran scheiterte, den nächsten Schritt zu tun …
Kapitel 2
Sasberg, 12. Tag des Taumondes – Serta Kahragon
Nebelbahnen trieben durch die Luft. Es roch kein bisschen nach Frühling, sondern nach Kälte. Vielleicht nach Stein. Wenn ein Windzug die dichten Schwaden zerriss, wirbelten Glaskörnchen wie Sand über das Pflaster. Was für ein beklemmender Ort.
Kraburg barst vor Menschen. Zu jeder Tageszeit verstopften sie die Straßen. Sie schrien. Sie stanken. Sie hinterließen Unrat. Doch als Serta in einer verlassenen Gasse in der ehemaligen Hauptstadt des Königreichs ihrer Familie stand, schien ihr das alles gar nicht mehr so abstoßend. Es war besser als diese tote Stille.
Eine rote Abenddämmerung leuchtete irgendwo hinter dem Nebel. Hier erkannte man sie noch als blassrosa Schimmer auf den gläsernen Bodenplatten und den weißen Wänden der Häuser. Streunende Katzen hatten die Stadt erobert und zeigten sich als lautlose Schatten auf Treppenstufen. Die Menschen zeigten sich deutlich seltener. Hin und wieder begegneten Serta und ihr Vater einem Passanten, der seine täglichen Besorgungen verrichtete und dann wieder in einem Haus verschwand. Keine Rufe. Kein Lachen. Schon gar keine Ausgelassenheit. Und das lag nicht nur am Krieg.
Serta strich sich eine durchnässte Haarsträhne hinters Ohr. »Sie haben uns nicht einmal am Tor kontrolliert«, sagte sie.
Ihr Vater nickte. Eine aufwändige Illusion bedeckte sein Gesicht, machte seine Züge unkenntlich und färbte sein hellblondes Haar dunkelbraun. Als ehemaliger Herrscher dieses Landstrichs würde ihn so niemand mehr identifizieren. Und auch nicht als König des Feindeslandes. Denn Könige liefen nicht zu Fuß durch die Straßen. »Weil wir ihnen egal sind.«
»Wir könnten Spione oder Saboteure sein.«
Ihr Vater nickte. »Und es ist ihnen egal.«
Sie trugen unauffällige Kapuzenumhänge. Der Stoff kratzte an ihrem Hals, aber Serta wollte keine Magie auf etwas derart Unwichtiges verschwenden. Sie wusste, dass sie ihre Kräfte heute noch brauchen würde. Die Anspannung hielt sie fest im Nacken gepackt. Heute Morgen war sie müde gewesen, doch jetzt war ihr Blick geschärft und jedes Geräusch jagte ihr Kälte durch die Adern. Ihr Vater und sie trugen beide ein Amulett zum Schutz vor den Magieballungen um den Hals, doch tatsächlich leuchteten hier keine bunten Lichter. Die Leute hatten die Stadt nicht verlassen, weil sie sich vor den Geistern fürchteten. Es steckte etwas anderes dahinter. Die Frage war nur, was?
Auf einem Platz blieb ihr Vater stehen. Der Springbrunnen in seiner Mitte führte anstelle von Wasserfontänen nur ein Rinnsal, das sanft und gleichmäßig gluckerte. Über den Hausdächern ragten die Ruinen des Palastes auf. Lorrors Anhänger hatten nur dürftige Versuche unternommen, ihn wieder in Stand zu setzen. Um einige flache Gebäude sammelten sich noch immer Berge aus Scherben und geschmolzenem Glas.
»Du hättest hier geboren werden sollen«, sagte ihr Vater.
Seltsam, sich vorzustellen, wie anders ihr Leben dann ausgesehen hätte. Serta spürte keine Verbindung zu diesem Ort, auch wenn ihre Vorfahren viele Generationen lang hier residiert hatten. Die Linie der Kahragons führte direkt auf Saso Nebelläufer zurück. Die Wahrheit oder nur eine gute Geschichte, um den eigenen Thronanspruch zu legitimieren? Nun, unwichtig. Serta gab nichts auf ihre Vorfahren. Wie sollte sie auch?
»Wünschst du dir diese Zeit zurück? Die Zeit vor Lorror?«, fragte sie.
Einige Herzschläge lang blickte ihr Vater starr in Richtung des Palastes. Dann sah er Serta an. »Du meinst, als meine Eltern noch am Leben waren?«
Sie hob die Schultern. »Du erzählst wenig über sie. Ich höre nur das, was die Leute sagen.«
»Was die Leute sagen, ist niemals wahr.«
»Was irgendjemand sagt, ist niemals wahr. Jeder kennt nur einen Teil der Wahrheit.«
Ihr Vater verzog die Lippen. »Mag sein.«
»Und manchmal reicht dieser Teil dennoch aus.«
»Es ist bedeutungslos, wer deine Großeltern waren«, sagte ihr Vater. »Du hast nichts mit ihnen gemeinsam.«
Das bezweifelte sie. Doch sie widersprach ihm nicht. Nun, es war recht offensichtlich, was sie mit ihrer Mutter gemeinsam hatte. Die Leute spuckten ihr die Gemeinsamkeiten förmlich entgegen: Deine Haare, deine Augen, dein Gesicht … Als ob es für sie ein Kompliment wäre, ein Abklatsch eines anderen Menschen zu sein. Wenn es um ihren Vater ging, war die Ähnlichkeit schwerer zu bestimmen. Vielleicht war es seine Art, der Welt Fragen zu stellen. Vielleicht war es aber auch nur das, was sie am liebsten als Antwort auf diese Frage hören wollte. Tatsächlich hatte sie oft gegrübelt, wie zwei derart präsente Menschen so etwas Ruhiges wie sie hervorbringen konnten. Zumindest die mütterliche Seite dürfte kaum zu diesem Ergebnis beigetragen haben … also doch die Kahragons? Ihr Vater mochte ein Problem damit haben, wie die Leute über seine Vorfahren sprachen. Serta hatte das nicht. Orea und Eron Kahragon mochten vielleicht Tyrannen gewesen sein – Sie machte das aber noch lange nicht zu einer. Sollte sie sich jemals entscheiden, dass Härte der richtige Weg sei, dann würde das nichts mit ihnen zu tun haben.
»Na los, gehen wir zu dieser Versammlung«, sagte ihr Vater.
Einmal die Woche, manchmal öfter, trat auf dem großen Platz vor den Palastruinen einer von Lorrors Predigern auf und sprach zur Menschenmenge. Die Zeiten, in denen sich Lorror selbst an seine Anhänger gewandt hatte, waren seit Jahren vorbei. Kaum jemand bekam ihn mehr zu Gesicht, sodass man leicht spekulieren konnte, er wäre vielleicht gar nicht mehr am Leben oder würde sich nicht in Sasberg aufhalten. Doch er war da. Wer sonst würde die Palastruinen mit immer frischer Magie durchtränken? Eine Magie, die zwar unsichtbar, aber dennoch zu kraftvoll war, um sie zu ignorieren?
Ohne Pferd dauerte es fast eine Stunde, bis sie ihr Ziel erreicht hatten. Menschen, die sich kein Reittier leisten konnten, mussten sehr viel Zeit haben … oder viel zu wenig. Serta blieb neben ihrem Vater in einer Gasse stehen. Ein paar Herzschläge lang beobachteten sie stumm das Treiben.
Unter anderen Umständen hätte man den großen Platz vor den Palastruinen kaum belebt genannt. Zwar füllten ihn Menschen, doch sie drängten sich nicht aneinander und sie blickten so stumpf vor sich hin, als hätten sie seit Jahren kein Sonnenlicht mehr gesehen. Ein paar unterhielten sich leise miteinander, sodass die Luft von einem gleichförmigen Raunen erfüllt war. Eine Frau mit einem grauen Umhang, auf den mit einem grünen Faden eine Art vielzackiger Stern oder eine Sonne gestickt war, kletterte auf die grob zusammengezimmerte Bühne und räusperte sich. Das Gemurmel setzte sich fort. Sie räusperte sich noch einmal.
Serta hielt die Jugend der Predigerin für trügerisch. Vermutlich benutzte sie Magie, die dafür sorgte, dass sie wie ein Mädchen, das gerade einmal die Volljährigkeit erreicht hatte, aussah. Unverständlich, warum jemand ausgerechnet diesen Zustand zu konservieren versuchte. Serta wartete selbst nur darauf, dass sich der leidige Babyspeck an ihren Wangen endlich vollständig verwuchs, wie ihre Mutter es ihr versprochen hatte. Wenn sie ihre Zwanziger erreichte, dann würde alles besser werden … Nun ja … Im Grunde war es unwichtig. Doch manchmal packten sie eben Anflüge von Eitelkeit.
»Heute bin ich die Stimme des Propheten!«, schrie die Predigerin in die Menge. Endlich wandten sich die Leute zu ihr um und lauschten. »Er weiß, dass die Zeiten nicht einfach sind. Unsere Feinde rücken näher und schließen den Kreis um uns. Doch fürchtet euch nicht deswegen. Die Göttin –«
»Kennt ihr den Namen eures Propheten?«, rief Sertas Vater und drängte sich durch die Reihen. Serta folgte ihm durch die entstehende Schneise zwischen den Leuten.
Die Predigerin hielt inne. »Er braucht keinen Namen.«
Sertas Vater trat neben sie auf die Bühne. »Aber er hat einen: Lorror Kahragon.« Seinen Worten folgte ein unruhiges Stimmengewirr, doch der erwartete Schock blieb aus. Serta biss sich auf die Zunge. Ihr Vater fuhr unbeirrt fort. »Er wurde vor zweihundertzwei Jahren in Sasberg geboren. Seine Mutter war Lola und sein Vater Kanro Kahragon, Fürsten von Sasberg. Sein Bruder war Kostro Kahragon, Fürst von Sasberg, seine Tochter Klera Kahragon, Fürstin von Sasberg, seine Enkelin Orea Kahragon, Königin von Sasberg. Wenn euch Lorror nun regiert, tut er das dann wirklich im Auftrag der Göttin? Oder tut er es, weil er ans Herrschen gewöhnt ist?«
Serta hatte gemeinsam mit ihrem Vater die Rede geschrieben. Ob er sich daran halten würde, wusste die Finsternis. Mal tat er es, mal nicht, je nachdem, in welcher Stimmung er gerade war. Mal waren seine spontanen Ansprachen brillant, mal katastrophal, oft genug mittelmäßig. Ihre Mutter war darin besser. Was man ihrem Vater aber zugutehalten musste, war, dass er eine bemerkenswerte Begabung darin hatte, den Menschen bei seinen öffentlichen Auftritten in Erinnerung bleiben. Serta bedauerte sehr, dass sie die Selbstinszenierungsgabe ihrer Eltern nicht geerbt hatte. Man brauchte nicht stolz auf diese Tricks zu sein, aber sie waren eben doch verdammt nützlich.
Angespannt beobachtete sie die Menge. Die politische Botschaft der Rede ließen sie bereits seit einer Weile durch Agenten verbreiten, aber die meisten von ihnen waren schnell wie vom Erdboden verschluckt – Vermutlich hatte Lorror sie erwischt. Zeit, die Dinge selbst anzupacken, fand ihr Vater. Serta zweifelte, dass das tatsächlich eine gute Idee war, aber sie war nun einmal nicht in der Position, seine Entscheidungen infrage zu stellen. Also begleitete sie ihn lieber und hoffte, dadurch zumindest einen kleinen Einfluss auf ihn und die Lage ausüben zu können.
»Die Herkunft ist nicht von Bedeutung!« Die Predigerin versuchte sich mit herrischen Handbewegungen Gehör zu verschaffen. »Die Göttin hat ihn auserwählt. Nur darauf kommt es an.«
»Also wusstest du, wer er ist?«, fragte Sertas Vater.
Die Frau warf die blonden Locken zurück. »Die Göttin hat …«
»Vor euch steht Merto Kahragon.« Eine Männerstimme.
Serta fuhr herum und suchte nach dem Sprecher. Er befand sich nicht in der Menge, sondern am Rand des Platzes inmitten einer Gruppe von Soldaten. Sie trugen Uniformen, die denen der früheren sasbergischen Streitmacht bis ins Detail ähnelten, nur dass mit Farbe ein grüner Stern – oder eine Sonne oder was auch immer es darstellte – auf die Brustplatte gemalt worden war. Nur der Mann, der gesprochen hatte, wirkte nicht militärisch, sondern trug ein schimmerndes blaues Gewand unter einem grauen Umhang. Offensichtlich hatte er seine Stimme mit Magie verstärkt, damit man ihn hier überhaupt verstand. Serta beschlich eine Ahnung, wer er war.
Die Illusion bröselte vom Gesicht ihres Vaters und gab seine wahren Züge frei. »Gundoran«, bestätigte er ihren Verdacht.
»Es ist lange her«, erwiderte der Herzog von Morret am See. »Ich sah Euch zuletzt an der Seite Eures Vaters.«
»In der Tat sehr bedauerlich, dass Ihr meine Krönung verpasst habt.« Ihr Vater stieg betont lässig von der Bühne und ging langsam in Sertas Richtung.
Gundoran blickte ihn nur an. Einige Herzschläge lang wirkte es, als wollte er noch etwas sagen. Dann schloss er den Mund, schüttelte leicht den Kopf und gab den Soldaten einen Wink.
Die Finger ihres Vaters schlossen sich um ihren Arm. Dann zogen dichte Nebelschwaden um sie herum auf. »Schnell«, flüsterte er ihr zu und zerrte sie durch die Menschenmenge. Die Leute starrten sie entweder an oder wichen zurück. Niemand versuchte sie aufzuhalten oder anzugreifen. Doch hinter ihnen klirrten die Rüstungen der Soldaten.
Kaum erreichten sie eine Seitenstraße, lief ihr Vater los. Serta warf einen Blick über die Schulter. Noch hielt die Magie den Nebel in Form, doch Gundoran würde sicherlich jeden Moment einen Gegenzauber wirken. Oder nicht? Schnell holte sie zu ihrem Vater auf.
Ihre abgewetzten Stiefel pochten dumpf auf den Bodenplatten und inmitten der merkwürdigen sasbergischen Stille hörte Serta am lautesten ihren eigenen Atem. Ein grüner Schein befleckte die Wände. Noch einmal sah Serta sich um. Eine Ballung oder nur gezielte Magie? Sie packte mit der Hand das Amulett, das um ihren Hals hing.
»Renn schneller!«, rief ihr Vater.
Serta beschleunigte ihr Tempo. Die Kapuze rutschte ihr vom Kopf und ihr Haar flatterte hinter ihr her. Zwei Passanten vor ihr wichen verdutzt aus. Das grüne Licht erlosch.
Schweratmend blieb Serta stehen. Wo war …? Nichts. Keine Angriffszauber, kein Metallklappern, nicht einmal Pferdehufe … Nur die trostlosen Häuser der Stadt, deren Läden manchmal schief in den Angeln hingen oder Scheiben eingeschlagen waren. Das verbliebene Licht stammte von Laternen aus den bewohnten Räumen oder reflektierte sich als paarweise Tupfen in den Augen der Katzen.
Serta schüttelte den Kopf. »Die … lassen uns laufen.«
Ihr Vater schwieg einen Moment lang. »Es scheint ganz so.« Dann zog er seine Kapuze wieder über den Kopf und legte eine Illusion auf sein Gesicht. »Machen wir uns auf den Weg zurück ins Lager.«
Kapitel 3
Morretberg, 18. Tag des Taumondes – Äro Kahragon
Wenn in Morretberg der Sturm tobte, hörte man die unfreiwilligen Klänge von Glocken, die in den Türmen umherschaukelten. Je länger man hier lebte, umso einfacher war es, die Laute von einem echten Alarmsignal zu unterscheiden. Heute kamen keine Windgeister. Noch nicht.
Die Hufe seines Pferdes donnerten durch die Straßen. Das Tier mühte sich sichtlich ab, gegen den Wind anzukommen. Winterkalt peitschte er ihnen entgegen und biss sich in seine Haut. Äro wirkte absichtlich keinen Schutzzauber. Seine Magie brauchte er heute für andere Dinge. Er wollte leer an den Altar treten, um seinen Versuchsaufbau nicht zu verzerren. Und so ertrug er die Kälte, die sich in seine Haut biss und Krallen in seine Kleidung schlug.
Eine der Wachen hob die Hand, als er das Stadttor passierte. Sie kannten ihn inzwischen. Zumindest wussten sie, dass er der Herzog von Morret an der Küste war und entsprechende Befugnisse genoss. Aber ob sie wussten, wer er wirklich war … Natürlich war es noch nicht offiziell. Er musste erst die Prinzessin heiraten, um in seiner Position anerkannt zu werden. Vielleicht war sie allmählich alt genug.
Am Rand der Straße leuchteten die ersten Blumen des Jahres. Der Wind riss an den sattblauen Blüten des Frühlings-Enzians. Graues Licht hüllte die Gebirgslandschaft ein und ließ die Gräser fahl erscheinen. Äro folgte dem Weg, bis er die schmale Abzweigung erreichte. Die Pflastersteine hier waren hell und neu, nicht über Jahrhunderte glattpoliert wie auf der Hauptstraße. Er lenkte sein Reittier einen gewundenen Weg hinauf, bis das Gebäude in Sicht kam. Es war kaum mehr als ein Pavillon, das Dach getragen von gewölbten Rippen. Äro stieg von seinem Pferd und führte es in den angrenzenden Holzschuppen.
Dann wandte er sich zu der Tür des Pavillons. Sie besaß kein Schlüsselloch und keinen Griff. Öffnen konnte man sie nur mit dem richtigen Zauber. Und dem richtigen Blut. Äro drückte seine Hand auf die dafür vorhergesehene Mulde und ließ Magie hineinströmen. Mit einem Knirschen schob sich die Steinplatte zur Seite. Äro trat ein.
Die Dunkelheit wurde nur von dem matten Schein durchbrochen, der durch den Eingang fiel. Also öffnete er mit einem Zauber als erstes das Fenster im Dach. Frischer Wind fegte durch das kreisrunde Loch. Äro warf seinen Umhang auf den Schreibtisch und zog die Handschuhe aus. Sofort packte die Kälte fester zu – doch seine Bewegungsfreiheit war im Moment wichtiger. Schließlich musste er sich bei dem, was er vorhatte, konzentrieren.
Der felsige Boden war mit einem Zauber glattpoliert worden. Ein Gespinst aus Magieformeln zog sich in Form feiner Rillen durch den Boden. Glas, das aus dem Sand der Döetwüste gefertigt worden war, füllte sie. Äro kannte jedes Zeichen, jede Verbindung, jeden Schnörkel auswendig. Erst gestern hatte er die Struktur am Rand ein wenig verändert.
Kurz lauschte er. Der Wind toste um das Gebäude, raschelte durch trockenes Laub und verbog knarzend die dürren Bäume. Und diese klingenden Töne … waren das immer noch die Glocken aus Morretberg? Und wenn ja, waren sie dann lauter geworden? Mit Magie verstärkte Äro den Schall um sich herum. Die Geräusche schwollen an, hämmerten rhythmisch, von Menschenhand bewegt. Dann war es so weit. Erste Windballungen waren gesichtet worden. Äro ließ den Zauber los und die Geräusche klangen wieder dumpf.
Er zog eine Phiole vom Gürtel. Eine mattleuchtende Flüssigkeit tanzte in ihrem Inneren. Schnell entkorkte er sie und trank aus. Vertraute Hitze strömte durch seine Adern und vertrieb den Winter um ihn herum.
Äro trat in die Mitte des Glasliniengespinstes und schloss die Augen. Die Magie ballte sich in ihm zusammen, bahnte sich ihren Weg in seine Hände und floss aus ihm heraus. Äro ließ sie gleichmäßig in den Altar strömen. Als er blinzelte, tanzten blaue Lichtsprenkel um ihn herum. Blau wie der Enzian am Wegesrand. Das letzte Mal hatte sich eine Spur Violett ins Licht gemischt, doch die neueste Modifikation der Formel hatte die Färbung offenbar beseitigt.
Das Licht verglomm. Die Düsternis bedeutete jedoch keineswegs, dass die Magie versiegt war. Sie wogte um Äro herum, so deutlich zu spüren, dass er nach ihr greifen wollte. Stattdessen lenkte er seine Gedanken darauf, den beständigen Strom nicht abreißen zu lassen. Der Altar riss alle Wärme aus Äro heraus und ließ seinen Körper ausgelaugt und kalt zurück. Hastig öffnete er eine zweite Phiole und trank ihren Inhalt. Die Hitze kehrte schlagartig zurück. Äro atmete tief ein und genoss das prickelnde Gefühl. Die Magie stieg durch die Öffnung in der Decke und wirbelte durch die Landschaft.
Eine Weile passierte nichts. Dann berührte sein Zauber etwas. Oder etwas berührte seinen Zauber. Die Magie lockte sie an, das war längst kein Geheimnis mehr. Sie nährten sich an ihr, gingen in ihr auf und folgten ihr zu ihrer Quelle, um diese zu verzehren. Ein paarmal war es wirklich knapp gewesen, das musste Äro zugeben. Aber bisher hatte er jeden Versuch, den selbstgebauten Altar zu aktivieren, unbeschadet überstanden. Und heute … heute verbanden sich die Windballungen mit seiner Magie, ohne sie zu zerstören. Äro schnappte nach Luft. Es … funktionierte.
Die Überraschung bohrte sich in seine Konzentration und fast wäre ihm sein Zauber entglitten. Gerade noch rechtzeitig lenkte er seine Magie zurück in die richtigen Bahnen und begann, die Kraft von sich wegzuschieben. Nach Morretberg. Aber nicht in die Stadt hinein, sondern über sie hinweg. Durchs Gebirge. Die Hänge hinunter und über sonnenbeschienene Wiesen. Vorbei an einzelnen Baugruppen und direkt über das sprudelnde Wasser des Difraflusses.
Die Verbindung zerrte an ihm, als wollte sie ihm die Adern aus den Armen reißen. Äro biss die Zähne zusammen und kauerte sich auf den Boden. Klebrige Hitze lief aus seiner Nase. Dafür war der Mensch nicht geschaffen, ganz offensichtlich. Kleinere Mengen an Magie konnte er verwenden und er konnte sich auch an größere gewöhnen. Aber das hier … Sobald Hilfsmittel im Einsatz waren, wurde es gefährlich. Merto hatte immer recht gehabt, was das Magieelixier betraf. Aber verdammt nochmal … Es gab Wichtigeres als diese Schmerzen. Und das hatte auch Merto gewusst, als er seine eigenen Warnungen durch seine Taten wieder und wieder entkräftet hatte. Äro spuckte Blut aus und lenkte die Ballungen weiter in den Süden.
Kapitel 4
Velrücken, 18. Tag des Taumondes – Sveno Ralbarat
Rotes Licht fiel auf die felsigen Hänge und befleckte das zaghaft sprießende Wiesengras. Die Wüstengeister zogen durch die zerklüftete Landschaft, angelockt von der Magie – und ausgesandt vom Zentrum der großen skerischen Stufenpyramide. Sveno beobachtete von seiner Position aus, wie die Lichtgebilde matter glommen. Nach einer Weile des Wartens waren sie schließlich entweder verloschen oder so weit weg, dass er sie nicht mehr sehen konnte.
Er verlagerte sein Gewicht auf den anderen Fuß und verschränkte die Arme. Sveno stand zwischen stacheligen Sträuchern und trug eine Lederrüstung in der Farbe der hier üblichen hellen Steine. Das machte ihn zwar nicht sonderlich ehrfurchtgebietend, aber tarnte hervorragend. Und darauf kam es an.
»Ziehen wir uns zurück, General?«, fragte seine Stellvertreterin.
Sveno schüttelte den Kopf. »Es ist immer noch möglich, dass die Geister sie aus der Deckung treiben.« Denn die kraburg-morretbergischen Soldaten besaßen nicht genügend Amulette, um sich zu schützen. Natürlich galt das für die skerische Streitmacht, die er befehligte, genauso. Aber nun, der Unterschied war, dass sein Vater die Geister von der Döetwüste aus ganz gezielt auf Feste Vel zusteuerte, während Tet Velet weitgehend unbehelligt blieb.
Die einbrechende Dämmerung gab dem Himmel einen dunklen Schein. Sveno verschränkte die Arme. Verdammte Warterei. Das war mit Abstand das Schlimmste beim Militär: Nicht das harte Training, nicht die Kämpfe, nicht das Sterben – sondern das Warten dazwischen. Wenn man Zeit hatte, sich Gedanken zu machen. Wenn man nicht wusste, was als nächstes passierte. Wenn man auf die Schneisen in der Landschaft blickte.
Ja, die Geister hinterließen Verwüstung. Es hatte Jahre gebraucht, bevor sie sichtbar wurde. Doch jetzt befanden sich überall diese ausgedörrten Streifen. Zwei Soldaten hatten am Morgen aus Neugier einen Wacholderstrauch in eine Rinne verpflanzt. Doch als Sveno ihn jetzt betrachtete, waren die robusten grünen Nadeln vollständig braun geworden – Die Pflanze weigerte sich schier, in dieser toten Erde zu wurzeln. Irgendetwas machten die Geister mit der Landschaft. Oder genau genommen die wilde Magie, aus der sie bestanden. Und auch, wenn sie Skeret einen bedeutsamen strategischen Vorteil verliehen, so wurde Sveno das Gefühl nicht los, dass diese Waffe zu gefährlich war, um damit herumzuspielen, wie sie es taten.
Aber sag das mal meinem Vater, dachte er. Es war drei Monate her, seit er das letzte Mal mit ihm gesprochen hatte. Vermutlich würde er Sveno bald in die Hauptstadt zitieren. Mal sehen, wie lange sich das noch herauszögern ließ …
Der Wind frischte auf und wirbelte trockenes Laub über den Boden. Ein kalter Hauch streifte Svenos Haut. Seltsam.
»Reiterei!«, brüllte ein Späher.
Sveno fuhr zusammen und verengte die Augen. Tatsächlich. Staub stieg in der Ferne in die Luft und verriet die donnernden Pferdehufe auf der trockenen Straße. Sveno lächelte. »Ich wusste, sie kommen. Infanterie vorrücken.«
Seine Stellvertreterin musterte ihn von der Seite. »Ihr wusstet es?«
Hastig kontrollierte er seine Schutzzauber. »Die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass sie heute einen Versorgungstross aus Krensas erwarten. Sie lenken uns ab, damit wir nicht auf die Idee kommen, ihn zu überfallen. Schützen bereitmachen.«
»Aber wir überfallen ihn trotzdem«, vermutete sie.
»Wir überfallen Feste Vel.«
»Oh, Scheiße.« Sie ächzte. »Du bist inzwischen genauso verrückt wie dein Vater«, sagte sie.
Sveno maßregelte sie nicht dafür, dass sie aus der Rolle fiel, einen Moment lang nicht als Generaloberst, sondern als Freundin zu ihm sprach. Sie war doppelt so alt wie er, hatte unter seinem Vater gedient und jetzt unter ihm. Als Sveno mit einem Mal in die Position eines Generals katapultiert worden war, hatte er sehr von ihrem Rat profitiert. Er schuldete ihr etwas. Eigentlich sollte sie an seiner Stelle sein. Doch sie war es nicht. Denn sie war eine Frau aus einfachen Verhältnissen. Er hingegen war ein Prinz.
»Dann freue dich doch, dass das noch nicht auf dich abgefärbt hat«, sagte er spöttisch.
Sveno lief zu seinem Pferd und schwang sich auf seinen Rücken. Das Tier tänzelte unruhig auf der Stelle. Beruhigend klopfte er ihm auf die Flanke. »Nur eine weitere Schlacht, Marmelade, das kennst du doch alles schon«, sagte er leise.
Ein Windzug streifte ihn – ungewöhnlich kalt, selbst für diese Jahreszeit. Die Soldaten liefen an ihm vorbei und bildeten eine Formation. Sveno holte Luft, biss sich dann aber auf die Zunge. Die Offiziere unter ihm koordinierten die einzelnen Truppenbewegungen. Seine Aufgabe war es, das Ganze im Blick zu haben. Oft dachte er sich, dass er eigentlich nicht wirklich geeignet dafür war. Nicht, dass ihm das etwas half … Es hatte eine Zeit gegeben, da hätte er sich mit seinen Soldaten in den Kampf gestürzt. Heute blieb er auf seinem Pferd sitzen und beobachtete nur. Es fühlte sich falsch an.
Die feindlichen Reiter schienen eine Falle zu wittern, jedenfalls wurden sie auf halber Strecke langsamer und griffen nicht an. Seine Schützen jagten ihnen zur Provokation eine Pfeilsalve entgegen, die deutlich vor den gegnerischen Reihen am Boden einschlug. Die Kraburg-Morretberger ließen sich davon nicht aus der Fassung bringen. Also rückten die Skerer vor – langsam nur, jederzeit bereit, die Formation zu ändern.
Sveno biss sich auf die Zunge. Die Zeit rann ihm durch den Finger. Wenn er jetzt nicht den Befehl gab, Richtung Feste Vel zu stürmen, wäre es zu spät. Aber solange sich die Kraburg-Morretberger so verdächtig verhielten, war es zu riskant. Er wollte nicht als der General in die Geschichte eingehen, der die größte Niederlage seiner Zeit zu verantworten hatte. Und auch nicht als der König, der als Prinz auf dem Schlachtfeld versagt hatte.
Er atmete aus. »Die Infanterie soll die Schützen in Schussweite bringen. Außerdem soll die Hälfte des Magiertrupps hinterher. Ich will da Bewegung sehen«, sagte er zu seiner Stellvertreterin.
Sie nickte und gab seine Befehle mit lauter Stimme an die zuständigen Offiziere weiter. Der Wind toste nun stärker. Seine eisigen Klauen griffen nach Sveno. Er schauderte und wirkte einen Zauber, um sich abzuschirmen. Ablenkungen konnte er gerade wirklich nicht brauchen.
Mit Hilfe der Magier gelang es, zumindest einen Teil der Geschosse tatsächlich hinter die kraburg-morretbergischen Linien zu bringen. Die Reiterei donnerte los. Sveno atmete aus. Wenige Herzschläge später trafen die Heere aufeinander.
Es folgte der übliche Krach. Waffen klirrten, Menschen schrien vor Wut, Angst, Schmerz oder eben im Wahnsinn, der einen unweigerlich innerhalb eines solchen Gemetzels befiel. Wenn das alles nur nicht nötig wäre, wenn sie nur, verdammt nochmal, endlich Frieden miteinander schließen könnten. Zehn Jahre waren zu lang … Sveno massierte sich die Nasenwurzel. Das Militär war sein Leben. Er hatte nie etwas anderes gekannt. Aber er war inzwischen fünfundvierzig Jahre alt und wusste, dass normal eben nicht dasselbe war wie gut.
Die vorderen skerischen Linien lösten sich auf, als die Pferde in sie stießen. Gleichzeitig ging ein Teil der Reiter durch im Pfeilhagel zu Boden und auch die kraburg-morretbergische Formation geriet ins Wanken.
Feste Vel … Sveno rieb sich die Stirn. Es sah so aus, als könnte sich die skerische Übermacht durchsetzen, also sollte er seinen ursprünglichen Plan weiterverfolgen. Er sah noch einmal in Richtung Schlachtfeld, dann wandte er sich seiner Stellvertreterin zu und holte Luft …
»Gib den …« Sveno stockte. Irgendetwas stimmte da nicht. Der Himmel über dem Schlachtfeld schien plötzlich grauer und eine seltsame Düsternis umfing die Kämpfenden. Sveno wischte sich über die Augen und blinzelte. »Siehst du das auch?«
»Nein«, sagte sie. »Aber ich spüre, dass es zu kalt ist.«
Verwirrt senkte Sveno seinen Windschutzzauber und im selben Moment packten ihn eisige Krallen. Was zum …? Trotz der Höhe und der Jahreszeit war es am Velrücken zu dieser Stunde üblicherweise eher frisch als tatsächlich kalt, schließlich befand sich der Landstrich immer noch im Süden. Doch jetzt fühlte sich die Luft an, als hätte der Winter sie ausgespien.
»Da!« Seine Stellvertreterin streckte den Arm aus.
Sveno blinzelte noch einmal. Es war schwer zu sagen, woher die Bewegung kam, doch etwas näherte sich dem Schlachtfeld. Luftverwirbelungen, zarte Wolkenfetzen, ein grauer Schein … Was ist das?
»General?«
Verdammt, er musste jetzt eine Entscheidung treffen. Setzte er seine Leute dem Unbekannten aus oder ließ er zum Rückzug blasen? Sveno befeuchtete sich die Lippen. »Wir …«
Die Bewegung war nun direkt zwischen den Kämpfenden. Die Schreie schwollen an. Die kraburg-morretbergische Reiterei versuchte sich zu formieren, die Infanterie wich bereits zurück. Das Leuchten eines Zaubers flimmerte über die Rüstungen. Die ersten Magier gingen zu Boden und … Oh, Scheiße. Es waren Geister. Nur kamen sie nicht aus der Wüste, sondern aus dem Norden und sie ritten auf dem Wind. Ihre Konturen waren kaum zu erkennen, sie bestanden aus wirbelnder Bewegung und einem matten bläulichen Licht, das aus ihrem Inneren heraus flimmerte. Sie waren anders als die Wüstengeister und anders als die Nebelgeister in Sasberg. Dennoch zweifelte Sveno keinen Moment daran, dass sie genauso gefährlich waren.
»Keine Magie mehr verwenden!«, brüllte er. Eine Abfolge von Hornstößen gab das selten eingesetzte Signal weiter, dicht gefolgt vom Rückzugsbefehl. Doch auf dem Schlachtfeld stürmten die Leute wild durcheinander, flohen in verschiedene Richtungen, Morretberger, Kraburger und Skerer alle nebeneinander. Die Menschen blockierten sich gegenseitig, stolperten übereinander und stießen sich weg, während einzelne noch immer ihre Waffen schwangen. Verdammt, das ist nicht gut.
Sveno atmete tief durch. »Schaff unsere Leute zurück nach Tet Velet, Generaloberst.«
Seine Stellvertreterin blickte ihn starr an. »Was habt Ihr vor?«
Keine Ahnung. Sveno antwortete nichts, sondern trieb sein Pferd an. Marmelade galoppierte über die Ebene direkt auf das wirbelnde Chaos vor ihnen zu. Kurz bevor er die Schlacht erreichte, zog er sein Schwert und ließ Magie über die Klinge fließen. Er riss eine Waffe über den Kopf, wo ihre Spitze leuchtete wie ein einsamer Stern. Sveno zügelte Marmelade. Wind toste auf ihn zu, stieß ihm ins Gesicht und erinnerte ihn an kalte Tage aus einer lang entfernten Zeit in Kraburg. An nie enden wollende Wachschichten inmitten einer graudunklen Dämmerung. An Märsche über verlassene Felder, während sich alle Gräser in Wellenbahnen wiegten. An Schwertübungen auf zart verschneiten Kasernenhöfen, wenn nicht einmal die Anstrengung es schaffte, den Winter aus den Muskeln zu brennen.
Die Windgeister wirbelten um ihn herum, als wäre er das Auge des Sturms. Eine Bewegung streifte ihn wie die schärfste Klinge, die er je zu spüren bekommen hatte, grub sich durch das Leder seiner Unterarmpanzerung und hinterließ einen blutenden Schnitt.
Sveno biss die Zähne zusammen und lenkte die Magie in sein Amulett. Einen Moment lang löschte ein gelber Lichtblitz seine Sicht aus. Dann schälten sich die Konturen seiner Umgebung schattenhaft aus dem Leuchten und bunte Tupfen tanzten vor seinen Augen. Marmelade wieherte nervös. Sveno blinzelte. Die Geister trieben immer noch durch die Luft, doch ihre Bewegungen wirkten weniger aggressiv. Natürlich wusste er, dass sie keine Lebewesen waren, dennoch konnte er nicht verhindern, dass er dachte: Sie sind gesättigt und haben das Interesse verloren. Sveno atmete aus. Von Schlachtformationen und Soldatenreihen war nichts mehr übrig. Nur die Verwundeten lagen noch auf dem Schlachtfeld herum, während alle anderen das Weite suchten.
Er schluckte. Es war zu riskant für einen General, hier auf dem Präsentierteller zu bleiben, also trieb er Marmelade wieder an. Was für ein verdammter Tag. Jetzt gab es auch noch Windgeister. Und Feste Vel befand sich weiterhin in Feindeshand. Für ihn bedeutete das vor allem eines: Jetzt stand er wieder mit leeren Händen da – und mit einem uneinsichtigen Vater, der diesen Krieg auch noch Jahrzehnte weiterführen würde.
Kapitel 5
Velrücken, 18. Tag des Taumondes – Sarto Kahragon
Sie kommen wieder.« Mano streckte die Hand aus und deutete auf die roten Lichttupfen, die sich vom Süden her näherten. Sarto schluckte. Bisher hatte er die Ballungen immer nur von weitem gesehen. Doch jetzt … Sie flatterten durch die Landschaft wie Glühwürmchen, doch im Gegensatz zu den kleinen Insekten wuchsen sie innerhalb weniger Herzschläge zu faustgroßen Kugeln und schließlich wogenden Lichtstrudeln an. Der Anblick brannte sich in seine Netzhäute und es gelang ihm kaum, sich davon abzuwenden. Seine Schwester war bereits ähnlichen Ballungen an der Grenze zu Sasberg begegnet und selbst Mano hatte in seiner kurzen Zeit beim Militär schon Geister zu Gesicht bekommen. Doch er? Sarto gestand sich ein, dass er den Palast in Kraburg viel zu selten verlassen hatte.
Mano und er nahmen ihre Plätze in der Kompanie ein. Die wenigen Augenblicke vor dem Marschbefehl betrachtete Sarto seinen Freund. Er kannte Mano Sikat seit er denken konnte und in all der Zeit hatte er sich für ihn nie verändert. Doch das konnte kaum stimmen. Vor ein paar Monaten war Mano zum Militär gegangen. Und jetzt war er hier. Sarto war ihm vor wenigen Wochen mit einer gefälschten Akte, die ihn nicht nur ein Jahr älter machte, sondern auch seinen Beitritt zum Heer und die erfolgreich absolvierte Grundausbildung bescheinigte, gefolgt.
Also marschierten sie nun gemeinsam mit den anderen Soldaten in Richtung Feste Vel. Das Gras und die Sträucher unter ihren Füßen waren längst plattgetrampelt und so kamen sie gut voran. Gut genug, um die Festung rechtzeitig zu erreichen? Sarto glaubte nicht. Er atmete tief ein und wieder aus. Brodelnde Finsternis, er hatte noch nie ernsthaft gekämpft.
»Halt«, rief der Hauptmann.
Halt. Sarto schluckte. Das hieß übersetzt so viel wie: Wir waren zu langsam, um den Geistern zu entkommen. Jetzt blieb also nur noch die Flucht nach vorn. Wir müssen uns ihnen stellen. Die Kompanie nahm Form an: Die Soldaten pferchten sich zusammen. Außen standen diejenigen von ihnen, die ein Amulett besaßen. Tatsächlich besaß Sarto auch eines, doch das hatte er seinem Vorgesetzten nicht verraten. Sonst hätte er auch verraten müssen, woher er es hatte. Und das würde unweigerlich zu der Frage führen, wer er war. Und am Ende wäre alles anders.
Denn natürlich wusste seine Familie nicht, dass er hier war. Und die Karten standen gut, dass sie es nicht allzu schnell erfuhr. Wer im Palast würde ihn schon vermissen? Dafür waren sie alle viel zu beschäftigt, und Sarto hatte es schon immer verstanden, sich rar zu machen. Solange er nicht versehentlich unter die Augen von General Sikat geriet, war alles in Ordnung. Bis dahin war er einfach nur einer von vielen weiteren Soldaten.
Die Uniform war an das warme Wetter angepasst worden und bestand anstelle von Metall hauptsächlich aus Leder. Sie lag enger an, als er es gewohnt war, aber diese Spannung erzeugte auch einen Bewegungsdrang, der ihm hier sicherlich zum Vorteil gereichen würde. Denn es konnte jeden Moment so weit sein. Ein Signalhorn, die magisch verstärkten Stimmen der Offiziere, ein erneuter Marschbefehl …
Er spürte, dass Mano ihn nun seinerseits musterte. Sarto tat so, als würde er es nicht bemerken und straffte unauffällig den Rücken.
Mano schnaubte. »Du siehst albern aus.«
Empört knuffte ihn Sarto in die Seite. »Warum sagst du das? Warum sollte mir keine Uniform stehen?«
Mano schnitt eine Grimasse. »Weil du nicht hierhergehörst. Auf ein Schlachtfeld.«
»Und du schon?« Schon seit zwei Wochen taten sie alles, um sich vor Manos Vater zu verstecken. Der wusste im Gegensatz zu Sartos Eltern sehr wohl, dass sein Sohn hier stationiert war – Mano wich ihm aus anderen Gründen aus. Er wollte nicht die Gerüchte an sich kleben haben, er würde bevorzugt werden. Er wollte nicht unter Beobachtung stehen, sich ständig beweisen müssen. Er wollte keines dieser Streitgespräche mehr hören. Nicht ständig die Errungenschaften seiner Mutter vorgehalten bekommen.
»Meine Familie gehört ins Militär. Schon immer«, sagte er dennoch pflichtschuldig.
Sarto rollte mit den Augen. »Na ja. Wenn ich das richtig sehe, waren deine Großeltern die Herrscher von Skeret und du könntest jetzt genauso gut ein Prinz sein wie ich.«
Einen Moment lang war Manos Miene starr. Dann schlich sich ein Grinsen in sein Gesicht. »Ja, und dann wäre ich vielleicht mit dieser rartanischen Blondine verlobt und nicht du.«
Die Worte versetzten Sarto einen seltsamen Stich. »Ach, hör doch auf. Das ist überhaupt nichts Offizielles. Ich heirate sie nicht.«
»Warum nicht? Du fandest sie nett.«
»Ist sie auch. Sie ist freundlich, klug und schön. Ich glaube nur nicht, dass das auf Dauer reicht.«
Mano verzog die Lippen. »Oh, aber es reicht.«
»Woher willst du das wissen?«
Einige Herzschläge lang sahen sie sich in die Augen. Dann zuckte Mano schließlich mit den Schultern und wandte den Blick wieder nach vorne.
Sarto tat es ihm gleich. Rotes Licht überall auf den felsigen Abhängen. Oh, verdammt. Die Unterhaltung hatte einen Moment lang darüber hinweggetäuscht, in welcher Lage sie sich befanden.
»Näher zusammen«, schrie der Hauptmann.
Vielleicht achtzig Soldaten und eine ihm unbekannte Anzahl an Amuletten. Wie viele würde es erwischen? Auch wenn er selbst sich sicher fühlte, Finsternis, er wollte nicht dabei zusehen, wie das Feuer die Menschen fraß, deren Namen er sich jetzt endlich merken konnte. Mano drückte sich links eng an ihn. Auf der rechten Seite berührte ihn Newa. Im Nacken spürte er den Atem eines anderen Kameraden. Seine eigene Nase befand sich nur zwei Fingerbreit entfernt vom Helm von Lero.
Dann waren die Wüstengeister vor ihnen. Ihr roter Schein füllte sein Sichtfeld aus. Sarto presste die Augen zusammen. Sein Herz hämmerte, als wollte es durch seine Rippen brechen. Ein Schweißfaden lief über seine Stirn und blieb in seinen Wimpern hängen. Doch es blieb seltsam still um ihn herum. Als würden alle die Luft anhalten. Zögerlich blinzelte er. Das rote Licht schwappte über sie hinweg und zerfloss dann in der Landschaft. Sarto riskierte einen Blick über die Schulter und versuchte an den Gesichtern seiner Kameraden vorbeizusehen. Was passiert da?
»Feind in Sicht!«, schrie jemand.
»Feind«, wiederholte Sarto tonlos.
»Da vorne«, sagte Mano.
Und tatsächlich: Vor einer Felsgruppe tauchten sie auf, so plötzlich, als würde sie der Boden ausspeien. Eine Masse an Skerern, wie er sie noch nie gesehen hatte. Sarto schluckte hart. Seine erste richtige Schlacht. Schlacht. Das Wort war verwandt mit schlachten. Genau das kam nun wohl auf ihn zu. Warum, bei allen Kreaturen der Finsternis, war er verdammt nochmal hier? Er sah zu Mano. Dieser erwiderte seinen Blick mit unbewegter Miene. Mano war im Gegensatz zu Sarto seit seiner Kindheit hierfür ausgebildet worden. Er wusste, was auf ihn zukam. Oder? Wusste er es tatsächlich? Konnte man sich davon überhaupt eine Vorstellung machen?
Ein ferner Hornstoß dröhnte durch die Luft. Sarto riss den Kopf herum. Zuerst dachte er, das Signal käme vielleicht von den skerischen Reihen, doch eigentlich klang es dafür zu vertraut. Und tatsächlich. Noch auf einer anderen Seite der Ebene kehrte Bewegung ein.
Eine Woge der Erleichterung spülte durch seine Brust, als er die Standarten der kraburg-morretbergischen Reiterei entdeckte. Dann war noch nicht alles verloren und er würde diesen Tag hier vielleicht doch überleben.
Aber dann blickte er wieder zu den Skerern. Eine Front an Soldaten in hellen Uniformen marschierte heran, hinter ihnen eine Kompanie Schützen. Oh, Finsternis, das sind viele. Ganz offenbar war der Angriff der Wüstengeister nur ein Vorspiel gewesen. Der erste Akt in dieser Dramaturgie des Kämpfens. Der Ausgangspunkt einer gut durchdachten Falle. Und sie waren direkt hineingetappt.
»Marsch!«, brüllte der Hauptmann.
Habe ich mich gerade verhört? Sarto ächzte. »Ödnis, warum macht er das? Wir sind eindeutig in der Unterzahl, warum ziehen wir uns nicht zurück?«
»Offenbar steht etwas auf dem Spiel, das wir beide nicht kennen«, sagte Mano finster. Er schnitt eine Grimasse. »Ich meine, es hatte ja auch einen Grund, dass wir hier draußen stationiert wurden.«
»Ich dachte, das wäre nur ein Routine-Marsch«, sagte Sarto.
»Im Krieg gibt es keine Routinen.«
»Hast du das von deinem Vater?«
Mano zog die Brauen zusammen. »Warum sollte ich mir so etwas nicht selbst ausdenken können?«
Na ja. Sarto hielt Mano nicht für einen großen Denker. Was keineswegs abwertend gemeint war, manche Leute waren eben mehr praktisch veranlagt und andere kreativ. Und beide Gruppen ergänzten sich perfekt, fand Sarto. Er atmete aus. Aber vielleicht täuschte er sich auch in Mano. Vielleicht ging da mehr in seinem Kopf vor, als er sagte. Vielleicht war das einfach nur seine schweigsame Ader.
Die Kompanie setzte sich in Bewegung, Sarto und Mano mittendrin. Es ging nicht schnell voran, dennoch würde es wohl nur Minuten dauern, bis sie in Reichweite der Schützen gelangten.
Sarto lachte auf. Er wusste selbst nicht, warum er das tat, wo es doch so völlig unpassend war. »Ich mache mir heute in die Hose«, sagte er.
»Ich werde dich nicht dafür verurteilen«, erwiderte Mano.
»Ruhe, ihr beiden«, rief der Hauptmann.
Ruhe, der Kerl ist wirklich lustig, dachte Sarto. Oder wie, verdammt nochmal, stellte der sich das vor, in einer solchen Situation Ruhe zu bewahren?
Ein Pfeilhagel schlug vor ihnen ein. Die Geschosse waren noch weit genug entfernt, aber der Hauptmann machte immer noch keine Anstalten, ihren Vormarsch zu drosseln. Sarto verstärkte seinen magischen Schild. Viele andere um ihn herum hatten vermutlich keinen, schließlich war es recht anspruchsvoll, etwas derart Substanzielles wie Pfeile abzuwehren. Vorsichtshalber dehnte er seinen Zauber aus, sodass er auch über Manos Kopf reichte. Und so gerne er die gesamte Kompanie geschützt hätte – das überstieg seine Kräfte.
Die Reiterei donnerte heran. Der Boden vibrierte unter den Tritten der Pferde. Oder bildete er sich das nur ein? Ging seine Fantasie mit ihm durch? Weil es besser war zu fantasieren, als der Realität ins Auge zu blicken? Sich der Tatsache zu stellen, dass da Menschen auf ihn zuliefen, die ihn töten wollten. Und dass sie von ihm erwarteten, dass er tötete. Aber das würde er nicht. Oder würde er? Er würde nicht.
Der Hauptmann brüllte etwas. Daraufhin zogen alle ihre Schwerter, also tat Sarto dasselbe. Sie stellten sich wieder neu auf, in geordnete Reihen. Und jetzt stehen wir da und warten, dass jemand auf uns losgeht. Warum?
»Das ist ein Alptraum«, murmelte Sarto. Dabei hatte es noch nicht einmal richtig angefangen. Witzig, oder? Wie sehr er hier versagte. Warum ging irgendjemand freiwillig zum Militär? Warum?
Ein weiterer Pfeilhagel trieb die Formation auseinander. Sarto stolperte zur Seite und starrte auf den gefiederten Schaft, der vor ihm im Gras steckte. Das hätte auch sein Kopf sein können, aus dem das Ding ragte. Vielleicht würde genau das am Ende des Tages passieren.
Wieder Gebrüll, doch diesmal leisteten die Soldaten den Befehlen des Hauptmanns nicht so schnell Folge. Die Skerer schossen immer noch auf sie, die Reihen hielten ihnen nicht stand.
Das ist Irrsinn.
»Mano, lass uns hier …« Gerade als Sarto den Kopf wandte, bohrte sich ein Pfeil durch Manos Brustpanzer. Aber warum? Hielten seine Schilde nicht? War er … Sarto beobachtete, wie Mano aufschrie, die Hand auf die Wunde presste, zusammenbrach und sich am Boden krümmte. Ein weiterer Pfeil schlug neben ihm im Boden ein. Sarto schüttelte die Starre ab.
Nein, nein, nein. Sarto packte Mano unter den Achseln und schleifte ihn über den Boden. Wir müssen hier weg. War er nun ein Deserteur, weil er seinen Freund aus der Schusslinie zerrte? Würde man ihn dafür vor Gericht stellen? Hastig baute er einen Illusionszauber vor sich auf. Einer genaueren Betrachtung würde die flimmernde Wand nicht standhalten, aber wer sah in einer Schlacht schon genauer hin?
Eine Blutspur befleckte den Boden. Alle Kraft war aus Manos Körper gewichen, sodass er wie eine Puppe in Sartos Armen hing. Nein. Sarto ließ ihn fallen und fühlte seinen Puls. Ein schneller Herzschlag flirrte durch seine Adern. Sarto atmete aus. Nur bewusstlos. Brodelnde Finsternis, er musste sich beeilen.
Kapitel 6
Jegaret, 18. Tag des Taumondes – Rako Aristedes
Regentropfen donnerten gegen die Fensterscheiben. Unter einem dämmergrauen Himmel schäumte das dunkle Meer der Küste von Jegaret. Ein Kaminfeuer erhellte den Raum. Das Licht der zuckenden Flammen ließ die Schatten der Möbel tanzen. Norla lag zwischen einigen Decken auf dem Bauch und beobachtete Rako. Der Feuerschein schimmerte auf ihrer Haut und verfing sich in ihren offenen braunen Haaren. Ihre Augen fixierten ihn und schienen sich dabei kaum zu bewegen.
Rako setzte sich auf. »Starr mich nicht so an.«
Sie befeuchtete sich die Lippen. »Weißt du, meine Tochter wird bald siebenundzwanzig und ich dachte …«
Kurz sah er sie an. Dann sprang er auf und schnappte sich seine Hose vom Boden. »Verdammt, keine Politik!«
Norla rollte mit den Augen. »Sei doch nicht so empfindlich.« Sie stützte das Kinn auf die Hände. »Es ist eben schwierig, Politik auszuklammern, wenn das ganze Leben daraus besteht.«
»Ich klammere sie sehr gut aus«, sagte Rako ärgerlich. Denn das hier war alles, aber sicher nicht politisch. In seiner Position war es nun einmal schwierig, Frauen zu finden, die politisch völlig uninvolviert waren – denn auf geistlose Mätressen, deren einziges Talent darin bestand, den ganzen Tag das Bett für ihn vorzuwärmen, konnte er getrost verzichten.
Norla zwinkerte. »Bist du dir sicher?«
Rako zog sein Hemd über. »Wäre ich sonst hier?«
Sie lächelte. »Politisch relevant genug bin ich für den Besuch des Kaisers also nicht?«
»Nicht für diese Art von Besuch«, sagte er.
»Oh, wer bekommt denn außer mir diese Art von Besuch?«
Rako biss die Zähne zusammen. »Niemand.«
»Du lügst.« Norla lachte. »Sie liegen dir zu Füßen, die Frauen. Und falls du willst auch die Männer.«
»Sie langweilen mich.« Rako trat ans Fenster. Jegaret hatte nie zu den Städten gehört, in denen er viel Zeit verbracht hatte. Während der Morretbergschen Revolution war der Graf ein Königstreuer gewesen. Und auch später hatte dieser Ort kaum Bedeutung für ihn besessen. Warum auch? Jegaret war so abgelegen, dass man die Stadt gerne vergaß und auch in der morretbergischen Geschichte kam sie kaum vor. Stürme und Fische – mehr gab es hier nicht.
Wieder gluckste Norla. »Wie das? Früher schienen sie dich durchaus nicht gelangweilt zu haben.«
Rako fuhr herum. »Wer sagt das?«
Sie zwinkerte ihm zu. »Man hört eben das ein oder andere.«
War das so? Oder wollte sie ihn nur provozieren? Rako atmete aus. »Früher habe ich bei vielen Dingen andere Prioritäten gesetzt als heute.«
Sie grinste breit. »Ich bin eine Priorität?«
»Oh, Norla. Du bist eine Ablenkung, nichts weiter.«
»Das weiß ich doch.« Sie glitt ebenfalls aus dem Bett und hob ihr Kleid vom Boden auf.
»Und?«, fragte er.
Sie hob die Brauen. »Was und?«
»Das ist dir egal?« Rako war ehrlich verwundert. Den meisten Menschen, die er kannte, wäre es durchaus nicht egal und das Verhältnis wäre genau an dieser Stelle beendet gewesen. Vielleicht war Norlas Abgebrühtheit genau das, was er an ihr mochte.
»Ist es tatsächlich. Ich bin nicht naiv, Rako. Das war ich noch nie«, sagte sie.
Er nickte. »Ja.«
Der Regen draußen ließ etwas nach. Wenn er an die Vergangenheit dachte, erinnerte er sich oft an Regen, manchmal auch an Schnee. Die eisige Luft in den Bergen, der ewige Wind und die Kälte, die einem besonders dann in die Knochen kroch, wenn man von einem Kampf ausgelaugt war und alle Magie für Heilzauber verbraucht hatte. Manchmal erinnerte er sich aber auch an die warmen Hügel von Larkana und Krensas, wo ewiger Sommer herrschte und die Kämpfe oft so weit weg waren.
Rako trat vor den Spiegel und ordnete mit Magie seine Haare und Kleidung. »Ich gehe.«
»Jetzt am Abend?«, fragte Norla. Und dann: »Kommst du wieder?«
Rako zuckte mit den Schultern. Die Wahrheit war, dass er es selbst nicht wusste. Dass sich ihre Treffen, wenn er hinterher daran dachte, oft schal anfühlten. Und trotzdem war Norla im Moment die Einzige, die ihn ertrug, und das trieb ihn wieder zurück. Vielleicht war es heute das letzte Mal gewesen. Vielleicht sollte er sich weniger mit den Menschen um ihn herum befassen und stattdessen lieber öfter die Einsamkeit des Gebirges suchen. Oder er kehrte zurück in den Krieg. Kämpfe gäbe es immerhin genug.
Kapitel 7
Velrücken, 18. Tag des Taumondes – Sarto Kahragon
Sie schafften es vom Schlachtfeld herunter und auch noch ein Stück weiter. Dann brach Mano wieder zusammen. Sarto hielt ihn fest und konnte so zumindest verhindern, dass er mit dem Kopf gegen die Steine schlug. Dennoch war es ein unsanfter Fall.
»Tut mir leid«, sagte Sarto und ging auf die Knie. Manos Lider flatterten einen Moment, dann stöhnte er und drehte den Kopf zur Seite. »Halt durch, es dauert nicht lang.« Sarto kramte in seinem Gedächtnis nach dem passenden Heilzauber. In Ordnung, es war nicht kompliziert. Eine Nummer größer als normalerweise, aber deswegen keineswegs komplexer. Doch zuerst musste der Pfeil heraus. Arg. Sarto packte den Schaft fest, schloss die Augen und riss ihn mit aller Kraft heraus. Mano bäumte sich auf uns schrie.
»Tut mir leid«, schrie Sarto zurück. Er drückte seine Hand auf die Wunde. Heißes Blut befleckte seine Finger. Nicht drandenken. Einfach machen.
Eine Wolke aus Magie schwebte um ihn herum. Warum …? Sarto blinzelte hektisch. Sie sollte in Manos Körper fließen und seine Verletzung heilen. Was war da los? Vielleicht … Sarto zerrte sein Amulett hervor und schmiss es ein Stück entfernt auf den Boden. Ein leichter gelber Schimmer lag auf der Glasplatte. Oder bildete er sich das nur ein? Er tastete Manos Hals ab, fand auch dort eine Schnur und brachte ein weiteres Amulett zum Vorschein. Sarto warf es ebenfalls weg.
Erneut wirkte er einen Heilzauber. Wieder wand sich die Magie widerwillig um Mano herum, ohne ihn zu berühren. Sarto ächzte. Was …? Nachdenken. Dafür musste es eine Erklärung geben. Und entsprechend auch eine Lösung. Aber … Sarto rieb sich die verschwitzte Stirn. Seine Gedanken tanzten wild im Kreis. Was mache ich falsch? Was …?
Der Wind trug wütende Schreie herbei. Sarto zuckte zusammen und sah sich um. Eine einzelne Eiche stand in der kargen Landschaft und versperrte den Blick auf die Felsen. Doch die Schlacht war nur ein paar Minuten entfernt und er hatte keinen Grund anzunehmen, dass sie bereits vorüber war.
Er musste Mano von hier fortbringen – sofort. Und er würde es kaum schaffen, ihn zu schleppen. Also brauchte er ein Transportmittel, das es ihm einfacher machte. Etwas wie … Eine Trage. Gute Idee. Sarto lief zu der Eiche. Er war sicher nicht handwerklich begabt, aber irgendetwas würde sich aus den Ästen schon zusammenzimmern lassen. Nach kurzem Nachdenken formte er einen Zauber wie eine Klinge und setzte sie an die Rinde. Die Magie blitzte gelb und erlosch. Was zum …? Sarto versuchte es noch einmal. Eine Hitzewoge hinterließ schwarze Stellen am Stamm des Baumes. Es roch nach Rauch.
Sarto wich zurück. Nicht nur Heilzauber versagten hier, sondern auch alles andere. Kalte Finger griffen in seinen Nacken und die Welt drehte sich vor seinen Augen. Keine Magie? Wie soll man leben ohne Magie? »Finsternis.« Sarto legte den Kopf in die Hände und atmete schwer, bis der Schwindel wieder nachließ. Bei der Ödnis. »Was soll ich jetzt machen?«, fragte er Mano. Doch der hielt die Augen geschlossen und regte sich nicht.
Erst einmal weg von hier. Das muss auch so gehen. Es muss. Sarto packte eilig die Amulette wieder ein, biss die Zähne zusammen und hievte Mano in die Höhe. Sein Freund stieß ein Wimmern aus, doch er schien kaum mehr bei Bewusstsein. Sarto legte ihn sich über seine Schulter und machte einen wackligen Schritt voran. Finsternis. Mano war zwar nicht größer als er, aber sicherlich kräftiger und entsprechend schwerer. Sarto zweifelte, dass er diesen Kraftakt lange durchhalten würde. Oder dass er Mano überhaupt irgendwohin tragen konnte. Aber ich muss. Also bewegte er sich Schritt für Schritt voran.
Der Ort war nicht mehr als eine Mulde zwischen einigen Felsbrocken. Kein gutes Versteck, aber für den Moment musste es reichen. Sarto hockte schweißüberströmt am Boden und schnappte nach Luft. Mano lag neben ihm im Gras, die Wunde notdürftig mit einem Stück Stoff verbunden. Der Himmel über ihnen war dunkel.
»Ich verstehe das nicht«, murmelte Sarto. »Du kämpfst viel besser als ich. Also warum ist das dir passiert und nicht mir?« Mano reagierte nicht auf seine Worte. Wahrscheinlich hörte er sie nicht einmal. »Ohne dich wäre ich nicht hier. Ich meine, natürlich war es meine Entscheidung, aber ohne dich hätte ich keinen Grund, mir so etwas anzutun«, fuhr Sarto fort. Das Militär – pfui, Finsternis