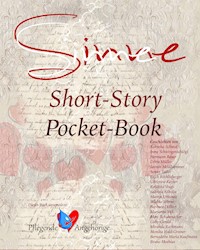Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ISEGRIM
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thelxiope, genannt Thel, ist eine Sirene. Um einen gutbezahlten Tauchauftrag zu erledigen, reist sie nach Venedig. Doch bald muss sie erkennen, dass es nicht um Geld, sondern um ihr Leben geht. - Nur eine Sekunde der Unaufmerksamkeit und Brookes ganzes Leben steht Kopf, als sie mit dem geheimnisvollen Apoll zusammenläuft. Denn plötzlich ist er überall. Und als wäre das nicht schon seltsam genug, versteht es Apoll ein großes Geheimnis daraus zu machen, woher er kommt und wieso er so überraschend in Brookes Leben aufgetaucht ist. - Ein Dorf im Wald ist das Zuhause der Geschichtenschreiber, die mit geschriebenen Worten Leben verändern können. Gerald und Lisandra leben beide im Wald und könnten unterschiedlicher nicht sein. Nach einigen Streits kommen sich die beiden dennoch näher. Doch dann begeht Lisandra einen Verrat, der alles zu verändern droht… - Als Delia unerwartet ihren Job verliert, flüchtet sie an den Strand, um dort einen sorglosen Abend zu verbringen. Doch dann wird sie von einem Strudel ins Meer gezogen und findet sich plötzlich in der mystischen Stadt Atlantis wieder. - Als mutierte Wölfe aus dem Labor entkommen und Sunnys Heimatstadt „Waterville“ verwüsten, riegelt das Militär die Stadt ab. Sunny zählt zu den wenigen Überlebenden und kämpft gemeinsam mit Lehan gegen die Zeit. Schaffen sie es innerhalb von 2 Stunden am anderen Ende der Stadt zu sein, damit sie gerettet werden können? - Magisch – mystisch – übernatürlich! Tauche – manchmal im wahrsten Sinne des Wortes – ein in verwunschene Welten und lass dich verzaubern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inahltsverzeichnis
Die Autoren
Kornelia Schmid - FLÖTENTÖNE IM MEER
Stefanie Daidrich - BIS DU WIEDER DA BIST
1
2
3
4
Julia Buchholz - WALD DER GESCHICHTEN SCHREIBER
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Epilog
Tigist Brhane - JENSEITS DES OZEANS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Julia Lindenmair - WATERVILLE
Vollständige e-Book-Ausgabe
»Verwunschene Welten«
© 2022 ISEGRIM VERLAG
in der Spielberg Verlag GmbH, Neumarkt
Covergestaltung: Ria Raven, www.riaraven.de
Coverillustrationen: © shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung können ziviloder strafrechtlich verfolgt werden.
(e-Book) ISBN: 978-3-95452-838-7
www.isegrim-buecher.de
Die Autoren
Julia Buchholz begeisterte sich schon früh für das Schreiben. Im Alter von acht Jahren dachte sie sich bereits Kurzgeschichten für ihre Familie aus. Mit ihrer Kurzgeschichte ›Der Wald der Geschichtenschreiber‹ möchte sie ihre Liebe zu Wörtern zum Ausdruck bringen und ihre Leser gleichzeitig dazu ermutigen, ihre eigene Geschichte zu schreiben.
Julia Lindenmair hat es sich seit ihrer Kindheit zum Vergnügen gemacht, fantastische Geschichten auf Papier zu bringen. Sie hat bereits zwei Bücher im Bereich Romantasy veröffentlicht.
Kornelia Schmid hat ihre Kurzgeschichten bereits in verschiedenen Anthologien veröffentlicht. ›Flötentöne im Meer‹ ist ihr erster Ausflug ins Genre Urban Fantasy, aber ihre zweite Erzählung, die in Venedig spielt – eine Stadt, die sie schon mehrfach besucht hat.
Stefanie Daidrich wurde 2003 in einer kleinen Gemeinde in Niederbayern geboren. Nach ihrem Realschulabschluss hat sie 2019 ihre Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin (PTA) in Passau begonnen.
Tigist Brhane liest seit sie denken kann leidenschaftlich gerne Bücher. Ihr Traum war es immer, selbst Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen, damit sie Leser auf eine Reise mitnehmen, unterhalten und faszinieren kann.
Die Luft roch nach totem Fisch. Fäulnis haftete an den bröckelnden Mauern. Ein leichter Salzfilm hellte den Stein an manchen Stellen auf. Das Gekreische der Möwen mischte sich unter das Stimmengewirr der Touristen, die bereits am Morgen die Stadt fluteten, und die brummenden Motoren der Vaporettos. Es war wunderbar.
Thel fragte sich, warum sie nicht früher nach Venedig gekommen war. Sie brachte ihren Koffer ins Hotel und verließ die Enge der Räume schnell wieder, um auf den schmalen Brücken über die Kanäle zu laufen. Das Wasser war trüb und verbarg seine Geheimnisse gut. Im Moment zumindest. Thel freute sich darauf, sie ihm zu entreißen. Heute schon. Dann würde sie unter die gründunkle Fläche tauchen und sich von der Tiefe verschlingen lassen. Kein Mensch würde je verstehen, was ihr daran Freude bereitete.
Die Blicke der Passanten klebten an ihr. Für Thel fühlten sie sich an wie ein ausgespuckter Kaugummi, der nicht reißen wollte, egal wie sehr man ihn in die Länge zog. Sie ekelte sich vor der Vorstellung, aber sie wusste, dass es niemals anders werden würde. Manche Leute blieben sogar stehen oder drehten sich um, um sie anzustarren. Thel bemerkte es und sie ignorierte es, wie sie es immer tat. Manche Leute hätten sich angesichts all der Aufmerksamkeit geschmeichelt gefühlt. Aber Thel wusste, dass nichts, was die Leute in ihr sahen, irgendetwas mit ihrem Inneren zu tun hatte. Es war ihre Magie, die auf die Menschen wirkte, nichts weiter. Der Fluch ihrer Geburt.
In den überfüllten Gassen war es schwierig, niemanden zu berühren. Thel schob sich vorsichtig durch die Menschenmenge. Hunde bellten sie an. Im Gegensatz zu ihren Besitzern spürten sie sehr wohl, dass mit Thel etwas nicht stimmte. Dass sie gefährlich war. Sie nahm einen Umweg durch die Seitengassen.
Wenn sie einen Stadtplan benutzt hätte, um die Piazza zu finden, wäre sie vielleicht nicht zu spät gekommen. Der kleine Platz lag nicht in unmittelbarer Nähe der wichtigsten Touristenattraktionen. Trotzdem war es auch hier zu voll. Auf den Stufen eines kleinen Brunnens saßen Menschen und riefen einem Hund Kommandos zu. Da keiner der Kanäle direkt angrenzte, war der Meeresduft weniger stark. Nur die Steine verströmten den allgegenwärtigen Geruch von Alter. Der Putz bröckelte von den Wänden der Häuser. Hinter ihren Dächern ragte einer der vielen Kirchtürme Venedigs auf.
Thel blieb stehen und fragte sich, wer von den Gästen ihr Auftraggeber war. Eine Beschreibung von sich hatte er ihr nicht gegeben. Doch seltsamerweise schien er sie sofort zu erkennen. Ihr war nicht wohl bei der Vorstellung, dass er sich Informationen über sie beschafft hatte. Thel gab nicht viel über sich preis, war nicht in den Sozialen Medien aktiv und auch ihre Homepage zeigte kein Bild von ihr. Doch der Mann an dem Tisch etwas abseits der anderen winkte ihr wie selbstverständlich zu. Sie tat so, als würde sie es nicht sofort bemerken und musterte ihn aus dem Augenwinkel.
Nicht nur für einen Italiener war seine Haut auffällig bleich. An einem Nebeltag hätte Thel ihn vermutlich für einen Vampir gehalten, aber so wie er hier im Morgenlicht saß, konnte das nicht sein. Seine Augen wurden von einer Sonnenbrille verdeckt. Sein graues Haar war glatt zurückgekämmt. Ob Conti sein richtiger Name war, würde sie nicht erfahren. Aber sie nahm an, dass jemand, der so viel Geld für einen Auftrag bot, etwas vorhatte, bei dem richtige Namen durchaus hinderlich waren. Kurz erwog sie, einfach wieder zu gehen. Auf irgendwelche krummen Dinger würde sie sich nicht einlassen.
Andererseits konnte es nicht schaden, sich den Auftrag zumindest anzuhören. Thel straffte die Schultern und schritt auf ihn zu. Seine Rechte, die er ihr zu Begrüßung hinstreckte, steckte in einem Handschuh. Seltsam für diese Jahreszeit. Es war Frühling. Die Luft war kühl, wo die Sonnenstrahlen sie nicht berührten. Doch es war eine milde Kühle, die wärmeres Wetter ankündigte. Thel mochte keine Berührungen – nicht mit Menschen. Doch sie gab sich einen Ruck und drückte die Hand so kurz wie möglich, ohne unhöflich zu wirken.
»Wie schön, dass Sie gekommen sind, Signorina.«
Signorina. Dem Wort haftete etwas an, das Thel nicht mochte. Es klang so zart. Und anständig. Nicht nach ihr, jedenfalls. Trotzdem lächelte sie. Schließlich musste sie Signore Vampirhaut nicht mögen, um sein Geld – wovon er offenbar reichlich besaß – anzunehmen. Genau genommen mochte sie die meisten Leute, die viel Geld besaßen, nicht. Geld lohnte sich nur, wenn man länger an einem Ort blieb – an einem Ort, an dem es Menschen gab.
Thel setzte sich nicht sofort. »Sie sagten, zehntausend.«
»Zehntausend, ja.« Conti nickte.
»Das lässt mich annehmen, dass meine Aufgabe entweder sehr gefährlich oder sehr verboten ist.«
»Ersteres«, sagte Conti bestimmt. »Aber nur, wenn Sie Pech haben, Signorina. Es könnte genauso gut sein, dass eine Nereide wie Sie nicht länger als zehn Minuten braucht, um dieses unbedeutende Objekt aus der Tiefe zu holen.«
Unbedeutend war das Ding ganz sicher nicht. Zumindest nicht für ihn. Thel faltete die Hände. Auf ihrer Homepage bot sie Tauchgänge an. Dass sie dafür keine Ausrüstung verwendete, hatte sie nirgendwo geschrieben. Wie kam der Kerl also auf die Idee, dass sie eine Nereide war? Die Vampirthese wurde wahrscheinlicher. Magische Wesen erkannten einander.
»Und wenn ich Pech habe?« Ihre Stimme klang barsch. Es war ihr Geschäftstonfall, der die Leute nicht wissen ließ, was sie in Wirklichkeit dachte. In diesem Fall an ihre Mutter, die der festen Überzeugung war, dass man Vampiren – unter anderem – nicht trauen konnte. Was genau das war, was andere über ihresgleichen sagten. Vielleicht war es deshalb so verlockend, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der wusste, dass es auch eine Welt hinter dem Offensichtlichen gab. Thel drückte selbstbewusst den Rücken durch.
Conti lächelte dünn.
»In diesem Fall spüren Sie unter Wasser Zauber, die sie … aus dem Gleichgewicht bringen könnten.«
Und Gleichgewicht war eine Übersetzung für? Dass er ihr nicht genau sagte, was auf sie zukam, machte ihn unsympathisch. Trotzdem ließ Thel sich auf den Stuhl fallen, hängte einen Arm über die Lehne und lächelte schief.
»Über mein Gleichgewicht müssen Sie sich keine Sorgen machen.«
Conti schlug mit der Hand auf den Tisch, sodass seine Espressotasse auf der Fläche klirrte.
»Das ist die Art von Arbeitshaltung, die ich schätze. Sie nehmen also an?«
Thel schlug die Beine übereinander. »Erzählen Sie mir mehr.«
Die Straßenlaternen hüllten die Stadt in gelbes Licht, das auf den Mauern glühte und im nachtschwarzen Wasser der Kanäle glitzerte. Die abendliche Kühle raubte der Luft ihre Schwere, sodass sie seltsam rein in Thels Lunge drang. Die Tagestouristen waren verschwunden und ließen die kleinen, abseits gelegenen Gässchen leer und dunkel zurück. Ohne die Blicke der Leute mochte sie die Stadt wirklich. Jeder Weg führte am Wasser vorbei. Jeder Atemzug ließ sie seine Gegenwart schmeckten. Vielleicht sollte sie eine Weile hierbleiben, sobald ihr Auftrag erledigt war. Wenn sie das Geld hatte, gab es in nächster Zeit erstmal keine Verpflichtungen mehr. Sie könnte hier Urlaub machen. Sie könnte wochenlang durch die Kanäle schwimmen, ohne aufzutauchen. In dem trüben Wasser würde sie kein Mensch jemals zu Gesicht bekommen. Ein Lächeln stahl sich auf ihre Lippen.
Sie passierte einige Bars, vor denen sich die Einheimischen zusammengefunden hatten und lachend an den Tischen standen. Manchmal wehte von drinnen Musik heraus. Wenn der Takt in Thels Ohren drang, spürte sie den drängenden Impuls zu singen.
Als Kind hatte sie viel gesungen. Zum Glück war die Insel so abgelegen, dass es meist nur ihre Familie gehört hatte. Thels Stimme war so schön, dass ihre Cousine Peisinoe immer eifersüchtig gewesen war. Es sei eine Schande, hatte Thels Mutter ihr erst kürzlich ins Handy gebrüllt. Welch Schande, dass sie ihr Talent so verkommen ließ. Thel sang nicht mehr. Nicht für Menschen. Nicht, wenn es nicht unbedingt sein musste und auf gar keinen Fall mehr als ein paar Töne. Deshalb biss sie sich auch jetzt auf die Zunge und zog weiter in den Norden der Stadt.
In den einsamen Gässchen standen die Hauswände oft so nah beieinander, dass kein Licht bis auf ihren Boden fiel und Thel sich ungesehen im Schatten bewegen konnte. Bald war das einzige Geräusch, das sie hörte, fernes Hundegebell und das wohlklingende Plätschern der Wogen, die an die Mauern schlugen.
Sie war allein. Der Kanal war vollkommen leer. Thel schlüpfte aus ihren Schuhen und platzierte sie zusammen mit einem Rucksack mit Kleidung zum Wechseln in einer Ecke. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie beides nicht wiederfand, war nicht zu unterschätzen. Es wäre nicht das erste Mal. Aber es gab Schlimmeres als in nasser Kleidung aus dem Meer aufzutauchen und den Rucksack nicht mehr zu finden. Ganz ohne Kleidung aufzutauchen zum Beispiel. Thel setzte an die erste Stelle ihrer gedanklichen Liste, sich mit Contis Geld einen neuen, wasserdichten Koffer zu kaufen. Danach ein wasserfestes Handy. Oder überhaupt – sie würde eine ganze Menge wasserdichte Dinge kaufen, um sich den Alltag zu erleichtern.
Thel ließ sich auf die Kaimauer nieder. Das Gluckern der Wellen lockte sie, hieß sie willkommen. Seit fünf Tagen war sie nicht mehr im Wasser gewesen. Es war längst überfällig. Thel schloss die Augen und glitt hinein.
Im ersten Moment spürte sie die Kälte des Meeres auf ihrer Haut wie eine eisige Umarmung. Thel nahm einen tiefen Atemzug. Wasser strömte in ihre Lungen und hinterließ ein vertrautes Gefühl der Ruhe und Wärme. Der Pulsschlag des Ozeans pochte in ihren Adern. Sie spürte die Gondeln, die an der Wasseroberfläche schaukelten. Sie hörte das Plätschern der Wellen an der Kaimauer. Sie fühlte den Tanz des Seegrases am Boden und die Bewegungen der Fische um sie herum. Es war anders als bei ihrer Familie in Griechenland. Der Geschmack des Wassers war dunkler. Trotzdem fühlte sie sich sofort Zuhause.
Thel blinzelte. Innerhalb der lichtlosen Schwärze des Wassers sah sie nicht wie über der Oberfläche. Doch ihre Sinne waren geschärft und ihre Umgebung zeichnete sich in ihrem Geist klarer ab, als sie sie hätte sehen können. Der Kanal ging in nur wenigen Metern ins Meer auf. Von dort aus musste sie weiter nach Norden, um den Ort, den Conti ihr beschrieben hatte, zu erreichen. Verfehlen würde sie ihn nicht, da war sie sich sicher. Ihr magisches Erbe hatte sie in dieser Hinsicht noch nie im Stich gelassen. Also begann sie zu schwimmen.
Sie war schneller als Menschen es je sein könnten. Die Wellen gehorchten ihr und trugen sie voran, egal in welche Richtung sie sich bewegte. Ihre Kleidung saugte sich voll und scheuerte an ihrer Haut, doch Thel hatte gelernt, das Gefühl zu ignorieren. Seit ihrer Geburt übte sie, sich im Ozean zu bewegen. Erneut spürte sie den Drang zu singen. Hier würde sie wohl auch niemand hören. Dennoch – es war besser, die Lippen verschlossen zu halten.
Sie fand ihren Rhythmus, sodass sie sich nicht mehr auf die Schwimmbewegungen konzentrieren musste. Stattdessen beobachtete sie den Lauf der Krebse am sandigen Boden.
Nach einer Weile veränderte sich der Klang des Meeres. Ein Geräusch mischte sich unter das Wellenrauschen, das sie hier unten noch nie gehört hatte. Es war, als würde jemand in eine Flöte blasen und ihr dabei seltsam tiefe Klänge entlocken. Es war nicht direkt eine Melodie, vielmehr eine Abfolge von Lauten, die ebenso willkürlich wie harmonisch in ihren Ohren wirkte und sich in ihren Geist eingrub, dass Thel glaubte, sie nie wieder vergessen zu können.
Sie hielt inne und ließ sich von der Strömung treiben. Conti hatte ihr nichts Genaues über den Gegenstand, den sie bringen sollte, erklärt. Nur, dass er sich in einem gesunkenen Schiff befand, lang war, spitz zulief und anscheinend aus einem Knochen gefertigt worden war.
Du wirst es merken, wenn du das Objekt vor dir hast, hatte Conti gesagt. Du wirst es spüren, Nereide.
Thel schwamm weiter. Die Flötentöne kamen aus der richtigen Richtung. Es konnte nicht schaden, der Sache nachzuspüren, auch wenn sich am Ende herausstellte, dass es sich um etwas anderes als das Artefakt handelte.
Je weiter sie vordrang, umso lauter wurden die Geräusche. Dann, als sie glaubte, schon ganz nahe zu sein, änderte sich etwas. Die Abfolge der Töne wurde schneller, drängender. Ein neuer Rhythmus verwirbelte die Melodie, die sie zuvor gespürt hatte.
Thel schüttelte den Kopf und sah sich um. Sie spürte den sandigen Boden unter sich. Die Schnecken und Krabben, weiter vorne eine unnatürliche Erhebung. War es das? Thel glitt näher heran. Das Wrack war vollständig mit Muscheln und Kalkablagerungen bedeckt, sodass man es kaum als Schiff erkannt hätte. Eine klaffende Öffnung befand sich zwischen den bewachsenen Pflanzen. Darunter lag tiefste Schwärze. Sie zog sich ein Stück hinab und lauschte. Die Flötenklänge kamen nicht von dort unten. Ihre Quelle musste vielmehr ein Stück über ihr liegen und es schien, als würden sie sich bewegen.
Thel zog die Brauen zusammen und drang noch tiefer in das Wrack ein. Nicht die Spur eines gefährlichen Zaubers wartete in der Finsternis. War es wahrscheinlicher, dass heute ihr Glückstag war oder dass die Dinge anders lagen, als Conti gesagt hatte?
Na egal. Zurückkommen konnte sie immer noch, falls sie nichts fand. Thel tauchte wieder aus dem Wrack heraus und folgte den Flötentönen. Jetzt waren sie leiser als zuvor und sie war sich sicher, dass sich das Ding von ihr entfernte. Also beschleunigte sie ihr Tempo.
Die Melodie füllte ihren Geist aus, sodass Thel die Veränderung der Wasserströmung viel zu spät bemerkte. Die Wasserwirbel, die ihre Haut berührten, mussten von den mächtigen Flossenschlägen eines viel zu großen Fisches stammen – oder von etwas anderem, sie konnte es nicht genau sagen. Es gab in der Lagune keine Tiere dieser Größe.
Es war einfach, der seltsamen Melodie zu folgen. Die Wassermassen umspielten Thel viel leichter, je näher sie der Wasseroberfläche kam. Die Schwärze des Ozeans wurde immer mehr von matten Morgensonnenstrahlen verdrängt, die vor ihr einen Wald aus Lichtsäulen bildeten. Thel war überrascht, wie viel Zeit vergangen war, seit sie ihre Suche begonnen hatte. Andererseits – unter Wasser spürte sie die Stunden nie.
Endlich erkannte sie vor sich eine Gestalt. Ein schwarzer Schemen kämpfte sich durchs Zwischenlicht. Thel verdoppelte ihre Anstrengungen, ihn einzuholen und schärfte ihre Sinne. Das Wasser umschloss einen kräftigen schuppigen Körper und weiches Haar.
Was …? Das Wesen war definitiv kein Fisch. Der hintere Teil seines Körpers endete zwar in einer Flosse, doch der vordere erinnerte vielmehr an ein Pferd. In der Tiefe wäre es mit seinem schwarzen Fell unsichtbar gewesen, doch hier erkannte Thel seine Konturen deutlich. Die kurze Mähne wirbelte in den Wellen und die Augen blitzten wie Saphire. Zwischen seinen Zähnen steckte eine Art Speer von weißgelber Farbe. Die Widerhaken vorne sahen scharf aus. Der Schaft hingegen war von unzähligen Löchern durchsetzt, in die das Wasser drang und mit Silberklängen wieder heraustrat.
Jetzt, da die Geräusche so nahe waren, flatterte Thels Herz. Egal, ob das Ding das Objekt war, das Conti suchte, oder nicht. Sie wollte es haben.
Thel schoss von der Seite auf das Pferd zu und schlang die Arme um seinen Hals. Es warf den Kopf herum. Die kräftige Bewegung schüttelte Thel beinahe ab, doch dann bekam sie die Haare der Mähne zu fassen und krallte die Finger hinein. Das Zucken des Pferdes riss sie herum und auf einmal stieß ein Huf gegen ihre Brust. Thel schrie auf und ein Schwarm silberner Bläschen trieb aus ihrem Mund. Schmerz pochte heiß auf ihrer Haut.
Das Mistding blickte sie mit blauen Augen an, fast hämisch. Na warte. Thel strampelte mit den Beinen und warf sich dem Pferd erneut entgegen. Dieses Mal tat sie nur so, als wolle sie seinen Hals packen und drehte sich im letzten Moment, um stattdessen den Speerschaft zu umklammern. Der Ruck riss den Kiefer des Pferdes nach unten. Der Druck verschwand, sodass Thel nun den Speer allein hielt und damit durchs Wasser trudelte. Ein Blitz schoss unter ihre Haut und durchfuhr sie mit solcher Kraft, dass einen Moment lang alles vor ihren Augen weiß wurde. Die Flötentöne hämmerten auf einmal direkt hinter ihrer Stirn und formten eine Melodie, die sie kannte. Es klang nach ihrer Insel in Griechenland. Sie dachte an Peisinoe beim Singen. Wie sie ihr Haar kämmte und dabei so harmlos aussah, dass kein Mensch ahnen konnte, wie sehr sie bereit war zu töten. Auch Thels Mutter hatte dieses Lied gesungen. Alle Sirenen kannten es. Es war die Musik, die Seefahrer ins Verderben lockte. Thel hatte sie lange nicht mehr gehört. Sie schrie auf und versuchte die Laute aus ihrem Kopf zu verdrängen.
Ihre Bewegungen hatten den Takt verloren. Thel blinzelte heftig. Strampelnd versuchte sie, ihr Gleichgewicht wiederzufinden. Das Geräusch von Motoren vibrierte durchs Wasser.
Ich singe nicht! Nicht das. Nicht jetzt. Die Tonfolge stieg auf und endete in einem schrillen Staccato. Es war nicht mehr das Lied ihrer Mutter, sondern eine verzerrte Version davon, vermischt mit einem schrecklichen Motorendröhnen.
Über ihr raubte ein Schatten dem Wasser das Licht. Etwas Schwarzes zuckte vor ihr durch ihr Sichtfeld. Dann donnerte der Lärm von allen Seiten auf sie ein und etwas traf sie am Kopf.
Über ihr breitete sich ein gelber Morgenhimmel aus. Gras kitzelte ihre Wange, Pflanzen stachen in ihren Rücken. Über ihrem Kopf summten Insekten. Thel blinzelte ein paar Mal. Ihre nasse Kleidung klebte unangenehm kalt an ihrer Haut. Irgendwo in der Nähe hustete jemand.
Thel fuhr in die Höhe. Neben ihr im Gras stand ein junger Mann, vermutlich in ihrem Alter. Er beachtete sie nicht, sondern bückte sich nach etwas, das vor ihm auf dem Boden lag. Seine Kleidung war genauso nass wie ihre. Sein schwarzes Haar klebte ihm an der Stirn. Er hob einen Gegenstand auf. Ein langer weißer Speer, Löcher im Schaft und Widerhaken an der Spitze. Keine Flötentöne waren zu hören, aber trotzdem brauchte Thel nicht lange zu überlegen.
Sie öffnete den Mund und wollte den Fremden schon anfahren, er solle das Ding hergeben, oder … Dann fiel ihr auf, dass es kein oder gab. Thel schluckte. Sie sang nicht mehr. Sie hatte ewig nicht mehr gesungen. Sie hasste die trüben Blicke, die die Menschen bekamen, wenn sie ihre Stimme hörten. Wenn sie schon von hirnlosen Idioten umgeben war, dann wollte sie zumindest nicht diejenige sein, die die Leute dazu gemacht hatte, indem sie ihnen den Verstand wegsang. Ihre Cousine Peisinoe hatte schon unzählige Male versucht, ihr die vielen Vorteile der hirnlosen Idioten zu erklären. Tja … Thel hielt Peisinoe für eine dämliche Ziege. Daran würde sich auch nichts ändern.
Also, welche Möglichkeiten hatte sie? Aufspringen, dem Kerl in den Magen treten, ihm den Speer entreißen und … Sich von hinten anschleichen, ihn überraschend niederschlagen und … Es war albern. Rohe Gewalt war nicht besser als ein paar Töne. Und wenn sie nur ein bisschen …? Okay. Thel nahm sich fest vor, sich zu zügeln. Nur ein paar Zeilen. Mehr nicht.
Thel räusperte sich. Erschrocken fuhr der Fremde zu ihr herum, den Speer immer noch in der Hand.
»Komm her zu mir«, sang Thel. Die Worte flossen aus ihr heraus, zäh wie Honig. Nun, sie war nicht in Übung. Thel kam auf die Beine. »Komm her zu mir und gib mir den Speer«, sang sie weiter.
Seine Augen waren blau. Es war eine unnatürlich leuchtende Farbe, die sie an Kornblumen denken ließ. Er starrte sie an. So wie jeder eine Sirene anstarrte, wenn sie zu singen begann. Thel zwang sich zu einem Lächeln und wiederholte ihre Worte. Er stand nur ein paar Schritte entfernt. Jetzt fiel ihr auf, dass in seinem schwarzen Haar derselbe blaue Schimmer wie in seinen Augen lag. Seine Haut war nicht bleich, aber doch so hell, als wäre er nicht oft in der Sonne.
Endlich kam er auf sie zu. Thel versuchte, nicht den Speer zu fixieren, sondern dem Blick der blauen Augen standzuhalten. In seinem Gesicht stand nicht dasselbe leere Verlangen, das sie von anderen Opfern des Sirenengesangs kannte, aber immerhin eine offensichtliche Verwirrtheit. Nun, das musste reichen. Als er direkt vor ihr stand, streckte Thel die Hand aus und schloss die Finger um den Speer, um sanft daran zu ziehen. Er ließ ihn nicht los. Thel zog heftiger und verstärkte ihre Stimme. Doch der Trottel hielt den Schaft weiterhin eisern fest. Na toll. Kaum, dass sie es zur Abwechslung mal versuchte, funktionierte es nicht einmal. Sie war wirklich eine lausige Sirene.
Okay, es gab natürlich noch weitere Möglichkeiten, ihre Magie wirksamer zu gestalten. Nicht, dass sie sonderlich erpicht darauf gewesen wäre. Ihre blieb also die Wahl zwischen zehntausend Euro und ihrem Stolz. Ach komm. Brauchte ja niemand zu wissen. Thel lächelte den Fremden noch einmal an, schlang die Arme um seine Brust und küsste ihn.
Ihre Sirenenmagie floss in seinen Körper, um ihm seine Kraft zu rauben. Thel wusste, sie konnte den armen Narr umbringen, doch natürlich würde sie das nicht tun. So war sie nicht und würde es auch niemals sein. Sie würde ihn nur ein wenig benebeln und rechtzeitig aufhören. Dann würde sie sich den Speer schnappen und … Er erwiderte ihren Kuss und ein seltsames Kribbeln zuckte durch ihre Adern und ließ ihr Herz flattern wie einen Vogel im Käfig. Was bei Poseidon war das denn? Wärme breitete sich in ihrer Brust aus und Thel sank in einen Fluss aus Kornblumenlicht. Sie wollte nie wieder daraus auftauchen. Sie wollte für immer in den Armen dieses Fremden bleiben. Sie wollte …
Von plötzlichem Entsetzen gepackt riss Thel sich los. Der Fremde rang nach Luft und blickte sie genauso erschrocken an, wie sie sich fühlte. Eine knisternde Stille hing zwischen ihnen. Thels Herz pochte unnatürlich laut in ihrer Brust und ihr Blut rauschte heiß durch ihren Kopf.
Dann räusperte er sich. »Es … ist kein Speer, sondern eine Harpune«, sagte er auf Englisch.
»Was?«, schnappte Thel.
Der Fremde wirbelte herum und rannte in Richtung Wasser davon, den Speer immer noch in der Hand. Sie war viel zu perplex, um ihn zu verfolgen.
Es hätte nicht sein dürfen. Thel saß frierend unter den Bäumen auf der Mauer eines Kanals und blickte in das grüne Wasser unter sich. Sie wusste nicht, wie sie auf dieser kleinen, dicht bewachsenen Insel gelandet war. Aber sie befand sich wohl ein ganzes Stück von Venedig entfernt. Thel würde zurückschwimmen, doch nicht jetzt. Sie war nicht in Stimmung und außerdem hätte sie jemand sehen können.
Ihr gegenüber befanden sich einige heruntergekommene Häuser aus rötlichem und weißen Stein. Ein Boot, von dessen Planken der grüne Lack abblätterte, war an einen rostigen Ring gebunden und schaukelte im Wasser. Zum Glück jedoch waren im Moment keine Menschen in der Nähe.
Thel massierte sich die Nasenwurzel und versuchte die Erinnerung an den warmen kornblumenblauen Fluss aus ihrem Geist zu verdrängen. Doch er blieb beharrlich in ihren Gedanken – und mit ihm der Fremde.
Der Typ hätte viel zu benebelt zum Sprechen sein müssen. Und sie hätte nichts spüren dürfen – jedenfalls nicht das. Es war, als hätte sie bei dem Kuss ihre eigene Magie gefühlt – oder zumindest eine Form von Magie, die ihrer ganz ähnlich war. War das denn möglich? Alle Sirenen, die sie kannte, waren weiblich – und außerdem mit ihr verwandt. Es hatte noch nie männliche Nachkommen gegeben. In Jahrtausenden nicht! Im Übrigen hatte der Fremde nicht einmal gesungen.
Verdammt, sie hätte ihm hinterherlaufen müssen, um ihn zur Rede zu stellen. Und natürlich, um ihm den Speer wegzunehmen. Verdammt, der Speer! Sie hatte bei ihren Aufträgen noch nie versagt. Zugegebenermaßen waren ihre Aufträge bisher immer deutlich einfacher gewesen. Meistens fischte sie nur Gegenstände aus dem Wasser, die irgendwelche Idioten beim Bootsausflug versehentlich fallen gelassen hatten, und die Thel hinterher bezahlten, sie ihnen zurückzubringen. Ausgerechnet jetzt, wenn sie einmal einen wirklich lohnenden Auftrag hatte, musste sie versagen. Und das alles nur wegen irgendeinem Kerl …
Thel biss sich auf die Zunge. Genug! Sie fror, sie hatte Hunger und sie musste zurück zu Conti. Die ganze Sache aufzuschieben half ja doch nichts. Besser, sie sagte ihm, was Sache war, bevor sie sich einfach aus dem Staub machte. Wenn sie es geschickt formulierte, würde er ihr vielleicht nicht einmal eine negative Bewertung auf der Homepage hinterlassen.
Also rappelte sie sich in die Höhe und kämpfte sich durch die Sträucher zurück zum Ufer, wo sie aufgewacht war. Nach einem kurzen Kontrollblick in die menschenleere Umgebung watete sie ins Wasser, bis es tief genug war, um unterzutauchen. Schnell spürte sie die Kälte nicht mehr. Sie schwamm ein Stück, dann ließ sie sich treiben und schloss die Augen. Nur zart drangen die Geräusche von Flossenschlägen an ihr Ohr. Leise rauschten die Wellen. Die Flötentöne im Ozean waren verstummt.
Conti hatte darauf bestanden, dass sie mit dem Objekt in sein Hotel kam, sobald sie es hatte. Thel hätte sich viel lieber wieder im Café mit ihm getroffen, aber sie konnte verstehen, dass er fürchtete, jemand Falsches könnte sein geliebtes, teuer bezahltes Artefakt zu Gesicht bekommen. Sein Zimmer lag im ersten Stock, sodass sie nach einer Treppe auch noch einen schmalen, spärlich beleuchteten Flur durchqueren musste, bis sie die Tür mit der richtigen Nummer fand.
Sie holte tief Luft und klopfte. Ein paar Sekunden lang blieb es still im Raum dahinter und Thel fürchtete schon, er wäre nicht da und sie hätte den Weg umsonst gemacht. Dann hörte sie Schritte und die Tür schwang auf.
Wäre es nicht unmöglich gewesen, hätte sie gesagt, seine Haut wirke heute sogar noch bleicher als gestern. Diesmal hing ihm das graue Haar wirr ins Gesicht und er trug keine Sonnenbrille. Seine Augen waren seltsam farblos. Obwohl es nicht kalt war, fröstelte Thel.
»Signorina.« Contis Mundwinkel formten etwas, das vermutlich ein Lächeln sein sollte, doch der Rest seines Gesichts blieb starr. »Kommen Sie doch herein.«
Er trat zurück und machte eine einladende Geste, die bei Thel genau das Gegenteil bewirkte. Doch sie riss sich zusammen und schob sich widerwillig an ihm vorbei.
Eine einzelne Lampe am Nachttisch spendete gelbes Licht, ansonsten war es dunkel. Thel mochte das Zimmer nicht. Die Wände waren mit beigem Stoff bezogen. Die Möbel verströmten den Geruch des Alters und die Vorhänge wirkten so schwer und starr, als bestünden sie aus Stein. Conti deutete auf zwei Gläser und steuerte die Minibar an, doch Thel schüttelte den Kopf. Er zuckte mit den Schultern und schenkte sich selbst ein. Ihr entging nicht, dass er keinen Schluck nahm. Jetzt fiel ihr auch wieder ein, dass er keinen Kaffee getrunken hatte. Gestern hatte zwar eine Tasse neben ihm gestanden, doch sie war voll gewesen und er hatte sie nicht angerührt. Irgendwas stimmte nicht mit dem Kerl. Besser, sie machte, dass sie von hier fortkam.
»Ich nehme an, Sie waren erfolgreich, Signorina Thelxiope?«, fragte Conti mit einem weiteren starren Lächeln.
So, Vampirhaut hatte also ihren vollen Vornamen erraten. Thel knirschte mit den Zähnen. Nur ihre Familie nannte sie so – und das würde auch so bleiben.
»Der Gegenstand, den ich bergen sollte, war nicht mehr im Wrack.«
Contis graue Brauen hoben sich ein wenig. »Ach?«
»Tut mir leid«, sagte Thel und wandte sich zum Gehen. Nun, geschickt formulieren ging anders. Wann lernte sie endlich, sich ihre Worte vorher zu überlegen?
»Nicht mehr?«, fragte Conti. »Sie sagten, er wäre nicht mehr dort gewesen.«
Thel biss sich auf die Zunge. Jetzt begannen also die Rechtfertigungen. Irgendwie hatte sie das Gefühl, es wäre besser, ihm nicht alles zu erzählen. Er brauchte nicht von dem Kampf mit dem Pferd zu wissen, sonst würde er sie nur für schwach halten. Thel drehte sich zu ihm um und hob lässig die Schultern.
»Ich habe das Wrack an der Stelle gefunden, wo Sie es vermutet haben. Ich bin hinein getaucht und habe es durchsucht, aber nichts gefunden, das auch nur annähernd ihrer Beschreibung entsprochen hätte oder mich irgendeine Art von Magie hätte vermuten lassen. Was ich gefunden habe, waren weggebrochene Muscheln, weshalb ich vermute, dass jemand vor kurzem dort unten war und das Objekt geborgen hat.« So. Sie fand es glaubhaft.
Contis Lippen kräuselten sich. »Das ist ausgesprochen bedauerlich. Haben Sie eine Vermutung, wer das gewesen sein könnte?«
Ein verdammter Gestaltwandler, der gegen ihre Magie beinahe immun war.
»Natürlich nicht«, entgegnete Thel ärgerlich.
»Sie haben sicherlich Verständnis, dass ich Ihnen unter diesen Umständen nicht den abgesprochenen Betrag auszahlen kann. Aber für ihre Umstände werde ich Sie natürlich entschädigen.«
»Nicht nötig«, brummte Thel. Sie wollte mit dem unsympathischen Kerl nichts mehr zu tun haben. Bei all dem Wasser in dieser Stadt würde sie bestimmt einen anderen Auftrag finden, der sie über die Runden brachte. »Auf Wiedersehen.«
»Warten Sie doch bitte noch einen Moment, Signorina Thelxiope«, sagte Conti und ging zu seinem Nachttischschrank.
Thels Hand lag bereits auf der Klinke. Sie rollte entnervt mit den Augen. »Was ist denn noch?«
Conti fuhr herum und richtete eine Waffe auf sie. Thel starrte auf die Pistolenmündung und fragte sich, ob das ein Witz war. Schließlich passierte so etwas nur in blöden Filmen.
Conti befeuchtete sich die Lippen. »Ich fürchte, ich kann Sie nicht gehen lassen.«
»Wer sind Sie, die Mafia?« Thel schnaubte. »Da unten war nichts außer Muscheln, ein paar morscher Bretter und Fischscheiße. Also lassen Sie mich gefälligst in Ruhe.«
»Oh, das hat nichts mit dem Auftrag zu tun«, erklärte Conti und kam langsam näher. »Auch, wenn Sie mir den Gae Bolga gebracht hätten, hätte ich Sie nicht gehen lassen können.« Er lächelte dünn. Seine Haut wirkte dabei seltsam papiern. »Sehen Sie, ich habe ein besonderes Verhältnis zu magischen Wasserwesen, wie Sie eines sind, meine kleine Nereide. Ich brauche solche wie Sie, damit ich weiterleben kann. Genau genommen«, er legte den Kopf schief, »brauche ich Ihr Blut.«
Oh verdammt, der Typ war ein Psychopath. Thel wagte es nicht, sich zu rühren, aus Angst, dass er plötzlich abdrückte. Also öffnete sie nur den Mund, räusperte sich und … begann zu singen.
»Tritt zurück.« Der Klang ihrer Stimme füllte den Raum. »Dreh dich um.«
Contis Augen weiteten sich. Die Waffe in seiner Hand zitterte, aber die Mündung blieb weiter beharrlich auf Thels Gesicht gerichtet. Und wenn er doch ein Vampir war? Wie andere magische Wesen auf ihre Fähigkeiten reagierten, war ganz unterschiedlich, aber es konnte schon mal passieren, dass sie Möglichkeiten fanden, sich irgendwie vor ihrem Gesang abzuschirmen. Sie verstärkte ihre Stimme und bedachte Conti mit einem mühsamen Lächeln. Dabei drückte sich langsam die Klinke herunter.
Conti schüttelte wild den Kopf.
»Nicht, Signorina«, stieß er mühsam hervor.
Thel riss die Tür auf und rannte hinaus. Im selben Moment peitschte ein Schuss durch die Luft. Sie spürte einen Schlag im Arm, gefolgt von klebriger Wärme. Doch sie rannte weiter, sprintete die Treppe des Hotels hinunter und lief mit tränenden Augen durch das Foyer. Schwindel erfasste sie, doch sie zwang ihre Beine, weiter zu rennen. Durch die Tür und hinaus in die dämmrige Stadt, mit einem Satz hinein in den nächsten Kanal. Sie hörte noch erschrockene Stimmen hinter sich, bevor sie untertauchte und das Wasser sie wohltuend umfing.
Thel sank auf den Boden in den Schlick. Neben ihr lag ein Stuhl, der irgendwie den Weg auf den Grund des Kanals gefunden haben musste. Einen Moment lang verharrte sie und riskierte einen Blick auf ihren Arm. Eine Blutwolke wirbelte durchs Wasser. Thel schrie auf und tastete nach der Wunde. Als würde der Anblick reichen, bebte brennend heißer Schmerz durch ihren Körper.
Eine Gondel glitt über sie hinweg und erinnerte sie daran, dass sie nicht einfach hierbleiben konnte. Wahrscheinlich stand Conti oben am Kai, bereit, erneut abzudrücken, sobald er eine Bewegung unter Wasser sah. Also schloss sie die Augen, zählte einmal bis zehn und glitt dann vorsichtig voran. Sie schwamm ein Stück, bis sie weit genug vom Hotel entfernt war, dass sie es wagte, ihr Tempo zu beschleunigen. Dann schoss sie voran durchs Wasser, bis sie nicht mehr konnte und sich müde am Boden zusammenrollte.
Fische stupsten sie an und kniffen ihr in die Haut. Thel riss die Augen auf. »Haut ab, ich bin nicht tot!«, rief sie. Obwohl die Tiere es nicht verstehen konnten, stoben sie doch auseinander.
Thel richtete sich auf. Offenbar war die Nacht über der Stadt hereingebrochen, denn weit über ihr schimmerten die gelborangen Lichter der Straßenlaternen inmitten der Dunkelheit. Thel hätte gerne gewusst, wie spät es war, doch sie trug keine Uhr. Ihre Haare wirbelten im Wasser. Offenbar hatte sich ihr Zopf bei ihrer Flucht gelöst.
Vorsichtig tastete sie nach ihrem Arm und spürte Schorf auf der Wunde. Also riskierte sie einen Blick. Offenbar war es ein Streifschuss gewesen, mit dem Conti sie erwischt hatte. Nun, Wesen wie sie waren zäh und das Meer hatte bisher noch immer alles geheilt, was ihr zugestoßen war. Was ihrem Körper zugestoßen war, zumindest. Wenn ihr Conti allerdings in den Kopf geschossen hätte, wäre sie wohl trotzdem tot gewesen. Thel atmete durch die Nase aus und spürte das Kribbeln der aufsteigenden Luftblasen auf ihrer Haut. Zum Glück hatte sie ihm nicht gesagt, dass sie eine Sirene war. Zum Glück sagte sie niemandem, dass sie eine Sirene war. Das brachte nur Scherereien.
Thel begann zu schwimmen, um einen kleinen Kanalarm zu finden, der nicht von Straßenlaternen gesäumt war, sodass sie unauffällig auftauchen konnte.
Und dann?
Thel hielt inne. Was, wenn Conti wusste, in welchem Hotel sie sich eingemietet hatte? Was, wenn er nach ihr suchte? Und selbst wenn nicht – die Stadt war klein genug, dass sie sich auch rein zufällig erneut über den Weg laufen konnten. Bei Poseidon! Thel stieß einen Schrei aus, der sich unter das Rauschen der Wellen mischte. Was sollte sie machen? Abhauen und den Mistkerl damit durchkommen lassen, dass er sie angeschossen hatte? Oder bleiben und ihm eine Falle stellen – und damit riskieren, dass er erneut auf sie schoss und beim zweiten Mal wie vorgesehen traf? Aber er würde das doch wohl kaum vor Zeugen machen, oder doch? Dann wäre sie sicher, solange sie unter Leuten war. Andererseits würde sie nicht auf Contis Vernunft vertrauen. Vielleicht würde er es darauf anlegen. Wer wusste das schon.
Okay, alles der Reihe nach. Sie musste auf jeden Fall zurück ins Hotel, schließlich waren ihre Sachen noch dort. Dann musste sie sich umziehen. Dann sollte sie sich anderswo ein Zimmer nehmen und dort konnte sie dann zumindest eine Weile nachdenken – hoffentlich. Innerhalb eines kreativen Umfelds würden ihr mit Sicherheit Möglichkeiten einfallen, ihn büßen zu lassen. Zumindest darauf konnte sie vertrauen.
Die Räder von Thels Koffer holperten über die Pflastersteine. Der Abend war noch jung, aber schon jetzt waren die Menschenmassen deutlich zurückgegangen und ließen die Gassen Venedigs unheilvoll leer zurück. Thel wählte nur die breiten, gut besuchten Wege und erreichte auf diese Art unbeschadet das nächste Vaporetto.
Es waren nicht viele Leute hier. Eine Familie mit zwei Kindern saß schräg neben ihr und ein paar Reihen vor ihr hockte ein Mann und drückte die Nase gegen die Scheibe. Die junge Frau vor ihm wandte sich immer wieder um und spielte auffällig mit ihrem rot gefärbten Haar, doch er reagierte nicht darauf, sodass sie irgendwann eine ärgerliche Grimasse schnitt und es sein ließ. Thel musste schmunzeln und lehnte sich zurück. Der Plastikstuhl war unbequem und das Geräusch der Motoren dröhnte viel zu laut in ihren Ohren. Das Schiff zockelte für ihren Geschmack deutlich zu langsam voran, sodass ihr nichts anderes übrigblieb, als ebenfalls aus dem Fenster zu schauen.
An der nächsten Haltestation stiegen sowohl die Rothaarige als auch die Familie aus, sodass Thel und der Mann allein zurückblieben. Er war definitiv nicht Conti, aber trotzdem hatte sie auf einmal kein gutes Gefühl mehr. Thel riskierte einen weiteren Blick, doch er schien sich nicht bewegt zu haben und stierte noch immer in derselben angespannten Haltung hinaus. Auf dem Sitz neben ihm ragte ein in Papier gepackter länglicher Gegenstand in die Höhe, der Thels Aufmerksamkeit erregte. Er war schlampig verpackt, sodass die Hülle an einer Stelle aufklaffte und den Blick auf einen weißen Stab freigab. Das konnte doch nicht …? Thel sah den Fremden noch einmal genauer an. Seine schwarzen Haare waren nass.
Oh scheiße! Schnell zog sie den Kopf ein.
Es wäre nicht nötig gewesen. Er starrte derart gedankenverloren aus dem Fenster, dass er wahrscheinlich noch nicht einmal gemerkt hätte, wenn plötzlich ein Ufo vom Himmel gefallen wäre.
Eigentlich hatte sie nicht vorgehabt, an der nächsten Station auszusteigen. Aber was sollte sie machen, wenn er aufstand? Dann würde er an ihr vorbeigehen und sie bemerken. Aber wenn sie zu früh ausstieg, war sie in der Nähe von Contis Hotel und das musste nun wirklich nicht sein. Und wenn sie es darauf ankommen ließ und doch noch eine Station wartete? Und wenn … sie einfach aufhörte so eine feige Nuss zu sein und die Sache regelte? Fremde Männer anzusprechen sollte Sirenen doch im Blut liegen. Naja, genau genommen würde eine Sirene einen fremden Mann eher ansingen. Zu schade, dass es in diesem Fall nicht funktionierte.
Thel stand auf, straffte sich und ging zu ihm vor. Als sie neben ihm stand, griff er hastig nach dem Speer und zog ihn zu sich herüber. Dann blickte er sie an. Seine Augen weiteten sich ein wenig.
»Hallo«, sagte Thel und setzte sich ohne Umschweife neben ihn.
»Hallo«, entgegnete er.
Thel holte Luft und lächelte schief. »Sind wir uns nicht schon einmal begegnet?«, fragte sie auf Englisch.
Er lächelte ebenfalls. »Gut möglich.« Sein Akzent war schottisch, tippte sie.
»Mein Name ist Thel«, stellte sie sich vor und hielt ihm die Hand hin.
Einen Moment lang beäugte er sie misstrauisch, bevor er den Speer in die Linke nahm und ihre Finger mit der Rechten ergriff.
»Cailan«, sagte er. Seine Berührung war kühl, als hätte er kein Blut in den Adern. Verdammt, der war nicht auch ein Vampir, oder?
»Also«, Thel schluckte, »ich will dir dieses Ding nicht mehr wegnehmen, okay? Du brauchst es nicht so zu umklammern. Ich habe einfach nur eine Frage. Oder zwei.«
Er hob eine Braue. »Ich habe dich mit meinem Huf am Kopf erwischt, als ich dich von dem Boot wegziehen wollte, da bist du bewusstlos geworden. Also habe ich dich ans Ufer gezerrt. Ich habe dazu in deinen Knöchel gebissen, wenn du es genau wissen willst. Es war anstrengend.«
Gebissen? Hatte er gerade gebissen gesagt? Ähm. »Warum?«
»Weil du schwer bist und ich gleichzeitig den Gae Bolga mitnehmen musste«, sagte Cailan.
Machte der sich gerade über sie lustig? »Das meinte ich nicht. Warum hast du mich aus dem Wasser gezogen?«
»Weil ich mir nicht sicher war, wie lange du im Meer bleiben kannst.«
»Es hätte dich nicht kümmern brauchen, was aus mir wird.«
Cailan schwieg. Das Vaporetto erreichte die nächste Haltestelle, doch niemand stand am Steg. Cailan lehnte sich zurück und wirkte dabei fast ein wenig lässig. Doch das Lächeln auf seinen Lippen war angespannt.
»Ich bin eben manchmal ein recht netter Kerl und fresse nur ganz selten Jungfrauen«, sagte er leichthin.
Thel schnaubte. »Wenn du eine unschuldige Jungfrau suchst, bist du bei mir an der falschen Adresse.«
Cailans Lächeln erlosch. »Nein, du bist … eine Sirene?«
Er benutzte das Wort irgendwie anders als andere. Ganz ohne Abscheu.
»Ja.« Thel musterte ihn. »Ich bin eine Frau, die jeden, mit dem sie zusammen sein will, irgendwann umbringt.«
Cailan nickte. »Kenne ich.«
»Andere Sirenen?«, fragte Thel.
»Nein, dein Problem. Das kenne ich. Ich bin ein Kelpie.«
Aha. Thel befeuchtete sich die Lippen. »Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.«
Cailan zog die Brauen zusammen. »Ein Kelpie«, wiederholte er. »Ein Wasserdämon. So wie du.«
»Wirklich?« Thels Mund war auf einmal trocken. »Ich dachte, das mit dem Jungfrauen-fressen war ein Witz.«
»Naja.« Cailan räusperte sich. »Wir leben im 21. Jahrhundert. Jungfrauen-fressen ist aus der Mode gekommen, meinst du nicht?«