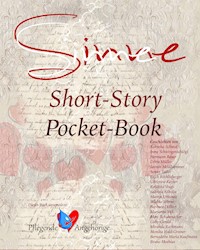Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Der Krieg gehört mir nicht. Noch nicht.« Ein Kaiser auf der anderen Seite des Meeres. Eine Stadt in der Wüste. Tanzende Lichter im Sand. Und eine nahende Schlacht, die sich wie ein Sturm am Horizont zusammenbraut. Als der Kaiser von Morretberg Kraburg den Krieg erklärt, gibt es nur eine denkbare Option: zurückzuschlagen. Doch während die kraburgischen Truppen durch eine endlose Sandwüste marschieren und im Feindesland einen Kampf nach dem anderen ausfechten, erkennt Oberst Sveno Tsabaca, dass es dabei um mehr geht als den Krieg zweier Reiche: Denn Schatten der Vergangenheit sind erwacht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Kornelia Schmid wurde 1993 in Regensburg geboren und hat dort Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Geschichten hat sie schon in der Grundschule geschrieben – und nicht damit aufgehört. Im Alter von zwölf Jahren entstand ihr erster Roman über ein magisches Schwert, der seitdem ein Schattendasein auf der Festplatte fristet. Seit 2016 veröffentlicht sie in Anthologien regelmäßig Kurzgeschichten unterschiedlicher Genres der Fantastik, wobei sie am liebsten in magische Welten eintaucht. Inzwischen hat sie sich das Schreiben zum Beruf gemacht und arbeitet als Redakteurin in München. Mit »Das Licht im Sand« ist der zweite Teil ihrer Romantrilogie »Herrscher des Lichts« erschienen.
Inhalt
Kapitel 1 8
Kapitel 2 11
Kapitel 3 16
Kapitel 4 21
Kapitel 5 25
Kapitel 6 32
Kapitel 7 35
Kapitel 8 40
Kapitel 9 44
Kapitel 10 46
Kapitel 11 49
Kapitel 12 52
Kapitel 13 55
Kapitel 14 59
Kapitel 15 62
Kapitel 16 66
Kapitel 17 70
Kapitel 18 71
Kapitel 19 73
Kapitel 20 74
Kapitel 21 78
Kapitel 22 82
Kapitel 23 83
Kapitel 24 87
Kapitel 25 89
Kapitel 26 92
Kapitel 27 96
Kapitel 28 100
Kapitel 29 104
Kapitel 30 109
Kapitel 31 113
Kapitel 32 117
Kapitel 33 120
Kapitel 34 123
Kapitel 35 124
Kapitel 36 126
Kapitel 37 129
Kapitel 38 133
Kapitel 39 137
Kapitel 40 141
Kapitel 41 142
Kapitel 42 145
Kapitel 43 150
Kapitel 44 154
Kapitel 45 159
Kapitel 46 163
Kapitel 47 167
Kapitel 48 170
Kapitel 49 173
Kapitel 50 177
Kapitel 51 178
Kapitel 52 184
Kapitel 53 189
Kapitel 54 194
Kapitel 55 198
Kapitel 56 202
Kapitel 57 206
Kapitel 58 209
Kapitel 59 216
Kapitel 60 220
Kapitel 61 224
Kapitel 62 228
Kapitel 63 229
Kapitel 64 234
Kapitel 65 235
Kapitel 66 241
Kapitel 67 242
Kapitel 68 245
Kapitel 69 249
Kapitel 70 254
Kapitel 71 258
Kapitel 72 261
Kapitel 73 267
Kapitel 74 270
Kapitel 75 273
Kapitel 76 278
Kapitel 77 281
Kapitel 78 283
Kapitel 79 287
Kapitel 80 291
Kapitel 81 295
Kapitel 82 302
Kapitel 83 306
Kapitel 84 312
Kapitel 85 315
Kapitel 86 321
Kapitel 87 324
Kapitel 88 327
Kapitel 89 329
Kapitel 90 333
Kapitel 91 338
Kapitel 92 341
Kapitel 93 344
Kapitel 94 353
Kapitel 95 358
Kapitel 96 361
Kapitel 97 364
Kapitel 98 369
Kapitel 99 372
Kapitel 100 380
Kapitel 101 384
Kapitel 102 386
Kapitel 103 389
Kapitel 104 392
Kapitel 105 395
Kapitel 106 398
Kapitel 107 401
Kapitel 108 403
Danksagung 405
WREADERS E-BOOK
Band 231
Dieser Titel ist auch als Taschenbuch erschienen
Vollständige E-Book-Ausgabe
Copyright © 2024 by Wreaders Verlag, Sassenberg
Verlagsleitung: Lena Weinert
Druck: BoD – Books on Demand, Norderstedt
Umschlaggestaltung: Saskia Ziegenbalg, Jasmin Kreilmann
Lektorat: Alina Lindecke, Sina Kleber
Satz: Annina Anderhalden
www.wreaders.de
Das Jahr 673 kraburgischer Zeitrechnung
Kapitel 1
Ferretshafen, 24. Tag des Hitzemondes – Nakro Tsabaca
Wann greifen sie an?« Nakra hob den Vorhang an und spähte in die Nacht hinaus, wo sich die Stadt ausbreitete. Feuer flackerten in den Straßen und blitzten auf den Rüstungen der Soldaten, die in Richtung Meer marschierten. Rauchfahnen wurden vom Wind zerrissen. Am Himmel schrien Möwen, ansonsten war es seltsam still. Das Hafenviertel war evakuiert worden. Die restlichen Bewohner der Stadt verschanzten sich in ihren Häusern.
Nakra und Reko hatten das Glück – oder eben Pech – in der Nähe des Herzogpalastes zu leben. Sollte die Stadt dem Angriff standhalten, würden weder sie noch ihr Eigentum einen Schaden davontragen. Sollten die Morretberger hingegen bis hierher vordringen, würde es Plünderungen geben, unter denen das Reichenviertel dann am stärksten litte.
Nein. Nakro trat neben seine Mutter und zog den Vorhang wieder zurück. »Das weiß ich nicht«, antwortete er verspätet.
Seine Eskorte wartete vor dem Haus seiner Eltern. Rekro saß mit Reko unten in der Küche. Ihr Lachen wehte herauf.
Nakra verschränkte die Arme. »General Tsabaca. Man sollte meinen, das zu wissen, wäre dein Beruf.« Kaum Falten hatten sich nach all der Zeit in ihr Gesicht gegraben. Falls sie Sorgen hatte, verbarg sie das gut. Wie immer. Ihre Haut war ein wenig dunkler als die von Nakro und ihrem Ehemann – und ein Vielfaches dunkler als die der Kraburger –, aber nachdem sie jahrzehntelang erhobenen Hauptes durch Ferretshafen geschritten war, lernten die Leute allmählich, diesen Umstand zu ignorieren. Ja, sie wusste, wie man Sorgen verbarg.
»Wissen ist nicht mein Beruf, Nakra. Nur Siegen«, sagte er.
Ihre Augen verengten sich. »Du darfst mich ruhig Mutter nennen.«
»Mutter«, sagte er.
Sie verzog die Lippen und durchquerte den Raum, um sich auf einen Sessel zu setzen. Der golddurchwirkte Webstoff stammte aus Skeret. Im Privaten gestattete sie sich diesen Luxus. »Ach Nakro. Warum dieser Krieg?«
»Der Krieg gehört mir nicht.« Noch nicht.
Sie zuckte mit den Schultern und setzte sich auf das Sofa. »Aber du bist hier. General Tsabaca. Du bist an die Spitze des Militärs aufgestiegen, wie du es wolltest. Niemand steht über dir.«
»Doch«, sagte Nakro widerwillig. »Die Königin und der König.«
Nakra hob fragend die Hand. »Wem schuldest du etwas? Warum hast du dich für den Krieg entschieden? Du könntest jetzt irgendwo …«
»Getreide säen?«, schlug Nakro vor.
Sie schnaubte. »Ich weiß, wenn du dich über mich lustig machst.«
Nakro legte die Hand auf die Klinke und öffnete die Tür. Dunkelheit füllte den Korridor. Natürlich hatte Nakra die Diener heimgeschickt. »Gehen wir runter zu den anderen, in Ordnung?«
Sie rührte sich nicht von der Stelle, sondern schlug die Beine übereinander und taxierte ihn. »Ich hasse deinen Beruf. Was ist, wenn du stirbst?«
Nakro räusperte sich. »Charmant … Mutter.«
Sie zuckte noch einmal mit den Schultern und stand auf. »Man sollte über den Tod sprechen. Wir haben immer darüber gesprochen, nicht wahr? Wir wenden das Gesicht nicht ab.«
Wie auch? Wie wandte man das Gesicht ab von all dem Blut? Und obwohl sie wir sagte, war sie diejenige, die es nicht gesehen hatte. Nakro zwang sich zu einem Lächeln. Es kam leicht genug. »Du wirst nicht allein sein. Du hast Reko, Rekro und Reka. Du hast sogar eine Schwiegertochter und Enkel, nicht wahr? Irgendjemand wird bei dir sein, selbst wenn ich es nicht sein sollte.«
»Es geht nicht nur um mich. Was ist mit Sveno?«
Wie oft hatte er diese Frage in seinem Leben schon gehört? »Er ist alt genug, um für sich selbst zu sorgen.«
Nakra verzog missbilligend das Gesicht. »Das Wissen, wer seine Mutter ist, willst du mit ins Grab nehmen? Jeder hat ein Recht –«
»Er weiß es längst.«
Sie hielt inne. »Du hast es ihm gesagt? Wann? Und vor uns verheimlichst du es weiterhin?«
Es gab längst Gerüchte. Meist versiegten sie verdächtig schnell, aber diese Stille würde nicht ewig andauern. Nicht, wenn Skarta ihn weiterhin in der Öffentlichkeit duzte und Sveno wiederum sie.
»Seine Mutter ist Königin Skarta Kahragon von Kraburg.« Nakro holte Luft. »Und jetzt wirf mir noch einmal vor, dass ich es nicht herumerzähle.«
Sie starrte ihn an. Starrte ihn an und sagte nichts. Wofür er ihr dankbar war. Sie kritisierte ihn, wenn sie es für angemessen hielt, aber sie respektierte das Leben, das er gewählt hatte. Was mehr war, als man von den meisten behaupten konnte. Wenn sie eines Tages den Brief öffnete, den er ihr heute geben würde, und seine Bitte las, würde sie sie erfüllen. Sie würde das Meer überqueren. Das war der Grund, warum er in diesem Moment mit ihr sprach und nicht mit Reko. Nakro zog das Schriftstück aus seinem Handschuh, doch bevor er etwas sagen konnte, kam sie ihm zuvor.
»Willst du deswegen nicht heiraten? Weil du sie noch immer liebst? Seid ihr noch … ein Paar?«
Nakro seufzte. »Nakra, ich finde in der Tat nicht, dass man alles zerreden muss.«
»Ich bin deine Mutter«, sagte sie.
»Ja«, sagte Nakro und drückte ihr den Brief in die Hand. »Öffne ihn, sobald du hörst, dass ich morretbergischen Boden betreten habe. Nicht vorher.«
Nakra hob die Brauen und schnappte ihm den Umschlag entschieden aus der Hand. »Morretbergischen oder skerischen?«
Nakro atmete aus. »Beides.«
Sie straffte sich, zerdrückte den Brief in ihrer Hand. »Und wann wird das sein?«
Auf der Straße schrie jemand. Nakra eilte zum Vorhang und zog ihn auf. Als der Stoff zurückfiel, fluchte sie und riss ihn herunter. Was vorher nur als ferner Schatten am Horizont zu erahnen gewesen war, entpuppte sich nun als Linie morretbergischer Schiffe vor der Stadt.
»Es geht los«, sagte Nakro. »Ich muss mich nun darum kümmern, dass meine Anweisungen korrekt ausgeführt werden.«
»Zweifelsfrei.« Seine Adoptivmutter schnaubte. »Ich hasse es, dass wir in diesen Krieg geraten sind.«
»Ich nicht.« Nakro verließ das Zimmer. »Ich habe Pläne.«
»Ein Grund mehr, die Beine in die Hand zu nehmen«, sagte Nakra hinter ihm.
Kapitel 2
Ferretshafen, 24. Tag des Hitzemondes – Äro Kahragon
Die Linie aus Schiffen verdeckte den Horizont. Noch waren sie außer Schussweite der Hafentürme, aber die Soldaten in Ferretshafen bliesen Alarm und auch Äro spürte, dass das Manöver gleich beginnen würde. Die roten Flaggen der Morretberger flatterten im Wind. Die Kanonen wurden aus den Luken geschoben. Äro fragte sich, welche Art von Magie die Geschosse leitete. Oder würden sie sich auf die rohe Kraft einer Explosion verlassen?
Sein Nacken kribbelte. Er nahm das Fernglas von den Augen und drückte es seinem Berater in die Hand. Er hatte Hunger.
»Bringt mir mein Pferd«, sagte er und trat von der Brüstung zurück.
»Herzog, ich würde Euch raten, besser im Palast zu bleiben. Dort ist es am sichersten«, sagte sein Berater.
Äro machte sich nicht die Mühe, darauf zu antworten. Der sicherste Ort in dieser Stadt war da, wo er sich befand. Schließlich war er der beste Magier hier. Es wurde Zeit, dass das noch mehr Leute erkannten. Dieser Angriff war die perfekte Gelegenheit dafür. Sein Magen knurrte. Äro biss die Zähne zusammen. Wahrscheinlich würden ihn die Morretberger um sein Abendessen bringen.
Der General hatte ihm versichert, sie wären auf alles vorbereitet. Aber Vorbereitung allein garantierte nun einmal keinen Erfolg.
Licht blitzte über dem Meer auf. Dann folgte das Donnern einer Explosion. Selbst von hier aus war es laut genug. Die Hufe seines Pferdes schlugen auf die Pflastersteine. Nie hatte er die Straßen derart verlassen erlebt.
Statt Fisch und Salz roch es im Hafen nach Rauch. Grauer Dunst umhüllte die morretbergischen Schiffe. Äro stieg vom Pferd und lief zu Fuß weiter. Von den Wehrtürmen aus hätte er einen besseren Überblick und könnte Zauber wirken. Äro fasste eines der Bauwerke ins Auge. Ein Licht aus den Schießscharten unter dem Dach zeugte davon, dass sich die dort positionierten Magier an der Verteidigung der Stadt versuchten.
Finger krallten sich in seinen Arm und zerrten ihn hinter eine Hausmauer. Im nächsten Moment schlug ein Geschoss neben ihm ein und riss einige Pflastersteine aus dem Boden.
»Falls Ihr vorhattet, auf der Promenade zu flanieren, muss ich Euch enttäuschen«, sagte der Mann, der ihn gepackt hatte.
Äro war nicht gut darin, sich Gesichter zu merken, aber die drei goldenen Streifen an seinen Armen wiesen ihn als Generaloberst aus, also handelte es sich bei ihm um den Bruder des Generals, Rekro Sikat.
Ein weiteres Geschoss schlug in einer Mauer in Sichtweite ein. Eine Wolke Steinstaub umhüllte die Einschlagstelle, sodass Äro die Schäden nicht genau erkennen konnte. Doch im nächsten Moment sackte die obere Hälfte des Hauses hinab und begrub alles darunter unter Schutt und Trümmern.
Äro zog die Brauen zusammen und wandte sich dem Generaloberst zu. »Warum stürzt meine Stadt ein?«
»Wir müssen warten, bis die Schiffe näher heran sind, damit wir unsere Falle auslösen können«, antwortete Sikat.
»Und wie viele Häuser müssen noch einstürzen, bevor sie nahe genug heran sind?«
Der Generaloberst befeuchtete sich die Lippen. »Hör mal …«
»Herzog Kahragon«, half ihm Äro auf die Sprünge.
»Äro, richtig?«, fragte Sikat.
»Nicht richtig«, erwiderte er ärgerlich.
Der Generaloberst lächelte säuerlich. »Du verstehst etwas von Politik, wir verstehen etwas vom Kämpfen. Lass uns unsere Arbeit machen, ja?«
Gedanklich machte sich Äro eine Notiz, die herablassende Art Sikats nicht zu vergessen, aber er sparte es sich, etwas darauf zu erwidern. Solange Krieg war, wurde der Mann noch gebraucht.
»Wie nah müssen sie kommen, damit die Falle ausgelöst werden kann?« Soweit er wusste, hatten sie irgendetwas versenkt und beabsichtigten, es mit Magie zu heben. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, ihn einzuweihen.
»Ins Hafenbecken, wo das Wasser flacher ist«, sagte Sikat.
Noch waren die Schiffe knapp in Reichweite der Wehrtürme. Wenn sie sich weiter näherten, liefen sie Gefahr, in ihr Kreuzfeuer zu geraten. Also mussten sie erst die Türme zerstören, bevor sie ins Hafenbecken einliefen. Das hieße, die Verteidigung der Stadt wäre für die nächsten Monate zerstört – und er würde die Gelder für ihre Wiederinstandsetzung beschaffen müssen. Wie sollte er das anstellen, jetzt, wo ohnehin fast alle Einnahmequellen der Stadt ausfielen? Sicher würde er Merto nicht um Unterstützung anbetteln, Krieg hin oder her.
»Sie zerschießen meine gesamte Stadt, bevor sie so weit vorstoßen«, sagte Äro.
»Nur den Hafenbereich«, sagte der Generaloberst widerwillig. »Deswegen haben wir ihn evakuiert.«
Äro rollte mit den Augen. Ein weiteres Geschoss schlug nur ein paar Schritte von ihm entfernt auf der Straße ein. Der Steinstaub kratzte in seiner Kehle und ließ ihn husten. Im immer dichteren Rauch liefen Tränen über seine Wangen. Äro presste die Lippen zusammen und verließ seine Deckung.
»He!«, brüllte der Generaloberst hinter ihm. »Was soll das?«
Äro ignorierte ihn und lief geduckt über die Hafenpromenade. Zweifelsfrei sahen sie ihn – Kraburger wie Morretberger gleichermaßen. Schließlich war er das Einzige, was sich hier bewegte – sah man von den heranrasenden Geschossen ab. Ein Lichtblitz erschütterte seinen Schutzschild und ließ Äro zur Seite taumeln. Ärgerlich schüttelte er den Kopf und rannte weiter. Es brauchte deutlich mehr, um seinen Zauber zu brechen. Sollte ihn dieser Angriff beleidigen?
Er beschleunigte sein Tempo. Rennen. Explosion. Weiterrennen. Explosion. Verdammter Staub. Äro hustete wieder. Dann erreichte er das äußere Ende seines Hafens. Vor ihm ragte einer der Wehrtürme auf, wo ein paar Magier so taten, als würden sie die Stellung halten, indem sie hin und wieder etwas auf die Morretberger schossen. Scheißplan.
Äro kümmerte sich nicht um den Turm, sondern trat an den Rand der Kaimauer und musterte die Fischerboote, die dort vertäut waren. Er wählte das größte von ihnen aus und sprang hinab.
Das Boot schaukelte wild unter seinen Füßen. Falls ein Geschoss es zerschlüge, würde er ebenfalls im Wasser des Hafenbeckens landen, inmitten des Beschusses. Trotzdem weitete er seinen Schutzzauber nicht auf das Gefährt aus. Er brauchte seine Kraft für das, was er vorhatte. Äro ging in die Hocke, zog seinen Handschuh aus und hielt die Hand ins Wasser. Zu dieser Jahreszeit war es nicht kalt, sondern lediglich angenehm kühl. Äro schloss die Augen.
Jetzt nicht ungeduldig werden. Er sandte seine Magie vorsichtig aus, konzentrierte sich auf die Wogen, die er im nächsten Moment am ganzen Körper spürte, als würde er schwimmen. In wilden Wirbeln brandete das Meer gegen die Mauer und spritzte in die Höhe. Weiter draußen wiegte es sich kraftvoll um die Schiffsrümpfe. Gut. Äro setzte mehr Magie frei, erhöhte den Druck. Er schickte sie nicht zu den Schiffen, sondern hinter sie.
Schreie um ihn herum. Sein bröckelnder Schutzschild. Ein Schwall Salzwasser, der ihm ins Gesicht klatschte. Äro blinzelte und beobachtete die Wirkung seines Zaubers, während er die Magie weiter fließen ließ. Hinter den Morretbergern erhob sich das Meer. Eine gewaltige Woge trug die Schiffe in die Höhe, bereit, sie direkt in den Hafenbereich zu tragen. Der Beschuss hörte auf. Äro ließ seinen Zauber los und kletterte zurück auf die Kaimauer, um von dort aus zu beobachten, wie die Riesenwelle die Morretberger in den Hafen zwang.
»Feuer!«, brüllte eine Stimme und auf den Wehrtürmen flammten rote Lichter auf.
Äro verschränkte die Arme und reparierte seinen Schutzschild. Sein Magen krampfte sich zusammen und erinnerte ihn daran, dass er verdammt nochmal etwas essen musste. Ihm war übel. Jetzt erst recht.
Die Woge erreichte den Hafen und flutete ihn mit Meerwasser. Es strömte um Äros Schild herum, sodass er einen Moment lang wie unter einer Glasglocke stand und auf das Wasser blicken konnte. Das Geräusch splitternden Holzes verriet, dass die Fischerboote das Ergebnis seines Zaubers nicht gut überstanden. Äro blinzelte und beobachtete, wie die morretbergischen Schiffe beidrehten, statt ihre Offensive fortzuführen. Eines von ihnen war in Schräglage geraten. Ein Flammenball schlug ins Holz. Das Gefährt war verloren. Gut.
Eine Reihe von Bogenschützen bezog neben ihm Position. Sie schossen nicht, sondern warteten darauf, ob die Morretberger doch noch einen Versuch unternahmen, an Land zu gehen. Sie warteten vergeblich. Die Schiffe fuhren davon. Äro wandte sich ab und machte sich auf den Weg zurück zu seinem Palast. Wo war sein Pferd?
Als er den Hauptteil des Hafens erreichte, bemerkte er einen Mann, der direkt auf ihn zukam. Es war der General, gut zu erkennen an seiner aufwändigen Rüstung und der dunklen Hautfarbe, die er sich mit seinem Bruder teilte. Er blieb vor Äro stehen und für einige Herzschläge sahen sie sich schweigend an.
»Herzog Kahragon. Ein beeindruckender Zauber«, sagte Tsabaca dann. Irgendetwas an dem Lob störte Äro. Der Tonfall, vermutlich. Der General lächelte nicht, sondern blickte ihm nur starr in die Augen. »Wir hätten ihnen die Rümpfe aufgeschlitzt, wenn sie nicht beigedreht hätten.«
Äro zuckte mit den Schultern. »Sie sind weg und meine Stadt steht noch. Tut nicht so, als wäre das etwas Schlechtes.«
Tsabaca blickte aufs Meer hinaus. »Sie werden wiederkommen.«
»Dann könnt Ihr ihnen ja die Rümpfe aufschlitzen«, sagte Äro und ging an ihm vorbei. Wenn er jetzt nicht sofort etwas zu essen bekäme, würde es heute noch ein paar Tote geben. Äro biss die Zähne zusammen und beschleunigte seine Schritte.
Kapitel 3
Kraburg, 6. Tag des Weizenmondes – Merto Kahragon
Magie? Keine Magie. Merto beäugte die Kiste misstrauisch. Kontaktgift vielleicht. Aber sie mussten doch wissen, dass er die meiste Zeit Handschuhe trug. Hinter ihm stieß sein Sohn einen schrillen Schrei aus. Die beiden anderen Kinder kicherten. Merto drehte sich nicht um.
»He!«, brüllte seine Leibwächterin. »Junge, lass den Prinzen in Ruhe!«
Merto holte Luft. Ruhe. Das war das Wort. Er gab sich einen Ruck und klappte die verdammte Kiste auf. Grüne Flammen schossen in die Höhe. Merto machte einen Satz rückwärts, doch der Zauber löste sich schnell auf.
»Papa, was war das?« Seine Tochter trat neben ihn und zupfte an seinem Umhang.
Hastig riskierte er einen Blick in die Kiste und betrachtete den abgeschlagenen Kopf seines Attentäters. Seine Augen starrten ihn trüb an. Getrocknetes Blut befleckte das Holz. Mist. Das Gift, das er dem Mann anvertraut hatte, war doch so gut – exzellent, um genau zu sein – gegen Magie getarnt gewesen. Wie hatte das schiefgehen können? Sein verfluchter Opa – Uropa – war ganz schön aufmerksam. Lag in der Familie. Schnell klappte er den Deckel zu.
»Nichts, mein Schatz«, sagte er. »Spiel wieder mit deinem Bruder.«
Serta sah ihn aus großen Augen an. Großen, zimtbraunen Augen. Mit ihrer blassen Haut und ihrem schwarzen Haar glich sie sehr ihrer Mutter. Ihr Bruder ebenso. Die Kahragons waren meist eher hellhaarig gewesen. Nun ja. Die Dinge änderten sich.
Als er sich umwandte, hatte Manar gerade sowohl ihren Sohn Mano als auch Sarto am Kragen gepackt. Die beiden waren gleich alt und verbrachten viel Zeit miteinander. Man hätte einwenden können, dass der nicht-adelige Mano vielleicht kein guter Umgang für Sarto war. Aber Merto scherte sich nicht darum und Skarta mochte Manar.
»Wenn du Nichts in diesem Tonfall sagst, Papa, dann tust du immer so, als wäre ich zu dumm, es zu verstehen«, sagte seine Tochter ärgerlich.
»Nicht zu dumm, nur zu jung, mein Schatz«, sagte er und klemmte sich die Kiste unter den Arm.
Als er den Raum verließ, folgte ihm Serta. Skarta hatte sie in ein lavendelfarbenes Kleid gesteckt, das in Mertos Augen für ein achtjähriges Mädchen viel zu erwachsen wirkte. Doch natürlich hütete er sich, etwas dergleichen zu sagen. Schließlich wählte er auch seine eigene Garderobe nicht mehr selbst aus. Vermutlich war das auch gut so. Merto zupfte sich am Kragen.
Der Speisesaal wurde vom rotgoldenen Licht des Sonnenuntergangs ausgeleuchtet. Skarta saß am Tisch und neben ihr … Tsabaca. Na wunderbar. Konnte dieser Tag noch besser werden? Merto fasste sich und trat ein.
Skarta hob den Blick. »Warum trägst du deine Krone wieder nicht?«
»Äh«, sagte Merto und fuhr sich durch die Haare. »Einen König macht mehr aus als eine dumme Krone auf seinem Kopf.«
Tsabaca stand auf. »Hoheit, es gibt Schwierigkeiten.«
»Äh?« Merto sah auf die Kiste hinab.
»Morretberg hat uns den Krieg erklärt.«
»Scheiße«, sagte Merto.
»Ein König sagt so etwas nicht«, bemerkte Serta.
Merto blickte in seinen Becher und bemerkte, dass in ihm schon wieder Wein war, also stellte er ihn ab. Seine Hand ruhte auf dem Deckel der Kiste, damit Serta nicht hineinsah, wenn er nicht aufpasste. Tsabaca breitete eine Karte vor ihm aus und fuhr mit dem Finger die morretbergische Küstenlinie nach.
»Aristedes führt seit fünfzig Jahren Kriege. Die Verteidigungsanlagen der morretbergischen Städte sind stark und modern. Ein Angriff wäre dumm.«
Dumm, ja. Was nicht dumm war, war der Zeitpunkt, den Aristedes gewählt hatte. Dieser Drecksack wusste von den Auseinandersetzungen mit Lorror in Sasberg und war offenbar naiv genug zu glauben, sie würden sich einfach in Luft auflösen, wenn er Merto vom Thron entfernte und sich selbst daraufsetzte. Nein. Lorror würde ihn erledigen. Denn Kaiser Aristedes hatte den Nachteil, nicht sein Urenkel zu sein.
Merto schluckte. »Wir können uns keinen Krieg leisten.«
»Ja. In der Defensive zu bleiben, wird uns ausbluten.«
»Na wunderbar«, sagte Skarta. »Angriff ist schlecht und Defensive auch? Gibt es irgendetwas dazwischen?«
»Wir müssen den Krieg nicht gewinnen, aber Morretberg zumindest einen derartigen Schlag verpassen, dass der Kaiser Verhandlungen zustimmt. Dann erwirken wir einen Waffenstillstand und können uns wieder in Ruhe auf die Gefahr aus Sasberg konzentrieren. Wenn wir uns Schwäche erlauben, haben wir den Einarmigen bald hier«, sagte Merto.
Serta neben ihm versuchte seine Hand beiseitezuschieben, aber Merto ließ sie eisern auf dem Deckel der Kiste liegen. Warme Funken tanzten durch die Luft. Offenbar übte sie sich in Magie und hoffte, er würde es nicht bemerken.
»Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht.« Skarta lehnte sich zurück und umklammerte ihren Becher. Ob sich darin ebenfalls Wein befand? »Sollen Aristedes und er sich doch gegenseitig zerfetzen.«
»Das wird nicht ohne Kollateralschaden vonstattengehen«, sagte Merto.
Tsabaca nickte. »Gut gesichert sind vor allem die Städte des ursprünglichen morretbergischen Territoriums einschließlich Krensas. Doch es gibt eine Sache, mit der Aristedes nicht rechnet: dass wir in Skeret einmarschieren.«
Merto zog die Brauen zusammen. »Skeret? Was hätten wir davon?«
»Nun, es wäre der empfindliche Schlag, den Ihr anstrebt. Aristedes wird Skeret nicht aufgeben wollen. Wenn wir es also erobern, habt Ihr etwas in der Hand, um Morretberg zu erpressen und einen Friedensvertrag zu erzwingen.«
»Willst du wirklich nach Skeret?«, fragte Skarta zweifelnd. Merto mochte ihren Tonfall nicht. Und auch nicht die Tatsache, dass sie ihn duzte. Wenigstens waren die Leibwächter hier drinnen die einzigen, die es mitbekamen.
Tsabaca sah sie kurz an. »Ist das eine Frage des Wollens? Ich diene meinem Land.«
Skarta stellte ihren Becher klirrend auf die Tischplatte. »Ich hasse es, wenn du so bist.«
»Wie bin ich denn?«
Merto räusperte sich. »Ihr haltet es für möglich, Skeret einzunehmen? Wir haben nur ein begrenztes Truppenkontingent zur Verfügung. Wir können weder die Grenzen zu Sasberg noch die Küstenstädte ohne Verteidigung lassen.«
Zum Glück wandte sich Tsabaca wieder ihm zu. »Die Skerer hassen die Morretberger. Es wäre möglich, einige von ihnen auf unsere Seite zu ziehen.«
»Wir sind nur neue Besatzer. Wieso sollten sie uns den Morretbergern vorziehen?«
»Weil ich es sein werde, der mit ihnen verhandelt. Ich stamme aus Skeret, ich habe die passende Hautfarbe, ich spreche Skerisch und kenne die Gebräuche.«
»Ihr werdet ihnen Versprechen machen, die wir nicht zu halten gedenken? Das ist nicht die Art, wie ich herrschen möchte.«
Tsabaca lächelte knapp. »Wer sagt, dass ich die Versprechen nicht halte?«
»Ihr wollt Skeret erobern, um es anschließend wieder an Morretberg zurückzugeben«, erinnerte ihn Merto.
»Skeret ist wertvoll. Aristedes wird Zugeständnisse eingehen müssen.« Tsabaca hob die Schultern. »Im Übrigen gilt der Mann als impulsiv. Sein General ist nicht viel besser. Wenn wir ihren Zorn wecken, können wir sie zu Fehlern verleiten.«
»Welche Möglichkeiten haben wir sonst?«, fragte Skarta.
»Abzuwarten und auf die Angriffe der Morretberger zu reagieren.«
»Das klingt beschissen«, sagte Merto.
Tsabaca nickte. »Ist es auch.«
»Ein König sagt so etwas nicht«, meinte Serta.
Die Kiste stand auf seinem Schreibtisch. Noch einmal hob Merto den Deckel an, betrachtete den Kopf und klappte sie wieder zu. Hoffentlich würde es dem anderen Agenten, der für ihn in Sasberg spionierte, besser ergehen. Sein letzter Brief war vor Wochen hier angekommen – eine viel zu lange Zeit.
Merto seufzte. Das war wirklich verdammt viel Blut da drinnen. Lorror hätte auch einfach einen Brief schicken können. Aber nein, ein Kopf und grüne Flammen mussten es sein. Hauptsache dramatisch. Wir beide haben nicht viel gemeinsam, nicht wahr? In seiner Familie hatte Blut stets eine große Bedeutung gehabt, schließlich war es das, was man miteinander teilte. Eine Verbindung, die schon vor der Geburt geschmiedet wurde und ein ganzes Leben lang anhielt. Doch was bedeutete Blut? Merto hatte sich seinen Verwandten nie sonderlich nahe gefühlt.
Blut … das, was ihn mit Lorror verband. Das, was ihn Lorror näherbrachte als irgendjemanden sonst. Sein einziger Vorteil in dieser Angelegenheit. War es ein Vorteil? Merto zog sich den Handschuh von der Hand und schnitt sich mit Magie in die Haut. Rot trat zwischen den Silberlinien seiner magischen Zirkel hervor und tropfte auf den Schreibtisch. Merto schloss die Augen und umhüllte es mit Magie. Dann weitete er seinen Zauber aus, ignorierte die naheliegenden Präsenzen seiner Kinder und wanderte weiter Richtung Westen.
Das Band zu Lorror war nicht stark. Natürlich nicht, zwischen ihnen lagen drei Generationen. Doch unverkennbar war es da. Sein Urgroßvater schien sich in Sasberg aufzuhalten. Im Moment bewegte er sich nicht. Vielleicht saß er an einem Schreibtisch ebenso wie Merto in diesem Moment. Merto atmete aus und lehnte sich zurück. Warum schickte ihm Lorror immer Dinge? Erst Magieballungen, dann Priester, jetzt Köpfe. Vielleicht wurde es Zeit, dass er etwas zurückschickte. Aber was gab es in Kraburg? Nichts als Wind. Er strich lau durch das Fenster herein und trug eine Woge drückender Hitze mit sich. Merto strich sich durch die Haare. Wind. Aber … warum eigentlich nicht Wind?
Kapitel 4
Morretberg, 8. Tag des Weizenmondes – Rako Aristedes
Ein Sturm braute sich über Morretberg zusammen. Es war schon das zweite Mal innerhalb der letzten vier Wochen. Aber offenbar wollte sich der Sturm diesmal richtig mit ihm anlegen, indem er sich ausgerechnet diesen Tag ausgesucht hatte. Nachdenklich stützte sich Rako mit den Ellenbogen auf die Balustrade seines Balkons und betrachtete den dämmergrauen Himmel. Der Abend näherte sich, irgendwo hinter der dichten Wolkenschicht ging die Sonne gerade unter. Die Häuser der Stadt wucherten auf den Felsen, sodass man die Klüfte, die zu diesem Gebirge gehörten, kaum mehr erkennen konnte. Menschen drängten sich durch die Straßen, an den öffentlichen Plätzen wehten unzählige rote Fahnen zur Feier des Jubiläums. Der Wind riss mit einer solchen Kraft am Stoff, dass die Banner waagerecht flatterten.
Rako schloss die Augen und lauschte. Kälte biss ihm beinahe schmerzhaft in die Haut und eine Weile genoss er das Gefühl, sich der Gewalt des Wetters auszuliefern. Dann wandte er sich ab und ging zurück in sein Zimmer. Die Kleidung, die er auf dem Fest tragen würde, lag bereit. Er hatte nichts gegen sie, wirklich nicht. Aber manchmal vermisste er die Freiheit, sich einfach vom Wind gegen die nackte Haut peitschen zu lassen. Als er nach dem Stoff greifen wollte, erklangen die Glocken. Rako erstarrte.
Das Geräusch mischte sich unter das Tosen des Sturms und schaffte es nur mühsam, ihn zu übertönen. Das westliche Stadttor? Oder doch eher das im Norden? Bestimmt das nördliche. Sie kamen fast immer aus dem Norden.
Einige Herzschläge lang umklammerte Rako noch den Ärmel seines Hemdes und dachte, dass er sich heute – heute! – wirklich zurückhalten sollte. Andererseits, wäre das nicht genau das richtige Signal? Dass er das Wohl seiner Bürger über die Formalität einer Feier – so wichtig sie auch war – stellte. Rako wirbelte herum und ging noch einmal auf den Balkon. Von hier oben konnte er die Schreie der Menschen nicht hören, aber deutlich beobachten, wie die meisten von ihnen eilig Schutz in ihren Häusern suchten.
Ja, verdammt! Er brauchte etwas anderes zum Anziehen.
Es war seltsam, das Geräusch der Pferdehufe kaum zu hören. Stattdessen rauschte der Wind in seinen Ohren, löschte jeden anderen Laut aus. Sein Reittier kämpfte gegen den Sturm, kam nur mühsam voran. Rakos Augen tränten.
Er überquerte eine der Brücken, die die Klüfte überspannten. Morretberg war vor Jahrhunderten einmal ein verschlafenes Nest gewesen, das sich an einen Berghang schmiegte. Doch während der Tekanzeit hatte sich General Sendorel hierher zurückgezogen, da der Standort im Gebirge gut zu verteidigen war. Von da an war Morretberg gewachsen – immer mehr Menschen, immer weniger Platz auf dem Hang. Sie hatten Plateaus, Pfeiler, Treppen und Brücken gebaut, um die felsigen Abgründe zu überwinden, sodass sich ihre Stadt ausbreiten konnte. Sie war ein Labyrinth geworden – eines, bei dem man nie wusste, wann der Weg vor einem felsigen Abgrund endete.
Die Glocken läuteten noch immer. Rako war sich inzwischen sicher, dass der Kampf am Nordtor tobte. Bei der nächsten Kaserne gab er sein Pferd ab und rannte zu Fuß weiter. Das Tier war eines seiner besten im Stall, er wollte es nicht verlieren.
Der Sturm rauschte immer lauter. Rako zog sein Schwert. Dabei wusste er genau, dass es ihm nichts nützen würde. Nicht gegen diese Gefahr. Aber er hatte einfach gerne etwas in der Hand, wenn er kämpfte.
Endlich erreichte er das nördliche Stadttor. Es war verschlossen – als ob das etwas nützen würde. In den beiden angrenzenden Türmen leuchteten magische gelbe Lichter. Und auf den Wällen stellten sich die Soldaten den Windgeistern. Rako rannte die Treppe hinauf. Einen Moment lang schirmten ihn die Wände des Turms vor dem kalten Tosen ab, bevor er wieder ins Freie trat. Die Gestalten wirkten wie zusammengeballter Wind, aufgeladen mit einem bläulichen Licht, das wie ein Gewitterblitz knisterte. Sein Schein bedeckte die grauen Mauern und erhellte die Gestalten der Soldaten. Rako drängte sich an einem Mann vorbei, der gerade vor einem der Geister zurückwich.
Die Wesen waren nicht wirklich intelligent – Rako war sich nicht einmal sicher, ob Wesen überhaupt die richtige Bezeichnung war. Doch irgendwie gelang es ihnen, etwas von ihrer Umgebung aufzunehmen. Die Ängste der Menschen, die sie anlockten. Wenn man den Aufzeichnungen Glauben schenken durfte, kamen sie seit Jahrhunderten aus den Bergen – eines der Übel, die dieser Standort mit sich brachte. Doch heutzutage waren sie seltener geworden.
Der Geist vor ihm glitt auf ihn zu. Rako unterdrückte den Impuls, einen Duellzauber zu formen. Auf normale Schild- oder Angriffszauber reagierten sie nicht. Doch wenn man einfach mit roher Kraft auf sie einhackte, konnte man sie vertreiben – vorausgesetzt man besaß genug Kraft. Also stieß er einen Schrei aus und schoss Magie aus seiner Hand. Sie züngelte in Form blauer Flammen über sein Schwert, sodass es so aussah, als würde die Klinge brennen. Rako hieb sie in den Körper des Geistes.
»Es ist der Kaiser!«, rief irgendjemand in der Nähe, doch Rako achtete nicht auf ihn. Der Geist wirbelte und zuckte, dann stob er auseinander. Rako sah sich nach dem nächsten um. Ein Soldat vor ihm ging schreiend zu Boden. Die Berührung der Geister war schmerzhaft, konnte einen Menschen von innen ausbrennen. Rako hatte es selbst erlebt. Er rannte auf den Windgeist zu und entließ erneut Magie aus seiner Hand, doch das blaue Licht auf seinem Schwert war nun deutlich matter als zuvor. Eine Woge Übelkeit erfasste Rako und ließ ihn taumeln. Seine Sicht verschwamm und eine bleierne Müdigkeit legte sich auf seine Glieder.
Nein. Rako biss die Zähne zusammen. Er holte aus und stieß dem Geist sein leuchtendes Schwert in die Brust, sodass er zerfiel. Das Licht erlosch. Rako holte Luft. Kälte drang schmerzhaft in seine Lungen. Er hatte nicht die Kraft für einen Wärmezauber. Das hieß – er war verwundbar. Sira würde ihn für seinen Leichtsinn umbringen. Dass er wieder einmal ohne seine Leibwachen aufgebrochen war. Dass er sich verausgabt hatte. Dass er es potentiellen Attentätern nur allzu leicht machte. Und sie würden kommen, nicht wahr? Sie kamen immer, aber wenn er einen neuen Krieg begann, dann kamen besonders viele von ihnen.
Finger packten seinen Arm, schnitten sich in sein Fleisch, als wären sie Klingen. Rako wirbelte herum, schleuderte einen Lichtball in den Geist und klammerte sich an eine Zinne. Brodelnde Finsternis! Er durfte die Soldaten seine Schwäche nicht sehen lassen! Er würde von hier nicht weggehen, bevor nicht der letzte Geist vertrieben war.
Neben ihm loderte Licht auf. Offenbar ahmten die ersten Soldaten seine Taktik nach. Rako spannte die Finger an und packte den Schwertgriff fester. Einen noch. Einen würde er schaffen. Rako stürzte vor, brüllte, schleuderte eine Magiewoge auf die nächstbeste Windgestalt und beobachtete, wie sie davonwirbelte.
Schweratmend sah er sich um. Nur noch vereinzelte Geister tanzten im Sturm. Doch sie schienen es nicht mehr unmittelbar auf die Soldaten abgesehen zu haben, sondern zogen über die Felshänge.
Rako lehnte sich gegen eine Zinne und schloss einen Moment lang die Augen. Als er sie wieder öffnete, sah er, dass die Straße nicht mehr leer war. Ein Trupp Soldaten auf Pferden eskortierte eine Kutsche, die gemächlich die gepflasterte Gebirgsstraße entlang rollte. Die Gräfin war spät dran, aber sie würde es noch pünktlich zur Feier schaffen. Im Gegensatz zu ihm.
»Das Tor …«, sagte jemand.
»Das ist die Kutsche von Gräfin Undion von Jegaret. Lasst sie herein«, sagte Rako. Er beobachtete das Gefährt eine Weile, doch er bezweifelte, dass Undion ihn auf der Mauer stehen sah.
»Die Gräfin hat Glück, dass die Windgeister sie nicht erwischt haben«, sagte einer der Soldaten.
»Das hätte ich nicht zugelassen«, sagte Rako. Auch wenn es natürlich keine Möglichkeit gegeben hätte, es zu verhindern. Wie hätte er überhaupt davon erfahren sollen? Wie hätte er sie schnell genug erreichen können? Doch natürlich stellte niemand seine Aussage infrage. Sie hörten es – und sie glaubten es. Schließlich stammten die Worte von niemand geringerem als ihrem Kaiser. Rako wandte sich ab und ging zurück zur Treppe.
Kapitel 5
Morretberg, 8. Tag des Weizenmondes – Varla Lavian
Varla hatte beschlossen, zu spät zu kommen. Das war nicht so einfach, wie es klang. Vielmehr erforderte es einen perfekt abgestimmten Plan. Ihre Kutsche fuhr zu spät vor, sie stieg zu spät aus und betrat gemeinsam mit ihrem Ehemann viel zu spät den Palast des Kaisers. Und trotzdem schaffte es Rako Aristedes auch diesmal, sie zu überbieten. Er rauschte die Straße entlang, dunkles Metall am Körper, sein Schwert am Rücken. Die Krone fehlte, ebenso die obligatorische Eskorte, aber natürlich würden ihn auch ohne sie alle erkennen. Jeder seine Schritte verriet, dass er der Kaiser war.
Er stürmte die Treppe zum Tor hinauf und kurz hoffte Varla, er würde sie einfach ignorieren. Doch dann streifte sie sein Blick, er erstarrte und drehte sich um. Lefto neben ihr versteifte sich. Varla griff nach seiner Hand.
Entschieden lächelte sie. »Zu spät zu Eurer eigenen Feier, Hoheit?«
Rako musterte sie. Er hatte noch nicht einmal den Anstand, es unauffällig zu tun. Dann betrachtete er Lefto und verengte die Augen. »Ich habe überlegt nicht hinzugehen. Aber ich gehöre nun einmal zu den unverzichtbaren Teilnehmern.«
Ach, wie putzig, deine kleine Lüge. Als würdest du das alles nicht genießen. Varla lachte, Lefto ebenfalls. Rako hielt sich nicht länger mit ihnen auf, sondern lief in den Palast. Vermutlich hatte er es eilig sich umzuziehen, bevor er auf dem Fest erschien.
Ein kalter Windstoß riss an ihren Haaren und ihrem Kleid und Varla fröstelte. Es war Hochsommer, sie sollte nicht frieren. Nicht einmal hier in Morretberg, wo die Luft stets das Versprechen eines nahenden Winters barg und die Tage meistens aus stürmischem Grau bestanden. Es gab viele Gründe, die Hauptstadt zu meiden. Das Wetter war nur einer von ihnen.
Lefto entwand seine Hand der ihren. »Ich weiß nicht, warum er mich so sehr hasst. Er hasst mich mehr als alle anderen.«
»Das bildest du dir ein«, sagte Varla, während sie nebeneinander zur Treppe gingen.
»Nein, tue ich verdammt noch mal nicht. Er hasst mich.«
Die Wachen fragten nicht nach ihren Einladungen – es wäre mehr als unverschämt gewesen, die Fürstin von Krensas und den Herzog von Morret an der Küste nicht zu erkennen. Varla lächelte, bis sie drinnen waren. Gut, dass sie darin Übung hatte: ein Lächeln stundenlang herumtragen, bevor es schließlich von den Lippen bröselte.
Fein gekleidete Gäste füllten die Vorhalle. Magische Lichtkugeln hingen hoch über ihren Köpfen und tauchten den gesamten Raum in goldfarbenes Licht. Riesige morretbergische Banner dekorierten die Wände. Es wäre auch zu viel verlangt, zu erwarten, dass Rako sein verdammtes Wappen irgendwann verdross. Nein, jedes Jahr dasselbe.
»Das beruht ja wohl auf Gegenseitigkeit«, antwortete Varla verspätet.
»Warum? Am Anfang war es noch nicht so schlimm«, sagte Lefto finster.
Am Anfang war er ein tatkräftiger – oder vielmehr finanzkräftiger – Unterstützer der Morretbergschen Revolution gewesen und Rako hätte es sich nicht leisten können, ihn vor den Kopf zu stoßen. Möglicherweise hatte er damals auch keinen Anlass dazu gesehen.
»Du konntest ihn nie leiden«, sagte Varla.
»Nein, konnte ich nicht. Aber er hat mich in Ruhe gelassen.« Lefto ballte die Hände zu Fäusten. »Jetzt schikaniert er mich.«
Varla seufzte. »Würde es helfen, wenn ich dich ein wenig bemitleide?«
Er schnaubte und schritt zügig aus. Die überfüllte Haupthalle verriet, dass die meisten Speichellecker auf Pünktlichkeit großen Wert gelegt hatten. Sie standen in Gruppen beieinander, unterhielten sich und lachten gekünstelt, warteten, bis Rako sie endlich mit seiner Präsenz beehrte und seine alljährliche Rede hielt. Varla suchte in der Menge die Kaiserin. Sie trug – wie könnte es anders sein? – ein Kleid in morretbergischem Rot und hatte die sonst glatten dunkelbraunen Haare in leichte Wellen gebogen. Heute war nicht nur der Tag, an dem vor vierundfünfzig Jahren die Morretbergsche Revolution geendet hatte und Rako und Sira Aristedes sich zu Kaiser und Kaiserin gekrönt hatten, heute war auch ihr Hochzeitstag. Doch natürlich scherte das niemanden. An diesem Tag war viel passiert, um das sich niemand mehr scherte. Varla biss sich auf die Zunge und schluckte.
»Steh nicht herum, wir haben viel zu tun«, sagte Lefto.
Natürlich. Sie waren nicht gekommen, um zu feiern, sondern um ihre Pläne voranzutreiben. Deswegen gab sie sich auch Mühe, nicht auf Rako zu achten, als er endlich auftauchte und strahlend in den Saal schritt. Stattdessen suchte sie nach der Gräfin von Jegaret. Lächelnd bewegte sich Varla durch die Menge, plauderte mit einigen Bekannten und ignorierte das Essen, das ihr die Diener anboten. Dafür war ihr viel zu übel.
Endlich entdeckte sie Undion in der Menge. Kurz hielt sie inne und beobachtete sie. Die Gräfin hatte immer zu Geschmacklosigkeiten geneigt. Vielleicht hoffte sie auch einfach, irgendwann doch noch eine neue Mode einzuführen. Heute trug sie ein Kleid, das in derart grellem Pink gehalten war, dass Varla glaubte, ihre Augen würden brennen. Leider hatte die Gräfin zudem eine rosa Hautfarbe, was die Gesamtkomposition schier unerträglich machte. Ihre imposante Hochsteckfrisur war bestenfalls als unkonventionell zu bezeichnen und während sie Varla so von weitem angrinste, vergaß sie einen Moment lang, was genau sie eigentlich vorgehabt hatte. Diese Frau musste wirklich ein gewaltiges Selbstbewusstsein besitzen.
Rako hielt gerade seine Rede. Varla achtete nicht auf seine Worte, das tat sie nie. Sie waren emotional und nur allzu überzeugend, wenn man sich darauf einließ. Was sie nicht vorhatte. Möglichst unauffällig schob sie sich durch die Menge, bis sie neben Undion stand.
»Amüsiert Ihr Euch gut?«, fragte sie leise.
Das Grinsen der Gräfin wurde noch breiter. »Ganz wunderbar amüsiere ich mich. Ebenso wie Ihr, vermutlich. Ich amüsiere mich über uns … wie wir hier so stehen … und applaudieren … und was wir sonst noch alles tun, um unserem Kaiser zu gefallen.«
»Ich glaube nicht, dass wir ihm gefallen«, sagte Varla und nahm einem Bediensteten ein Weinglas ab.
Auch die Gräfin hielt ein Glas in der Hand und drehte es. »Das ist aber schade. Wo es uns doch so amüsiert, ihm zu gefallen.«
»Ich glaube auch nicht, dass er darauf Wert legt.«
»Tut er nicht. Obwohl ich mich schon frage, was ihm denn eigentlich gefällt?«
Varla seufzte still. Sie wusste genau, warum Lefto nicht mit der Gräfin sprechen wollte, sondern sich lieber Graf Dorno Murior von Turmstadt vorknöpfte. Dieser war grundsätzlich zwar der problematischere Kandidat, doch dafür blieben in einer Unterhaltung mit ihm die Nerven kühl.
»Wie schade, dass wir uns so viele Gedanken um unseren Kaiser machen müssen«, sagte Varla.
Die Gräfin nickte langsam. »O ja. Ich denke dauernd an ihn. Manchmal im Badezimmer. Meistens aber, wenn ich so ein verdammtes Dokument auf dem Tisch habe, das ich nicht allein unterschreiben darf.«
Varla lächelte. »Ich glaube, wir verstehen uns.«
Undion seufzte theatralisch und hob ihr Glas. »Na endlich, ich habe mich schon gefragt, ob ihr niemals die Initiative ergreifen würdet. Was gab es denn da so lange zu diskutieren?«
Varla blickte sich kurz nach Lefto um, entdeckte ihn in eine ernst wirkende Unterhaltung mit Murior vertieft und wusste nicht recht, was sie sagen sollte. »Nun, wir …«
»Schon gut, schon gut.« Undion wedelte mit der Hand und lächelte Varla gönnerhaft an. »Was genau habt ihr denn vor?«
»Das sollten wir nicht hier besprechen.« Wenn man Lefto und den Grafen so beobachtete, musste man ohnehin fürchten, dass Rako Verdacht schöpfte.
»Wann treffen wir uns?«, fragte Undion.
»Wir werden Euch benachrichtigen.«
»Werdet ihr den da auch benachrichtigen?« Undion nickte in Richtung des Grafen von Turmstadt. »Spart euch die Mühe. Der besitzt ungefähr so viel Rückgrat wie eine Weinbergschnecke – die richtig zubereitet aber ausgezeichnet schmeckt, wenn ich das anmerken darf.«
»Wie wollt Ihr unsere Schnecke zubereiten?«, fragte Varla.
Die Gräfin sah noch einmal zu Murior hinüber und musterte ihn recht lange. »Vielleicht könnte ich mit ihm sprechen …«
»Das wäre sehr hilfreich.«
»Da bin ich mir nicht sicher.« Undion blickte durch den Raum, fand einen Punkt hinter Varla und zuckte dann leicht zusammen. »Ach du liebe Güte …«
Varla drehte sich um und bemerkte die Tochter der Gräfin, die mit großen Augen zu Rako aufblickte, der ihr anscheinend irgendetwas – und seinem Hang zu pathetischen Gebärden nach zu urteilen, konnte sich Varla ziemlich genau ausmalen, was – erzählte.
»Nun …« Varla zuckte mit den Schultern. »Wollt Ihr sie retten?«
»Wenn schon ein Affront, dann muss er nicht heute sein.« Undion verzog die Lippen und wirkte seltsam verstimmt. Das Schweigen zog sich hin und Varla fürchtete schon, sie hätte ihre Aufmerksamkeit nun verloren, als sich die Gräfin endlich vom Anblick ihrer Tochter losriss und leise schnaubte. »Seltsam, dass man nichts hört, eigentlich.« Jetzt schmunzelte sie wieder ein wenig, aber es wirkte aufgesetzt. Wobei, eigentlich wirkte alles an ihr aufgesetzt.
»Was sollte man denn hören?«, fragte Varla.
»Dass er irgendeine Geliebte hätte. Oder mehrere.«
Varla nippte am Wein. »Müsste er das?«
»Schaut da hinüber.«
Varla tat ihr den Gefallen. Sira Aristedes stand neben der Gräfin von Turmstadt und sagte etwas zu ihr. Die Gräfin antwortete mit einem einzelnen Wort und einem zittrigen Lächeln. Dann blickten die beiden schweigend in die Menschenmenge. Varla drehte sich weg, bevor ein Blickkontakt entstand. »Die Kaiserin. Na und?«
»Macht diese Frau einen sonderlich glücklichen Eindruck auf Euch?«
»Sie macht einen angespannten Eindruck. Was bei dieser grauenvollen Feier nicht verwundern sollte.«
»Habt Ihr einmal gezählt, wie oft sie sich gemeinsam zeigen? Nur dann, wenn sie sich einmal im Monat dazu herablassen, von ihrem Balkon aus zu winken. Dann ist das Volk wieder zufrieden und glaubt, die beiden würden eine Vorzeigeehe führen.«
»Natürlich tun sie das nicht.«
»Natürlich nicht.« Gräfin Undion und nickte. »Also, wo hat er irgendwelche Geliebten? Sollte eine außereheliche Beziehung publik werden, würde das sein öffentliches Ansehen deutlich schmälern. Am Ende trifft er sich womöglich heimlich mit Männern, wer weiß? Wäre das nicht wunderbar?« Die Gräfin lachte, anscheinend ehrlich belustigt von der Vorstellung, und Varla stimmte einen Moment lang mit ein.
»Darf ich dann davon ausgehen, dass Ihr der Sache nachgehen werdet?«
»Ich?« Undion blickte sie mit verblüffter Miene an, bevor sie wieder lachte. »Sehe ich aus wie die Frau, die diesen Mann verführen könnte?« Varla hoffte, dass sie nicht mit einer Antwort rechnete, denn dann müsste sie erwidern: nein, der Kaiser sehe lieber in blaue Augen. »Oh, man stelle sich vor, ich die Geliebte eines so mächtigen Mannes wie des Kaisers von Morretberg. Herrlich.« Varla hüstelte und Undion warf sich übertrieben in Pose. Im eigentlichen Sinne war sie zumindest nicht hässlich, aber eben schrecklich … unkonventionell. Und in dieser Rolle schien sie sich auch zu gefallen. »Als neuer Gatte kommt er ja leider nicht infrage, denn dann würde ich gar nicht mit Euch über diese Angelegenheit sprechen.« Sie prostete Varla zu und nahm dann einen Schluck Wein aus ihrem Glas. Nachdem sie noch einen Augenblick lang versonnen in die Runde gelächelt hatte, fasste sie Varla ins Auge und musterte sie von oben bis unten. »Nein, liebe Fürstin, wirklich nicht. Da müsste er schon sehr verzweifelt sein. Versucht Ihr doch Euer Glück.«
Varla nahm ebenfalls einen großen Schluck und wünschte sich, der Wein wäre stärker. »Ich hoffe, Ihr macht Scherze.«
»Ich meine ja nur, dass es doch hilfreich wäre zu wissen, ob er grundsätzlich empfänglich für derlei Angebote wäre. Ihr müsst ja nicht allzu tatkräftig werden.«
»Sehe ich aus wie die Frau, die diesen Mann verführen könnte?«
»Ja.« Undion musterte sie noch einmal und Varla fragte sich, wie genau sie auf die Idee kam, den Frauengeschmack des Kaisers beurteilen zu können. »Ihr könntet Chancen haben. Er hat gerade zu Euch herübergesehen.«
Varla unterdrückte den Impuls, sich zu Rako umzuwenden. »Ich hoffe, Ihr macht Scherze«, wiederholte sie.
»Nun, Ihr wart doch diejenige mit der brillanten Idee, die Leichen in seinem Keller aufzuspüren, oder irre ich mich?« Genau genommen hatte Varla davon nichts gesagt, sie hatte es allerdings gedacht und widersprach deswegen nicht. Undion beugte sich ein wenig zu ihr vor. »Und wenn es da keine Leichen gibt – was ich bezweifle – dann müssen wir eben welche hineinschaffen.«
»Also darf ich annehmen, dass Ihr unserem kleinen Bündnis beitreten werdet?« Varla glaubte kaum, dass sie heute irgendetwas falsch verstanden hatte, aber es war besser, sich noch einmal zu versichern.
»Selbstverständlich.« Undion rollte mit den Augen und trank dann ihr Glas leer. »Stellt Euch nur vor, wir hätten Erfolg. Wäre das nicht wunderbar? Dann hätten wir einen Helden bezwungen. Oder nein, einen Gott!« Undion lachte wieder. »Aussehen tut er ja so. Finde ich. Ihr nicht?«
Varla kippte ebenfalls den restlichen Wein hinunter, lächelte die Gräfin noch einmal an und ging dann zu Lefto hinüber, der bereits auf sie wartete. Jedenfalls stand er mit finsterer Miene neben dem Tisch mit den Feigen aus Skeret, den aufgeschnittenen Wassermelonen aus Nara und den gestückelten Mangos aus Brilet und hielt einen leeren Teller in der Hand.
»Eine wahnsinnig witzige Frau, die Gräfin von Jegaret.« Varla sah sich nach einem neuen Weinglas um.
»Sag mir etwas Neues«, brummte Lefto.
»Sie ist dabei.«
»Das ist nichts Neues. Und sie wird uns sicher nicht verraten. Dieser Speichellecker aus Turmstadt ist das Problem.«
»Wir sollten tanzen. Sonst denkt am Ende noch jemand, wir wären nur hier, um den ganzen Abend zu konspirieren.«
Lefto schnaubte, stellte aber seinen Teller weg und nahm ihre Hand. Er fand den Takt nicht sofort, aber nachdem sie eine Weile entschlossen geführt hatte, kehrte wieder Routine ein und sie drehten sich im Saal.
»Wenn du nur ein besserer Tänzer wärst«, sagte Varla.
»Wenn du einen besseren Tänzer willst, dann tanz doch mit dem Kaiser.«
Varla seufzte stumm. Als sie über Leftos Schulter blickte, bemerkte sie, dass Gräfin Undion anscheinend das Unmögliche geschafft und sich zum Tanzen an Rako herangeworfen hatte. In diesem Moment fing Varla Undions Blick auf und die Gräfin zwinkerte ihr lächelnd zu.
Kapitel 6
Morretberg, 8. Tag des Weizenmondes – Rako Aristedes
Er hätte es nicht zugegeben, aber er mochte das Tanzen. Er mochte die Herausforderung, seinen Körper völlig in Einklang mit dem Rhythmus des Orchesters zu bringen. Und Gräfin Norla Undion störte diesen Einklang. Sie war eine miserable Partnerin, egal wie entschlossen er führte. Sie setzte ihre Schritte ungeschickt und bewegte sich immer eine Spur zu spät. Zu allem Übel hatte sie auch noch die Frechheit, das herunterzuspielen.
Undion lächelte ihn an. »Ihr seid ein ausgezeichneter Tänzer, hat Euch das schon einmal jemand gesagt?«
Die Worte klangen so einstudiert, dass ihm Hitze in den Kopf stieg. »Selbstverständlich. Glaubt Ihr nicht auch, dass ich denjenigen köpfen lassen würde, der etwas anderes behauptet?«
Undion hüstelte. »Ah. Ich nehme an, das war ein Scherz?«
»Selbstverständlich war das ein Scherz. Was habt Ihr denn gedacht?« Rako zwang sie zu einer Drehung und Undion stolperte beinahe über ihre eigenen Füße.
»Ah.« Sie räusperte sich. »Eure Majestät besitzen ausgezeichneten Humor.«
Rako verzog die Lippen. »Ich würde auch denjenigen köpfen lassen, der das abstreitet.«
Jetzt schaffte sie es wieder, ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zwingen. »Ihr seid ganz ausgezeichn–«
»Und Ihr langweilt mich mit Phrasen. Also, was wollt Ihr wirklich?«
Schrill lachte sie auf. Man hörte an ihrer Stimme, dass die Bewegungen sie allmählich außer Atem brachten. »Wie kommt Ihr denn auf die Idee, dass ich etwas will? Also, abgesehen von den üblichen Dingen, meine ich …«
»Ihr wart ja versessen auf diesen Tanz«, sagte Rako.
»Das sind wir doch alle.« Undion zwinkerte ihm zu, bevor sich ihre Miene glättete. »Ich habe gesehen, dass Ihr mit meiner Tochter gesprochen habt.«
Rako hob die Brauen. »Und?« Er sprach mit allen möglichen Leuten. Schließlich war er der Kaiser. Womöglich mochte auch Undions Tochter darunter gewesen sein, er hatte nicht darauf geachtet.
Undion befeuchtete sich die Lippen. Röte färbte ihre Wangen. »Nun … ich weiß natürlich, dass sie Euch vergöttert und –«
Rako stieß Luft aus. »Erwartet Ihr Euer baldiges Ableben?«
Sichtlich schluckte sie. »Nein. Wieso? Sollte ich?«
»Offensichtlich liegt Euch die Nachfolgefrage am Herzen.«
Undions Bewegungen wurden noch unharmonischer als ohnehin schon. Ärgerlich zog er sie wieder in den Takt, doch Undion gelang es nicht mitzuhalten. »Mit Eurer Erlaubnis könnte ich sie zur Mitregentin ernennen«, keuchte sie.
»Sie ist zu jung. Fragt mich in ein paar Jahren noch einmal.«
»Aber Hoheit …«
»Allmählich solltet Ihr wissen, dass ich das Wort aber etwa so gernhabe wie eine Fliege in der Suppe.« Rako ließ ihre Hand los und schritt von der Tanzfläche.
Magische Lichtkugeln schwebten unter der Decke der Halle und warfen roten und goldgelben Schein auf die Menschenmenge. Die Spiegel an den Wänden reflektierten das Licht. Auf einem Podium mühte sich das Orchester mit Streichinstrumenten ab.
Die Menge teilte sich, wo immer er hinging. Ein paarmal trat jemand in seinen Weg, doch Rako scheuchte sie alle weg, bis er seine Frau entdeckte. Sie war umringt von einigen Damen, von denen er keine einzige kannte. Trotzdem sah er sie sofort. Vielleicht lag es daran, dass ihr Kleid um ein Vielfaches teurer war und im Lichtschein blitzte. Vielleicht war es etwas viel Natürlicheres, das sie ausstrahlte. Er konnte es nicht sagen, aber er sah sie sofort.
Sira behielt ihr Lächeln bei, bis er neben sie getreten war. »Wo warst du?«, zischte sie. »Du warst zu spät.«
»Windgeister«, sagte er. »Ich habe mich darum gekümmert.«
»Warum? Weil die Stadtwache das nicht hinbekommt?« Sira strahlte noch immer in die Runde, doch ihre Miene war dabei so starr, dass er glaubte, sie würde bei der geringsten Erschütterung bröckeln.
»Nein, tut sie nicht«, sagte Rako.
»Oh, hör auf, Ausreden zu erfinden. Du wolltest um jeden Preis Kaiser werden. Du hättest wissen müssen, dass das bedeutet, fortan hauptsächlich vom Schreibtisch aus zu arbeiten.«
Rako presste die Lippen aufeinander. Eine Weile standen sie stumm nebeneinander und beobachteten das Treiben. Was mochten die Leute denken, die sie beobachteten? Dass sie sich nichts zu sagen hatten?
Sira schüttelte den Kopf und stieß ein leises Schnauben aus. »Und das ausgerechnet heute.«
Rako zog die Brauen zusammen. »Was ist das Problem?«
Sira nickte in Richtung der Tanzenden. »Schau genauer hin.«
Varla klammerte sich dort an ihren nichtsnutzigen Ehemann. Ihre Schritte waren präzise, doch Lavian ließ ihr wenig Spielraum. Er hatte sie schon immer beschränkt. Das hätte sie wissen müssen.
»Ich sehe nichts«, sagte Rako.
Siras Lippen zuckten kurz. »Ich trage Rot. Fürstin Lavian trägt Himmelblau, Gräfin Undion Pink und –«
»Undion ist kein Maßstab.«
Sie schnappte sich ein Weinglas von dem Tablett eines Dieners. »Glaub mir, das ist stiller Protest.«
Rako hob die Schultern. »Sie haben immer still protestiert.«
»Und Herzog Lavian habe ich seit bestimmt dreißig Jahren nicht mehr in morretbergischem Rot gesehen«, fügte Sira hinzu.
»Es steht ihm ja auch nicht.« Rako musterte den Herzog erneut und kam zu dem Schluss, dass er mit seiner langen Nase und den hellen Haaren noch immer wie ein Frettchen aussah. Da änderte sich auch nach all der Zeit nichts. Im Gegenteil. Die Ähnlichkeit schien jedes Mal, wenn er ihn wiedersah, ein wenig stärker geworden zu sein.
»Sie versuchen sich von uns abzugrenzen. Da kriselt es.«
Ungläubig schnaubte er. »Glaubst du, es kümmert mich, was sie anhaben?«
»Das sollte es. Offen würden sie sich niemals gegen dich stellen. Aber sie setzen kleine Zeichen.«
»Putzig, ihre Rebellion.« Rako lachte auf. »Ich werde beginnen, mir Sorgen zu machen, wenn sie große Zeichen setzen.«
Kapitel 7
Morretberg, 9. Tag des Weizenmondes – Sira Aristedes
Mitternacht war überschritten und Sira war müde. So gerne sie sich auch zurückgezogen hätte, als Kaiserin konnte sie sich das nicht leisten. Als Herzog Lavian auf sie zusteuerte, spielte sie mit dem Gedanken, eine Ausrede zu erfinden und sich davonzustehlen, aber natürlich ging das nicht.
Er lächelte sie steif an, deutete eine Verbeugung an und hielt ihr dann die Hand hin. »Hoheit. Es wäre mir eine Ehre, würdet Ihr mir die Gunst eines Tanzes erweisen.«
»Diese Ehre könnte ich Euch niemals verwehren, Herzog.« Sira griff nach seinen Fingern, doch die Berührung fühlte sich so flüchtig an, als würde sie einen Schmetterling streicheln.
Lavian warf einen Blick über ihre Schulter, bevor er sie zur Tanzfläche führte, das entging ihr nicht. Allerdings hätte sie gerne gewusst, zu wem er sah. Zu Rako oder zu seiner Frau? Sira lächelte zurückhaltend und überließ ihm die Führung, auch wenn sie das Gefühl hatte, dass er nicht recht bei der Sache war. »Heute vor vierundfünfzig Jahren endete die Morretbergsche Revolution«, sagte sie dann. »Sollten hier nicht alle rot tragen?«
Endlich sah Lavian ihr in die Augen. »Rot ist die Farbe Morretbergs. Das Wappen Morrets an der Küste ist blau, wie Ihr sehr gut wisst.«
Ein wenig zu gut, leider. »Und Morret an der Küste gehört zu Morretberg, wie Ihr sehr gut wisst.«
»Das tut es.«
Sira lächelte weiter. »Herzog Lavian, Ihr provoziert. Seid Ihr Euch sicher, dass das gut für Euch ist?«
Er schwieg einen Moment, die Musik setzte aus, aber weder er noch Sira gingen von der Tanzfläche, bevor das nächste Stück einsetzte. »Euer Ehemann kann mich nicht ausstehen«, antwortete Lavian schließlich. »Ich glaube kaum, dass ich irgendetwas tun könnte, um seine Meinung zu ändern.«
Sira lachte leise. »Wie kommt Ihr darauf?«
»Es liegt auf der Hand. Dabei bin ich mir keiner Schuld bewusst.«
»Wenn Ihr Schuld auf Euch geladen hättet, hätte es mein Ehemann kaum versäumt, Euch darauf hinzuweisen. Nachdrücklich hinzuweisen, versteht sich.«
»Genau.«
Abstreiten ließ sich seine Unterstellung leider nicht. Rako hatte von keinem seiner Fürsten eine hohe Meinung, aber Lefto Lavian schien er geradezu zu verabscheuen. Sira konnte nicht genau sagen, wann das passiert war. In der Endphase der Morretbergschen Revolution waren sie Verbündete gewesen und Lavian hatte – damals noch Kaufmann – Rakos Sache großzügig unterstützt. »Aber, Herzog Lavian, Ihr werdet doch wegen derlei Kleinigkeiten nicht beleidigt sein?«
»Was würdet Ihr tun, wenn ich es wäre?«
»Ich würde Euch bedauern.«
»Ihr scheint Übung im Bedauern zu haben.« Jetzt lächelte Lavian ebenfalls.
Sira schluckte. »Wie kommt Ihr darauf?«
»Das Ende der Morretbergschen Revolution. Die Krönung. Ist heute nicht auch Euer Hochzeitstag?«
»Angesichts der anderen Vorkommnisse spielt das kaum eine Rolle. Was ist schon eine Hochzeit im Vergleich zum Ende eines Krieges?«
»Und bedauert Ihr das nicht?«
Lavians eindringlicher Blick machte deutlich, dass Leugnen zwecklos wäre. Was natürlich nicht hieß, dass sie es zugeben konnte. Also lächelte Sira eisern weiter und schwieg. Lavian nickte kaum merklich. »Und bedauert Ihr nicht auch den Tod –«
»Es ist besser, Ihr sprecht jetzt nicht weiter, Herzog«, sagte Sira scharf und konnte nicht verhindern, dass das verdammte Lächeln ihr von den Lippen rutschte.
Lavian nickte noch einmal. »Ihr denkt, es wäre alles unverrückbar.«
»Der Tod ist das wohl.«
»Der Tod vielleicht. Ihr jedoch seid noch am Leben.«
Sira schwieg einen Moment lang und überlegte, ob er wirklich das meinte, wonach es klang. »Ihr sprecht von Hochverrat.«
»Wirklich, habe ich das getan? Bei den Klingen der Windgeister, das war niemals meine Absicht«, sagte Lavian in entsetztem Tonfall, doch sein Blick ließ genau das Gegenteil vermuten. Natürlich war es seine Absicht. Aus irgendeinem undurchsichtigen Grund schien er der Meinung zu sein, sie würde es Rako nicht erzählen. Oder er fürchtete sich nicht, weil sie nichts gegen ihn in der Hand hatten. Noch nicht zumindest. »Ich bemerke nur, dass es so viele Menschen gibt, die nach der Krone streben. Ich nicht. Interessanterweise scheint aber auch Euch recht wenig daran gelegen zu sein.«
»Wie kommt Ihr darauf?«
»Versteht mich nicht falsch, Ihr erfüllt Eure Pflichten sehr vorbildlich. Aber es sind eben nur Pflichten.«
»Herzog Lavian, ich glaube es ist besser, wir verfolgen dieses Thema nicht weiter.«
»Selbstverständlich. Verzeiht mir, falls ich Euch beleidigt haben sollte.«
Sira nickte und löste sich von ihm. Lavian lächelte und verneigte sich wieder, bevor er in Richtung seiner Frau davonging. Auch Sira verließ die Tanzfläche. Es war Zeit, sie hatte diesen Irrsinn lange genug mitgemacht. Mit geradem Rücken und erhobenem Haupt verließ sie den Saal und schritt die Treppe hinauf. Erst, als sie ihre privaten Gemächer erreichte, gestattete sie es sich, die Maske fallenzulassen.
Es dauerte noch zwei Stunden, bis Rako endlich auftauchte. Sira hatte gebadet und ihr Nachtgewand angezogen. Jetzt saß sie im Lehnstuhl und legte ihr Buch weg. Durch das Fenster strömte angenehm kühle Luft herein, aber als sie Rako hörte, schloss sie es. Wer wusste schon, wer heute versuchen würde zu lauschen. Ausgerechnet an diesem Tag. Ihrem Hochzeitstag. Sira seufzte stumm und faltete die Hände im Schoß.
Als er eintrat, musterte er sie kurz. Dann rauschte er an ihr vorbei, zog seine Handschuhe aus und schmiss sie auf den Tisch. »Du bist früh gegangen.«
Sira holte Luft. »Wir sollten uns trennen, Rako.«
Rako erstarrte und drehte sich zu ihr um. »Nein, sollten wir nicht«, sagte er.
»Aber es wäre das Beste.« Ihre Ehe war eine Farce. Sie teilten sich nur die Gemächer, um den Gerüchten etwas entgegensetzen zu können. Tagsüber benutzte sie andere Räume. Sie brauchte diese Freiheit, so geringfügig sie auch war. Rako ließ sie ihr, wenn auch unter Protest.
»Es würde so aussehen, als hätte ich einen Fehler gemacht.« Der Ärger schwang allzu deutlich in seiner Stimme. Rako nahm seine Krone vom Kopf und ließ sie neben den Handschuhen auf den Tisch krachen. Sira zuckte bei dem Geräusch zusammen.
»Vielleicht hast du das«, sagte sie.
Rako zog die Brauen zusammen und schmiss seinen Gürtel auf den Tisch. Das betraf zum Glück auch den Dolch, der dort in einer Scheide steckte. Auf dem Tisch – nicht außer Reichweite. Sie glaubte nicht, dass er sie angreifen würde, das hatte er nie getan. Doch sie hasste die Blicke der Diener, wenn sie die zerstörten Möbel sahen.
»Wie stellst du dir das vor?« Seine Stimme war betont ruhig. Zu ruhig. Jeder, der ihn kannte, wusste, dass nun der Zeitpunkt gekommen war, besser die Klappe zu halten. Dass sie es nicht mehr tat, war wahrscheinlich der Grund, warum sie inzwischen deutlich schlechter miteinander auskamen als früher.
»Ich würde auf den Thron verzichten und mich zurückziehen«, sagte Sira. »Ich beanspruche keine Reichtümer, ich brauche nicht viel. Vielleicht ein Landhaus in Rasoberg? Oder, wenn es dir lieber ist, auch in Larkana oder Waria.«
»Das kommt nicht infrage.« Rakos Stimme war bereits lauter.
»Warum nicht? Du wärst weiterhin Kaiser und könntest tun und lassen, was du willst. Nicht, dass du das nicht ohnehin schon tun würdest.« Oh, das hätte sie nicht sagen sollen. Sira hob beschwichtigend die Hand. »Jetzt bitte kein Wutausbruch, Rako.«
»Ich habe keine Wutausbrüche.« Rako fegte alles, was er auf den Tisch geschmissen hatte, samt Krone, auf den Boden. »Diese verdammten Fürsten versuchen, mich hinter meinem Rücken zu sabotieren, damit ich den Krieg verliere, und jetzt kommst du auch noch mit diesem Unsinn!«
Kurz war sie verblüfft. Verblüfft darüber, dass er offenbar doch über ihre Worte bei der Feier nachgedacht hatte und zum Schluss gekommen war, dass sie recht hatte.
Sira schluckte und faltete wieder die Hände. »Ich habe dir nur einen Vorschlag gemacht.«
»Du fällst mir in den Rücken«, rief er.