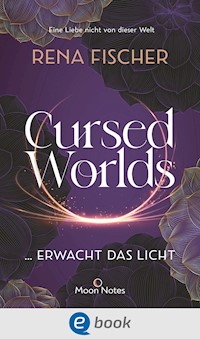9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sturmgraublaue Zeit der Liebe Die junge deutsche Wolfsforscherin Kaya wird von dem schottischen Milliardär Alistair MacKinley angestellt, um auf seinen Ländereien wilde Wölfe anzusiedeln. In dem einsamen Herrenhaus in den Highlands trifft sie auch auf den verschlossenen Nevis, Alistairs attraktiven Sohn, mit Augen wie das Sturmgraublau des schottischen Himmels. Der verwundete Ex-Elitesoldat soll sich von seinen schweren Kriegsverletzungen erholen. Doch er verweigert die Therapie und torpediert das Wolfsprojekt, wo er nur kann. Kaya ist wütend und fasziniert zugleich, ohne das tragische Ausmaß seines Zustands zu ahnen. Eine Zusammenarbeit mit Nevis endet katastrophal. Erst als sich beide ihrer Vergangenheit stellen, können sie ihre Liebe und ihre Zukunft retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Die junge deutsche Wolfsforscherin Kaya wird von dem schottischen Milliardär Alistair MacKinley beauftragt, auf seinen Ländereien wilde Wölfe anzusiedeln. In dem noblen Herrenhaus in den Highlands trifft Kaya auch auf den verschlossenen Nevis, Alistairs attraktiven Sohn, mit sturmgraublauen Augen wie der Himmel über den schottischen Bergen. Der hochdekorierte Ex-Elitesoldat soll sich in der Heimat von seinen schweren Kriegsverletzungen erholen. Doch Nevis schottet sich ab, verweigert die Therapie und torpediert das Wolfsprojekt seines Vaters, wo er nur kann. Kaya ist irritiert und verärgert und fühlt sich gleichzeitig immer mehr zu Nevis hingezogen. Aber sie erahnt nicht das wahre Ausmaß seiner psychischen Probleme. Als Nevis bei dem Wolfsprojekt mitarbeiten soll, mündet das in eine Katastrophe …
Für Stefan
»I didn’t want you cosy and neat and limited.I didn’t want you to be understandable, Understood.I wanted you to stay mad and limitless, Neither bound to me nor bound to anyone else’s or your own preconceived idea of yourself.«
Margaret Tait, »To Anybody At All«
1
Die Polster der Sitze sind so grau wie die Gesichter der Anzugträger um mich herum. Routinierte, gelangweilte Gelassenheit. Menschliche Leitwölfe, wie mein neuer Arbeitgeber, der ein Ticket für mich in der Business Class offenbar für angemessen hält. Während ich voll Unbehagen an ihnen vorbei den schmalen Gang hinunter zu der Tür des Airbus A320 spähe, stelle ich mir vor, wie ich die sieben Sitzreihen nach vorne sprinte, um das Flugzeug vor dem Start wieder zu verlassen. Meine Finger klammern sich an den verschlissenen Stoff des Rucksacks auf dem Schoß, als sich eine Flugbegleiterin zwischen mich und meinen Fluchtweg stellt und beginnt, ihr Sicherheitsprotokoll abzuspulen. Ich schließe die Augen und wünsche mich zurück in den Wald, atme wieder den würzigen Geruch von Fichten und Erde. Ich stütze mich im weichen Moos auf und sehe durch mein Fernglas bernsteinfarbene Augen, die mich aus dem Dickicht beobachten. Loan hat mich natürlich längst gewittert.
»Flugangst?«
Die Stimme neben mir lässt mich zusammenzucken. Sie gehört zu einer Frau, die so viele Falten im Gesicht hat wie weiße Pünktchen auf ihrer dunkelblauen Bluse. Nicht die Sorte grimmige Furchen. Vielmehr sieht sie aus, als hätte sie jede Menge Spaß gehabt, und auch jetzt liegt ein feines Lächeln auf ihrem Gesicht.
»Nein!«, beteuere ich schnell. »Mir geht es gut.« Glaubt sie mir, oder verständigt sie gleich die Flugbegleiter, weil sie Angst hat, ich könnte mich beim Start auf ihren wollweißen Plisseerock übergeben? Sie ist nach mir ins Flugzeug gestiegen, schmal und feingliedrig, aber mit aufrechtem Rücken und dem energischen Gang einer gealterten Coco Chanel. In dunkelblauen Mary-Jane-Schuhen mit breitem Riemen und kurzem Absatz, die Haare weiß, schulterlang und gewellt. Eleganz von Kopf bis Fuß. Ich kann nicht sagen warum, aber ich bin aufgestanden und habe sie ans Fenster gelassen, obwohl der Platz für mich reserviert ist.
»Möchten Sie doch lieber am Fenster sitzen?«, fragt sie jetzt. Sie muss meinem Blick gefolgt sein und hat ihn falsch gedeutet.
»Bitte legen Sie Ihren Rucksack in den Fußraum«, tönt eine männliche Stimme in diesem Moment neben mir, bevor ich ihr antworten kann. »Oder soll ich ihn für Sie oben verstauen?«
Ich schüttle den Kopf und setze den Rucksack vor mir ab. Der Flugbegleiter überprüft die Anschnallgurte und verschwindet so schnell aus meinem Blickfeld, wie er aufgetaucht ist. Von vorne höre ich ein dumpfes Geräusch und schaue zur Tür. Sie wird eben geschlossen. Jetzt ist es endgültig zu spät. Mein Mund wird trocken. Die Ansage der Rettungshinweise kommt über den Lautsprecher und passt nicht zu der pantomimischen Vorführung der Flugbegleiterin in der grellgelben Rettungsweste und dem puppenhaften Gesicht. Sie sirrt in meinen Ohren wie ein Alarmsignal. Der Geschäftsmann links von mir über dem Gang mustert mich inzwischen misstrauisch. Überhaupt habe ich plötzlich das Gefühl, alle würden mich anstarren. Ich fühle mich wie ein Wolf, eingesperrt in einen Zwinger. Der Drang, ausbrechen zu wollen, beherrscht plötzlich alles. Meine Hände werden feucht, und ich höre ein Rauschen. Zuerst denke ich, es wäre mein fliegender Puls, aber dann wird mir klar, dass es nur die Lüftung über mir ist, die gerade anläuft, und dass die alte Dame neben mir immer noch auf meine Antwort wartet.
Himmel, Kaya, du bist achtundzwanzig! Reiß dich mal zusammen! Die Hälfte deiner ehemaligen Studienkollegen würde für dieses Projekt freiwillig ihre Doktorarbeit wiederholen.
Ich räuspere mich und setze zu einer Antwort an. Die Frau lächelt immer noch, und ihr Blick scheint spielend alle Schichten meiner mühsam aufrecht gehaltenen Beherrschung zu durchdringen. »Danke, nein. Es sei denn, Sie möchten …«
»Sind Sie schon einmal Fallschirm gesprungen?«, unterbricht sie mich unvermittelt.
»Bitte?«
»Ich schon.« Sie zwinkert, und in ihre blassblauen Augen tritt ein Glanz, um den ich sie beneide. »Sobald die Tür aufgezogen wird und man zu der Öffnung rutscht, die Beine über den Bordrand schwingt und sie ins Nichts darunter baumeln lässt, glaubt man zu sterben. Der Trick ist, nicht nach unten zu schauen. Wenn man das tut, hat man verloren. Unser Überlebensinstinkt springt an und setzt alle möglichen Prozesse in Gang. Feuchte Hände, Herzrasen, na, die übliche Armada eben. Noch schlimmer ist es, wenn man zurück ins Flugzeuginnere schaut. Der hässlichste Frachtraum kommt einem plötzlich viel zu behaglich vor, um ihn freiwillig zu verlassen.«
Sie lacht leise, und ich lächle zurück und frage mich, warum sie mir das alles erzählt. Der Flugkapitän meldet sich zu Wort. Schnelles britisches Englisch, aber kein schottischer Akzent. Ein Ruck geht durch das Flugzeug, als es losrollt.
»Reisen Sie als Touristin nach Edinburgh?«
»Beruflich«, antworte ich knapp. Sie ist freundlich, aber das Letzte, was ich jetzt brauchen kann, ist Smalltalk über den wahrscheinlich größten Fehler meines Lebens. Gut, den zweitgrößten. Julian ist so schnell nicht zu toppen.
»Beim Springen muss man den Blick nach vorne richten, mitten in den blauen Himmel, und sich vorstellen, wie ein Vogel in seine Luftströmungen zu tauchen.«
Ich nicke mechanisch, kämpfe gegen die Beklemmung in mir an und taste nach dem kleinen Holzelefanten in der Tasche meiner Jeans. Lena hat ihn mir als Glücksbringer aus Indien mitgebracht. Meine Schwester, die schon immer viel mutiger gewesen ist als ich.
»Dasselbe gilt an den Wendepunkten unseres Lebens«, fährt sie fort, und ich blicke auf. »Wir dürfen weder zurückschauen noch in die ungewisse Ferne. Nur nach vorne, auf das Nächstliegende. Zum Beispiel«, sie streckt die Hand aus, zieht ein Faltblatt aus dem Netz des Sitzes und reicht es mir schmunzelnd, »was das Bordmenü zu bieten hat und welche Drinks kostenlos sind.«
2
Ich nehme vor Überraschung einen zu hastigen Schluck Tee und verbrenne mir die Zunge.
»Warum ich?«, stoße ich hervor und stelle die Tasse so heftig ab, dass ein Teil der braunen Flüssigkeit auf den Unterteller schwappt. Blaue Kornblumen auf weißem Porzellan mit Goldrand, seit zwei Jahrhunderten im Besitz meiner Familie. Jahrelang bin ich darauf konditioniert worden, mich in Stresssituationen zu beherrschen. Jetzt kostet es mich erstaunlich viel Kraft, die Tasse nicht einfach gegen die Damast-Tapete zu schleudern.
»Kann sie kein Taxi nehmen? Und wozu beschäftigst du einen Chauffeur?«
Wir sitzen beim Frühstück. Das heißt, ich sitze beim Frühstück. Es ist gegen elf, und mein Vater hat sicher schon vor fünf Stunden gefrühstückt, weshalb wir auch nicht im Speisezimmer, sondern im roten Salon sind, in dem nachmittags der Tee serviert wird. Alles muss schließlich seine Ordnung haben. Nach der vergangenen Nacht würde ich lieber allein frühstücken, doch ausgerechnet heute scheint mein Vater erschreckend viel Zeit für gezwungene Konversation übrig zu haben. Sir Alistair MacKinley sitzt mir gegenüber in seinem rotgepolsterten Ohrensessel mit Stickereien aus lachsfarbenen heraldischen Lilien, gekleidet in dem, was er einen lässigen Gentlemen-Style und ich den Gipfel konventioneller Spießigkeit nenne: graues Tweed-Sakko in Fischgrät, dunkelblauer Kaschmirpullover über einem weißen Hemd, dunkle Cordhose. Neuerdings trägt er dazu einen Bart, ein denkbar schlechter Ersatz für seinen zunehmenden Haarausfall. Hoffentlich bin ich nicht ausgerechnet mit diesen Erbanlagen gesegnet. Ich kenne den Text schon auswendig, bevor er ihn aufsagt. Seit einem Dreivierteljahr immer wieder dieselben Worte, im selben geduldigen Tonfall, wie bei einer seiner antiquierten Langspielplatten aus Schellack, wenn die Saphirnadel des Tonarms an einem Kratzer hängenbleibt.
»Muss ich dich an unsere Abmachung erinnern?«
Kurz vor meinem achtzehnten Geburtstag bin ich zum Militär gegangen, um genau dem und noch einigem anderen zu entfliehen. Es folgten meine Ausbildung zum Offizier in Sandhurst, Einsätze in Afghanistan, Somalia, Jemen, Mali und im Irak. Letztere als Mitglied der britischen Eliteeinheit Special Air Service (SAS). Ihr Motto »Wer wagt, gewinnt!« habe ich vor einem Jahr zusammen mit meinem Stolz und der mühsam erkämpften Freiheit von Familie und Tradition im roten Wüstenstaub, etwa fünfzig Kilometer westlich von Gao im Nordosten von Mali, begraben. Jetzt, mit neunundzwanzig Jahren, bin ich daheim gestrandet und führe innerlich eine Strichliste. Wie lange kann ich es hier ertragen, bis es mir endlich gelingt, mein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen?
»Unsere Abmachung sieht mindestens einen monatlichen Besuch im Combat Stress Centre bei Dr. Sutherland vor, nicht Chauffeurdienste für deine privaten Hobbys.«
»Ich bitte dich, Nevis! Es ist doch kein großer Umweg.«
Ich lache auf. »Genau genommen fahre ich auf meinem Rückweg von Ayr hier vorbei und dann in die entgegengesetzte Richtung weiter nach Inverness.«
»Du könntest über Perth fahren.«
»Klar, ich könnte auch noch einen Abstecher an die Küste nach Aberdeen machen, um ein wenig Seeluft zu tanken«, entgegne ich zynisch. Der Appetit ist mir vergangen. Das hat Alistair wieder geschickt eingefädelt. Er muss sich bei meinem Therapeuten nach dem nächsten Termin erkundigt und den Flug der deutschen Biologin darauf abgestimmt haben.
»Kaya Lehmann wird hier bei uns wohnen. Sie vom Bahnhof abzuholen, ist eine gute Gelegenheit, sie unterwegs kennenzulernen.«
»Du quartierst sie hier im Herrenhaus ein?«, frage ich entgeistert. Eine Fremde im Haus, womöglich noch in der Nähe meiner Räume, ist das Letzte, was ich in der momentanen Lage brauchen kann.
Alistair zieht eine Augenbraue hoch. »Hast du etwa gedacht, sie schläft wie Mogli bei den Wölfen? Wir haben über vierzig Zimmer, sie wird dir wohl kaum im Weg sein. Im Übrigen hat sie ausgezeichnete Referenzen. Martha hat sie als engagiert, freundlich und ausnehmend intelligent beschrieben.«
Ich verdrehe die Augen und denke an die blonde resolute Frau im Alter meines Vaters, die vor einem Monat hier aufgekreuzt ist und für noch mehr Wasser auf den Mühlen seiner Wolfseuphorie gesorgt hat. Sie ist die Leiterin eines Wolfsforschungsinstituts in Deutschland und Kaya Lehmanns Vorgesetzte. Und sie hat Alistair versichert, sie werde die junge Frau überreden, ihm in seiner misslichen Lage zu helfen und ihn bei dem Aufbau eines Wolfs-Informationszentrums zu unterstützen.
»Wenn sie so überaus intelligent wäre, hätte sie ihren Master in Biochemie oder Genetik gemacht und sich nicht ausgerechnet der Zoologie und den Wölfen verschrieben«, spotte ich, nur um ihm zu widersprechen.
Alistair hebt die Tasse, trinkt einen Schluck von seinem Tee und entgegnet ruhig: »Gerade du solltest ihre Intelligenz nicht voreilig mit einer gewinnbringenden Ausbildungsrichtung assoziieren.«
Alistair hat seinen Biss in all den Jahren unserer Schlagabtausche nicht verloren. Mir fallen sie momentan umso schwerer. Lange Gespräche ermüden mich, ich büße viel schneller als früher die Konzentration ein, und meine Gedanken wandern an Orte, die ich in den Tiefen meines Unterbewusstseins versenkt geglaubt habe. Dass Alistair meine Militärlaufbahn missbilligt, trotz all der Auszeichnungen, die ich erhalten habe, ist für mich dagegen nichts Neues und trifft mich schon lange nicht mehr. Um ehrlich zu sein, bedeuten mir die Orden für außergewöhnliche Tapferkeit und herausragende Leistungen unter Gefahr für Leib und Leben auch nicht viel. Ich habe nur getan, was ich in der jeweiligen Situation für richtig hielt. Aber Alistair legt gewöhnlich viel Wert auf Titel und Verdienste. Zumindest bei anderen.
»Ich dachte an die intellektuelle Herausforderung, nicht an das Geld, das sie in alternativen Ausbildungsbereichen hätte verdienen können. Aber lassen wir das, Vater. Über den Wert des Geldes hatten wir schon immer unterschiedliche Ansichten, nicht wahr?«
Es ist nur ein minimales Zucken seines rechten Augenlids und ein unmerkliches Erblassen, aber ich weiß, dass mein Vater die Anspielung verstanden hat. Einen Augenblick lang ist es so still im Raum, dass ich das Wispern des feinen Regens an den Fenstern hören kann. Winzige Tropfen, die sich an den Scheiben zu einem netzartigen Mosaik verbinden, das die Sicht auf die grauen Umrisse der Monadhliath Mountains in verschwommene Unschärfe taucht.
Alistair räuspert sich. »Du weißt, wie sehr es mich freuen würde, wenn du dich in dieses Projekt ein wenig einbringst, zumindest bis du …«, er zögert, »… dich wieder neu orientierst.«
Ich fluche innerlich.
Das Wolfsprojekt ist leider nicht nur irgendein Hirngespinst meines Vaters, für das er mich kurzfristig einspannen will. Er hat das Projekt schon vor Jahren verfolgt, als ich noch in Afghanistan stationiert war. Alistairs Vision, dass in Schottlands Highlands künftig wieder wilde Wölfe umherstreifen, ist mittlerweile zur fixen Idee geworden. Er ist nicht der einzige Milliardär im Vereinigten Königreich, der sich neuerdings exzentrischen ökologischen Hobbys widmet. Weiter nördlich, am River Carron, gibt es ebenfalls ein mit privaten Mitteln finanziertes Naturschutzgebiet mit der Absicht, nicht nur Wiederaufforstung zu betreiben, sondern ursprünglich in Schottland lebende Tierarten wieder anzusiedeln. Bislang ist dem Besitzer jedoch nur das Ansiedeln der schottischen Wildkatze genehmigt worden. In England, etwa zwanzig Kilometer südlich von Schottlands Grenze, macht sich eine Baroness für die Rückkehr von Bären stark. Ebenfalls ohne jeden Erfolg. Als Alistair mir das erste Mal von dieser Schnapsidee erzählte, lag ich gerade schwer verwundet im Krankenhaus und hatte wahrhaft andere Sorgen als die Wiederansiedlung eines ausgerotteten Raubtiers. Erst hielt ich das ganze Gerede von den Wölfen nur für einen Vorwand, nicht über das Offensichtliche mit mir sprechen zu müssen: dass ich als Krüppel mit einem amputierten linken Unterarm von einem SAS-Einsatz im Rahmen der Operation Toral gegen die Taliban aus Afghanistan zurückgekehrt bin. Ich sollte mich täuschen.
»Ich dachte, du bringst Miss Lehmann im Whitebridge Hotel unter, so wie Alexei.«
Mein Vater verzieht das Gesicht. Whitebridge ist ein weniger als hundert Einwohner zählendes Nest, nicht weit von uns entfernt, das seine touristische Beliebtheit vor allem der Nähe zu Loch Ness und dem jährlich im Oktober von hier startenden Marathon um den See verdankt. Seit es meinem Vater überraschenderweise vor eineinhalb Jahren gelungen ist, die Genehmigung für ein zwölf Quadratkilometer großes, eingezäuntes Wildtierreservat auf seinen privaten Ländereien zu erhalten, sind die Bewohner von Whitebridge, das nur wenige Kilometer von der neu zu errichtenden Anlage entfernt liegt, nicht mehr gut auf ihn zu sprechen. Man munkelt, der steinreiche Finanzexperte habe die Behörden bestochen. Ich bin mir zumindest sicher, dass mein Vater etliche Beziehungen hat spielen lassen, um seinen Traum zu verwirklichen. Alistair hat vergebens gehofft, das Misstrauen der Dorfbewohner werde sich legen, wenn die Wölfe erst einmal da sind, und quartierte, jedweder Vernunft zum Trotz, den Naturschützer und Wolfsexperten Alexei Kutuzow, den er kurzerhand zusammen mit einem Wolfspaar aus Weißrussland importiert hatte, im Whitebridge Hotel ein. Nur eine seiner folgenschweren Fehlentscheidungen. Insgeheim gebe ich dem ganzen Wolfshumbug maximal noch ein halbes Jahr. Dann wird Kaya Lehmann wie Kutuzow vor der ihr entgegenschlagenden Feindseligkeit der Einwohner kapitulieren und das Weite suchen. Selbst ein unverbesserlicher Sturkopf wie mein Vater wird das Scheitern seines Projekts einsehen und das mittlerweile sechs Wölfe zählende Rudel einem bereits länger eingesessenen Wildpark schenken müssen.
»Nicht jeder hat Kutuzows dickes Fell. Miss Lehmann wird besser hier wohnen und, wann immer sie es sich einrichten kann, auch an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen.«
Das wird ja immer schöner. Eine Eigenschaft, die ich an Alexei besonders geschätzt habe, war seine Schweigsamkeit. So ganz bin ich nie dahintergekommen, ob diese darin begründet war, dass der Weißrusse, der ungefähr fünf Jahre älter war als ich, nicht gerade fließend Englisch sprechen konnte oder ob er nur menschenscheu war. Den redseligen Gastwirten im Whitebridge Hotel ist er schon allein deshalb suspekt gewesen.
Ich stehe abrupt auf.
»Wo willst du hin?«, fragt Alistair verblüfft.
»Packen«, antworte ich, was nicht ganz gelogen ist, denn ich habe tatsächlich noch nicht meine Reisetasche für Hollybush vorbereitet. Allerdings dauert es nur ein paar Minuten, die wenigen persönlichen Dinge, die ich für eine Übernachtung im Combat Stress Centre benötige, zusammenzusuchen. Aber ich bin die Unterhaltung leid. Es kommen massenhaft Probleme auf mich zu, wenn diese Kaya erst einmal bei uns im Haus untergebracht ist.
»Du hast mir noch keine Antwort gegeben«, ruft Alistair, als ich schon vor der Tür stehe. Der geschnitzte Pfau in dem rötlichen Kirschholz sieht so genervt drein, wie ich mich fühle. »Wirst du Miss Lehmann übermorgen am Bahnhof abholen?«
Vielleicht ist es gar keine üble Idee, mit der Biologin zu sprechen, bevor mein Vater ihr seine romantisierenden Visionen von den Wölfen in den Highlands in den Kopf setzt. Ich kann sie ungestört auf die harte Realität vorbereiten. Wer weiß, womöglich kehrt sie auf der Stelle wieder um?
»Wenn es sein muss«, seufze ich und verlasse den Salon.
3
Die Gangway schwankt unter meinen Füßen, während ich in den feinen Nieselregen hinaustrete, und ich bin mir nicht sicher, ob das an der wackligen Konstruktion, dem Wind oder dem Sauerstoffschock für mein alkoholbenebeltes Gehirn liegt. Was habe ich mir nur dabei gedacht, auf die alte Dame zu hören und fünf Drinks zu bestellen? Ich trinke so gut wie nie Alkohol. Schon nach einem Glas Sekt bin ich leicht beschwipst! Aber es hat sich einfach richtig angefühlt. Mir ist wohlig warm geworden, und die Aussicht, bald als private Zoologin eines schottischen Milliardärs die alleinige Verantwortung für seinen Wildpark und das Gelingen seines ehrgeizigen Wiederansiedlungsprojekts zu tragen, erscheint mir plötzlich gar nicht mehr utopisch. Ich klammere mich an den Handlauf und spüre, wie ein feuchtkalter Windstoß unter meine Strickjacke fährt. Natürlich habe ich kein Mittelmeerklima in Schottland erwartet, aber es ist immerhin Anfang August, zumindest milde Frühlingstemperaturen sollten mich empfangen. Mir ist ein wenig übel, und meine Zähne schlagen vor Kälte aufeinander, als ich endlich die Halle mit den Förderbändern der Gepäckausgabe erreiche. Um mich herum summt das Stimmengewirr wie in einem Bienenstock. Marie Clark, meine Sitznachbarin, der ich den benebelten Zustand und einen zugegeben höchst amüsanten Flug mit vielen Anekdoten aus dem Leben der einstigen Journalistin verdanke, hat ihren kleinen Trolley schon gefunden.
Sie umarmt mich herzlich zum Abschied, reicht mir ihre Visitenkarte, für alle Fälle, und erklärt augenzwinkernd: »Verlieren Sie Ihr Herz bloß nicht an einen Highlander, Schätzchen. Er lässt Sie nie wieder gehen.«
Ich bin eigentlich nicht der Typ, der Menschen gleich in Schubladen steckt. Sicher ist der Alkohol schuld daran, dass in diesem Moment vor meinem inneren Auge ein stämmiger Kerl mit rotem Bart und grünkariertem Kilt auftaucht, der mich morgens mit Dudelsackmusik aus dem Schlaf reißt und auf dessen Schoß ich abends whiskytrunken im Pub sitze, während er Haggis in sich hineinschaufelt. Ich winke Marie nach und wende mich dann schaudernd wieder dem Gepäckband zu. Womöglich ist mir jetzt noch ein Stück übler.
»Mit einem stärkeren Traditionsbewusstsein wirst du dich in Schottland schon abfinden müssen«, hat Martha erklärt. Sie ist nicht nur meine Vorgesetzte im Wolfsforschungsinstitut LUPUS. In den letzten drei Jahren ist sie mir eine ältere Freundin geworden, weshalb ich auf ihren Rat gehört und sicherheitshalber zwei große Koffer gepackt habe, um nicht in die Verlegenheit zu geraten, mich in Schottland erst einmal einkleiden zu müssen. Nicht dass meine Garderobe besonders extravagant ist. Der größte Teil lässt sich in zwei Kategorien einteilen: bequemer Couch-Potato-Style oder wasserdicht und atmungsaktiv für das Gelände. Aber ein paar hübsche Lieblingsstücke habe ich dennoch, wie meine Flared Jeans mit der hohen Taille und den gestickten schwarzen Rosen am Hosenbein und die weiße Bluse mit Florentiner Spitze. Oder mein dunkelgrünes Partykleid mit Spaghettiträgern.
»Bei deiner Figur kannst du ruhig etwas weniger Langweiliges tragen«, tönt es in meinen Ohren. Ich schnappe nach Luft und zwinge mich, die Umgebung nicht panisch zu inspizieren. Bleib ruhig, er ist bestimmt nicht hier!
Aber Julians Stimme trifft mich manchmal so klar und deutlich, dass Erinnerung und Realität verschwimmen. Unmittelbar nach unserer Trennung habe ich ihn mehrmals täglich gehört. Jetzt kommt es nur noch ein paarmal im Monat vor.
Verdammt! Ich hätte wirklich nicht so viel trinken dürfen! Während ich den ersten Koffer vom Band wuchte, verdränge ich jeden Gedanken an Julian und rufe mir lieber die bezaubernde Geschichte der alten Dame in Erinnerung.
Marie hat mir erzählt, wie sie einem schottischen Schriftsteller verfallen war, den sie kurz vor ihrer geplanten Hochzeit mit diesem unverschämt attraktiven amerikanischen Fotojournalisten interviewt hat. Die Trauung mit dem Amerikaner platzte eine Woche später, und Marie zog zu ihrem Highlander nach Edinburgh.
»Es sollte das letzte Interview vor meiner Hochzeitsreise für meinen Leitartikel Die geheimen Gärten erfolgreicher Menschen werden. Ich hatte für den Artikel bereits die unterschiedlichsten Menschen interviewt und die eigenartigsten Gärten zu Gesicht bekommen. Vom streng in Form gestutzten französischen Park eines Bankiers bis zum exotischen Palmenhaus mit Schmetterlingen einer Modedesignerin. Wissen Sie, ein Garten ist immer auch ein Spiegel der Seele seines Besitzers. Und nichts, absolut nichts konnte mich auf das vorbereiten, was ich bei Sean vorfand.«
Ich schmunzele bei dem Gedanken daran, wie Marie den Garten ihres geliebten Sean als ein aus Mittelerde entsprungenes, fantastisches, botanisches Kunstwerk beschrieben hat, mit Drachenskulpturen, Weidentunneln und Labyrinthen. Nahezu jede Pflanze und Skulptur in seinem Reich entstammte einem literarischen Werk. Sean wurde nicht müde, ihr davon zu erzählen, bis Marie sich erst in seinen Garten, dann in seine Stimme und am Ende in ihn selbst verliebte und den gutaussehenden Fotojournalisten alleine die Welt bereisen ließ.
Das kann mir zumindest nicht passieren. Erstens ist mein künftiger Arbeitgeber über sechzig, und sein Herrenhaus liegt einsam in den Wäldern nahe der Seenlandschaft rund um den Loch Ness. Ich werde höchstens einem Schafhirten über den Weg laufen, und was der von einer wolfsenthusiastischen Biologin hält, ist nicht schwer zu erraten. Zweitens hat es keinen Mann mehr in meinem Leben gegeben, seit ich mich von Julian vor drei Jahren getrennt habe. Auch wenn die Wunden längst vernarbt sind, so ist die Haut dünn wie das Eis eines Sees an einem sonnigen Wintertag Anfang März.
»Willst du ab jetzt etwa das Leben einer Klosterschwester führen? Vermisst du den Sex überhaupt nicht?«, hat mich meine Schwester Lena unverblümt gefragt, als sie mich wieder einmal zu einem Date mit einem ihrer zahlreichen Bekannten überreden wollte. Mir ist von ihrer Offenheit die Luft weggeblieben. »Ich meine das ernst, Kaya.«
Statt einer Antwort bin ich einfach aufgestanden und gegangen.
»Du kannst nicht ewig davonlaufen!«, hat Lena mir hinterhergerufen.
Als ob ich das nicht wüsste!
Der zweite Koffer rollt an mir vorbei, ein dunkelblaues Monster mit einem bunten Freundschaftsband an seinem Griff. Ich habe ihn zu spät gesehen, trete zurück, laufe mit dem Band mit und quetsche mich ein paar Meter weiter wieder in die wartende Menge. Als ich nach dem Koffer greife, beugt sich im selben Moment ein dunkelhaariger Mann vor, um mir zu helfen, ihn herunterzuheben. Seine Finger schließen sich dabei kurz über meinen.
»Du wirst nirgendwohin gehen!«
»Julian, lass mich los!«
Aber seine Finger drücken nur umso fester zu, reißen mich mitsamt Koffer an sich. Ich spüre seinen heißen Atem auf der Haut und erschaudere vor dem wilden Blick und dem wutverzerrten Gesicht, das mir plötzlich so nah ist.
Der Fremde vor mir lächelt freundlich, aber auf meinen Armen hat sich Gänsehaut breitgemacht. Vor Schreck lasse ich fast den Koffer fallen. Er sieht Julian nur geringfügig ähnlich und doch: Sekundenlang steht die Welt still, das Band bewegt sich nicht mehr, die braunen Augen des Mannes haben mich im Visier, und ich tue instinktiv das, was man im Angesicht eines Raubtiers tut. Langsam, ohne hastige Bewegungen zurückweichen.
Der Fremde blinzelt, und erst als sein Lächeln erstirbt und er sich mit einem Ausdruck von Verwunderung wieder abwendet, fahre ich herum, schnappe mir den zweiten Koffer und haste zum Ausgang. Das Blut steigt mir heiß in die Wangen, und ich kämpfe gegen das Gefühl von Angst und Scham, während ich mich frage, ob mein Körper jemals wieder diesen Fluchtmodus abschalten wird.
Sex? Lena hat keine Ahnung, was allein ein Händedruck in mir auslösen kann!
4
Der Teppich verschluckt den Klang meiner Schritte, während ich die breite, gewundene Holztreppe in den ersten Stock hochsteige, vorbei an den Porträts meiner Vorfahren, die, in schwere vergoldete Rahmen gepresst, steif und ernst auf mich herabsehen. Als kleines Kind habe ich mich vor ihnen gefürchtet. An ihnen vorüberzugehen war damals so, als marschierte ich morgens am versammelten Lehrerkollegium der Merchiston Boarding School vorbei, und alle würden mir ansehen, dass ich unvorbereitet in den Unterricht kam oder die Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Ich lief immer möglichst schnell die Treppe nach oben, weil ich glaubte, meine Ahnen könnten meinem Vater von den Kaulquappen erzählen, die ich in einem Senfgurkenglas in meinem Kleiderschrank hortete, oder von den Mäusefallen, deren Metallfedern ich verbogen hatte, damit sie nicht mehr zuschnappen konnten. Noch heute packt mich auf der Treppe eine gewisse Unruhe.
Im Grunde habe ich nichts gegen die Wölfe. Doch das, was mich in Wahrheit an dem Projekt stört und sich gerade an die Oberfläche meines Bewusstseins schieben will, dieses bittere, die Luft zum Atmen abschnürende Gefühl, verdränge ich rasch, indem ich mich auf die Stufen mit dem bordeauxroten Teppich und den messingfarbenen Läuferstangen konzentriere. Wer sich selbst nicht vergeben kann, wird nie in der Lage sein, anderen zu verzeihen. Und vielleicht will ich das auch gar nicht. Aber manchmal wünsche ich mir, es würde mir zumindest für ein paar Stunden gelingen, zu vergessen.
Ich bin müde, und die kurze Unterhaltung mit meinem Vater hat mich stärker erschöpft, als ich mir eingestehen will. Im Grunde habe ich seit meiner Zeit in Mali vergangenes Jahr nicht mehr als fünf Stunden am Stück geschlafen. In dieser Nacht sind es vielleicht drei bis vier Stunden gewesen. Ich bin im Bett liegen geblieben, minutenweise eingenickt und wieder aufgeschreckt, habe die Morgenroutine meines Vaters verpasst und gehofft, dass er aus dem Haus ist, wenn ich zum Frühstück gehe. Als ich gerade die Galerie im ersten Stock durchquere, höre ich den Knall. Dumpf und grollend hallt er in meinen Ohren nach, und jahrelanges Training und Kampferfahrung lassen meinen Körper reflexartig zu Boden schnellen.
»Shit! … IEDs … Jinglytruck … Luft gejagt!«
Ich verstehe Rory kaum, obwohl er direkt neben mir im Wüstenstaub liegt, Mund und Augen weit aufgerissen, und brüllt, was das Zeug hält. Das brennende Stechen in meinem Hinterkopf ist kaum auszuhalten, und meine Ohren sind halb taub von der Explosion der IEDs, Sprengfallen, die den grün und rot bemalten Truck mit den klimpernden Ketten vor unseren Augen in eine gleißende Skulptur aus Feuer und Rauch verwandelt haben. Eine Druckwelle muss uns von den Sitzen des Landrovers gerissen und rückwärts in den Straßengraben geschleudert haben. Ich drehe den Kopf. Einige Militärfahrzeuge vor uns im Konvoi haben sich sogar überschlagen. Wenige Meter von mir entfernt liegt jemand. Ich starre auf eine rote Tätowierung.
»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«
Ich fahre herum und frage mich, was diese bescheuerte Anrede soll. Will Rory mich verarschen? Hinter meinem Freund schiebt sich ein dunkler Schatten in mein Sichtfeld, und im nächsten Moment erkenne ich einen Mann mit Bart und schwarzem Turban, die AK-47 im Anschlag. Rory berührt mich an der Schulter, beugt sich vor, mitten hinein in die Schusslinie des Taliban. FUCK, NEIN!
»Sir?«
Ich reiße die Arme hoch, will ihn aus der Schusslinie stoßen, als Rorys Gesicht verblasst, wie bei einer Diashow, wenn ein Bild in ein anderes übergeht. Graue, trübe Augen sehen mich besorgt aus dem faltigen Gesicht des Butlers an.
»Mr Williams!«, stoße ich keuchend hervor, blinzle und erfasse innerhalb der nächsten Sekunden meine erbärmliche Situation. Ich kauere auf dem Teppich im Gang des ersten Stocks unseres Manors, nur wenige Schritte von der Galerie hinter mir und etwa vier Zimmer von meinem entfernt. Hastig springe ich auf. Zur Hölle, da ist gar keine Explosion gewesen! Vermutlich ist nur eine Tür im Erdgeschoss zugefallen.
»Ich … ich habe …«, stammle ich und sehe einer dunklen Ahnung folgend über meine Schulter. Doch bis auf den alten Diener scheint niemand meinen Kontrollverlust bemerkt zu haben. Mein Vater hat den Salon zum Glück noch nicht verlassen.
»Sie sind auf einer Teppichfalte ausgerutscht«, erklärt Thomas Williams in diesem Moment.
Ich fahre herum und sehe erst ihn, dann den makellos straffen Teppich unter mir an. »Ja«, stoße ich ein wenig atemlos hervor, während mich eine Welle von Sympathie für den alten Kerl ergreift. »Das muss es gewesen sein.«
»Ich werde das Personal instruieren, beim nächsten Staubsaugen besser darauf zu achten, dass der Teppich keine Falten wirft. Brauchen Sie noch etwas, Sir?«
»Nein, vielen Dank, Mr Williams.«
Ich bemühe mich, gemessenen Schrittes auf mein Zimmer zu gehen, obwohl ich am liebsten laufen würde. Nachdem die Tür hinter mir zugefallen ist, werfe ich mich auf das Bett und schließe die Augen.
Einmal im Monat fahre ich die viereinhalb Stunden nach Hollybush in Ayr, übernachte im Combat Stress Centre und erzähle meinem Psychiater das, was er hören muss, damit mein Vater beruhigt ist und nicht dafür sorgt, dass ich stationär in der Einrichtung für traumatisierte Ex-Soldaten untergebracht werde. Oder, schlimmer noch, er einen Therapeuten dauerhaft für mich hier im Herrenhaus anstellt. Es hat mich einige Mühe gekostet, mir das notwendige medizinische Fachwissen anzueignen, um Dr. Sutherland zielsicher die exakten Symptome zu schildern, die mir eine Klassifikation denkbar harmloser Störungen ermöglichen, und dem Arzt gleichzeitig Symptome zu verheimlichen, die darüber hinaus vorliegen. Ich habe Veteranen kennengelernt, die es in einer pervertierenden Interpretation von Heldentum als Auszeichnung betrachten, wenn bei ihnen PTBS, eine Posttraumatische Belastungsstörung, diagnostiziert wird. Manche sind regelrecht enttäuscht, wenn man ihre Probleme, nach ihren Einsätzen wieder in den Alltag zurückzufinden, nur als Angststörung bezeichnet. Bei mir liegt der Fall genau anders herum. Nach meinem Blackout in Mali bin ich mit dem Verdacht auf PTBS erst einmal vom Dienst suspendiert und zur Weiterbehandlung nach Hause geschickt worden. Seitdem besteht mein Leben in dem Drahtseilakt, mich einerseits selbst zu kurieren und andererseits meinem Vater und den Psychiatern und Therapeuten vorzugaukeln, ich hätte mein Leben im Griff, würde nur ab und an von Albträumen heimgesucht werden und unter Platzangst leiden. Alles Dinge, die man in relativ kurzer Zeit wieder bewältigen kann. Und kurz muss die Zeitspanne in der Tat sein, denn lange halte ich es hier bei meinem immer spleeniger werdenden Vater nicht mehr aus.
Die letzte Nacht ist wieder eine dieser Nächte gewesen, in denen die TikToks in meinem Kopf um die höchste Klickzahl ringen. TikToks. So nenne ich neuerdings die Flashbacks, die sich in meinem Kopf von Zeit zu Zeit abspielen. Auf die Idee hat mich Keith, der achtjährige Sohn von Rory gebracht, als er mir die gleichnamige chinesische Kurzvideo-App auf seinem Handy gezeigt hat. Mit dem Unterschied, dass meine Filme nichts mit den lustigen Clips gemein haben und innerhalb von Minuten nach einer etwaigen Veröffentlichung von den App-Betreibern gelöscht worden wären. Zum Glück für die Allgemeinheit bin ich ihr einziger exklusiver Zuschauer. Die Bilder kommen meistens nachts, und manchmal wache ich von einem Schreien auf, bin schweißgebadet und muss feststellen, dass ich derjenige gewesen bin, der gebrüllt hat. Anfangs hat Mr Williams nach mir gesehen. Mittlerweile hat er sich an meinen »lebhaften Schlaf«, wie er es nennt, gewöhnt. Schwieriger sind die TikToks, die mich tagsüber heimsuchen, so wie gerade eben. Rory ist der Einzige, dem ich von ihnen erzählt habe. Nebeneinander mit dem L85 im Anschlag durch die Ruinen Kabuls zu streifen und Angst wie Sauerstoff zu inhalieren, lässt wenig Raum für die Maske unverletzbarer Männlich-keit.
»Nimm das nicht alles auf die leichte Schulter, Nevis«, hat Rory geschimpft, nachdem er seinen Sohn nach draußen gescheucht hatte. »Verdrängen bringt nichts, glaub mir.«
»Ach ja? Und Aquarelle malen, Pferdeskulpturen aus Lehm formen und im Sitzkreis bei Combat Stress hoffen, dass man nicht als Nächster drankommt, hilft dir wirklich weiter?«
Rorys Schweigen ist mir Antwort genug gewesen.
Ich setze mich im Bett auf, greife nach dem Handy auf dem Nachttisch und rufe Rory an.
»Ist dir was dazwischengekommen?«, meldet er sich, als er meine Nummer erkennt. Im Hintergrund sind die Stimmen von Susie und Keith zu hören. Sie scheinen sich wegen irgendetwas in den Haaren zu liegen, und Rorys Stimme klingt angespannt. Einen Moment lang zögere ich. Dann gebe ich mir einen Ruck.
»Nein. Ich überlege nur gerade, ob ich nicht schon heute nach Ayr fahre.« Sekundenlang ist nur das quengelnde Geschrei seines Sohnes im Hintergrund zu hören, dann schlägt eine Tür zu und erstickt Keiths Jammern. Rory atmet schwer. Ist er nach draußen gelaufen?
»Du bist jederzeit bei uns willkommen, Nevis, das weißt du. Gab’s wieder Ärger mit deinem Vater?«
»Nein. Ja. Ach, ich erzähl’s dir besser persönlich.«
»Geht klar. Wann bist du da?«
Ich sehe auf meine Armbanduhr. »Gegen fünf?«
Das Handy noch am Ohr, stehe ich auf, schnappe mir die Reisetasche und werfe sie aufs Bett.
»Soll ich dich am Bahnhof abholen?«
»Nein, ich bin mit dem Auto unterwegs.«
Rory lacht hohl. »Du weißt, was ich davon halte.«
»Der Aston ist gut versichert«, erkläre ich, obwohl ich ganz genau weiß, dass er sich keine Sorgen um mein Auto macht, auch wenn es an seinem Wohnort auffällt wie ein bunter Hund. Rory lebt in einer dieser identisch aussehenden Vorortsiedlungen mit aneinandergereihten Drei- bis Vier-Zimmer-Häusern in Kilmarnock, etwa eine halbe Stunde von Ayr entfernt. Bei meinem letzten Besuch hat er darauf bestanden, dass ich mein Aston-Martin-Coupé in seine Garage fahre.
»Damit die Kids hier in der Gegend nicht auf dumme Gedanken kommen«, hat er erklärt und ist sich verlegen durch die Haare gefahren.
Ich bin an den tristen Mietskasernen vorbeigefahren, die nur ein paar Straßen von seiner entfernt liegen, graue, vier Stockwerk hohe Betonklötze, die aussehen, als hätte sie jemand vollkommen planlos auf den Rasenstücken ohne Bäume, Hecken oder Blumen verteilt. Auf einer der Grünflächen hat der Hausmeister ein gelbes Schild mit der Aufschrift »Keine Ballspiele« aufgestellt. Womit sollen die Kinder in der Ödnis aus Beton- und Grasflächen denn sonst spielen?
»Ist nicht nur ihre Schuld«, hat Rory erklärt, weil er meinen verärgerten Blick falsch deutete. »Ich meine, einige von denen sind wirklich in Ordnung. Aber hier aufzuwachsen ist die Hölle.«
»Vergiss das Stück Blech!«, sagt er jetzt. »Sicher, dass du mit dem Fahren klarkommst?«
»Du kennst mich.«
Er schnaubt.
Trotz zahlreicher Versuche hat es Rory, seit er den Dienst quittiert hat, nicht mehr geschafft, Auto zu fahren. Das geht nicht allen Ex-Soldaten mit PTBS so. Manche haben überhaupt kein Problem mit dem Fahren. Ein Trauma hat schließlich unterschiedliche Auslöser, und die haben eben nicht das erlebt, was wir beide durchgemacht haben. Ich selbst habe eine Weile gebraucht, bis es mir gelungen ist, weiter als bis Inverness zu gelangen, ohne durch das Hupen oder den Straßenlärm irritiert am Randstreifen anzuhalten und mit schwitzigen Händen das Lenkrad wie einen Rettungsring zu umklammern. Auch jetzt meide ich den Verkehr von Großstädten wie Edinburgh oder Glasgow. Zu groß ist die Gefahr, diesen verdammten Flashbacks zu unterliegen.
Als ich mit der Tasche über der Schulter die Treppe nach unten eile, hoffe ich, mein Vater wird mir nicht über den Weg laufen. Aus dem Salon höre ich gedämpft das Klirren von Porzellan. Vermutlich räumt Mrs Butcher mit Finn gerade das Frühstücksgeschirr ab. Meine Schritte werden von dem Teppich verschluckt, und lautlos gelange ich zu der doppelflügeligen Eingangstür aus schwerem Eichenholz mit blank polierten dunklen Metallbeschlägen.
»Verzeihung, Mr MacKinley!«
Ich zucke zusammen und sehe zur Seite. Williams eilt mir mit langen Schritten entgegen, einen crèmefarbenen Zettel in der Hand. Ich erkenne sofort das Briefpapier meines Vaters und frage mich widerwillig, welche Anweisungen Alistair mir noch geben will.
»Ihr Herr Vater hat das für Sie bereitgelegt.«
Ich nehme ihm den gefalteten Zettel aus der Hand.
»Richten Sie ihm bitte aus, dass ich schon heute gefahren bin und bei einem Freund übernachte«, presse ich hervor.
Ohne einen Blick auf das Papier zu werfen, verlasse ich das Haus, eile zu meinem Wagen, hieve die Tasche in den Kofferraum und brause so schnell los, dass der Kies zu beiden Seiten aufspritzt.
Auf der Landstraße drossele ich das Tempo und atme tief durch. Der Himmel ist immer noch grau, und der Asphalt glänzt schwarz von Nässe, aber es hat aufgehört zu regnen. Wolken hängen tief über dem Land, recken ihre feuchten Nebelfinger zu den Hügelkuppen hinab in das Heidekraut, purpurfarbene Tupfen zwischen grünem Gras und braunem Farn. Meine Gedanken schweifen zu meinem Vater, und ich spüre, wie sich mein Kiefer anspannt.
Alistair hat mir mehrfach seit meiner Beurlaubung vom aktiven Militärdienst angeboten, meine Entlassung einzureichen und in der Sicherheitsberatung der Privatbank und der Investmentfonds, denen er vorsteht, tätig zu sein. Interkulturelle Kommunikation, Führungskompetenzen und Konfliktmanagement gehörten zu meiner Ausbildung in Sandhurst, und meine Zeit in der Antiterroreinheit des SAS qualifiziert mich natürlich mehr als alles andere für eine Tätigkeit im Sicherheitsdienst. Aber weder will ich als Begünstigter meines Vaters arbeiten noch kann ich ihm verraten, dass ich mich gesundheitlich noch nicht bereit für eine solche Beschäftigung halte. Im Moment bin ich schon froh, wenn ich es schaffe, einen Tag ohne die verdammten TikToks zu überstehen, beim geringsten Geräusch zusammenzuzucken oder nachts aus ständigen Albträumen zu erwachen. Früher habe ich während des Fahrens laut Musik gehört. Inzwischen ist Stille mein bester Freund, und ich gehe das Risiko nicht ein, mich unnötig vom Straßenverkehr abzulenken. Im Gegenteil. Damit meine Gedanken nicht in unerwünschte Richtungen abschweifen können, zwinge ich mich, alle Straßenschilder aufmerksam zu lesen und aus den Autokennzeichen die Herkunft des Fahrers zu erraten. Im Kopf zähle ich die Fahrzeuge, die aus Edinburgh und Glasgow kommen, als wären es zwei konkurrierende Fußballmannschaften, und gewinnen würde diejenige, die sich am häufigsten auf den Überlandstraßen blicken lässt.
Ich habe versucht, Rory den Trick mit dem Fahren beizubringen. Aber es ist ihm nicht gelungen, sich lang genug auf Kennzeichen und Straßenschilder zu konzentrieren. Sein erster Versuch endete damit, dass Susie einen Nachbarn anbetteln musste, damit er sie in den nächsten Ort fuhr, wo Rory zitternd und kreidebleich an seinem Ford lehnte und sich weigerte, auch nur einen Meter weiterzufahren.
Kurz vor Stirling verlasse ich die zweispurige M9, um zu tanken. Jetzt werfe ich einen Blick auf die Nachricht meines Vaters. Sie beinhaltet die Reisedaten von Kaya Lehmann, ihre Handynummer und Alistairs Bitte, mich mit ihr in Verbindung zu setzen. Während ich mich in die Schlange an der Kasse einreihe, fällt mein Blick auf die Süßigkeiten, und ich greife nach einem kurzen Zögern zu einer Packung Royal Fudge. Rorys Frau Susie liebt dieses klebrig-weiche Karamellkonfekt mit salzigen Erdnüssen. Sie erwartet kein Gastgeschenk von mir, aber ich weiß, dass sie sich darüber freuen wird, und seit ich am Telefon ihren Streit mit Keith gehört habe, nagt das schlechte Gewissen an mir, die Familie mit meiner Anwesenheit noch zusätzlich zu belasten. Für den kleinen Quälgeist finde ich eine grellbunte Marvel-Figur, gefüllt mit Schokolinsen. Die pseudomilitärische Kampfausrüstung des Superhelden ringt mir ein verächtliches Schnauben ab.
»Geiler Schlitten«, sagt eine Stimme in diesem Moment anerkennend, und ich sehe unwillig von dem Helden Made in China auf. Vor mir hat sich die Schlange gelichtet, und der Kassierer, ein junger Kerl in einem schwarzen T-Shirt mit der regenbogenfarbenen Anti-Brexit-Aufschrift REMAIN, macht eine Kopfbewegung zu der Zapfsäule, an der mein Auto steht. Ich quittiere die Bewunderung mit einem Schulterzucken, bezahle die Tankfüllung und die Süßigkeiten und wende mich wortlos zur Tür. Vermutlich hält er mich jetzt für ein arrogantes reiches Arschloch. Was soll’s.
Früher habe ich mich geschmeichelt gefühlt, wenn ich mit dem Aston Aufsehen erregte. Den wahren Grund für die Anschaffung des Luxuswagens kennt nicht einmal Rory. Ich habe ihn Anfang 2015, in meinem letzten Jahr beim 4SCOTS The Highlander Regiment, gekauft. Damals war das Regiment noch im deutschen Bad Fallingbostel stationiert und machte sich bereit zum Abzug nach North Yorkshire in die Catterick Garnison. Ich wurde mit gerade mal vierundzwanzig Jahren nach meinen Einsätzen in Afghanistan und Somalia zum Captain befördert und bestand das strenge Rekrutierungsverfahren für die britische Eliteeinheit Special Air Service, was nur zwei bis zehn Prozent der Anwärter gelingt.
Who dares, wins. Kein anderer Leitspruch konnte zu dieser Zeit besser auf mich passen. Nichts schien in meinem Leben unerreichbar. Mein Vater richtete kurz darauf ein Depot auf meinen Namen bei seiner Privatbank ein und kaufte mir Aktien im Wert von einer Viertelmillion Euro hinein. Wer Alistair nicht kannte, hätte darin eine Anerkennung für meine Leistungen vermuten können. Ich jedoch weiß, dass es nur seine Art war, mir unter die Nase zu reiben, dass ich trotz hoher Vergütung beim SAS niemals reich werden würde und Besseres aus mir hätte werden können. Und daher ist es meine Art gewesen, ihm durch den Verkauf sämtlicher Aktien und dem Erwerb des Aston Martin Vanquish zu zeigen, was ich von seinen »Almosen« halte. Wenn ich heute daran denke, wie ich nachts auf der deutschen Autobahn getestet habe, ob die Herstellerangaben stimmen und der Wagen tatsächlich 320 Stundenkilometer fährt, erfasst mich Wehmut. Inzwischen bewegt sich nicht mehr mein Fahrkönnen, sondern nur noch der Spritverbrauch der Kiste und der Neid meiner Mitmenschen auf hohem Niveau. Doch den Aston zu verkaufen, wäre ein Fehlereingeständnis, und diesen nachträglichen Triumph will ich meinem Vater nicht gönnen.
5
Es gibt zwei Möglichkeiten, um vom Flughafen Edinburgh wegzukommen. Über den Airlink, eine Busverbindung in die Innenstadt von Edinburgh, und über den Tramlink. Auf meinem Zugticket der ScotRail nach Inverness ist die Verbindung mit der Trambahn ausgewiesen, weshalb ich mich an den roten Schildern orientiere. Während meiner Studienzeit in München habe ich vor allem S- und U-Bahnlinien genutzt, manchmal den Bus. Straßenbahn bin ich zuletzt vor Jahren mit meiner Schwester in der Weihnachtszeit gefahren. Die sternengeschmückte historische Christkindl-Tram aus dem Jahr 1957 mit ihren knarzenden Holzsitzen kann allerdings nicht mit dem futuristischen schnittigen Zug konkurrieren, der jetzt vor mir hält. Free WiFi on Board lese ich auf den Fensterscheiben. Dagegen wartet die Christkindl-Tram mit freiem Glühwein und Plätzchen auf. Ich schmunzle, während ich meine Koffer auf die Gepäckvorrichtung wuchte und gegenüber auf einem der dunklen Kunstledersitze Platz nehme.
Der Zug füllt sich rasch. Eine Familie mit zwei Kindern quetscht sich neben mich. Ich angle mein Handy aus dem Rucksack und wähle mich ins schottische Telefonnetz. Es dauert eine ganze Weile, bis der Netzanbieter gefunden wird, und erst, als der Zug losfährt, gelingt es mir, das WiFi zu aktivieren.
»Ich will nicht in das doofe Ädinburg. Ich mag zuerst Nessi sehen!«, mault neben mir der kleine Junge mit der grünen Regenjacke. Sein schwarzer Lockenkopf streift meinen Arm. Nicht eine Sekunde sitzt er still. Seine Beine reichen kaum zu Boden, und er schlenkert sie vor und zurück, eifrig darum bemüht, die Koffer vor ihm mit den Schuhspitzen zu treffen, während er unablässig mit dem Reißverschluss seiner Jacke spielt. Er muss noch im Kindergartenalter sein, die Wangen rund, eine Stupsnase voller Sommersprossen und riesigen braunen Augen, die alles in seiner Umgebung aufsaugen, wie ein Schwamm. Das deutlich ältere Mädchen lugt hinter seiner Mutter vor, die stirnrunzelnd den Fahrplan auf der Anzeigetafel studiert.
»Nessi gibt’s überhaupt nicht. Daran glauben doch nur Babys wie du!«
»Mia!«, tadelt der Vater. Vermutlich ist das der Beginn ihrer Reise, aber er sieht jetzt schon so erschöpft aus, als wären sie seit Wochen unterwegs. Das Kofferwuchten hat ihn schwitzen lassen.
Schreibtischheld, denke ich mir. Bei meinen LUPUS-Führungen mit Wildtierbeobachtung habe ich einige von dieser Sorte erlebt. Familienväter, die sich wegen ihres wöchentlichen Besuchs im vollklimatisierten Fitnessstudio für sportlich halten und bei dem kleinsten Marsch im freien Gelände in der Hitze oder vor Anstrengung zusammenklappen.
Das Gesicht des Jungen verrutscht. »Aber ihr habt versprochen, dass wir in Schottland Nessi sehen!«, erklärt er vorwurfsvoll, und sein Blick wandert verunsichert zwischen seiner Schwester, die ihre Augen verdreht, nach ihrem iPod greift und sich die In-Ears zurück in die Ohren steckt, und seinem Vater, einem Mittdreißiger mit deutlichem Bauchansatz, hin und her. Dessen Antwort geht in dem androgynen Singsang einer Durchsage unter. Ob er wohl weiß, dass Forscher nach einer umfangreichen DNA-Analyse von Wasserproben des Sees in dem Ungeheuer einen riesigen Aal vermuten?
Ich denke an meine Eltern, daran, dass sie uns sicher nicht angeschwindelt hätten, um uns Urlaubsziele schmackhaft zu machen, und weiß nicht, ob ich das gut oder fantasielos finden soll. Ehrlich währt am längsten ist einer von Papas Lieblingssprüchen. Während die anderen Kinder versuchten, den Osterhasen beim Verstecken der Eier zu ertappen, erläuterte er uns die Etymologie des Wortes Ostern und die zeitliche Festlegung durch den Frühlingsvollmond. Rational entzaubert war unsere Welt, für alles gab es eine logische Erklärung, und wo diese fehlte, war das Wissen der Menschheit einfach noch nicht weit genug fortgeschritten. Zum Ungeheuer von Loch Ness hätte er uns sicher einen halbstündigen Vortrag über Plesiosaurier gehalten, sich enttäuscht über unser mangelndes Wissen über die Kreidezeit gezeigt und nur durch das Eingreifen unserer Mutter davon abgesehen, einen Brief an unsere Biologielehrerin zu schreiben. Im Übrigen sind sie mit Lena und mir kaum verreist. Mama schob die Arbeit in der Praxis vor, und Papa wurde nicht müde, die Krankheiten aufzuzählen, die man sich in fernen Ländern einfangen konnte. Wir fuhren in den Sommerferien für ein bis zwei Wochen abwechselnd nach Sylt oder Heiligenhafen. Aber vermutlich nur deshalb, weil mein Vater das Meeresklima gut für unsere Lungen hielt.
Der Kopf des Jungen stößt erneut gegen meinen Arm, seine dunklen Haare glänzen wie das schwarze Fell der Wölfe des Mollies-Rudels in der aufgehenden Sonne, und plötzlich blitzt das Bild ihrer nicht minder ungestümen Welpen vor mir auf. Schwarze und graue Fellknäuel mit kugelrunden Bäuchlein und kleinen spitzen Ohren, die mehr einer Mischung aus Fuchs und Bär als einem künftigen Wolf glichen. Ich sehe wieder ihren weißen Atem vor mir, als sie, kaum vier Wochen alt, versuchten, in das Geheul ihres Rudels einzustimmen. Ihre ersten tapsigen Schritte nach Verlassen des Wolfsbaus zu erleben, hat selbst den abgebrühten, langjährigen Wolfsbeobachtern unserer Gruppe ein Lächeln entlockt. Um vier Uhr morgens sind wir damals aufgebrochen, haben bei erfrischenden acht Grad mit den Spektiven auf einem Hügel Stellung bezogen, ausgeharrt und auf den Sonnenaufgang gewartet. Am Vortag sind wir an einer Bisonherde vorbeigekommen, träge in den morgendlichen Nebelschwaden grasenden Riesen, aber von Wölfen keine Spur. Abends ist in unserem Camp dann die Nachricht einer Wolfssichtung eingegangen. Ich tat die ganze Nacht kein Auge zu vor Aufregung, zum ersten Mal wahrhaftig einen wilden Wolf zu sehen, kein gezähmtes, menschengewöhntes Tier eines Wildparks.
Die Mollies sind eines der ältesten Wolfsrudel im Yellowstone Nationalpark. Ihr Revier wird im Norden vom Lamar Valley und im Süden vom Yellowstone Lake begrenzt. Der Flug nach Wyoming und die abenteuerliche Beobachtung des Mollies-Rudels markierte nicht nur den Beginn meiner bedingungslosen Leidenschaft für die Wölfe. Meine Schwester Lena hat einen Großteil ihrer Ersparnisse zusammengekratzt, um mich damals mit dieser Reise aus einem Abgrund zu reißen, in den ich geschlittert war und aus dem ich ohne sie niemals herausgefunden hätte.
Das Vibrieren meines Handys bringt mich in die Gegenwart zurück. Drei neue Nachrichten sind während des Fluges eingegangen. Die erste stammt von Martha, die mich bittet, gleich nach der Ankunft anzurufen und ihr meine Eindrücke zu schildern. Nachdem sie mich tagelang mit Händen und Füßen zu diesem Jahr in Schottland überredet hat, klingt ihr Text jetzt richtig zaghaft.
Ich runzle die Stirn und öffne die nächste Nachricht. Lena wünscht mir einen guten Flug und schreibt: »Glaub bloß nicht, dass die zehn Stunden Fahrtzeit mich abschrecken werden! Sobald du dich eingelebt hast, überfalle ich dich :)«
Ich lächele. Lena hat ihr jahrelanges Globetrotter-Leben nach dem Abitur endlich aufgegeben und ist, zumindest vorübergehend, so etwas wie sesshaft geworden, seit sie Psychologie in London studiert. Sie hat kaum glauben wollen, dass ich auch nur eine Sekunde zögerte, Alistair MacKinleys Angebot anzunehmen.
»Kostenlose Unterbringung und einen Arbeitsvertrag mit der Option, ihn nach einem Jahr zu verlängern! Was gibt es denn da zu überlegen? Womöglich wohnst du sogar in seinem Schloss, und er hat seinen eigenen Koch, und ein Zimmermädchen putzt deine Wohnung!«
»Ja, ja, die schottische Küche ist weltberühmt, ich weiß!« Sie sieht mich nur verächtlich an. »Okay, ich hab einfach Angst, dass es mir nicht gefallen wird. Ich mag meine Arbeit bei LUPUS. Ich war noch nie so … so unternehmungslustig wie du.«
»Und? Heißt das, du willst in deinem Leben niemals etwas Neues ausprobieren oder dich weiterentwickeln? Martha hat dir doch zugesichert, dich wieder voll zu integrieren, falls du nach dem Jahr die Nase voll hast oder der Milliardär dir an die Wäsche geht.«
»Lena!«
Sie lacht und legt den Arm um mich. »Wenn du dieses Angebot ausschlägst, rede ich nie wieder ein Wort mit dir. Die Luftveränderung wird dir guttun, gerade nach diesem Wahnsinn mit den Hybriden.«
Ein Kloß bildet sich in meinem Hals. Vor ein paar Wochen hat das monatelange Drama um einen Wurf von Wolfsmischlingen sein tödliches Ende gefunden. Die Hybriden, Mischlinge zwischen einem Schäferhund-Rüden und einer Wölfin, haben wochenlang die Schlagzeilen der Presse beherrscht und zu erhitzten Diskussionen zwischen Naturschützern, Jägern und Beamten des Umweltministeriums geführt. Man sah in den Welpen eine Gefahr, da sie als Mischlinge zukünftig nicht die natürliche Scheu wilder Wölfe gegenüber Menschen an den Tag legen würden. Jagdverbände forderten, sie zur »Entnahme aus der Natur« freizugeben. Ich könnte immer noch kotzen bei der euphemistischen Umschreibung ihrer Tötung. Martha und ich hatten dafür gekämpft, sie einzufangen und in einem Wildtierpark mit Wölfen und Bären unterzubringen. Zunächst sah es aus, als würde uns das gelingen. Aber dann verloren wir ihre Spur, und die Behörden sahen sich aufgrund der aufgeheizten Stimmung durch die hetzenden Medien immer mehr unter Druck gesetzt. Wir waren einfach nicht schnell genug. Wir haben versagt.
»Kaya, das war nicht deine Schuld!«
»Wenn wir sie früher eingefangen hätten …«
»Du weißt nicht einmal, ob sie sich problemlos in das Wolfsrudel des Wildparks integriert hätten.« Sie seufzte. »Die Highlands sind doch genau dein Fall, umwerfende Landschaft, vollkommene Einsamkeit und dann noch dieses ehrgeizige Wolfsprojekt! Du kannst von der ersten Stunde an daran mitwirken, Wölfe wieder in Schottland anzusiedeln. Erzähl mir nicht, dass dich das nicht reizt.«
Ich biss mir auf die Unterlippe, und sie versetzte mir einen sanften Stoß mit dem Ellenbogen. »Eben. Und außerdem will ich dich im Schloss zum Tee besuchen.«
»Es ist laut Martha ein Herrenhaus und kein Schloss, und London liegt auch nicht gerade um die Ecke, falls dir das entgangen sein sollte.«
Aber Lena hat nur spöttisch die Mundwinkel verzogen. Schließlich hat sie nach dem Abi die halbe Welt bereist. Schottland ist für sie vermutlich nur einen Katzensprung von London entfernt.
Die dritte Nachricht auf meinem Handy stammt von Alistair MacKinley persönlich. Förmlich steif, wie in seinen bisherigen Mitteilungen, heißt er mich in Schottland willkommen und erklärt, wie sehr er sich freue, mich bald kennenzulernen. Er teilt mir mit, dass er meine Handynummer seinem Sohn gegeben habe, der sich freundlicherweise bereit erklärt habe, mich vom Bahnhof in Inverness abzuholen. Nevis MacKinley werde sich mit mir in Kürze in Verbindung setzen.
Sein Sohn? Komisch, Martha hat gar keinen Sohn erwähnt, lediglich erzählt, dass MacKinleys Frau nur selten auf dem Landsitz anwesend sei und sich die meiste Zeit über in ihrem Stadtwohnsitz in Glasgow aufhalte.
»Wenn ich Alistair richtig verstanden habe, wird auch er oft in Edinburgh oder anderenorts beruflich eingespannt sein. Du wirst die meiste Zeit allein sein und freie Hand haben«, hat Martha mir gesagt.
Vermutlich ist sein Sohn nur vorübergehend zu Besuch. Eine erneute Durchsage kündigt die Station Haymarket an, von der mein Zug nach Inverness weggeht. Ich will eben das Handy in die Jackentasche stecken, als es vibriert und den Eingang einer neuen Nachricht von einem unbekannten Absender verkündet.
»Warte um sieben am Bahnsteig 8. Versuchen Sie, pünktlich zu sein. Nevis MacKinley«
Ich starre auf das Display, bis die Bahn hält und die Türen sich öffnen. Hastig stopfe ich das Handy in die Tasche, schultere den Rucksack und greife nach den Koffern. »Tschüss!«, ruft der kleine Junge mir zu, und ich ringe mir ein hastiges Lächeln ab.
»Viel Spaß mit Nessi!«, rufe ich ihm noch zu, bevor ich mit meinem Gepäck bereits auf dem Bahnsteig stehe.
Der Unterschied zwischen den freundlichen, von höflichen Floskeln nur so wimmelnden Botschaften Alistair MacKinleys und dieser geradezu militärisch gebieterischen Nachricht seines Sohnes ist so eklatant, dass ich im ersten Moment vollkommen verwirrt bin. Hat er sich in der Nummer getäuscht und jemand anders anschreiben wollen? Ich lese den Text erneut. Aber die Erwähnung des Bahnsteigs lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Nachricht mir gilt. Ärger kriecht in mir hoch. Ich sehe auf das Fahrticket. Mein Zug kommt erst um 19:10 Uhr in Inverness an. Wie soll ich da pünktlich um sieben am Bahnsteig acht sein? Ich antworte:
»Sehr geehrter Mr MacKinley«
Lösche den Text und schreibe stattdessen:
»Ich komme um 7:10 pm in Inverness an. Sie werden zehn Minuten Wartezeit einkalkulieren müssen.«
Erneut lösche ich das Geschriebene und tippe:
»Ankunft um 7:10 pm. Kaya Lehmann«
Mit einem leisen Fluch lösche ich auch diese Nachricht und beschließe, Nevis MacKinley einfach zehn Minuten seines wertvollen Lebens auf Bahnsteig acht ohne weitere Erklärung schmoren zu lassen. Wenn er will, kann er gerne auf den Anzeigetafeln lesen, wann der Zug aus Edinburgh in Inverness einfährt.
6
Rorys bordeauxroter Ford steht auf der Straße vor seinem Haus, und das Garagentor ist hochgezogen. Auch ohne die Gartengeräte wie Rechen, Heckenschere und Besen, die sonst an den Haken der Wand befestigt sind und die Rory jetzt an die Mauer im Hof gelehnt hat, ist die Garage furchtbar eng. Ich muss das Auto millimetergenau hineinmanövrieren und kann mich nur mit Mühe aus der Tür quetschen. Deshalb bemerke ich Keith erst, als ich meinen Rucksack und die Reisetasche aus dem Kofferraum geholt und das Garagentor wieder heruntergezogen habe. Er steht plötzlich vor mir auf dem hellgrauen Pflaster, und ich kann ein Lachen nicht unterdrücken. Nicht nur seine Schuhe und die ehemals weißen Stulpen sind schlammverschmiert. Die blau-weißen Mannschaftsfarben des FC Kilmarnock verschwinden hinter rasengrünen und erdfarbenen Flecken, als wäre es eine Tarnuniform und kein Fußballtrikot. Keiths Haare kleben nass an seinem Kopf, und er strahlt über das ganze Gesicht.
»So sehen Sieger aus«, begrüße ich ihn. »Habe ich recht?«
Er nickt und grinst noch ein wenig breiter. Seit diesem Jahr ist er im Juniorteam des FC Kilmarnock und betet die Spielergebnisse der Fußballtabellen herunter wie andere Kinder das Einmaleins. Sehr zum Leidwesen seiner Mutter Susie, der es andersherum lieber wäre.
»Die Weicheier von Aberdeen hatten überhaupt keine Chance gegen uns! Haben sie zehn zu drei platt gewalzt.«
Ich recke den Daumen nach oben, als ein Aufschrei hinter mir ertönt.
»Oh, mein Gott! Hast du dich im Schlamm gewälzt?«
Wir drehen uns um und erspähen Susie, die mit entsetztem Gesichtsausdruck und in die Hüften gestemmten Händen kopfschüttelnd im Hauseingang steht. »Komm mir bloß nicht so ins Haus!«
»Oh, dann fahre ich eben wieder«, rufe ich und zwinkere Keith zu, der kichert.
»Nicht du, Nevis!« Susie ringt die Hände, aber kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Schön, dass du da bist.« Und ins Hausinnere ruft sie laut: »Rory, Nevis ist da! Und dein Sohn muss in die Quarantäneschleuse.«
Ein goldbrauner Blitz huscht an ihr vorbei, jagt die Treppe hinunter und schießt auf Keith zu. Der hebt abwehrend den Fußball über seinen Kopf. »Nein, Scot! Das ist nicht deiner! Wir spielen später.«
Aber der Airedale Terrier scheint das anders zu sehen und springt begeistert an dem Jungen hoch und versucht, den Ball zu erhaschen.
»Ich kauf dir keinen neuen, wenn du ihn wieder von ihm zerbeißen lässt!«, warnt Susie und ergänzt an mich gewandt: »Du hast keine Ahnung, wie viel diese verdammten Fußbälle mit Vereinslogo kosten!«
»Los, spritz ihn mit dem Gartenschlauch ab, Nevis!«, dringt in diesem Moment Rorys Stimme aus dem Haus.
»Okay.« Ich lasse meine Tasche und den Rucksack zu Boden gleiten und packe Keith am Saum seines Trikots. Vor Schreck lässt er den erdverschmierten Fußball fallen, Scot wittert seine Chance und jagt ihm in den Vorgarten hinterher, während Susie »AUS! SCOT!« brüllt. Aber da läuft Rory auch schon die Treppe hinunter, greift nach dem Gartenschlauch, der unaufgerollt im Hof liegt, und dreht den Wasserhahn auf. Scot erstarrt, lässt den Ball stehen und rast die Treppe hoch zurück ins Haus. Offenbar glaubt er, für seine Balljagd mit einer Dusche bestraft zu werden. Susie lehnt sich lachend an den Türrahmen.
»Spielstand?«, fragt Rory drohend mit todernster Miene, die Wasserspritze wie eine Pistole auf seinen Sohn gerichtet.
Ich gebe mir alle Mühe, ernst zu bleiben.
»Zehn zu drei«, stammelt Keith und schielt ängstlich zu meiner Hand, die sein Trikot immer noch fest im Griff hat. Vielleicht würde er sich losreißen, wenn ich ihn nicht mit meinem linken Prothesenarm festhalten würde. Zu spät kommt mir in den Sinn, dass er sich davor wahrscheinlich furchtbar gruselt, und ich lockere den Griff.
»Für uns«, ergänzt Keith hastig.
»Glück gehabt!« Rory geht vor ihm in die Hocke, legt den Schlauch mit der Wasserspritze neben sich ab und schnürt die Schuhe seines Sohnes auf. Als Keith aus ihnen geschlüpft ist und mit bangem Gesicht zu ihm aufsieht, grinst er, zieht ihn in einem Ruck, ungeachtet der verdreckten Kleidung, in seine Arme und hebt ihn hoch. Keith quietscht erschrocken auf.
»Lass mich runter, Dad! Das ist voll peinlich!«
»Mach dich nützlich, Nevis«, brummt Rory ungerührt mit einer Kopfbewegung zu Schlauch und schlammverkrusteten Schuhen. »Ich muss den Fußballhelden hier erst mal in die Dusche stecken.«
»Ich bin dein Vorgesetzter, schon vergessen?«, rufe ich ihm lachend hinterher, während er seinen Sohn an Susie vorbei ins Hausinnere schafft.
»O Captain, mein Captain!«, dröhnt seine Stimme spottend aus dem Inneren, und ungewollt überläuft mich ein Schauer.
O Captain, my Captain, our fearful trip is done!, vollendet meine innere Stimme in diabolischem Flüstern die erste Zeile von Walt Whitmans Gedicht über die Ermordung Abraham Lincolns. Ist sie wirklich jemals vorbei, unsere Reise des Grauens? Rory hat nur einen Witz machen wollen und kann unmöglich wissen, was dieses Gedicht mir bedeutet und wer mir diese Zeilen mit übertriebener Inbrunst zuletzt vorgetragen hat.
Susie kommt mir mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht zu Hilfe. »Ist das zu fassen? Jetzt kann ich auch noch Rorys Klamotten waschen! Weißt du was, die zwei machen mich vollkommen fertig!«
Einen Augenblick lang sieht es so aus, als wolle sie mich zur Begrüßung umarmen, aber ich gehe schnell genug in die Hocke, greife nach einem Fußballschuh und spritze ihn mit dem Wasser ab.
»Er wird Rory immer ähnlicher«, sage ich.
Sie kauert sich neben mich, schnappt sich den anderen Schuh und klopft den gröbsten Schlamm von der Sohle am Boden ab.
»Allerdings. Und wie geht’s dir, Nevis?«
»Immer gleich«, murmle ich schulterzuckend.
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.
Die Stille wird nur von dem Wasserrauschen des Gartenschlauchs unterbrochen. Und je länger sie andauert, umso mehr bedauere ich, dass der glückliche Moment von eben so schnell verflogen ist. Meistens läuft das so. Es ist, als würde ich einen winzigen Blick in mein früheres Leben werfen, nur um daran erinnert zu werden, wie es sein kann und was ich verloren habe. Aber dann schließt sich dieses Fenster, und ich weiß einfach nicht, wie ich es aufhalten soll, was ich sagen soll, um die Stille und die düsteren Gedanken zu überwinden. Ich versuche, mich daran zu erinnern, wie Smalltalk geht. Über das Wetter zu reden, die pinkfarbenen Blumen, die Susie im Vorgarten gepflanzt hat und deren Namen ich nicht kenne, ein Kompliment zu ihrer neuen Frisur. Hat sie überhaupt eine neue Frisur? Ich hebe den Kopf und sehe sie an. Ihre blonden glatten Haare sind zu einem kinnlangen Bob geschnitten, und ich kann mich verdammt noch mal nicht mehr daran erinnern, ob sie beim letzten Mal die Haare anders getragen hat. Sie erwidert meinen Blick. Verunsicherung glimmt in ihren hellblauen Augen auf.
»Stimmt was nicht?«
»Nein … ich … sorry!«, murmle ich und komme mir wie ein Idiot vor. Ich reiche ihr den sauberen, aber tropfnassen Schuh, und sie steht auf und legt ihn auf die oberste Treppenstufe unter das Vordach, während ich den zweiten Schuh bearbeite.
»Sag was, Nevis!«, dröhnt es in meinem Kopf. Aber da ist nur Leere und Walt Whitmans Gedicht, und es gehört sicher nicht zu Smalltalk, über die Ermordung Abraham Lincolns zu reden. Aber das Gedicht ist immer noch harmlos im Vergleich zu den Bildern aus der Vergangenheit, die gerade drohen, an den Rand meiner Wahrnehmung zu driften. Mike, halb tot in meinen und Rorys Armen und um uns herum nur Chaos, Explosionen und Blut. So viel Blut.