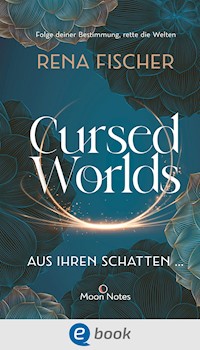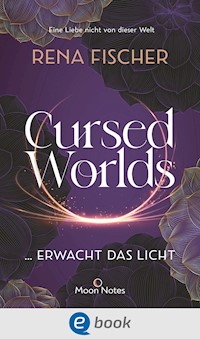Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leben kann gefährlich sein – manchmal auch die Liebe Frühling in Andalusien. Ein ungewöhnlicher Auftrag führt die junge Nina Winter von München nach Sevilla. Für einen wichtigen Großkunden soll die erfolgreiche Unternehmensberaterin die Seriosität einer archäologischen Ausgrabung prüfen. Grabungsleiter ist der so attraktive wie eigenwillige Dr. Taran Sternberg, der sich mit Leib und Seele der Wissenschaft verschrieben hat. Ist er wirklich einem sensationellen phönizischen Goldschatz auf der Spur? Und welche gefährliche Rolle spielt dabei der zwielichtige Archäologe Orlando Torres? Nina gerät zwischen die Fronten der rivalisierenden Männer, die bereit sind, mit allen Mitteln für ihr Ziel und um Ninas Herz zu kämpfen.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rena Fischer
Das Leuchten vergangener Sterne
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Christine,
ohne dich würden meine Sterne nicht leuchten
Eine Frau, die mit einem Archäologen verheiratet ist,
darf sich glücklich schätzen, denn je älter sie wird,
desto interessanter wird sie für ihren Mann.
Agatha Christie
Eins
Ich fliege.
Salz mischt sich mit dem Geschmack von Blut, als ich mir vor Aufregung auf die Unterlippe beiße. Die eben noch von meinem Bord aufgewirbelte Gischt, hunderte von winzigen Wasserkristallen, kann meine Füße nicht mehr erreichen. Sie funkeln sekundenlang unter mir wie die Steinchen in dem nachtblauen Swarovski-Füller, den Paps mir zum Übertritt aufs Gymnasium geschenkt hat. Dann fallen sie zurück ins Meer. Aber ich schwebe weiter über ihnen, und das Herz klopft mir so heftig in der Brust, wie der Wind an meinen Haaren reißt.
Vier Tage lang hieß es, Zähne zusammenbeißen. Trockenübungen am Strand, um ein Gefühl für die Bar, das Trapez und den Kite zu bekommen. Dann Bodydrags im Wasser. Und Theorie: Upwind. Downwind. Luv und Lee. Sicherheitschecks.
»Ist das ätzend«, hat Charlie gestöhnt und sich eine ihrer schwarzen Locken aus der Stirn gepustet. »Wann dürfen wir endlich aufs Bord? Wann lernen wir die Jumps?«
Heute ist es so weit.
Aber ausgerechnet heute ist Charlie mit ihren Eltern im Archäologischen Museum von Empúries, nur etwa zehn Gehminuten vom Sant-Martí-Strand entfernt, um die Ruinen und irgend so eine doofe Statue von Asklep-Irgendwas anzuschauen, dem griechischen Gott der Heilkunst. Darauf hat ihr Vater bestanden, weil der nämlich Arzt ist.
»Ein wenig Kultur sollte jeden Urlaub bereichern, liebe Charlotte«, erklärte er, als sie protestiert hatte. »Du kannst morgen wieder kiten.«
»Diese Statuen schauen doch alle gleich aus. Das macht seine Tochter nicht klüger und ihn zu keinem besseren Quacksalber«, hatte Paps gebrummt, als wir nach dem Abendessen mit Charlie und ihren Eltern wieder allein im Hotelzimmer waren.
Das finde ich auch. Gleich am ersten Tag des Kitesurf-Kurses habe ich mich mit Charlie angefreundet. Mit elf sind wir die Jüngsten in der Gruppe. Die vier Jungs sind alle zwischen dreizehn und fünfzehn. Ich ärgere mich, weil sie jetzt nicht hier ist, um zu sehen, was für einen phänomenalen Start ich mit dem Bord auf dem Wasser hingelegt habe. Das soll sie mir morgen erst mal nachmachen! Klatsch. Ich komme wieder auf dem Meer auf, verlagere das Gewicht, um auszubalancieren, gehe stärker in die Knie und beuge mich nach hinten, überlege, ob es mir gelingen wird, mit den Spitzen meiner Haare das Wasser zu berühren. Die Geschwindigkeit raubt mir den Atem, der Himmel wölbt sich in einem perfekten, wolkenlosen Blau über mir, und ich möchte schreien vor Glück. Aber es ist jemand anderes, der schreit.
»NINA!«
Als ich meinen Blick vom Himmel abwende, um zu sehen, was mein Kite-Lehrer von mir will, ist es zu spät. Ich verstehe nicht, wieso der Strand plötzlich so nah herangekommen ist und ich unmittelbar darauf zurase. Hektisch reiße ich an der Bar, schlenkere sie nach rechts und links. In meinem Kopf herrscht angsterfüllte Leere. Nichts von dem, was Antonio uns für solche Notfälle eingetrichtert hat, kommt mir wieder in den Sinn. Stattdessen hebe ich mit der nächsten Windbö erneut ab, aber jetzt erfasst mich kein Gefühl von Freude mehr, nur noch Panik, als Wasser hellem Sand weicht und ich plötzlich einen Jungen vor mir am Strand sehe. Er bemerkt mich nicht. Er hält einen Stab in der Hand, den er über den Boden bewegt, und schaut konzentriert nach unten. Vielleicht ist er blind?
»WEG DA!«, brülle ich und denke zu spät daran, dass er vermutlich überhaupt kein Deutsch versteht.
Sein Kopf ruckt hoch, braune Haarsträhnen fallen ihm ins Gesicht, das immer näher und näher kommt. Ich sehe, wie seine hellen Augen sich weiten, und dann krache ich auch schon in ihn hinein, reiße ihn zu Boden, verliere das Bord und fege über ihn hinweg. Mit den Knien schlage ich am Sand auf. Der Kite zerrt mich den Strand entlang, und Tränen brennen mir in den Augen. Meine Brust, die Knie und die Schienbeine schmerzen höllisch. Endlich erinnere ich mich an Antonios Drei-Stufen-Sicherheitssystem und lasse die Bar los. Im nächsten Moment packt mich jemand an meinen Füßen, hält mich fest und schiebt sich über meinen Rücken. Hände greifen über meinen Kopf hinweg und betätigen den Quick-Release. Der Kite segelt langsam wie ein Blatt Papier in den Sand, und ich fühle, wie meine Wangen sich röten. Warum habe ich daran nicht selbst gedacht? Das Gewicht über mir verschwindet.
»Alles okay?«
Ich stemme mich mit zitternden Händen auf die Knie. Dann starre ich in schilfgrüne Augen mit winzigen goldenen Punkten um die Pupille. Sie leuchten unglaublich hell in dem sonnengebräunten, sommersprossigen Jungengesicht.
»Tut mir leid«, murmele ich zerknirscht. Ein Lächeln huscht über seine Miene, dann runzelt er die Stirn. Blut klebt an seiner Unterlippe, und er streicht es sich zusammen mit Sandkörnern vom Mund. Der Sand ist durch seinen unfreiwilligen Sturz einfach überall, auf seinen Wangen, dem schwarzen T-Shirt und in seinem Haar. Vor Scham möchte ich im Boden versinken. Mein Blick bleibt an seinem Handgelenk hängen, an einem Armreif aus braungolden schimmerndem Metall. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Filigrane ineinander verschlungene Stränge, wie geflochten oder verknotet, und in ihrer Mitte ein Rad. Seine vier Speichen umfassen einen grünen, mattgeriebenen Stein und auch das Metall sieht ganz schön verwittert aus.
Jemand berührt mich an der Schulter und ich drehe mich um. Antonio redet wild gestikulierend in seiner typischen Mischung aus Spanisch, Englisch und Deutsch auf mich ein. Aber ich höre ihm nicht zu. Denn über seine Schulter hinweg sehe ich jetzt Paps auf uns zurennen, die Kamera, mit der er gefilmt hat, immer noch in der Hand, das Gesicht angespannt. Ich kenne diesen angsterfüllten Ausdruck darin nur allzu gut, und wenn ich nicht sofort zeige, dass alles in Ordnung ist, bricht er den Kitesurf-Kurs bestimmt ab. Also stehe ich auf und zwinge mich trotz der Schmerzen zu einem Lächeln und winke ihm fröhlich zu. Als ich mich wieder zu dem Jungen umdrehe, ist er weg. Ich entdecke ihn am Wasser, dort, wo ich mit ihm zusammengestoßen bin. Mein Bord liegt nur wenige Schritte von ihm entfernt, und ein Mann in Paps’ Alter steht bei ihm. Sie untersuchen den schwarzen Stab mit einem tellerförmigen Ende, den er vor meinem Überfall über den Boden bewegt hat. Was zur Hölle ist das nur? Ein Blindenstock für Sandstrände offenbar nicht. Ich starre ihnen nach, als sie weitergehen, ihre Blicke auf den Sand geheftet, und ein Gefühl macht sich in mir breit, das ich nicht benennen kann.
»Dreh dich um!«, wispert eine Stimme in mir.
Aber der schlaksige Junge geht neben dem Mann weiter, ohne auch nur einen Blick zurückzuwerfen, und da fällt mir ein, dass ich mich noch nicht einmal für seine Hilfe bedankt habe.
1
Nina Winter war stolz darauf, alles in ihrem Leben richtig gemacht zu haben. Sie sah von ihrem Schreibtisch auf und ließ den Blick zu der gewaltigen, bis zum Boden reichenden Panoramascheibe wandern. Der Frühlingshimmel präsentierte sich im hymnenverklärten Weiß und Blau, die Zugvögel kehrten allmählich zurück und weckten sie morgens mit ihrem fröhlichen Gezwitscher, und sicher würde sie sich auch bald an ihr neues Büro bei Macmillan & Richardson gewöhnt haben. Kurz nach Weihnachten hatte die deutsche Zentrale der weltweit führenden Unternehmensberatungsgesellschaft ihre neuen Geschäftsräume in München bezogen. Als diese von einem spanischen Architektenduo geplant worden waren, hatte Nina noch für ihren Bachelor in Betriebswirtschaftslehre gebüffelt und von einem Job bei einer der Big Five im Consulting nach ihrem Master geträumt. Jetzt, nach vier Jahren Projektlaufzeit und drei Jahren Bauarbeiten, saß Nina nicht nur in einem futuristischen, energiesparenden Glaspalast mit Solardach, neuester Belüftungstechnik und begrüntem Innenhof, ihr war auch eines der wenigen Blue Offices zugeteilt worden. Ein Einzelbüro war eine Auszeichnung und unterstrich ihre neue Position in der Firma. Zeitgleich mit dem Umzug hatte sie nämlich den Ritterschlag zur Projektleiterin, das interne »Beraterdiplom«, errungen. Und das mit achtundzwanzig Jahren! Die Blue Offices waren die gläsernen Wellenbrecher zur Außenwelt mit Panoramablick zum Münchner Hofgarten und der Bayerischen Staatskanzlei auf der einen und dem Karolinenplatz auf der anderen Seite des Gebäudes. Nach innen umarmten sie mit ihren blaugetönten Glaswänden und -türen das unruhige Meer eines Open-Space-Büros mit Schließfachanlagen und diverse Lounges und Bartheken mit Teeküche und Kaffeeinsel. Dort arbeiteten die Fellows und Associates, die noch nicht lange bei der Firma waren. Auch sie mussten sich erst an das moderne Arbeitskonzept gewöhnen, denn sie suchten sich täglich einen neuen Arbeitsplatz und räumten das persönliche Office Kit abends wieder in eines der Schließfächer. An manchen Tagen dachte Nina mit gemischten Gefühlen an das alte Stadtpalais an der Isar mit dem dunkelfleckigen Fischgrätparkett, den stuckverzierten Decken, beschlagenen Altbaufenstern im Herbst und Eisblumen im Winter zurück, an ihren gemütlichen Schreibtisch aus Nussbaumholz mit zahllosen kleinen Kerben. Heute beherrschte der Minimalismus Ninas Tisch, ein schneeweißes Design-Hochglanzstück mit Curved Monitor, Telefon und diversen integrierten Anschlüssen für Laptop, Smartphone und Netzwerk. Keine Zettelwirtschaft, Notizblöcke oder Post-its, keine Privatfotos in silbernen Bilderrahmen, nicht einmal mehr die schlichte Vase mit frischen Tulpen schmückten die Schreibtische der Consultants. Die neue Devise bei Macmillan & Richardson lautete: Klarheit auf dem Tisch führt zu Klarheit im Kopf.
Notizen wurden mit elektronischen Eingabestiften auf dem Tablet notiert, in Druckschrift umgewandelt und interne Anweisungen über das Firmennetzwerk verschickt und in diversen Chatgruppen diskutiert. Hierarchische Bürostrukturen waren aufgebrochen worden, mehr Interaktion und Kommunikation wurden gefordert. Wer zu häufig den Großraumarbeitsplatz verließ und die privatere Atmosphäre in den gemütlichen Lounges suchte, wurde misstrauisch beäugt. Auch Nina fühlte sich manchmal beobachtet in ihrer Käseglocke, wie sie ihr neues Büro insgeheim nannte. Links konnte sie durch das Panoramafenster zu dem Obelisken auf dem Karolinenplatz spähen, rechts lagen Schreibtische wie bunte Inselgruppen im Meer des Open- Space-Büros, vor und hinter ihr befanden sich die nächsten Blue Offices. Zu oft war sie versucht gewesen, die eingebauten Stoffjalousien per Knopfdruck herunterzufahren. Doch die gläsernen Wände ihres Büros brachten mehr Tageslicht in die Gemeinschaftszone, und das hielt sie davon ab, für mehr Privatsphäre zu sorgen. Vor allem aber, weil es bislang auch kein anderer Berater getan hatte.
Ein Signalton ließ sie zurück auf ihren Monitor schauen. In fünf Minuten Team-Meeting Area 11 poppte als Erinnerung auf. Seufzend stand sie auf, steckte das Smartphone in die Tasche ihrer marineblauen Stoffhose, nahm das Tablet und wandte sich zur Tür. Um ein Haar wäre sie zurückgeprallt, denn dort wartete schon ihr Vorgesetzter, mit einem Lächeln so breit wie seine Schultern. Nils öffnete die Glastür und hielt sie ihr auf. Wie immer ganz der Gentleman.
»Guten Morgen, Nina! Haben wir noch Zeit für einen Espresso in der Lounge?«
Sie sah demonstrativ auf ihre Uhr, auf deren Display ebenfalls die Terminerinnerung aufleuchtete.
»Lass uns lieber pünktlich sein, heute steht wirklich viel auf der Agenda.«
In der Nacht nach der Eröffnungsfeier der neuen Büroräume und anlässlich ihrer Beförderung hatte sie sich beschwipst von Nils nach Hause fahren lassen und sich seither oft dafür verflucht, kein Taxi genommen zu haben.
»Ich gratuliere dir von Herzen«, hatte er an jenem Abend mit seinem einnehmenden Lächeln gesagt und ihr ein weiteres Glas Champagner gebracht.
»Danke, aber ich muss noch fahren.«
»Unsinn, Nina. Darauf musst du doch mit allen anstoßen! Mach dir keine Sorgen, ich kann dich später auch nach Hause bringen.«
Ein verdammter Moment der Schwäche!
Nils war zwei Jahre älter als sie und bei ihrem Einstieg in die Firma vor fünfeinhalb Jahren ihr Mentor gewesen. Er war ein Mann, auf den sich sofort alle Blicke richteten, wenn er einen Raum betrat. Anfangs hatte er Nina dadurch ein wenig verunsichert, später kam sie nicht umhin, ihn zu bewundern. Mittlerweile war er Associate Partner und so verdammt perfekt, dass man Gänsehaut bekam, je länger man mit ihm zusammenarbeitete. Gleichgültig wie stressig und komplex die Arbeit wurde, er war immer wie ein Leuchtturm auf den Klippen, der mit seinem Licht den anderen den Weg aus jeder noch so verzwickten Kalkulation, Risikobewertung oder Analyse wies. Er hatte ein goldenes Händchen für Mitarbeiterführung und wickelte jeden Mandanten, ob Mann oder Frau, mühelos um den kleinen Finger. So auch sie an jenem Abend. Aber verliebt war sie eigentlich nie in ihn gewesen. Na ja, vielleicht anfangs ein wenig. Bis zu jener verdammten Nacht im Januar hatte sie jedoch nie daran gedacht, mehr als einen Arbeitskollegen in ihm zu sehen. Es gab noch so viel, was sie beruflich erreichen wollte. Sie hatte im Augenblick einfach keine Zeit für eine feste Beziehung, für den Stress, sich für lange Überstunden oder Arbeiten am Wochenende rechtfertigen zu müssen.
Never fuck the company.
Nina konnte sich immer noch nicht richtig erklären, wie es damals zu dem Kuss in Nils’ BMW und danach zu der gemeinsamen Nacht in ihrer Wohnung gekommen war. Sie hatte ihre Prinzipien und hatte sich bis dahin niemals auf einem Firmenevent betrunken. Vielleicht hatte auch das Weihnachtsessen mit Paps zwei Wochen zuvor eine nicht unerhebliche Rolle bei diesem verhängnisvollen Ausrutscher gespielt.
»Erinnerst du dich noch an die kleine Charlie und euren Kitesurf-Kurs in unserem ersten Urlaub an der Costa Brava?«, hatte er zwischen Gans mit karamellisiertem Apfel und Maronenpüree und dem Spekulatius-Tiramisu gefragt. Colette, seine langjährige Haushälterin aus dem Elsass, hatte sich wieder einmal mit dem Festtagsessen für sie beide übertroffen, bevor sie nach Hause zu ihrer Familie gereist war. Daran hatte Paps sicher die folgenden drei Tage bis zu ihrer Rückkehr zu futtern gehabt.
Nina hatte an dem Spätburgunder genippt. »Nur noch vage. Warum?«
»Ich bin ihrem Vater letzte Woche zufällig in Düsseldorf begegnet. Er sagte, sie erwarte ihr drittes Kind.«
Um ein Haar hätte Nina den Wein auf die Damast-Tischdecke gespuckt.
»Schau nicht so schockiert. In deinem Alter waren deine Mutter und ich auch schon seit drei Jahren verheiratet und du hast gerade laufen gelernt.«
»Die Zeiten haben sich geändert, Paps.«
»Nein. Du lässt nur niemanden an dich ran.«
»Nicht schon wieder dieses Thema!«
»Du bist bald dreißig.«
»Runden wir jetzt mathematisch auf?«
»Wenn du dich nicht beeilst, sind alle attraktiven Kerle weg und du musst dich mit der zweiten Wahl begnügen.«
Nina trank den Wein in einem Zug aus und zählte innerlich bis zehn. An jedem anderen Tag hätte sie keine Skrupel gehabt, aufzustehen und einfach zu gehen, wenn ihr seine als Ratschlag getarnten Vorwürfe zu bunt wurden. Aber Paps wusste ganz genau, dass er an Weihnachten bis zu einem gewissen Grad Narrenfreiheit hatte, und das hatte er bei jenem Mittagessen in vollen Zügen ausgekostet.
»Schau, ich will doch nur dein Bestes, Nina. Wenn jemand weiß, wie es sich anfühlt, auf Dauer allein zu leben, dann ich.«
Die Worte und sein trauriger Blick rissen ein Loch in ihre innere Abwehr, wie jedes Mal, wenn das Gespräch auf den frühen Tod ihrer Mutter zu sprechen kam. Als sie starb, war Nina vier Jahre alt gewesen. Ihr Vater hatte ihr erzählt, dass zwischen der überraschenden Diagnose »Schwarzer Hautkrebs« und Konstanzes Tod nur sieben Monate gelegen hatten. Ninas Erinnerungen an ihre Mutter waren grobe Scherenschnitte verglichen mit den bunten Bildern, die ihr Vater heraufbeschwor, wenn seine Stimme diesen warmen Klang bekam und ihr Herz schwer von unerfüllter Sehnsucht wurde. Sie hatte nie verstanden, warum er später nicht wieder geheiratet hatte. Eine Zeitlang hatte sie sogar gehofft, dass zwischen ihm und der geschiedenen Colette mehr sein würde als ein freundschaftliches Verhältnis. Aber das, was ihre Eltern verbunden hatte, musste etwas Einzigartiges gewesen sein, etwas, wovon sie manchmal insgeheim träumte, wenn sie in einer klaren Nacht den Sternenhimmel betrachtete und sich daran erinnerte, wie Paps ihr als Kind immer erzählt hatte, dass Mami jetzt ganz besonders hell zwischen all den Sternen leuchten würde. Bisher war ihr aber niemand begegnet, mit dem sie sich eine solche Partnerschaft auch nur ansatzweise hätte vorstellen können. Wer wusste schon, ob es so jemanden überhaupt gab und ob ihr Vater nicht nachträglich die Beziehung zu ihrer Mutter einfach nur verklärte.
Du bist eine naive Träumerin! Auf einen Märchenprinzen zu warten – einfach lächerlich!
»Weißt du, Spatz«, hatte ihr Vater gesagt und damit auch noch Öl in das Feuer ihrer weihnachtsmelancholischen Stimmung gegossen, »das Leben ist einfach zu kurz, um nicht nach dem einen Menschen zu suchen, der dich ohne Worte versteht, die eigenen Interessen und Ziele teilt, mit dem du lachen, weinen oder auch einfach mal schweigen kannst, ohne dass du dir langweilig dabei vorkommst.«
Ihrem Vater gehörte ein großes Abbruchunternehmen in Deutschland. Er war ein eiskalt kalkulierender Geschäftsmann und harter Verhandlungspartner. Diese verletzliche Seite von ihm kannte nur sie und womöglich noch Colette. Vielleicht hatten seine eindringlichen Worte an diesem Weihnachtstag unbewusst als Amors Pfeil ihre Abwehr geschwächt und ihren Blick ausgerechnet auf Nils gelenkt. Denn wer könnte sonst ihre Interessen teilen, lebte ebenso für den Beraterjob wie sie, stellte sich mit Begeisterung immer neuen Herausforderungen und brannte darauf, Auswege für scheinbar unlösbare Beratungsfälle zu finden? Gutaussehend war er obendrein auch noch.
Oder du warst einfach nur vollkommen betrunken gewesen!
Das Erwachen neben ihm im Bett tags darauf hatte sie jedenfalls so ernüchtert wie ein unfreiwilliger Sturz in die Isar Mitte Januar. Nina war auf Zehenspitzen ins Bad gehuscht, hatte sich in Windeseile angezogen und war aus ihrer eigenen Wohnung geflüchtet, ohne noch einen letzten Blick auf das zerwühlte Bett und Nils’ fitnessclubgestählten Oberkörper zu werfen. Erst nach zwei Kopfschmerztabletten, Kaffee mit Sojamilch beim Bäcker und einem ausgiebigen Spaziergang an der Isar hatte sie sich so weit wieder im Griff gehabt, dass sie zurückgegangen war. Nils hatte schon in seinem Anzug mit übereinander verschränkten Armen am Auto gelehnt und auf sie gewartet. »Nina …«, hatte er in einem für ihn ungewohnt weichen Tonfall begonnen und sie mit seinen eisblauen Augen intensiv gemustert. Sie hatte sofort die Schultern gestrafft und abwehrend die Hände gehoben. »Du musst mir nichts erklären. Wir sind beide erwachsen genug, um zu wissen, welchen Stellenwert wir der gestrigen Nacht beimessen sollten.« Er hatte die Augenbrauen hochgezogen, und sie hatte schnell ergänzt: »Versteh mich bitte nicht falsch, es war wirklich …« Sie hatte innerlich nach einem Wort gerungen, das ihn nicht verletzen, aber ihm auch nicht Hoffnung machen würde. »… einzigartig. Und das muss es auch bleiben. Also lass uns jetzt bitte zu M&R fahren und unsere hervorragende Teamarbeit und gute Freundschaft nicht durch so einen Ausrutscher gefährden.«
Sie hatte ihr kollegialstes Lächeln aufgesetzt und seinem Blick standgehalten, bis er geschluckt und dann langsam genickt hatte. »Sicher. Lass uns … erst einmal über alles in Ruhe nachdenken und nichts überstürzen.«
Das war nicht die Antwort gewesen, die sie hatte hören wollen. Anfangs hatte Nina sogar befürchtet, er würde sich vor anderen in der Firma damit brüsten, sie erobert zu haben. Schließlich hatte sie bislang jeden im Team abblitzen lassen, der sich ihr hatte nähern wollen. Aber auch in dieser Hinsicht verhielt sich Nils vorbildlich. Kein Wort über jene gemeinsame Nacht kam ihm über die Lippen und er unterließ weitere Annäherungsversuche. Ein Mann mit Anstand. Und das machte die ganze Situation nur noch schwerer für sie. Denn an der Art, wie er sie manchmal verstohlen musterte, wenn er sich unbeobachtet fühlte, erkannte sie, dass nur ein Wort von ihr genügen würde, um jene verhängnisvolle Nacht zu wiederholen und mehr daraus werden zu lassen.
Nils’ herber Rasierwasserduft, Sandelholz mit einem Hauch frischer Zitrone, streifte sie, als sie an ihm vorbeischritt, und weckte die verschwommene, alkoholvernebelte Erinnerung daran, wie seine warme Haut sich unter ihren Fingern angefühlt hatte. Einen Moment lang versuchte Nina sich vorzustellen, dass Nils der Mann sein könnte, mit dem sie zusammen alt werden würde. Das klickende Geräusch, als er hinter ihr die Glastür ihres Büros schloss, brachte sie glücklicherweise in die Realität zurück, bevor ein Nils mit Halbglatze, Falten und gemütlichem Meister-Eder-Bauch sich vor ihrem inneren Auge aufbauen konnte. Konzentriere dich mal lieber auf das Meeting!
Sie liefen an den Schreibtischen des Open-Space-Bereichs zur Area 11 vorbei wie durch ein Labyrinth. Die Team-Meeting-Räume lagen alle zum Innenhof, in dem ein Springbrunnen, Ahornbäume und mehrere Skulpturen moderner Künstler die Tristesse aus Pflastersteinen auflockerten.
»Ich bin wirklich gespannt, wie du Roths Image aufpolieren möchtest«, sagte Nils augenzwinkernd, bevor sie Area 11 betraten. »Er ist eine verdammt harte Nuss. Als ich das letzte Mal mit ihm telefoniert habe, meinte er: Ich freue mich auf eure Vorschläge, aber ich werde bestimmt kein Sponsor für selbstverliebte Versager, nur um den Aktionären und der Presse Honig ums Maul zu schmieren. Von sozialem Firmenengagement ist er so weit entfernt wie Attila der Hunne von Nächstenliebe.«
Nina grinste. »Es gibt keine schwierigen Mandanten, nur falsche Strategien!«, zitierte sie einen seiner Mentor-Leitsprüche.
»Wäre nicht das erste Mal, dass du mich überraschst.«
2
Taran hatte aus der Erforschung vergangener Kulturen vor allem eines gelernt: für die Magie des Augenblicks zu leben. Sonnenstrahlen fielen durch das Jugendstilgewölbe aus Gusseisen und Glas, während er an seinem Café Cortado nippte und die winzigen Tropfen des Wassersprühnebels betrachtete, die einen zarten Regenbogen erblühen ließen. Sie landeten auf den breiten Blättern von Palmen, Bananenstauden und anderen Pflanzen des tropischen Gartens vor ihm und versanken im glitzernden Wasser des Bassins. Jede Menge Kinder tummelten sich davor, um die kleinen Schildkröten und bunten Fische zwischen den Wasserpflanzen zu bestaunen – und sie hoffentlich nicht mit ihren fettigen Churros zu füttern. Einige Palmen ragten so hoch auf, dass sie fast die Metallstreben der Decke berührten. Kinderlachen, das vielstimmige Gemurmel von Reisenden, ein unregelmäßiges Staccato diverser Schuhabsätze, Rollgeräusche von Trolleys, Durchsagen von ankommenden und abfahrenden Zügen und das Zischen des Kaffeevollautomaten in nächster Nähe vereinigten sich in der gewaltigen alten Bahnhofshalle Atocha von Madrid zu einer einzigartigen Sinfonie.
»Wir müssen los«, riss Ramón ihn aus seinen Betrachtungen und schob sich den letzten Bissen seines Croissants in den Mund. Ein paar Blätterteigkrümel verfingen sich in dem schwarzen Vollbart, den er sich neuerdings hatte wachsen lassen.
»Macht du jetzt auf Álvaro Morte?«, hatte er ihn vor ein paar Wochen aufgezogen. Er sah dem spanischen Schauspieler tatsächlich ein bisschen ähnlich.
»Bärte liegen im Trend«, hatte Ramón schulterzuckend geantwortet. »Du trägst doch selbst einen.«
»Ja, aber nur weil ich zu faul bin, mich täglich zu rasieren.« Unter der Woche kam er einfach nicht dazu und rasierte sich dafür an beiden Wochenendtagen.
Taran winkte der Kellnerin zu, als sein Kollege den Geldbeutel aus dem Rucksack fischen wollte, und erklärte rasch: »Heute bin ich dran.«
Lächelnd dachte er an das langwierige Bezahlen, wenn er in Deutschland mit Kollegen essen gegangen war. Zum Glück war es hier in Spanien unüblich, Einzelrechnungen auszustellen.
»Denkst du, sie verlängern das Projekt?«, fragte Ramón und kratzte sich am Bart, während sie in die Neubauhalle eilten, die kathedralenhoch und mit kalten, schmucklosen Bahnsteigen und Betonsäulen keinen größeren Gegensatz zum alten Bahnhofsteil hätte bilden können. »Elena schien gestern Abend ziemlich beeindruckt von deinen Grabungsfortschritten.«
Taran zuckte die Schultern und musterte die Anzeige, um das richtige Gleis zu finden, auf dem der Schnellzug zwischen Madrid und Sevilla einfahren würde. Er liebte seine Arbeit, aber das ewige Zittern darum, wie lange er sie fortführen konnte, war bei jeder Ausgrabung von Neuem zermürbend. Und gleichgültig, wie die Direktorin des Deutschen Archäologischen Instituts in Madrid persönlich zu ihm und seinen Fortschritten stand, sie konnte schließlich nicht allein über eine Verlängerung entscheiden. Dr. Elena Munez war vor knapp sieben Jahren zur Leiterin der spanischen Zweigstelle des DAI aufgestiegen. Sie war Mitte fünfzig und brannte für die Archäologie wie er selbst, besonders für Tarans Spezialgebiet über die Phönizier und ihre Expansion in den westlichen Mittelmeerraum. Sie hatten schon unzählige Diskussionen über das antike Seefahrervolk geführt.
»Ich bin Archäologe – wir sind es gewohnt, Steine, die uns im Weg liegen, freizuräumen«, spottete er. »Ich habe mein Möglichstes getan, um die Bedeutung der Befunde in ein günstiges Licht zu rücken. Aber du weißt, wie das bei uns läuft. Für die meisten Ausgrabungen werden Mittel für maximal drei Jahre bewilligt, eher kürzer. Elena muss eine Verlängerung beim deutschen Außenministerium rechtfertigen oder Geld bei externen Stiftungen lockermachen. Bei den seltenen Liebhabern der Archäologie.«
Sie hatten das Gleis erreicht, an dem gerade ein Zug im schnittigen ICE-3-Design einrollte. Der AVE fuhr bis zu dreihundert Stundenkilometer schnell, weshalb sie für die knapp fünfhundert Kilometer zurück nach Sevilla nur unglaubliche zweieinhalb Stunden brauchen würden. Ramón hatte die Tickets gebucht. Taran hätte auch nichts gegen gemächlicheres Reisen in langsameren Zügen einzuwenden gehabt. Er mochte Bahnfahren und genoss es, aus dem Fenster zu blicken und die Landschaft auf sich wirken zu lassen. Zumindest waren die Fahrkarten für den AVE nicht wesentlich teurer, sodass selbst er sich regelmäßige Fahrten mit dem Schnellzug leisten konnte. Bei dem Gedanken an seine finanzielle Lage huschte ein grimmiges Lächeln über sein Gesicht.
»Schon Wahnsinn, von wie vielen Dingen bei euch eine Verlängerung des Arbeitsvertrags abhängt«, erklärte Ramón kopfschüttelnd. »Noch schlimmer als der Kampf um öffentliche Aufträge bei uns Geophysikern.«
»Eine meiner Professorinnen an der Uni hat mal gesagt: Wer die Bruchstücke der Vergangenheit finden und zusammensetzen möchte, muss geduldig, anspruchslos und ein Glückspilz sein.«
»Glück wirst du hier in Andalusien auf jeden Fall brauchen. Am Ende verweigert dir nämlich sonst das Denkmalpflegeamt die Genehmigung weiterer Grabungen, weil sich jemand von privaten Bauträgern hat bestechen lassen, und all deine Bemühungen um Geldgeber waren umsonst.«
»So zynisch heute?«, lachte Taran verwundert. Das passte gar nicht zu Ramóns fröhlich-optimistischer Art.
Sein Freund verdrehte die Augen und schwenkte die Zeitung, auf deren Titelseite von einem Bestechungsskandal in Regierungskreisen die Rede war. »Eher realistisch.«
Er stieg schwungvoll vor Taran in den Zug. Es war ihm anzusehen, wie sehr er sich auf zu Hause freute. Im Bahnhofsshop hatte er Süßigkeiten für seine Kinder und ein Buch von Carlos Ruiz Zafón für seine Frau gekauft. Dabei waren sie keine zwei Tage lang getrennt gewesen! Taran folgte grinsend dem spanischen Romantiker. Aber leider hatte Ramón recht. Auch die Genehmigung des Denkmalpflegeamts stand bei einer Verlängerung der Ausgrabung noch in den Sternen. Der andalusische Bauunternehmer, der ursprünglich eine Urbanisation mit Ferienhäusern auf dem Grabungsareal hatte bauen wollen, drängte seit der Notgrabung vor zwei Jahren darauf, dass die archäologischen Arbeiten zu einem Abschluss kamen und er mit dem ersten Spatenstich beginnen konnte. Sicher bereute er es mittlerweile, den Fund von Fragmenten einer antiken Amphore überhaupt gemeldet zu haben. Wahrscheinlich hatte er gehofft, schnelles Geld zu machen, indem er die andalusische Regierung auf Entschädigung verklagte. Manchmal war der bürokratische Berg von Steinen, der ihre Funde verbarg, tatsächlich höher als die einzelnen Bodenschichten, die sie hinterher bei der Ausgrabung abtrugen.
Sie wanderten die Sitzreihen entlang bis zu ihren Plätzen, als der Zug sich mit einem leichten Ruck in Bewegung setzte. Die beigefarbenen Stoffsitze waren bequem und boten angemessene Beinfreiheit für Ramón. Taran, mit seinen knapp ein Meter neunzig, stieß jedoch mit den Knien an den Vordersitz. Er gähnte, strich sich die Haare aus der Stirn und warf einen müden Blick aus der dunkel getönten Scheibe. Es war vergangene Nacht ganz schön spät geworden, selbst für spanische Verhältnisse, wo man gewohnt war, nicht vor einundzwanzig Uhr zum Abendessen zu gehen. Ramón und er waren vom DAI nach Madrid zu den Phönizisch-punischen Donnerstagen geladen worden, einer internationalen Veranstaltungsreihe, die seit Jahren regelmäßig neue Forschungsergebnisse über das semitische Händler- und Seefahrervolk veröffentlichte. Im Anschluss waren sie mit anderen Rednern und einigen Leuten vom DAI in eine nahe gelegene Tapas-Bar gegangen und hängengeblieben.
Ramóns Handy klingelte und als sich seine Miene aufhellte und dieses gewisse Leuchten in seine Augen glitt, wusste Taran sofort, dass er mit Sofía sprach. Er fühlte einen leichten Stich in der Brust. Im vergangenen Jahr war er oft genug bei der Familie Pérez zu Gast gewesen, um zu wissen, dass dieses glückliche Funkeln in Ramóns Augen echt war. Früher hatte Taran sich nicht so viele Gedanken über feste Beziehungen gemacht. Er wusste auch nicht, woher das plötzlich kam, schließlich fühlte er sich seit Jahren mit der Archäologie verheiratet. Heute hier, morgen da. Flexibilität war in seinem Job ebenso unverzichtbar wie gute Sprachkenntnisse und meist auch der Verzicht auf Familie. Taran wurde dieses Jahr dreißig, und viele seiner ehemaligen Studienkollegen hatten die Forschungsarbeit inzwischen an den Nagel gehängt, um ihr privates Glück zu finden, sesshaft zu werden, in einem Museum oder fachfremd zu arbeiten und eine Familie zu gründen. Die Frauen, mit denen Taran in den vergangenen Jahren zusammen gewesen war, hatten alle auch im Bereich der Archäologie gearbeitet. Gemeinsame Interessen waren zwar eine großartige Sache, aber führten am Ende dazu, dass sie sich etliche Monate nicht sehen konnten, weil entweder er oder sie gerade irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs waren. Wortwörtlich. Man hatte gar nicht die Möglichkeit, den anderen näher kennenzulernen, um die Beziehung zu vertiefen. Da hatte es Ramón, der selten für archäologische Institute, sondern meist im Auftrag privater Bauunternehmer oder Städte arbeitete, leichter.
Während er mit seiner Frau telefonierte, drehte Taran gedankenverloren den keltischen Metallarmreif an seinem Handgelenk und betrachtete die vorbeifliegenden Felder, auf denen der Winterweizen langsam in die Höhe schoss. Über fünftausend Hektar ökologische Landwirtschaft befanden sich rund um Madrid, und in Andalusien betrug das landwirtschaftlich genutzte Land sogar das Hundertfache. Kein Wunder, dass deshalb Bauern beim Umgraben ihrer Felder vereinzelt auf archäologische Artefakte stießen. Im Vorbeifahren erhaschte Taran einen Blick auf einen Landarbeiter, der die langen schwarzen Kunststoffschläuche für die Tröpfchenbewässerung inspizierte, und zwei kleine Jungen in Jeans, T-Shirt und Baseballcap, die dem Zug nachwinkten. Er hob lächelnd seine Hand an die Scheibe und winkte zurück. Es war unwahrscheinlich, dass sie ihn hinter den spiegelgetönten Fenstern bei dieser Geschwindigkeit gesehen hatten. Dennoch weckten die beiden in ihm die Erinnerung daran, wie er selbst als Kind mit seinem Vater über Ackerfurchen gewandert war und hinterher Schlamm und Steine aus dem Profil seiner Wanderschuhe gekratzt hatte. Erde war so früh sein Element gewesen wie die See für Fischerkinder. Sie kannten die Gezeiten auswendig, er die unterschiedlichen Bodentypen und wie man sie am besten bearbeitete, um an die verborgenen Schätze zu gelangen.
»Hör endlich auf, dem Jungen deine albernen Hirngespinste in den Kopf zu setzen!« Das Gesicht seiner Mutter tauchte wie ein Gespenst aus der Vergangenheit vor Tarans innerem Auge auf, ihre schmalen Lippen abfällig verzogen, der Tonfall hart. Schatzsucher hatte sie ihren Mann genannt. Nachts, wenn Taran und seine Schwester Jennifer in ihren Betten lagen, hatte sie allerdings noch ganz andere Bezeichnungen für ihn übriggehabt. Manchmal war er ins Bad geschlichen und hatte Wattepads aus ihrem Kosmetikschrank geklaut, um sie sich in die Ohren zu stecken, weil er die lauten Stimmen seiner Eltern nicht mehr hören wollte. »Die ganze Schule macht sich schon über uns lustig«, hatte Jennifer ihm oft in diesen Nächten zugeflüstert.
»Na und? Die reden doch immer irgendwas«, hatte Taran eingewandt. Er war drei Jahre jünger als seine Schwester. Ihr war damals alles peinlich gewesen. Die Pickel im Gesicht, die Umarmungen der Mutter vor ihren Freundinnen, das immer mehr Raum einnehmende Hobby ihres Vaters. Taran hatte es nichts ausgemacht, ein Außenseiter zu sein. Das galt auch heute noch. Vielleicht hatte ihr das die Geborgenheit vermittelt, die ihr das Elternhaus nicht geben konnte. Er schob die Gedanken an seine Schwester beiseite. Sie gingen immer mit dem schlechten Gewissen einher, sich viel zu lange nicht bei ihr gerührt zu haben.
Ramón hatte aufgelegt und grinste ihn an.
»Was?«, fragte Taran.
»Sofía hat mich gefragt, wie mein Vortrag gestern lief, und ich habe nur gesagt: Kroak!«
Taran lachte und schüttelte den Kopf. »Du wirst ihr das erklären müssen.«
»Sie hat behauptet, wenn das ein Hinweis darauf ist, dass sie mich bei meiner Ankunft küssen und künftig Tisch und Bett mit mir teilen muss, würde sie es sich lieber noch einmal gründlich überlegen.«
»Sofía würde dich selbst dann aufnehmen, wenn du dich tatsächlich in eine glitschige, fette Kröte verwandeln und nach Schlick riechen würdest.«
Ramón grinste noch ein Stück breiter.
Die Stimmung am Abend in der Tapas-Bar war ausgelassen gewesen und irgendwann hatte sein Freund ihm zugeprostet und erklärt: »Ich meine das ernst, Taran! Während du dir in aller Eile ein paar Notizen auf der Hinfahrt im Zug gemacht hast, habe ich mich ganze zwei Abende lang mit diesem Vortrag herumgeschlagen. Aber wenn ich den Mund vor Publikum aufmache, fühle ich mich immer wie eine dieser ununterbrochen quakenden Kröten in den Sümpfen des Guadalquivir! Kroak, kroak, kroak. Entsprechend entgeistert und mitleidig sehen die Leute mich an.«
Ramón war wirklich kein besonders guter Redner, aber so schlimm, wie er tat, war er nun auch wieder nicht gewesen. Immerhin nahm er es mit Humor.
»Also ich fand deine Ausführungen zur Verlandung und der Veränderung der Küstenlinie in den letzten dreitausend Jahren durchaus spannend, Ramón«, hatte Elena augenzwinkernd eingeworfen und beruhigend seine Hand getätschelt.
»Du würdest es auch spannend finden, 50 000 Tonscherben in den nächsten zwei Jahren zu sichten und zu katalogisieren«, hatte Ramón gebrummt und die Augen verdreht.
»Ich bin Archäologin, das kannst du mir wohl kaum vorwerfen«, hatte sie kichernd erwidert.
»Das nicht. Aber dass du mich ausgerechnet mit Taran zusammen hast vortragen lassen.«
»Was habe ich denn schon wieder falsch gemacht?«, hatte Taran nachgehakt.
»Ach, du warst nur der Prophet, der über das Wasser gewandelt ist und mit seiner flammenden Rede die Kröten zum ehrfürchtigen Verstummen gebracht hat«, hatte Jorge gespottet und sein Glas in Richtung der Direktorin erhoben. »Lass Taran das nächste Mal an der Autónoma vortragen, Elena, und die Studentenzahlen für archäologische Studienrichtungen werden explodieren.«
Die Phönizisch-punischen Donnerstage fanden entweder am DAI – wie vergangenen Abend – oder an einer der beiden Madrider Universitäten Autónoma oder Complutense für Studierende und andere Interessierte statt. »Bloß nicht noch mehr arbeitslose Absolventen«, hatte Clara auf diesen Vorschlag hin händeringend gerufen. Sie war die leitende Bibliothekarin im DAI, betreute über achtzigtausend Bücher und mehrere hundert laufende Zeitschriften und empfand für sie eine ähnliche Leidenschaft wie Taran für archäologische Befunde. Wehe dem, der ihre Schützlinge nicht in tadellosem Zustand zurückbrachte.
»Ihr übertreibt wieder einmal alle maßlos«, hatte Taran sich grinsend verteidigt. Er konnte auch nicht sagen, warum ihm das Reden über seine Projekte so leichtfiel. Vorträge zu halten, war für Taran Routine. Die Zahl der Arbeitsplätze in der Forschung war so rar, dass es nicht genügte, fachlich zu brillieren. Man musste seine Arbeit auch gut präsentieren können. Mittlerweile war er im Bereich der Phönizier-Forschungen ein gefragter Redner auf dem Internationalen Kongress der Klassischen Archäologie. Meistens blendete er das Publikum einfach aus und stellte sich vor, er würde mit seinem Vater bei einem Glas Bier zusammensitzen und ihm von seinen neuesten Ergebnissen erzählen. Er genoss diese gemeinsamen Vater-Sohn-Abende. Denn obwohl Max Sternberg, der seinen Sohn nach Taranis, dem keltischen Donnergott, genannt hatte, seine Leidenschaft für die Archäologie so teuer hatte bezahlen müssen, war sie auf seinen Sohn übergesprungen wie der Funke des olympischen Feuers. Taran hatte schon in archäologischen Fachzeitschriften geblättert und mit seinem Vater über römische Feldzüge in Germanien diskutiert, als seine Klassenkameraden noch Nintendo gezockt und den Limes für einen alkoholischen Drink mit Fruchtgeschmack gehalten hatten. In der Schule hatte er deshalb als Sonderling gegolten, woran auch seine guten sportlichen Leistungen nur wenig ändern konnten.
»Wenn wir dieses ganz besondere Timbre, das sich immer in deine Stimme schleicht, sobald du von deiner Forschung sprichst, und das jedem eine Gänsehaut über den Rücken jagt, einmal außer Acht lassen …«, hatte Clara begonnen, und Taran hatte belustigt die Augenbrauen gehoben und sich noch ein Tapas-Häppchen in den Mund geschoben, »… ist es natürlich vor allem dein heißes Aussehen, das die Studierenden dahinschmelzen lassen wird.«
Er hatte sich an dem Blätterteig mit Aioli und scharfer Chorizo-Wurst verschluckt und verzweifelt versucht, den Hals wieder mit einem Schluck Rioja freizubekommen.
»Danke, Clara. Jetzt fühle ich mich endgültig wie die ungeliebte, hässliche Kröte«, hatte Ramón gelacht.
»Ich darf das sagen.« Die Bibliothekarin hatte grinsend ihre beringte Hand gehoben. »Schließlich bin ich ebenso glücklich verheiratet wie du, mein Lieber.«
3
Phönizier-Archäologie?« Nils riss den Kopf zu Nina herum, die gelassen die Überschrift mit dem antiken Segelschiff und der Amphore auf ihrem Tablet beiseitestrich und die nächste Präsentationsseite auf dem Whiteboard aufrief. Sie konnte sehen, wie es hinter seiner Stirn zu arbeiten begann.
»Ganz recht.«
»Ich dachte, Roth hält nichts von kulturellem Engagement?«, warf Maren zaghaft ein und drehte den Stift ihres Tablets nervös zwischen den Fingern. Ihre Stimme klang ein wenig schrill. Sie und Yannik waren die jüngsten Fellows in ihrer Runde und noch nicht einmal ein halbes Jahr bei Macmillan & Richardson. Vor Ninas Präsentation hatten sie die Gelegenheit bekommen, eigene Vorschläge zu machen, die zum Aufpolieren des Images der Alexander Roth AG in der öffentlichen Wahrnehmung beitragen sollten. Bei diesem Mandanten wahrlich kein leichtes Unterfangen. Dennoch fragte Nina sich, ob sie ähnlich defensiv bei ihren ersten Teamsitzungen geklungen hatte. Marens und Yannicks Vorschläge waren solide gewesen – für einen Durchschnittsmandanten. Sie hatte die altbewährte KTU-Strategie vorgetragen: Spenden an Kinder-, Tier- oder Umweltschutzorganisationen, also alles, was sich in den sozialen Medien emotional gut verkaufen ließ. Kundenbindung durch Corporate Social Responsibility. Nicht nur das Produkt, auch der Ruf einer Firma selbst müsse Qualität und gesellschaftliche Verantwortung aufweisen, um die Kunden dauerhaft für sich einzunehmen. Maren hatte allerdings nicht bedacht, dass sich die typische Kundschaft von Roths Werft nicht mit denen eines Maschinenbauers oder Automobilherstellers vergleichen ließ. Denn die Aktiengesellschaft, an der ihr Gründer Alexander Roth immer noch satte dreiundfünfzig Prozent der Anteile besaß, war eine der größten Marinewerften Deutschlands, die militärische Schnellboote und zivile Luxusjachten baute. Zu ihren Auftraggebern zählten daher neben der deutschen Marine und diversen Streitkräften anderer Länder eine illustre Klientel von saudi-arabischen Prinzen, russischen Oligarchen und Filmstars bis hin zu milliardenschweren Software-Entwicklern. Nicht gerade ein Personenkreis mit besonders ausgeprägtem Interesse an sozialem Engagement. Da traf Yannik schon eher ins Schwarze. Er setzte auf Sportlerförderung, um das sportlich-dynamische Image der Firma mit ihren Jachten und Schnellbooten zu unterstreichen.
Während nun auf Marens Wangen rote Flecken aufblühten und sie an ihrem grünen Seidenschal zupfte, lehnte sich Yannik in seinen Stuhl zurück, breitbeinig, die Arme siegessicher über der Brust verschränkt – ganz der vor Selbstüberschätzung strotzende Mann. Ninas Präsentation auf dem Whiteboard betrachtete er mit einer Miene, als hätte sie vorgeschlagen, Roth solle an Straßenmusiker in der Spitalerstraße oder gar an die Skateboard-Kids an Hamburgs Jungfernstieg Geldscheine verteilen. Selbst das konnte eine gute Strategie sein, wenn sie entsprechend medienwirksam in Szene gesetzt wurde. Sie unterdrückte ein Schmunzeln. Nils bewahrte seine unverbindliche Pokermiene, aber die beiden Neulinge im Team hatten das »Körpersprache-in-Verhandlungen«-Modul noch nicht besucht, sonst würden sie ihre Verunsicherung und Ablehnung nicht so offen zur Schau stellen und damit eine verhängnisvolle Angriffsfläche bieten. Die Angst der Uniabsolventen, die Probezeit bei Macmillan & Richardson nicht zu bestehen, war in den vergangenen Jahren bedauerlicherweise noch gewachsen. Dabei hatte sie selbst schon die Spannungen innerhalb der Teams und die Versuche Einzelner, sich zu profilieren und andere auszustechen, in ihrer Anfangszeit bei M&R belastend empfunden. Mentorenprogramme und Workshops konnten über den internen Konkurrenzdruck ebenso wenig hinwegtäuschen wie das pausenlose Wiederholen der Aussage, Beratung sei ein Mannschaftssport.
»Wir fahren ein hohes Tempo in einem sich ständig wechselnden Beratungsumfeld. Wer nicht flexibel ist und mit der Mannschaft mithalten kann, fliegt eben raus«, hatte Nils erst kürzlich zu ihr gesagt, als sie ihn auf die Kündigung von Jan, einem Mitarbeiter im Risikomanagement, angesprochen hatte.
»Na ja, ich glaube, er hatte privat ein paar Wochen ziemlich viel Druck«, hatte sie eingewandt. Eine Kollegin hatte ihr nämlich verraten, dass seine Zwillingsschwester einen schweren Autounfall gehabt hatte. Sie war im Koma gelegen und die Familie hatte wochenlang um ihr Leben gebangt. Zum Glück war sie mittlerweile auf dem Weg der Besserung.
»Dann hätte er eben unbezahlten Urlaub nehmen und seine privaten Dinge in Ordnung bringen müssen, statt nur mit halbem Kopf hier bei der Sache zu sein.«
Als ob er das mehr gebilligt hätte! Sie seufzte innerlich. Vermutlich hatte Nils recht und Maren und Yannik mussten lernen, mit der internen Konkurrenzsituation einer Teamsitzung klarzukommen, um künftig einem waschechten Hamburger Unternehmer-Haudegen wie Alexander Roth gegenübertreten zu können. Letzterer hatte Nina bei ihrem ersten Treffen zusammen mit Nils so viel Beachtung geschenkt wie eine Spinne einer leichten Sommerbrise, die zufällig an ihrem Netz zupfte. In den vergangenen zwei Jahren hatte es sie ein hartes Stück Arbeit gekostet, Roth von ihrer Kompetenz zu überzeugen. Sie hatte die Fusion mit zwei anderen Werften erfolgreich für ihn abgewickelt, Konzepte zur Kostensenkung und Reduzierung der Mitarbeiterzahl entwickelt und war dennoch überrascht gewesen, dass er sich nun erstmalig direkt an sie und nicht zuvor an Nils gewandt hatte, als er ihr vor einigen Wochen bei einem Telefonat gesagt hatte: »Wir sollten uns mal über das öffentliche Image der Roth AG unterhalten, Frau Winter.«
Roths Familie hatte sich den Erfolg ihrer Werft über drei Generationen hinweg erwirtschaftet, war zweimal kurz vor der Insolvenz gestanden und hatte sich wieder hochgekämpft. Der Unternehmergeist war Alexander Roth schon in seiner Schulzeit im Eliteinternat Schloss Salem eingetrichtert worden und seither war er der Ansicht, dass es jeder, der sich nur den Herausforderungen des Lebens stellte, auch ohne Zuwendungen zu etwas bringen könne. Ausgerechnet die Begegnung mit einem ehemaligen Schulkameraden aus Salem hatte diese Meinung jedoch ins Schwanken gebracht, wie sich bei ihrem Treffen herausstellte.
»Mark ist jetzt im Lions Club«, hatte er geschnaubt, als sie eine Woche nach dem Telefonat bei einem Kaffee in dem Verwaltungsgebäude seiner Werft mit Blick auf die Alster zusammensaßen. Es hatte geklungen, als würde er von einem anrüchigen Nachtclub sprechen, in den sein Freund da geraten war, und nicht von einem konservativen ehemaligen Herrenclub, der erst Ende der Achtzigerjahre überhaupt zögerlich begonnen hatte, Frauen in seinen Reihen als Mitglieder willkommen zu heißen, und der sich diversen karitativen Aufgaben widmete.
»Außerdem will er einen Teil seines Firmenvermögens in eine Stiftung einbringen und schwärmt von der Steuerersparnis, steigenden und beständigen Kundenzahlen und einem besseren Image, das sich auch in überschwänglichen Pressemitteilungen niederschlägt. Kurz und gut, er unterstellt mir, nicht mehr zeitgemäß zu sein. Was halten Sie davon? Glauben Sie auch, ich sollte Rumschlunzer unterstützen, nur um nicht als Steinzeitunternehmer zu gelten?«
Nina hatte sich um ein Haar an ihrem Kaffee verschluckt. Vorsichtig hatte sie die Tasse auf den Mahagonitisch mit aufwendigen nautischen Intarsien abgestellt und ihm ein schmales Lächeln geschenkt. »Wenn Sie das so formulieren, kann ich Ihnen nur abraten, Herr Roth.«
Er hatte aufgelacht und sich über den Tisch gebeugt. Alexander Roth war sechzig und erinnerte Nina ein bisschen an George Clooney. Grauhaarig, aber immer noch gutaussehend, sportlich-athletisch, die wettergegerbten Gesichtszüge kantig und energisch, die Augen blaugrauer Stahl. Er musterte Nina sichtlich amüsiert.
»Sehen Sie, genau deshalb wollte ich diese Sache mit Ihnen besprechen. Sie sind unverblümt ehrlich. Ihr Herr Reinecke hätte sofort einen neuen Beratungsauftrag gewittert und mich aalglatt zu einer Stiftung für mittelmäßige Künstler oder einer Spende an die Welthungerhilfe zu überreden versucht.«
Erstaunlich, wie gut er Nils durchschaute. Bislang hatte Nina gedacht, alle Mandanten würden sich von seinem Charme einwickeln lassen, und sie fragte sich unwillkürlich, was Roth wohl sonst noch von ihr dachte. Unverblümt ehrlich. Damit konnte sie gut leben.
»Verstehen Sie mich nicht falsch, viele Menschen auf der Welt sind in Not, fristen ein Leben in bitterer Armut und hungern, das ist mir schon klar«, hatte er rasch ergänzt, weil sie nicht sofort geantwortet hatte. »Aber solange die politischen und gesellschaftlichen Strukturen sich in diesen Ländern nicht ändern, die Menschen sich nicht aufraffen, sich ihrer Despoten zu entledigen, ist jede Form von Hilfe doch nur ein rasch versiegender Tropfen auf einem heißen Stein und damit nutzlos.«
Dass er mit ebenjenen Despoten, wie Nina aus seinen Bilanzen ganz genau wusste, selbst gute Geschäfte machte, indem er ihnen Luxusjachten und mit Genehmigung des Bundessicherheitsrats auch militärische Patrouillenboote verkaufte und damit Unterdrückung und kriegerische Auseinandersetzungen indirekt förderte, machte seine Aussage umso zynischer. Aber sie hatte die spitze Bemerkung, die ihr auf der Zunge lag, hinuntergeschluckt. Roth musste man mit seinen eigenen Waffen schlagen, der Appell an Empathie war sicher nicht das Mittel der Wahl.
»Zufriedene Kunden zu haben, ist auch unser Ziel«, hatte sie ruhig erwidert und die Hände ineinander verschränkt. »Was für Ihren Freund eine Imageverbesserung ist, kann für Sie vollkommen ungeeignet sein. Soziales Engagement ist ein komplexes Thema, und es geht hier nicht nur darum, ob Sie, als Privatperson oder im Rahmen der AG, durch eine Spende, die Mitgliedschaft in einem Club oder die Gründung einer Stiftung tätig werden. Pauschal und ohne eine umfassende Untersuchung kann ich Ihnen tatsächlich hier und jetzt keinen Rat erteilen.«
Er zog die Augenbrauen hoch.
»Aber was ich Ihnen versichern kann, ist Folgendes: Sich als Unternehmer für die Gesellschaft zu engagieren, macht nur dann Sinn, wenn Sie wirklich mit vollem Herzen dabei sind, die Sache medienwirksam begleiten und die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht wird. Sie können eine neue Jacht schließlich auch nicht verkaufen, wenn Sie nicht hinter Ihrer Arbeit stehen und Ihre Käufer von der Qualität und Langlebigkeit, von Ihrem Service und dem Eingehen auf ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche überzeugen. Es genügt also nicht, im Jahresabschluss oder im Lagebericht verschämt auf Ihre Spenden aufmerksam zu machen, ohne mit voller Inbrunst in der Presse Ihre Anstrengungen hinauszuschreien. Wir müssen etwas finden, das Ihnen tatsächlich ein inneres Bedürfnis zur Unterstützung anderer ist, etwas, das Sie bewegen wollen, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Wenn Ihnen also eine derartige Imageförderung tatsächlich ein Anliegen ist, werde ich gerne eine Lösung suchen, die zu Ihnen passen könnte.«
»Sie glauben also, Sie entdecken den barmherzigen Samariter in mir?«, hatte er belustigt gefragt.
Wohl eher den Klabautermann, hatte sie gedacht, aber augenzwinkernd erwidert: »Schlummert nicht in jedem Saulus ein Paulus, der nur auf seine Erweckung wartet?«
Seit jenem Gespräch waren einige Wochen vergangen, in denen sie sich das Hirn zermartert hatte, was für einen Eisblock wie Roth förderungswürdig sein könnte. Jetzt galt es, Nils und die anderen Teammitglieder von ihrem Konzept zu überzeugen, bevor sie es ihm präsentierte.
»Dein Einwand ist schon richtig. Roth würde es vermutlich niemals in den Sinn kommen, Kunststudenten zu unterstützen«, sagte Nina mit einem Seitenblick zu Maren. »Die Förderung von archäologischer und kunsthistorischer Phönizier-Forschung hat jedoch durchaus das Zeug, sein Herzensprojekt zu werden, denn die Phönizier und er haben einige Gemeinsamkeiten aufzuweisen.« Sie scrollte zur nächsten Folie mit einer Landkarte des Mittelmeers 1000 vor Christus. »Die Phönizier waren nämlich nicht nur eine international erfolgreiche Handelsmacht, wenn man davon ausgeht, dass sich in der damaligen Zeit die Internationalität im Wesentlichen auf den Mittelmeerraum bezog, sondern auch geschickte Schiffsbauer und Navigatoren. Sie stellten mit ihren Galeeren die besten Kriegs- und Handelsschiffe des Altertums her. Aus diesem Grund lieferten sie über Jahrhunderte die Flotte und Söldner für die Großreiche der ägyptischen Pharaonen, Babylonier und Achämeniden.« Nina tippte auf ihr Tablet und zeigte die nächste Präsentationsseite auf dem Whiteboard. Die Zeichnungen von Galeeren mit drei oder fünf Ruderreihen verschwanden und machten Platz für das Porträt eines Mannes mit Zylinder und Schnauzbart. »Dass erfolgreiche Unternehmer Interesse an Archäologie zeigen, ist im Übrigen nicht neu. Heinrich Schliemann war Geschäftsmann, Abenteurer und Selfmade-Millionär, der sich 1870 seinen Kindheitstraum erfüllte, als Hobbyarchäologe das Troja Homers zu entdecken. Bereits Mitte vierzig fand er«, Nina ließ ein Zitat aufploppen, »man könne auch ohne Geschäfte leben. Er stieg aus, lernte Latein und Altgriechisch, verkaufte seine Unternehmen und begann Altertumswissenschaften zu studieren. Schliemann widersetzte sich der akademischen Elite, die den privaten Hobbyarchäologen nicht ernst nehmen wollte und öffentlich verunglimpfte, verfolgte zielstrebig seinen Traum und machte eine der größten Entdeckungen der archäologischen Welt. Darüber hinaus verstand er es wie kein Forscher zuvor, mit seinen Ausgrabungen die Öffentlichkeit zu begeistern, indem er sie medial als ›Geheimnisse der Geschichte‹ oder ›Schatz des Priamos‹ inszenierte. Ich finde, die Archäologie braucht neue Visionäre wie ihn, und Roth ist einfach der perfekte Kandidat!«
»Vorsicht, Nina«, entgegnete Nils belustigt. »Wenn du Roth zu sehr anfeuerst, kommt er noch auf die Idee, ebenfalls seine Firma zu verscherbeln, und als in der Erde wühlender Aussteiger können wir kein Geld mehr mit ihm verdienen.«
Gelächter füllte den Raum.
»Dann entwirft Nina eine ausgefeilte Marketingstrategie für ihn, um seine Funde in ein besonders strahlendes Licht zu setzen und ihn zum neuen Stern am Archäologenhimmel zu katapultieren, nicht wahr?«, sagte Mai-Lin und zwinkerte ihr zu. »Mir gefällt die Idee. Welche konkreten Möglichkeiten für eine Förderung schweben dir vor?«
Nina freute sich. Mai-Lin war Associate Partner wie Nils, die Älteste im Team und gewöhnlich nicht so schnell zu beeindrucken. »Das Deutsche Archäologische Institut ist in der Phönizier-Forschung aktuell an mehreren Standorten aktiv.« Sie öffnete einen Screenshot der Website des DAI mit einer Übersicht der weltweiten Einsatzorte. Die Phönizier-Grabungsorte hatte sie blau markiert. »Er könnte sich mit einer großzügigen Spende an einer der Ausgrabungen persönlich oder über seine Kapitalgesellschaft beteiligen. Bei Interesse an einem umfangreichen und nachhaltigen Engagement würde ich ihm das Errichten einer gemeinnützigen Stiftung vorschlagen. Bei Roths hoher Steuerprogression würde das bedeuten, dass er am Ende netto nur die Hälfte investieren muss.«
»Er kann also damit werben, eine Million gespendet zu haben, wendet aber durch die Steuerersparnis letztlich nur etwa eine halbe Million auf?«, hakte Yannik nach.
»Exakt. Hier sind die Berechnungen.«
»Auf die Phönizier und Schliemann«, sagte Nils und hob sein Rotweinglas zum Anstoßen, als sie Stunden später zusammen beim Lunch in dem gemütlichen italienischen Lokal, nur wenige Häuserblocks von Macmillan & Richardson entfernt, saßen.
»Noch hat Roth den Vorschlag nicht angenommen.« Nina trank einen Schluck. Der Merlot passte perfekt zu ihrer Pizza mit Rucola.
»Ich vertraue deinem Verhandlungsgeschick.«
Nina lächelte glücklich. Sie war froh, dass sie wieder zu ihrer alten freundschaftlichen Kollegialität gefunden hatten. »Wusstest du, dass Schliemann seinerzeit selbst nach den ersten Funden enorm unter Beschuss stand?« Sie schob eine von der Pizza gerutschte Olive zurück auf den knusprigen Teig. »Sein Palast des Priamos habe die Größe eines Schweinestalls, wurde ihm unterstellt. Und ein Berliner Satiremagazin spottete, er habe die Schachtel ägyptischer Streichhölzer gefunden, mit denen Achilles den Scheiterhaufen des Patroklos anzündete.«
»Ich bin sicher, Roth wird sein Projekt ebenso streitbar verteidigen und sich einen Dreck um böse Stimmen scheren, genauso wie Schliemann«, erwiderte Nils. Aber irgendwie wirkte er nicht ganz bei der Sache. Er sah sich im Lokal um, als suchte er nach bekannten Gesichtern. Nina folgte seinem Blick. Doch sie waren die Einzigen von M&R hier. Die anderen waren entweder früher Essen gegangen oder hatten mit der nahe gelegenen Kantine der Handwerkskammer vorliebgenommen, die für einen raschen Imbiss geeigneter war. Nils legte sein Besteck rechts und links an den Tellerrand ab, faltete die Hände über dem Tisch und sah aus, als ob er mit sich ringen würde. Verwundert hob Nina die Augenbrauen.
»Sag schon. Was gefällt dir an meiner Lösung nicht? Wir waren doch immer ehrlich zueinander.«
»An dem Projekt? Nein, nein, damit ist alles in Ordnung.« Er atmete tief ein, presste die Lippen aufeinander, warf erneut erst einen Blick aus dem Fenster, dann zur Tür. Er wirkte so verwundbar, wie sie ihn noch nie erlebt hatte. Ninas Nackenhaare stellten sich auf und sie ließ nun ebenfalls das Besteck sinken.
»Ich habe ein Angebot erhalten, als Senior Partner bei Roland Berger einzusteigen.«
Sie starrte ihn an, unfähig sich zu rühren. »Du machst Witze.« Aber sein Gesicht war wie in Stein gemeißelt. »DU willst bei der Konkurrenz anheuern?«, raunte sie ungläubig. Nils hatte nie einen Hehl daraus gemacht, wie wohl er sich bei Macmillan & Richardson fühlte. Hatte es unter den Partnern Ärger gegeben? Hatte er einen wichtigen Auftrag vermasselt? Aber dann wäre Mai-Lin in der Teamsitzung nicht so gut gelaunt gewesen, oder?
Ein Lächeln glitt über sein angespanntes Gesicht, als er ihre Gedanken erriet.
»Es ist nicht, wie du denkst. Nur … Nina, ich habe es versucht, aber ich kann so nicht weitermachen.«
»Ich verstehe nicht …?«
»Wenn ich den Job wechsle, dann steht die Firma nicht mehr zwischen uns.« Er griff über den Tisch nach ihrer Hand. Sie erwiderte seinen Händedruck nicht, schaffte es gerade mal, nicht zurückzuzucken, und fühlte sich wie paralysiert von dem Abgrund, der sich nun vor ihr auftat, als er weitersprach: »Dann kann ich dich bitten, uns eine Chance zu geben und ganz von vorne anzufangen.«
4
Die Nacht war kühl, höchstens fünfzehn Grad, was die Gäste auf den Unterdecks jedoch nicht davon abhielt, ausgelassen zu feiern. Vielleicht tanzten sie sich aber auch nur auf den frisch geölten Planken aus edlem Palisanderholz warm. Orlando war vor der fröhlichen Menge geflohen und hoch auf das vierte Deck der Rosa gegangen, benannt nach der einzigen Tochter seines Chefs, die dort unten gerade mit jedem auf ihre einundzwanzig Jahre anstieß. Er war nach ihrem Vater und ihrer Mutter der Dritte gewesen, noch vor ihren zwei Brüdern und anderen Verwandten, auf den sie zugeeilt war, um Küsschen auf ihre vor Aufregung erhitzten Wangen zu erhalten und ihre Champagnerkelche zum Klingen zu bringen. Der Blick, den ihr Vater ihm daraufhin geschenkt hatte, war wie ein in seine Richtung geworfenes Jagdmesser. Rosa würde bald ein größeres Problem für ihn werden als all die Speichellecker, die sich um ihren Vater scharten und versuchten, Orlando auszustechen. Sie trug heute ein nachtblaues Paillettenkleid von Julien Fournié und mehr Make-up als sonst. Es war nicht einfach für die Jüngste, sich in der Familie Ferer zu behaupten. Aber weder Highlighter noch etliche Lagen Mascara konnten ihr den Anschein von Reife geben und darüber hinwegtäuschen, dass sie ein verwöhntes Nesthäkchen war und von niemandem hier ernst genommen wurde. Am wenigsten von Orlando selbst. Er war Rosa zum ersten Mal vor sechzehn Jahren im Haus ihres Vaters begegnet. Damals war er vierzehn gewesen und hatte schon auf eigenen Füßen gestanden, ehrgeizig, zielstrebig und überzeugt davon, wahrhaft Großes im Leben zu erreichen. Dass zehn Jahre später die inzwischen fünfzehnjährige Rosa begonnen hatte, ihn anzuhimmeln, hatte er amüsant gefunden und auch ein wenig schmeichelhaft. Er war sicher gewesen, dass ihre kindliche Schwärmerei sich bald legen würde. Aber mit seinem stetigen Aufstieg im Imperium ihres Vaters war ihre Bewunderung nur noch gewachsen. Daran hatte auch ihre monatelange Abwesenheit während ihres Grafik- und Designstudiums in Madrid offenbar nichts ändern können. Orlando seufzte, stützte sich mit den Unterarmen auf die Reling und hob den Blick von dem bunten Treiben neben dem abgedeckten Swimmingpool und ließ ihn über das nachtschwarze, ruhige Meer und die Lichter des Hafens schweifen, hoch zu der Sierra Blanca mit ihrem Pico de la Concha, dem Berg, der tagsüber dem Äußeren einer faltigen Muschel glich und nachts wie ein dunkler Koloss über die Enklaven des internationalen Jetsets, Nueva Andalucía und Marbella, wachte. Zum ersten Mal seit vielen Jahren dachte er wieder an seinen Vater. Weit hinter den Bergen lag die Provinz Jaén mit ihren sanften Hügeln und kargem Boden, über die sich, in nicht enden wollenden Hainen, an die sechzig Millionen Olivenbäume erstreckten. Mit 600 000 Tonnen des grünen flüssigen Goldes produzierte Andalusien mehr Olivenöl als ganz Italien. Jetzt, im Februar, war der Großteil der Ernte, die Ende Oktober begann, eingebracht. Orlando schloss die Augen und spürte wieder, wie die Sonne unbarmherzig auf ihn niederbrannte, Schweiß von seiner Stirn tropfte und er am Boden kniend mit bloßen Händen nicht enden wollende Mengen von kleinen grünbraunen Früchten in Jutesäcke schaufelte. Er sah den sonnenverbrannten, drahtigen Körper seines Vaters vor sich, der riesige Netze unter den nächsten knorrigen Stämmen ausbreitete und mit einem langen Stab die Oliven aus den Zweigen schlug.
»Apúrate ya, Orlando!«, herrschte er ihn an. Fortwährend: »Apúrate ya!«
Er beeilte sich doch! Aber egal, wie flink seine kleinen Finger nach den reifen Perlen griffen, er musste sich trotzdem immer vorhalten lassen, langsamer als sein Großvater zu sein, der neben ihm kauerte, um die Säcke zu befüllen. Vielleicht lag es auch daran, dass er manchmal an einer besonders spannenden Stelle innehielt, während der geliebte Abuelo ihm Märchen erzählte, vom verlorenen Sohn bei den Gnomen oder vom Kalifen, dem Hirten und der Glückseligkeit. Wie alt war er damals wohl gewesen? Fünf? Sechs? Wenn Orlando heute Oliven in seinem Salat vorfand, schob er sie stets an den Tellerrand, was ihm schon oft Spott eingebracht hatte.
»Nur die Äste des Maulbeerbaums sind lang und elastisch genug für diese Arbeit«, hatte der Abuelo ihm eingeschärft, während sie so nebeneinander arbeiteten.
Von den modernen Rüttelmaschinen der Großgrundbesitzer der Umgebung, die wie ein Propeller an einem langen Stab in die Baumkrone gehalten wurden, wo sie Oliven, Blätter und feine Äste rücksichtslos herunterfrästen, hielt er nichts. »Schändest du den Baum, schändet er dich«, hatte er geschimpft. Denn die Astspitzen mussten erst einmal nachwachsen, und sein Großvater war davon überzeugt gewesen, dass die Olivenernte nach einer solchen Behandlung im nächsten Jahr geringer ausfallen würde. »Kümmerst du dich aber um das Land, sorgt es für dich dein Leben lang. Wer Land besitzt, wird niemals Hunger leiden, merk dir das, Lando. All das«, er hatte seinen Arm zu einer ausholenden Geste gereckt, »wird einmal deiner lieben Mamá und dir gehören.«
Und Orlando hatte genickt, noch eifriger die Oliven eingesammelt und seinem Großvater jedes Wort geglaubt. Wie hätte er damals auch ahnen können, wie nah ihr Leben am Abgrund gebaut war? Ihr fragiles Fundament kam ins Rutschen, als er gerade in die zweite Klasse gekommen war und seine Mutter ihn eines Nachmittags nicht wie versprochen abholte, um mit ihm in Úbeda, der nächstgrößeren Stadt, neue Schuhe zu kaufen. Über eine Stunde lang hatte er auf der kleinen Mauer mit den roten Geranien neben dem Pausenhof ausgeharrt. Schließlich hatte er sich zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Orlando erinnerte sich an die kochende Wut in seinem Bauch, heiß wie die Sonne, die ihn auf seinem einsamen Weg niederdrückte, ebenso wie der Gedanke daran, was die anderen Kinder am nächsten Tag sagen würden, wenn er ohne die bereits vollmundig angekündigten neuen Schuhe kam. Die Scham erdrückte ihn schon jetzt. Tagelang hatten sie daheim gestritten.
»Neue Schuhe zum Geburtstag, schön und gut, aber muss der Bengel sich ausgerechnet dieselben aussuchen, die dieser Antonio trägt?«, hatte sein Vater geschimpft. Antonio war der Sohn des Bürgermeisters gewesen, ein Wichtigtuer, der Orlando immer nur Gitano-Bastard nannte. Damals hatte er noch gar nicht gewusst, was das Wort Bastard bedeutete, und noch viel weniger, was Gitanos mit der Vergangenheit seines Vaters zu tun hatten und warum niemand in der Familie über seine Herkunft sprach. Aber er verstand, dass Antonio ihn beschimpfte und sich für etwas Besseres hielt. Deshalb waren ihm diese Schuhe so wichtig gewesen. Heute konnte er sich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wie sie überhaupt ausgesehen hatten. Aber er wusste noch genau, dass sein Vater von einem Señor Hernandez bei der Banco Bilbao gesprochen hatte und davon, dass man Orlando nicht so verwöhnen durfte, aber Mamá hatte ihm nie einen Wunsch abschlagen können. In seiner Erinnerung verschwamm ihr Bild stets mit dem der gütigen Madonna auf dem Heiligenbildchen am Nachttisch seiner verstorbenen Großmutter. Mit langen, zornigen Schritten war er also an diesem Nachmittag nach Hause gestapft, hatte Steine den vorbeifahrenden Autos und Lastwagen auf der Landstraße hinterhergekickt, sodass seine Hosensäume vom aufwirbelnden Staub bis zu den Knien gelb gepudert waren. Osito war zum Zaun gestürmt und hatte ihn mit lautem Bellen freudig begrüßt, aber die Haustür war zu Orlandos Verwunderung sperrangelweit aufgestanden und niemand war zu Hause gewesen. Er hatte gerufen und die Felder abgesucht. Und dann war seine Wut plötzlich in Angst umgeschlagen. Orlando erinnerte sich noch an das endlose Warten. Zeit war ein eigentümlicher Stoff. Wenn er mit seinen Freunden zusammen Fußball gespielt hatte, war sie ihm wie Sand vorgekommen, der zwischen den Fingern verrann. An diesem Nachmittag war sie fester Beton, der keinen Millimeter nachzugeben schien. Irgendwann hatte er sich auf die Türschwelle gesetzt. Grillen hatten in dem hohen trockenen Gras auf den Feldern neben der Landstraße gezirpt, und die Sonne war immer tiefer gesunken, bis nur noch vereinzelte Strahlen hinter den Aprikosen- und Orangenbäumen im Garten hervorlugten. Osito hatte leise zu winseln begonnen und seltsamerweise hatte ihm dieses Geräusch gegen die aufsteigende Panik in seinem Inneren geholfen. Dem Hund beruhigende Worte zuzuflüstern und ihn hinter den Ohren zu kraulen, war eine Aufgabe gewesen, die Orlando zu dem Stärkeren von ihnen beiden gemacht hatte.