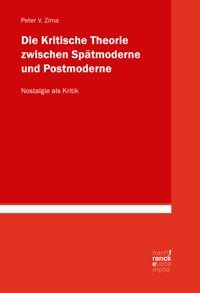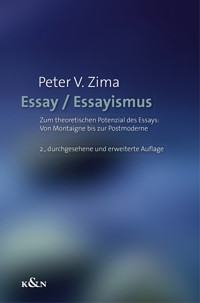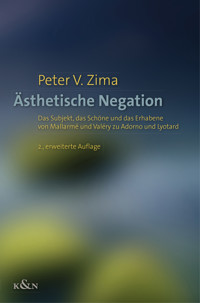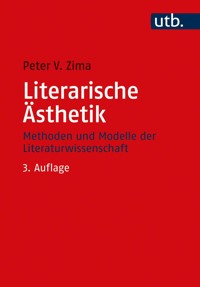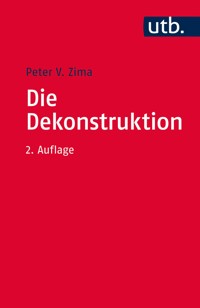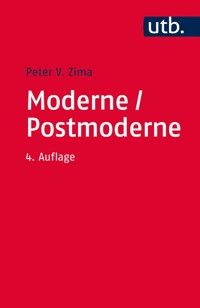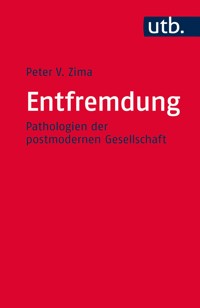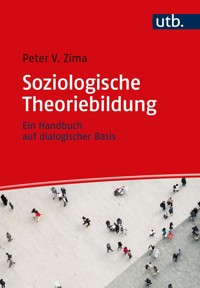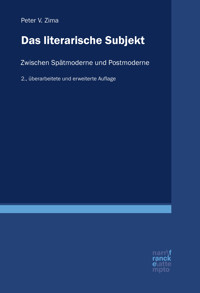
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Band zeichnet Peripetien individueller Subjektivität in der spätmodernen und postmodernen Literatur nach. Während in der Spätmoderne (bei Mallarmé, Valéry, Adorno) Negativität, das Schöne und das Erhabene der Stärkung subjektiver Autonomie dienten, schlägt in nachmodernen Texten - etwa in Pynchons Gravity's Rainbow - das Erhabene in Subjektnegation um. So verwandelt sich das Schreiben, das im Modernismus Prousts, Virginia Woolfs, Svevos zur Subjektkonstitution beitrug, in der Postmoderne Jürgen Beckers, Oswald Wieners oder Maurice Roches in eine Subversion individueller Subjektivität. Zima zeigt, wie in einigen nachmodernen Texten (bei Robbe-Grillet, Süskind, Del Giudice) Subjektivität auf reine Körperlichkeit reduziert wird. Diese Reduktion prägt auch das Werk Foucaults, das im Mittelpunkt des neuen Schlusskapitels steht. Sie bewirkt, dass das Individuum als Körper in verschiedene, durch Diskontinuitäten voneinander isolierte Kontexte integriert werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter V. Zima
Das literarische Subjekt
Zwischen Spätmoderne und Postmoderne 2., überarbeitete und erweiterte Auflage
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381127122
© 2024 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISBN 978-3-381-12711-5 (Print)
ISBN 978-3-381-12713-9 (ePub)
Inhalt
Vorwort zur zweiten Auflage
Dieses Buch gehört zu einer Art Trilogie, die im Laufe der Jahre beim Tübinger Francke-Verlag erschienen ist und die Peripetien individueller Subjektivität zwischen Moderne und Postmoderne zum Gegenstand hat: Theorie des Subjekts. Subjektivität und Identität zwischen Moderne undPostmoderne (2000, 2016, 4. Aufl.) sowie Das Subjekt in Literatur undKunst. Festschrift für Peter V. ZimaZima, P. V. (Hrsg. Simona Bartoli Kucher, Dorothea BöhmeBöhme, G., Tatiana Floreancig), 2011. In diesem Triptychon stellt Das literarische Subjekt einen Versuch dar, die Subjekt-Problematik im Übergang von der literarisch-philosophischen Spätmoderne zur Postmoderne nachzuzeichnen und zu konkretisieren.
In allen drei Bänden kommt die prekäre Stellung des Subjekts zur Sprache, die die Entwicklung von einer modern-spätmodernen zu einer postmodernen Probelmatik erkennen läßt. Während bei Philosophen und Schriftsellern der Spätmoderne wie Theodor W. AdornoAdorno, Th. W., Hermann BrochBroch, H. oder Robert MusilMusil, R. Zweifel an der Kohärenz und der Autonomie des individuellen Subjekts aufkommen, folgen die meisten spätmodernen Denker noch MusilsMusil, R. Maxime: „Der Individualismus geht zu Ende. (…) Aber das Richtiger wäre hinüberzuretten.“
Von dieser Maxime verabschieden sich Vertreter der Postmoderne wie Jean-François LyotardLyotard, J.-F., Michel FoucaultFoucault, M., Thomas PynchonPynchon, Th., Alain Robbe-GrilletRobbe-Grillet, A. oder Jürgen BeckerBecker, J.. Symptomatisch für die gesamte Entwicklung ist das Buch Disidentità von Giampaolo LaiLai, G.,Lai, G. das hier am Ende des ersten Kapitels kommentiert wird.
Angezweifelt werden in diesem Buch die tradierten Vorstellungen vom Subjekt als einer mit sich selbst identischen, kohärenten Einheit: „Woher stammt also der Gedanke, die Forderung nach notwendiger Permanenz, nach einer Identität, die hinter den Veränderungen zu suchen wäre, nach einer Selbstgleichheit hinter der Verschiedenheit, nach einer Kontinuität hinter den Diskontinuitäten, nach einer Einheit hinter der Vielheit?“ (Und doch ist ein Baum, der wächst, der alte Blätter verliert und neue bekommt, ein und derselbe Baum – wie der Mensch, der sich an ein gegebenes Versprechen oder ein begangenes Verbrechen erinnert, wie Paul Ricœur sagt.)
Das neue Kapitel, das nun das Buch abschließt und das nach Erscheinen der ersten Auflage (2001) aus einem Vortrag über FoucaultFoucault, M. am Bielefelder Zentrum für Interdisziplinäre Forschung (ZIF) hervorging (2004) und sich mit dem Subjekt- und Werkbegriff in Foucaults Philosophie befaßt, wirft zusammen mit der Frage nach dem Subjekt die komplementäre Frage nach dem Werk auf, das in der Vergangenheit von der Anwesenheit eines Autor-Subjekts zeugte.
FoucaultFoucault, M. zweifelt sowohl die Gegenwart des Subjekts im Werk als auch dessen Kohärenz an, die immer wieder aus einer subjektiven Intentionalität abgleitet wurde. Damit fordert er das Kohärenz- und Kontinuitätspostulat einer etablierten Hermeneutik, die auch dem hegelianischen Marxismus zugrunde liegt, mit Nietzsches Gedanken heraus, daß das Subjekt und seine Logik Fiktionen sind, die sich bei näherer Betrachtung auflösen.
Das letzte Kapitel zeigt, daß spätmoderne Zweifel am Subjekt bei Autoren wie MusilMusil, R., KafkaKafka, F. oder AdornoAdorno, Th. W. in der Postmoderne in eine wachsende Skepsis individueller Subjektivität gegenüber übergehen, die zur Folge hat, daß der Subjektbegriff von Philosophen wie LyotardLyotard, J.-F. und FoucaultFoucault, M. abgelehnt und von Schriftstellern wie Thomas PynchonPynchon, Th., Oswald WienerWiener, O. oder Jürgen BeckerBecker, J. kritisch zerlegt und parodiert wird. MusilsMusil, R. Vorhaben, vom Individualismus das „Richtige hinüberzuretten“, scheint nicht länger Bestandteil des postmodernen Projekts zu sein.
Vorwort zur ersten Auflage
In diesem Buch, das neben einigen Originalbeiträgen Aufsätze aus den 90er Jahren zusammenführt, geht es primär darum, die Peripetien literarischer Subjektivität zwischen Spätmoderne und Postmoderne nachzuzeichnen. Konkreter ausgedrückt: Es soll gezeigt werden, wie spätmoderne Autoren versuchen, die Autonomie des individuellen Subjekts in extremis zu retten, während Autoren der Nachmoderne den modernen Entwurf einer autonomen und mündigen Subjektivität mit Skepsis betrachten oder gar ablehnen.
Während in der Spätmoderne (als Modernismus) so verschiedene Dichter und Schriftsteller wie MallarméMallarmé, S., ValéryValéry, P., MusilMusil, R., UnamunoUnamuno, M. de oder PirandelloPirandello, L. alle ihnen zur Verfügung stehenden ästhetischen und stilistischen Mittel einsetzen, um die Autonomie, Integrität und Identität des Einzelnen zu wahren, scheinen sich postmoderne Literaten, Philosophen und Psychologen mit der Fragmentierung des Subjekts abzufinden. Sie folgen darin Vattimos Plädoyer für eine vielfältige oder plurale Subjektivität1 und Giampaolo Lais dekonstruktivem Entwurf einer disidentità, den der Psychoanalytiker zwar nicht als postmodern präsentiert, der aber in jeder Hinsicht postmodern ist.2
Postmodern im Sinne eines antimodernen Affekts oder gar einer antimodernen Wende ist auch Francesco Remottis anthropologische Studie Contro l’identità (1996), die aus der „Logik der Identität“ ausbricht und einige extreme Positionen nachmoderner Literatur zu bestätigen scheint: Positionen, von denen aus spätmoderne Begriffe wie Autonomie, Kritik, Nichtidentität und Utopie als Anachronismen erscheinen, die von den allmählich verschwindenden kritischen Intellektuellen in quichottesken Rückzugsgefechten verteidigt werden.
An die Stelle von Adornos Nichtidentität, die eine Distanzierung vom Bestehenden (von den „powers that be“) meinte, tritt Lais disidentità, die bestätigt, was der Autor der Minima Moralia zur spätmodernen Subjektivität anmerkte: „Der Narzißmus, dem mit dem Zerfall des Ichs sein libidinöses Objekt entzogen ist, wird ersetzt durch das masochistische Vergnügen, kein Ich mehr zu sein, und über ihrer Ichlosigkeit wacht die heraufziehende Generation so eifersüchtig wie über wenigen ihrer Güter, als einem gemeinsamen und dauernden Besitz.“3 Inzwischen ist die „heraufziehende Generation“ fest etabliert und genießt – möglicherweise masochistisch – eine Literatur der disidentità, die ihr bestätigt, was sie z.T. unbewußt schon immer herbeisehnte: das Recht auf Vielfalt, Inkohärenz und Freiheit vom Identitätsgebot.
Freilich macht sich die Neigung, die Zwangsjacke der Identität abzustreifen, schon bei spätmodernen Autoren wie HesseHesse, h., SvevoSvevo, I. oder PirandelloPirandello, L. bemerkbar, deren Kritik gesellschaftlicher Konventionen immer wieder in eine Kritik an den kulturellen Determinanten des eigenen Ichs umschlägt. Das Unbehagen in der Kultur, dessen Pathologien FreudFreud, S. untersuchte, führt zu der Erkenntnis, daß das eigene Ich an den unglaubwürdig werdenden Konventionen einer krisengeschüttelten Kultur teil hat, auf die Modernisten und Avantgardisten mit destruktiver Kritik reagieren, ohne allerdings individuelle Subjektivität preiszugeben. Insofern halten sie alle – MusilMusil, R., KafkaKafka, F., ProustProust, M., BrochBroch, H. – an Hesses Prinzip des Eigensinns fest: „Wer eigensinnig ist, gehorcht einem anderen Gesetz, einem einzigen, unbedingt heiligen, dem Gesetz in sich selbst, dem ‚Sinn‘ des ‚Eigenen‘.“4 Spätmoderne Gesellschafts- und Sprachkritik, auch die der Surrealisten und Existentialisten, ist ohne diesen „Eigensinn“ als Streben nach Autonomie kaum vorstellbar.
Die surrealistische und futuristische Sprachkritik scheint Louis-Ferdinand Célines Werk noch zu überbieten. Die Radikalität seiner Revolte kündigt postmoderne Textexperimente (PynchonsPynchon, Th., Ransmayrs, Schwabs) an, in denen der destruktive Impuls zusammen mit den diskreditierten und verhaßten Konventionen die individuelle Subjektivität erschüttert.
Vor allem im ersten Teil, der mit einer Analyse von Célines Voyage au bout de la nuit schließt, soll dargetan werden, wie das Erhabene, das bei MallarméMallarmé, S., ValéryValéry, P. und AdornoAdorno, Th. W. im Rahmen einer spätmodern-negativen Ästhetik dem Schönen untergeordnet wurde, bei CélineCéline, L.-F. diesen Rahmen sprengt und bei LyotardLyotard, J.-F. letztlich gegen das individuelle Subjekt gewendet wird.
Während im ersten Teil die ästhetischen Begriffe des Schönen und des Erhabenen im Vordergrund stehen, stellt der zweite Teil die Kontingenz und den Zufall in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Das kontingente Ereignis, das Modernisten wie ProustProust, M., SvevoSvevo, I., MoraviaMoravia, A., UnamunoUnamuno, M. de und PirandelloPirandello, L. zum Thema wird, erscheint als ein zutiefst ambivalentes Phänomen: Es kann einerseits das handelnde Subjekt, dessen narratives Programm es scheitern läßt, in Frage stellen; es kann andererseits als glückbringendes Ereignis die Kreativität des Subjekts anstacheln und neue ästhetische Konstruktionen ermöglichen. Vor allem der Kommentar zu den Romanen Unamunos und Pirandellos soll erkennen lassen, wie sehr Kontingenz, Dekonstruktion und Selbstkonstruktion des Subjekts zusammenhängen.
Zugleich wird die Ambivalenz der spätmodernen Naturauffassung erkennbar: Während Autoren wie SartreSartre, J.-P., MoraviaMoravia, A. oder KafkaKafka, F. die Natur – zusammen mit der naturwüchsigen Kontingenz – als eine Bedrohung individueller Subjektivität erscheint, erblicken ProustProust, M., HesseHesse, h. und BretonBreton, A. in ihr eine befreiende Kraft, die sich auch im Unbewußten und im Zufall als Glücksfall manifestiert.
Im dritten Teil wird die Wende von der spätmodernen zur postmodernen Literatur noch einmal auf der Ebene der Intertextualität und des Zitats dargestellt. Während in modernen und spätmodernen Werken sowohl Intertextualität als auch Zitat die Funktion erfüllen, Subjektivität selbstkritisch zu konstituieren und zu stärken, tragen sie in postmodernen Texten zur Auflösung der Subjektivität bei.
Insgesamt wird deutlich, daß der Unterschied zwischen Spätmoderne (Modernismus) und Postmodernde nicht so sehr im Auftreten neuer stilistischer Merkmale und Begriffe besteht, sondern im Funktionswandel schon bekannter Erscheinungen u. a. im Hinblick auf das Problem der individuellen Subjektivität. Ironie, Sprachkritik, Kontingenz, Intertextualität und Zitat sind sicherlich nicht als Besonderheiten postmoderner Texte zu verstehen, zumal sie nicht nur in der spätmodernen, sondern auch in der romantischen und vorromantischen Literatur aufgezeigt werden können.5 Ihre Funktion ändert sich jedoch von Problematik zu Problematik6: Während Ironie und Intertextualität im Modernismus noch die Funktion erfüllten, eine kritische und selbstkritische Subjektivität zu begründen, leiten sie in der Postmoderne die Auflösung der Subjektivität im Textexperiment ein.
Ein Charakteristikum der Spätmoderne fehlt möglicherweise im postmodernen Kontext: Pirandellos und Unamunos umorismo oder humorismo. Als sentimento del contrario (PirandelloPirandello, L.), das fast stets Tragik und Komik vereint, bezieht sich der „Humorismus“ auf die ambivalente Situation des Subjekts, das sich zwischen Glück und Unglück, Zerfall und Konstruktion bewegt. Ohne diese Bewegung und ohne die Sorge um den Einzelnen, die auch bei Robert MusilMusil, R., Thomas MannMann, Th., Marcel ProustProust, M. und Jean-Paul SartreSartre, J.-P. zum Ausdruck kommt, gibt es keinen umorismo. Da die postmoderne Problematik die Sorge um das Einzelsubjekt im Sinne von Thomas Manns Erzähler Zeitblom, im Sinne von SvevoSvevo, I., BrochBroch, H. oder MoraviaMoravia, A. nicht mehr kennt, verliert sie auch den Sinn für einen tragi-komischen „Humorismus“, welcher aus der vom jungen LukácsLukács, G. beschriebenen Zerrissenheit der Subjektivität zwischen Denken und Sein hervorgeht. Die tragi-komische Ambivalenz des spätmodernen Subjekts geht unter in der postmodernen Austauschbarkeit identitätsloser Individuen. Die postmoderne Frage befällt uns gleichsam aus der Vogelperspektive und ist schwer von der Hand zu weisen: Wie wichtig ist Leverkühns, Marcels oder K.’s Schicksal eigentlich?
Die hier gesammelten Aufsätze knüpfen einerseits an die Gedankengänge von Roman und Ideologie (1986) im Bereich der Subjektproblematik an und sollen andererseits die in Moderne/Postmoderne (1997) und in der Theorie des Subjekts (2000) angestrebte Gesamtschau konkretisieren und korrigieren. Obwohl die theoretischen Prämissen dieser beiden Studien in die hier vorgelegten Modellanalysen eingegangen sind, so daß es naiv wäre, von einer unvoreingenommenen Überprüfung am Textmaterial zu sprechen, kann der Autor hoffen, durch Auseinandersetzungen mit Einzelproblemen – wie Kontingenz, umorismo oder Intertextualität – seine Auffassungen von Spätmoderne, Postmoderne und Subjektivität näher erläutert und plausibler gemacht zu haben.
Freilich hat diese Plausibilität auch ihre Kehrseite. Denn es könnte unschwer gezeigt werden, daß das vielfältige Material, das die Theorie bisweilen „von oben herab“ sichtet und zusammenführt, in Wirklichkeit, d. h. in den Einzelanalysen, auseinanderstrebt. Entzieht sich ein Autor wie CélineCéline, L.-F. nicht der spätmodern-postmodernen Periodisierung? Wer im Anschluß an HumeHume, D., CroceCroce, B. oder gar DerridaDerrida, J. so partikularistisch-dekonstruktivistisch argumentiert, kann stets mit einem Erfolgserlebnis rechnen. Er sollte selbst einen Entwurf wagen: Do it yourself.
1Das literarische Subjekt zwischen Spätmoderne und Postmoderne
Der Titel scheint eine Gesamtdarstellung zu versprechen, die in einer einleitenden Betrachtung nicht zu leisten ist: die Entwicklung individueller Subjektivität in der Literatur des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts. In Wirklichkeit geht es primär – obwohl nicht ausschließlich – um den vom Wörtchen „zwischen“ angedeuteten Übergang von einer spätmodernen (modernistischen) zu einer nachmodernen Problematik.
Die These, die nicht nur dieser Einleitung, sondern dem Buch in seiner Gesamtheit zugrunde liegt, lautet: Während in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Autoren wie BaudelaireBaudelaire, Ch., DostoevskijDostoevskij, F. und NietzscheNietzsche, F. den Zweifel an der Einheitlichkeit des individuellen Subjekts in den Mittelpunkt der literarisch-philosophischen Problematik stellen, wird nach dem Zweiten Weltkrieg (seit den 50er und 60er Jahren) die Frage nach dem Subjekt negativ beantwortet oder an die Peripherie einer neuen, postmodernen Problematik abgedrängt.
Die Gründe für diesen hier postulierten Vorgang sind vielfältig und können nur in einem interdisziplinären Kontext, wie er in der Theorie des Subjekts1 ins Auge gefaßt wurde, konkret dargestellt werden. Hier geht es nicht mehr um die interdisziplinäre Bestandsaufnahme der vielschichtigen Verlagerung des Subjektproblems, sondern um eine genauere Erforschung der literarischen Schicht.
Daß diese nicht völlig unabhängig von Philosophie, Psyche und Gesellschaft untersucht werden kann, versteht sich von selbst. Denn Autoren wie Luigi PirandelloPirandello, L. oder Robert MusilMusil, R. wird ein rein literaturimmanenter Ansatz, der von Alfred Binets Studie Les Altérations de la personnalité (1892) und Ernst MachMach, E.s Die Analyse der Empfindungen (1886) abstrahiert, nicht gerecht: nicht nur weil BinetBinet, A. Pirandello und Mach Musil beeinflußt hat, sondern auch deshalb, weil der Zweifel an Subjektivität und Ich-Identität seit Nietzsches Subjektkritik2 um die Jahrhundertwende allmählich zu einem Gemeinplatz philosophischer, psychologischer und literarischer Debatten wurde. Paul BourgetBourget, P. und Marcel ProustProust, M. in Paris, Hermann BahrBahr, H., Arthur SchnitzlerSchnitzler, A. und Robert Musil in Wien, Luigi Pirandello und Italo SvevoSvevo, I. in Italien ließen sich von Philosophen wie NietzscheNietzsche, F. und Mach, von Theoretikern der Psyche wie Binet (Pirandello) und FreudFreud, S. (Svevo, Schnitzler) inspirieren, sooft sie in ihren Erfahrungen und Werken mit den Unwägbarkeiten des Unbewußten, der „multiplen Persönlichkeit”3 oder dem Zerfall des Ichs zwischen Tag und Traum konfrontiert wurden.
Es kommt hinzu, daß Affinitäten im Bereich des Subjektproblems nicht nur auf der genetischen Ebene des Einflusses, sondern auch auf typologischer Ebene nachgewiesen werden können. So gesteht beispielsweise FreudFreud, S. in einem Brief an SchnitzlerSchnitzler, A., daß er den Schriftsteller beneidet, der seiner Intuition bestimmte Erkenntnisse verdankt, die sich der Psychoanalytiker mühsam erarbeiten muß: „Ich habe mich oft verwundert gefragt, woher Sie diese oder jene geheime Kenntnis nehmen könnten, die ich mir durch mühselige Erforschung des Objekts erworben und endlich kam ich dazu, den Dichter zu beneiden, den ich sonst bewundert.“4 Es kann hier folglich von einer typologischen Parallelentwicklung literarischer, psychoanalytischer und philosophischer Diskurse die Rede sein, die historisch und gesellschaftlich bedingt ist.5 Immer häufiger diagnostizieren Literaten, Psychoanalytiker und Philosophen eine Krise des individuellen Subjekts, die sich im Übergang von der Romantik und dem Realismus zur Spätmoderne als Modernismus verschärft.
Während Romantiker wie NovalisNovalis, WordsworthWordsworth, W., ChateaubriandChateaubriand, R. de oder LamartineLamartine, A. de in der individuellen Innerlichkeit noch eine Zufluchtsstätte subjektiver Freiheit und Kreativität erblicken konnten, erscheint bei spätmodernen Dichtern wie BaudelaireBaudelaire, Ch. und RimbaudRimbaud, A. das Ich als zerrissene, zerfallende Instanz. Die Romantiker meinen, in der subjektiven Innerlichkeit, die mit den als leblos empfundenen sozialen Konventionen konkurriert, eine neue Wahrheit entdeckt zu haben: „Diese subjektive Wahrheit, die das romantische Bekenntnis in Szene setzt, existiert nur durch ihre Einzelheit, d. h. durch die Distanz zwischen ihr und der Welt der sozialen Erfordernisse (…).“6 In der Spätmoderne zerfällt diese subjektive Wahrheit in der Ambivalenz, die Wahrheit und Lüge, Ich und Nicht-Ich, Erhabenes und Triviales, Echtes und Unechtes so zusammenführt, daß das Ich in seiner Zerrissenheit und Heterogenität als Zufluchtsort nicht mehr in Frage kommt: „Durchgängiges Merkmal der Baudelaireschen Texte ist ein Spiel mit der Perspektive, das auf der Funktionsgemeinschaft zweier Ich-Instanzen beruht. Dies ist ein Grund, warum ein Werk wie die Fleurs du mal mit herkömmlichen Kategorien – etwa der des lyrischen Ichs – nicht mehr zu erschließen ist. Rimbauds ‚Je est un autre‘ gilt bereits für den, den er als ‚wahren Gott‘ verehrt (…).“7 Anders gesagt: Das Ich als träumend Schaffendes, das bei Dichtern wie EichendorffEichendorff, J. von oder Lamartine als Alternative zum anbrechenden Industriezeitalter erschien, wird bei Autoren wie BaudelaireBaudelaire, Ch. und Rimbaud als eine von Widersprüchen zerrissene Welt erkannt.
Der Soziologe Georg SimmelSimmel, G. erklärt weshalb: „Die Folgen freilich, die die unbeschränkte Konkurrenz und die arbeitsteilige Vereinseitigung der Individuen für deren innere Kultur ergeben hat, lassen sie nicht gerade als die geeignetsten Mehrer dieser Kultur erscheinen.“8 Durch die arbeitsteilig bedingte Vereinseitigung ist der Einzelne immer weniger in der Lage, als Träger dieser Kultur aufzutreten. Er wird ihr entfremdet und fällt bald Ideologien, bald Marktgesetzen zum Opfer, die ihm Kulturersatz anbieten und ihn zu einem Pseudosubjekt machen: zu einem Unterworfenen, einem sujet assujetti im Sinne von FoucaultFoucault, M. und AlthusserAlthusser, L.9, das zu autonomem Denken und Handeln nicht mehr fähig ist.
Im folgenden sollen die Peripetien individueller Subjektivität zwischen einer spätmodernen rettenden Kritik und einer nachmodernen Verabschiedung des Subjektbegriffs nachgezeichnet werden. Während aristokratisch sich gebärdende Dandies ebenso wie Schriftsteller des frühen und späten Modernismus (vom Symbolismus bis zum Existentialismus) versuchen, das Einzelsubjekt in einer von Großkonzernen, Massenbewegungen und Marktmechanismen beherrschten Gesellschaft in extremis zu retten, werden im Übergang von der Spätmoderne (hier: von ca. 1850–1950) zur Postmoderne immer mehr Stimmen laut, die Subjektivität – zusammen mit anderen „alteuropäischen“ (LuhmannLuhmann, N.) Begriffen wie „Herrschaft“, „Kritik“ und „Utopie“ – verabschieden möchten. Am Ende dieser Entwicklung steht Giampaolo Lais Buch Disidentità (1988), dessen Autor sich mit postmoderner Gebärde von der psychoanalytischen Suche nach subjektiver Identität distanziert. Er spricht von einem identitären Vorurteil (pregiudizio identitario) und plädiert unerschrocken für Inkohärenz. Es geht hier nicht darum, gegen dieses Plädoyer ideologisch-dualistisch ein Identitätspostulat ins Feld zu führen, sondern zu zeigen, welche literarischen Entwicklungen diesem Postulat entsprechen.
1.1Subjektivität und Ambivalenz: Die spätmoderne Problematik
Die Spätmoderne als Modernismus (Modernism) lassen viele englischsprachige Autoren erst um die Jahrhundertwende beginnen. Insofern hat der von BradburyBradbury, M. und McFarlaneMcFarlane, J. herausgegebene Band Modernism 1890–1930 symptomatischen Wert.1 Bei diesen beiden Autoren fällt der literarische Modernismus mit der Schriftstellergeneration von 1870 zusammen, deren Vertreter – etwa GideGide, A. (1869–1951), ProustProust, M. (1871–1922), JoyceJoyce, J. (1882–1941), SvevoSvevo, I. (1861–1928) – ihre ersten Werke in den 90er Jahren veröffentlichen.
Gegen diese Konstruktion ist nichts einzuwenden, sofern man sich in erster Linie vornimmt, den Modernismus als ein Phänomen der Jahrhundertwende gegen verwandte Strömungen wie Symbolismus, Ästhetizismus und Avantgarde abzugrenzen. Charakteristisch für diese Auffassung ist D. W. Fokkemas Behauptung, der „modernistische Kode“ hebe sich „schroff vom koexistierenden Kode des Surrealismus ab“.2 Sie ist vertretbar, solange man den Modernismus mit Werken von Autoren wie ProustProust, M., ValéryValéry, P., T. S. EliotEliot, T. S., Thomas MannMann, Th. oder Ezra Pound identifiziert, denen eine (stets variierende) Autonomieästhetik zugrunde liegt. In diesem Kontext mag man mit Linda HutcheonHutcheon, L. von einem „hermetischen, ahistorischen Formalismus und Ästhetizismus“3 sprechen, dem politisches Engagement fremd ist. Symbolismus (MallarméMallarmé, S., RimbaudRimbaud, A.) und Ästhetizismus (WildeWilde, O., HuysmansHuysmans, J.-K.) mögen dann als verwandte „autonomistische Strömungen“ erscheinen oder gar in einem als „elitär“, „formalistisch“ und „ästhetizistisch“ apostrophierten Modernismus aufgehen.
Allerdings ist dies nur ein Aspekt des Modernismus, in dem man durchaus die Symbolisten MallarméMallarmé, S. und RimbaudRimbaud, A. sowie die Ästhetizisten WildeWilde, O. und HuysmansHuysmans, J.-K. erkennen kann. Haben diese Autoren nicht die spätmoderne Zerrissenheit des Subjekts antizipiert, die in den Werken des „High Modernism“, in den Romanen ProustsProust, M., Joyces, Svevos oder Hesses, in Szene gesetzt wird?
Doch schon die Namen JoyceJoyce, J. und HesseHesse, h. evozieren jenen anderen Modernismus, den Literaturwissenschaftler wie FokkemaFokkema, D. W. und HutcheonHutcheon, L. ausblenden müssen, um die von ihnen angestrebte Abgrenzung gegen Avantgarde und Episches Theater4 plausibel zu machen: den radikalen, gesellschaftskritischen Modernismus, der sich in Hesses Der Steppenwolf, Döblins Berlin Alexanderplatz, Joyces Ulysses oder Célines Voyage au bout de la nuit zu Wort meldet. Es ist absurd, diesen Modernismus als „hermetisch“, „ahistorisch“, „formalistisch“ oder gar „ästhetizistisch“ bezeichnen zu wollen; er ist das Gegenteil aller dieser Epitheta.
Er erweist sich bei näherer Betrachtung auch als enger Verwandter des französischen Surrealismus, dessen mitunter gewalttätiges Traumszenario in Hesses „Magischem Theater“ (am Ende des Steppenwolf-Romans) als integraler Bestandteil des Modernismus erscheint. Aber auch ProustsProust, M.Recherche mündet – fernab von Gewalt und Revolte – in den Surrealismus: Auf onirischer Ebene antizipiert die mémoire involontaire die auf das Unbewußte ausgerichtete attente mystique der Surrealisten, und Traumgegenstände wie die Madeleine oder die ungleichen Pflastersteine am Ende von Le Temps retrouvé weisen eine frappierende Ähnlichkeit mit den objets trouvés auf.5
Schon deshalb ist es sinnvoll, die Avantgarden (die Surrealismen und Futurismen, den Expressionismus und den Vorticismus) mit Astradur EysteinssonEysteinsson, A. der modernistischen oder spätmodernen Problematik zuzurechnen: „In that case, ‚modernism‘ is necessarily the borader term while the concept of the ‚avant-garde‘ has proven to enjoy a good deal of ‚free-play‘ within the overall reach of modernism. At the same time nothing that is modernist can escape the touch of the avant-garde.“6 Dies sollte hier durch die beiden Hinweise auf die surrealistischen Elemente bei HesseHesse, h. und ProustProust, M. veranschaulicht werden.
Sowohl modernistische als auch avantgardistische Elemente finden sich allerdings auch in den Werken MallarmésMallarmé, S. und HuysmansHuysmans, J.-K.’, BaudelairesBaudelaire, Ch. und Dostoevskijs. Während MallarméMallarmé, S. eine Ästhetik des Erhabenen ins Auge faßt, die die individuelle Subjektivität in Frage stellt7, und der HuysmansHuysmans, J.-K. von A Rebours (1884) lange vor MusilMusil, R. und SvevoSvevo, I. einen „essayistischen“ Roman ohne Handlung entwirft („roman concentré en quelques phrases“)8, visieren DostoevskijDostoevskij, F. und BaudelaireBaudelaire, Ch. das zentrale Problem der Spätmoderne an: die Ambivalenz aller Werte, die sowohl das Denken als auch das Handeln des Subjekts in Frage stellt.
Diese Ambivalenz sollte nicht als rein literarisches Problem mißverstanden werden, das vor allem im spätmodernen Roman anzutreffen ist.9 Denn sie ist ein Phänomen der entwickelten Marktgesellschaft, die so sehr von Tauschwert und Geldmedium beherrscht wird, daß Werte, die jede Religion, jede Ideologie rigoros trennen, jäh als Verwandte erscheinen. Der junge MarxMarx, K. sagt vom Geld, es zwinge „das sich Widersprechende zum Kuß“.10 Diese Aussage ist auf zwei Ebenen zu lesen: auf der Ebene der Krise und auf der Ebene der Kritik. Wenn unvereinbare Werte wie Gut und Böse, Freiheit und Unfreiheit, Liebe und Haß, Wahrheit und Lüge zusammengeführt werden, so entsteht einerseits ein Krisenbewußtsein, welches das individuelle Subjekt handlungsunfähig machen kann; andererseits kann aber der kritische Gedanke aufkommen, daß Gegensätze dialektisch zusammengedacht werden sollten, auch wenn die Hegelsche Synthese nicht mehr zu bewerkstelligen ist.
Das spätmoderne oder modernistische Bewußtsein der Ambivalenz vereinigt also Krise und Kritik, wobei das individuelle Subjekt einerseits geschwächt, andererseits gestärkt wird: Es wird geschwächt, weil es feststellen muß, daß das kulturelle Wertsystem der spätkapitalistischen Gesellschaft allmählich zerfällt; es wird zugleich gestärkt, weil es jenseits von allen religiösen und ideologischen Manichäismen und Dualismen beobachten kann, wie sehr Gegensätze zusammenhängen.
Anders gesagt: Das spätmoderne Subjekt ist das nachmetaphysische, nietzscheanische und freudianische Subjekt, dessen Handeln zwar problematisch wird – wie das Handeln der Romanhelden Pirandellos, Unamunos, ProustsProust, M. und MusilsMusil, R. –, dessen Denken aber über die reduktionistischen Dualismen von Religion, Metaphysik und Ideologie hinausgeht. Dieses Hinausgehen über tradierte Wertsysteme hat seinen Preis, denn das kritische Subjekt muß sich von NietzscheNietzsche, F. sagen lassen: „Die ‚scheinbare‘ Welt ist die einzige: die ‚wahre Welt‘ ist nur hinzugelogen…“11 Es muß Freuds Thesen zur Kenntnis nehmen, daß beim Zwangsneurotiker „Liebe und Haß einander die Waage halten“12 und „daß Gott und Teufel ursprünglich identisch waren“.13
Diese Erkenntnisse mögen das Subjekt verunsichern; sie schärfen aber auch seinen Blick für die Verflechtungen einer immer komplexer werdenden sozialen Wirklichkeit, in der nur noch Ideologen als große Vereinfacher eindeutig Gut und Böse bezeichnen können. Gegen sie wendet sich Charles BaudelaireBaudelaire, Ch., der (um 1860) zusammen mit NietzscheNietzsche, F. und DostoevskijDostoevskij, F. an der Schwelle zu einer Spätmoderne steht, die zur Selbstkritik, zur Reflexion der gesamten Moderne als Neuzeit wird. Anticartesianisch, antihegelianisch und nietzscheanisch ist sein Sprachduktus, wenn er in der Mystik ein Bindeglied zwischen Heidentum und Christentum erkennt oder wenn er feststellt: „La superstition est le réservoir de toutes les vérités.“14 Auf diese Destruktion der metaphysischen Wahrheit, die BaudelaireBaudelaire, Ch. um 1859 vornahm, scheint Nietzsche mit seiner Zerlegung des Wahrheitsbegriffs zu antworten: „Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen (…).“15 Die Wahrheit als Aberglaube, als bewegliche Konstellation, die jäh zerfällt und ihre rhetorischen Wurzeln zutage treten läßt: Aus dieser ambivalenten Betrachtung aller metaphysischen Gegensätze, aller modernen Wertsetzungen gehen die skeptisch-ironischen Diskurse der literarischen Spätmoderne hervor, die in Ästhetizismus, Symbolismus und Avantgardismus trotz aller Gegensätze einen gemeinsamen Nenner aufweisen, den Hermann BrochBroch, H. mit dem Ausdruck „Zerfall der Werte“ bezeichnet und Nietzsche mit der Metapher vom „Tode Gottes“ umschreibt.
Geht man mit AlthusserAlthusser, L. von dem Gedanken aus, daß Gott als höchstes Subjekt alle anderen Individuen zu Subjekten macht16, so ergibt sich aus dem Tode Gottes die von NietzscheNietzsche, F., MallarméMallarmé, S. und den Existentialisten erkannte Notwendigkeit, die menschliche Subjektivität ohne metaphysische Garantien neu zu begründen. Während Nietzsche den Nihilismus als „Zerfall der Werte“ durch den Übermenschen zu überwinden sucht – „Nicht ‚Menschheit‘, sondern Übermensch ist das Ziel!“17 –, fassen MallarméMallarmé, S., ProustProust, M. und der junge SartreSartre, J.-P. eine Überwindung des Nihilismus in der Sprache der Dichtung ins Auge. „L’absolu c’est le Moi pur comme simple déterminabilité et comme négation de la subjectivité empirique“18, bemerkt Sartre in seinem Artikel „L’Engagement de MallarméMallarmé, S.“ (1979), in dem er nicht nur mit MallarmésMallarmé, S. Ästhetizismus, sondern indirekt auch mit dem von La Nausée (1938) abrechnet, den er schon in Les Mots selbstkritisch relativierte. Tatsache ist aber, daß nicht nur MallarméMallarmé, S. und ProustProust, M., sondern auch der Autor von La Nausée versucht, die „empirische Subjektivität“, die an den Widersprüchen der Wirklichkeit zu scheitern droht, durch einen ästhetisch-literarischen Entwurf zu retten.
Wie sehr diese „empirische Subjektivität“ von der extremen Ambivalenz und dem aus ihr ableitbaren „Zerfall der Werte“ in Frage gestellt wird, lassen die Romane von MusilMusil, R. und BrochBroch, H. erkennen. Beide Autoren erblicken in der von Marktgesetzen, ideologischen Konflikten und arbeitsteiligen Prozessen ausgelösten Krise der Werte die Hauptursache für die Krise des individuellen Subjekts. Nach Nietzsches Destruktion und BaudelairesBaudelaire, Ch. Demaskierung der Wahrheit (als Aberglaube) vermag MusilsMusil, R. Romanheldin Diotima nicht mehr ohne weiteres am metaphysischen Wahrheitsbegriff festzuhalten: „Diotima hätte sich ein Leben ohne ewige Wahrheiten niemals vorzustellen vermocht, aber nun bemerkte sie zu ihrer Verwunderung, daß es jede ewige Wahrheit doppelt und mehrfach gibt.“19 Der Ausbruch einer solchen spätmodernen, nachmetaphysischen Skepsis kann Handlungsunfähigkeit zur Folge haben: „Jedesmal, wenn Diotima sich beinahe schon für eine solche Idee entschieden hätte, mußte sie bemerken, daß es auch etwas Großes wäre, das Gegenteil davon zu verwirklichen.“20 Vor dieser Ratlosigkeit, die das Subjekt zur Passivität verurteilt, fliehen Hermann Brochs Helden Pasenow und Esch in die manichäische Eindeutigkeit der Ideologie: „Denn im Kasino war alles eindeutig und es galt ja, ja, und nein, nein (…).“21 So ähnlich denkt der Ideologe Esch im zweiten Roman der Brochschen Trilogie: „Auch tat es ihm wohl, daß hier ein Mensch war, der eindeutig und bestimmt sich darstellte, ein Mensch der wußte, wo sein Rechts und sein Links, sein Gut und sein Böse zu finden ist.“22 Dualistisch reagiert der Ideologe auf die Ambivalenz, um handlungsfähig zu bleiben.
Eine ganz andere Haltung nimmt der spätmoderne Schriftsteller oder sein Erzähler an, der in der Ambivalenz nicht nur ein Symptom der Krise, sondern zugleich den Ausgangspunkt seiner Kritik erblickt. So decken beispielsweise Italo SvevoSvevo, I. und Luigi PirandelloPirandello, L. mit einer von Paradoxien durchsetzten Ironie die Ambivalenzen der Vater-Sohn-Beziehung auf: Hat der sterbende Vater in La coscienza di Zeno seinem Sohn Zeno absichtlich oder schon jenseits von Absicht und Bewußtsein eine Ohrfeige gegeben? War es überhaupt eine Ohrfeige oder nur eine letzte Geste des Sich-Aufbäumens gegen den Tod? Diese Zweideutigkeit, die vom Erzähler ironisch reflektiert wird, findet der Leser in Pirandellos Uno, nessuno e centomila wieder, wo die Vater-Sohn-Beziehung als von allen (von Freuds Psychoanalyse erforschten) Ambivalenzen durchwirkt erscheint. Ein Kapitel trägt gar den Titel: „Il buon figliuolo feroce“.23 MusilsMusil, R. Held Ulrich, der dem Erzähler des Romanfragments in mancher Hinsicht nahe steht, relativiert den Eifer des dualistisch dozierenden Ideologen Schmeißer mit ironischer Ambivalenz: „‚Dann behaupte ich‘, ergänze Ulrich lächelnd seinen Satz, ‚daß Sie an etwas anderem scheitern werden, zum Beispiel daran, daß wir imstande sind, jemand Hund zu schimpfen, auch wenn wir unseren Hund mehr lieben als unsere Mitmenschen‘.“24 In Brochs Romantrilogie bringt wiederum der Ironiker Eduard von Bertrand die Ideologen Pasenow und Esch aus der Fassung, indem er ihnen auf subtile Art die Einheit der Gegensätze ohne Synthese vor Augen führt.25
Aus dieser spätmodernen Zusammenführung der Gegensätze ohne hegelianische Aufhebung geht nicht nur MusilsMusil, R. Ironie hervor, die zugleich Selbstironie und Selbstkritik ist26, sondern auch Pirandellos umorismo, der in vieler Hinsicht mit Miguel de Unamunos humorismo verwandt ist. Von PirandelloPirandello, L. selbst wird der umorismo in seinem bekannten Aufsatz gleich zu Beginn mit der Melancholie, der malinconia, verknüpft27 und immer wieder als sentimento del contrario (Bewußtsein vom Gegenteil) definiert.28 Was den Humoristen vom Komiker oder Satiriker, auch vom Ironiker im gebräuchlichen Sinn, unterscheidet, das ist dieses Bewußtsein vom Gegenteil, das letztlich als das spätmoderne oder modernistische Bewußtsein der Ambivalenz zu verstehen ist. Der Humorist im Sinne des englischen humour lacht über die Wirklichkeit oder die Protagonisten seines Dramas oder Romans, nicht jedoch Pirandellos umorista: „Durch das Lächerliche hindurch (…) nimmt er die ernste und schmerzliche Seite wahr.“29 Der Sinn fürs Gegensätzliche hält ihn zur Reflexion an: „Diese Reflexion dringt scharf und subtil überall ein und zerlegt alles: jede Gefühlsvorstellung, jede Idealfiktion, jeden Schein der Wirklichkeit, jede Illusion.“30 Dieser Satz ist nicht nur nietzscheanisch, sondern für die literarische Spätmoderne als ganze charakteristisch. Er entspricht der kritisch-analytischen Attitüde des spanischen humorista Miguel de UnamunoUnamuno, M. de.
Wie PirandelloPirandello, L. verknüpft auch UnamunoUnamuno, M. de seinen humorismo mit einer ambivalenten Einstellung, wenn er in seinem Roman Niebla (1914) das Komische mit dem Tragischen einhergehen läßt. Was in Víctor Gotis Vorwort zu diesem Roman steht, könnte aus Pirandellos Humorismus-Aufsatz sein: „Zuweilen habe ich Don Miguel behaupten hören, daß das, was man hier Humor – den echten nämlich – nennt, in Spanien nie recht Wurzeln geschlagen habe und daß er dort in absehbarer Zeit schwerlich Wurzeln schlagen könne. Die Leute, die sich Humoristen nennen, sind, nach der Ansicht Don Miguels, entweder der Satiriker oder Ironiker, wenn sie nicht gar einfache Spaßmacher sind.“31 Im Gegensatz zu allen diesen Pseudohumoristen ist Unamuno ein umorista im Sinne von Pirandello: ein Denker der Ambivalenz, der Komik und Tragik, Leben und Tod, Lachen und Weinen zusammenführt, ohne auf höherer Ebene Synthesen anzubieten. Insofern ist er Nietzscheaner und Erbe von Søren KierkegaardKierkegaard, S., der der Hegelschen Aufhebung absagte und das Paradoxon unaufgelöst stehen ließ.32
Er ist auch Erbe Dostoevskijs, eines Romanciers der extremen Ambivalenz33, der zusammen mit NietzscheNietzsche, F. und BaudelaireBaudelaire, Ch. die spätmoderne Selbstkritik der Moderne in die Wege leitet. Auch DostoevskijDostoevskij, F. kann als Humorist im Sinne von UnamunoUnamuno, M. de und PirandelloPirandello, L. gelesen werden: „Humor und Witz an sich kommen in Dostoevskijs Texten kaum vor. Sie sind stets mit hintergründiger Ironie und Satire gepaart, bzw. sind ständig in Gefahr, in die Absurdität überzugehen. Auch ist die Komik bei Dostoevskij nie weit von der Tragik entfernt, wie beispielsweise in einer Episode aus Schuld und Sühne. Svidrigajlov zieht den Revolver, um Selbstmord zu begehen, als ihn ein Wachtposten auf der Straße auf die Ordnungswidrigkeit seines Verhaltens hinweist: ‚He, das dürfen Sie hier nicht…‘.“34 Der Zufall spielt hier eine ähnliche – komisch-absurde – Rolle wie in den Romanen Svevos, Pirandellos und Moravias: Während in Moravias Gli indifferenti der Held zufällig vergißt, seinen Revolver, mit dem er seinen Widersacher Leo Merumeci erschießen will, zu laden, wird Svidrigajlovs selbstzerstörerische Absicht vom zufälligen Auftauchen des Wachtpostens durchkreuzt. In beiden Fällen verwandelt der Zufall Tragik in Komik.
Zugleich offenbart er die Ohnmacht des Subjekts in der Spätmoderne: in einer Zeit, in der Schriftsteller die grundlegende Ambivalenz nicht mehr erzählerisch überwinden35, sondern nur noch humoristisch-essayistisch verarbeiten können. Ihre Protagonisten sind – wie MusilsMusil, R. fragmentarischer, essayistischer Roman zeigt – passive Gestalten, deren reflexiver, analytischer Scharfsinn sie am Handeln hindert. MusilsMusil, R. Ulrich, ProustsProust, M. Jean Santeuil und Marcel, Pirandellos Vitangelo Moscarda und Joyces Stephen verkörpern allesamt eine problematisch gewordene Subjektivität, die sich nicht mehr auf eindeutig definierbare Werte stützen kann.
MusilMusil, R. selbst hat die Literatur seiner Zeit als eine Literatur der Ambivalenz aufgefaßt: „Diese Überzeugung von der Übergänglichkeit der menschlichen Erscheinungen ineinander, die tiefere Verwandtschaft der moralischen Gegensätze kann man geradezu als ein Kennzeichen der zeitgenössischen Literatur im Unterschied zu früheren Zeiten ansprechen.“36 Es ist jedoch nicht nur eine Literatur passiver Helden, sondern zugleich – wie sich gezeigt hat – eine Literatur des umorismo, der Selbstreflexion und der Kritik: eine Literatur, die von NietzscheNietzsche, F. bis SartreSartre, J.-P. neue Subjektivitäten, neue Subjektentwürfe entstehen läßt.
1.2Spätmoderne Formen der Subjektivität: Dandyismus, Ästhetizismus, Existentialismus und Avantgarde
Eines der wesentlichen Anliegen der Spätmoderne, durch das sie sich klar von der gesamten postmodernen Problematik abhebt, hat Miroslav KrležaKrleža, M. in seinem Roman Povratak Filipa Latinovicza (1932) in wenigen Worten wiedergegeben: „Biti subjekt i osjećati identitet svoga subjekta!” („Subjekt sein und die Identität des eigenen Subjekt-Seins fühlen!”)1 Kaum ein anderer modernistischer Autor hat dieses zentrale Vorhaben der spätmodernen Philosophie und Literatur so knapp und klar formuliert. Sechs Jahre vor SartresSartre, J.-P. Antoine Roquentin denkt Krležas Held „über die Identität des eigenen ‚Ichs‘“2 nach und stellt fest, daß er dieses Ich nur sehr unklar und verschwommen wahrnimmt.
Seine Antwort auf die Frage nach dem Subjekt ist anders geartet als die Antworten HuysmansHuysmans, J.-K.’, MallarmésMallarmé, S., SartresSartre, J.-P., Svevos oder Pirandellos. Dieser Tatsache soll das Wort „Problematik“ Rechnung tragen, das ein Ensemble von verwandten Problemen oder Fragestellungen bezeichnet, auf die jeder Autor, jede Autorengruppe, die im Rahmen einer Problematik schreibt, anders reagiert. Entscheidend ist die Verwandtschaft der einzelnen Probleme, die eine Problematik ausmachen, eine Verwandtschaft, die beispielsweise die Frage nach dem Subjekt mit den analogen Fragen nach der Form, dem kritischen Gehalt, der Autonomie und der Negation des Bestehenden verbindet.3 Der Umstand, daß Vertreter des Ästhetizismus, des Symbolismus, des Existentialismus und der Avantgarde immer wieder versuchen, auf diese Fragen zu antworten, läßt ihre Zugehörigkeit zur spätmodernen Problematik erkennen. Daß diese Problematik weit über den literarischen (künstlerischen) Bereich hinausgeht, zeigt der Dandyismus als zugleich soziales und ästhetisches Phänomen diesseits der Kunst.
Denn der Dandy, der Schriftsteller von Barbey d’Aurevilly und BaudelaireBaudelaire, Ch. bis Oscar WildeWilde, O. und Marcel ProustProust, M. fasziniert hat, ist wohl eine der originellsten Antworten auf die Frage nach dem Subjekt. Dennoch ist er eine Antwort in „dürftiger Zeit“: in einer Zeit, in der ethische, ästhetische und politische Werte in zunehmendem Maße als durch den Tauschwert vermittelt erscheinen. Die riches mariages, zu denen der europäische Adel von Geldnöten gezwungen wird, laufen darauf hinaus, daß Land und Adelstitel von Millionären käuflich erworben werden. Durch diese Art von Geldheirat verwandelt sich beispielsweise in ProustsProust, M. Roman die reiche Madame Verdurin in die Prinzessin von Guermantes. In solch einer Situation, in der nahezu alles vom Kommerz erfaßt wird, stellt sich die Frage nach dem wahren, dem qualitativen Unterschied. Dies ist wohl der Grund, weshalb BaudelaireBaudelaire, Ch. vom Dandy sagt, er sei „vor allem auf Unterscheidung aus“ („épris avant tout de distinction“).4
Deutet man diese Diagnose – gleichsam retrospektiv – im Zusammenhang mit Bourdieus Studie über Die feinen Unterschiede (La Distinction, 1979), so hat man das kulturelle Feld der mondänen Gesellschaft vor sich, in der Dandies als Modekünstler und geistreiche Causeurs versuchen, ihr qualitatives Anderssein unter Beweis zu stellen. Sie sind anders als verbürgerlichte Adelige, die das authentische Auftreten ihrer Ahnen verlernt haben; sie unterscheiden sich radikal von bürgerlichen Parvenus, die sich in verarmte Adelsgesellschaften eingekauft haben; vor allem aber distanzieren sie sich von all den utilitaristisch denkenden Bürgern und Arbeitern, die einer nützlichen Tätigkeit nachgehen. Sie entwickeln und pflegen einen Habitus, der nicht jedermanns Sache ist. Denn nicht jeder kann mit einer eleganten Erscheinung aufwarten, als Causeur die richtige Bemerkung im richtigen Augenblick einwerfen und seine impertinence so brillant verkleiden, daß sie nie an plumpe Dreistigkeit erinnert. Anders gesagt: Der Dandy kann hoffen, alle seine mondänen Rivalen aus dem Feld zu schlagen, weil er bestimmte Archaismen der untergegangenen höfischen Gesellschaft mit neuem Leben erfüllt. Und er tut dies zu einem Zeitpunkt, da solche Archaismen zwar noch verstanden und goutiert werden, aber dennoch zum Aussterben verurteilt sind. So ist auch BaudelairesBaudelaire, Ch. bekannte Feststellung zu deuten: „Le dandysme est le dernier éclat d’héroïsme dans les décadences (…).”5 Der Dandy ist ein Held, weil er in einer sich demokratisierenden und verbürgerlichenden Gesellschaft unerschrocken aristokratische Allüren kultiviert.
Diese soziologische Skizze greift deshalb zu kurz, weil sie das Subjekt-Problem ausblendet. Ein ähnlicher Einwand gilt auch für einige Studien Bourdieus6, in denen das emsige Agieren sozialer Akteure in einem champ dargestellt wird, ohne daß die Frage aufkommt, mit welchem Wahrheitsanspruch sie auftreten. Nun ist „Wahrheit“ ein durchaus metaphysischer Begriff, der seit Nietzsches Kritik – nicht nur unter Soziologen – skeptisches Achselzucken auslöst. Dennoch ist die „Strategie“ der Dandies ohne Wahrheitsbegriff, ohne den Gedanken an einen Wahrheitsanspruch nicht zu verstehen. Denn es ist nicht nur der „Kult des Ichs“, „culte de soi-même“7, wie BaudelaireBaudelaire, Ch. sagt, der das Verhalten des Dandys erklärt, sondern auch und vor allem „le besoin ardent de se faire une originalité“8, von dem ebenfalls bei BaudelaireBaudelaire, Ch. die Rede ist. Es geht darum, mitten in der Tauschgesellschaft unverwechselbar zu sein, d. h. nicht dem subjekttötenden Mechanismus der Austauschbarkeit zum Opfer zu fallen: „Subjekt sein und die Identität des eigenen Subjekt-Seins fühlen“, würde KrležaKrleža, M. sagen. Diese kritisch-subjektive Komponente des Dandyismus, die sich gegen die Marktgesellschaft richtet und das Wahrheitsmoment des mondänen Ästhetizismus ausmacht, sollte nicht übersehen werden, zumal sie den Nexus von Subjektivität und Kritik zutage treten läßt.
Das Streben des Dandys nach Subjektivität und Originalität kann sich freilich nicht in reiner Idiosynkrasie erschöpfen; es setzt trotz aller Distinktions- und Distanzierungsversuche gesellschaftliche Anerkennung voraus. Dies ist Hiltrud GnügGnüg, H. aufgefallen: „Das heißt, seine Originalität, sein Wille zur Andersartigkeit, macht den Dandy zwar zum Außenseiter, aber die subtile Weise, in der er diese ausdrückt, läßt ihn für die Gesellschaft akzeptabel bleiben.“9 Vom vulgären Snob, dem nichts wichtiger erscheint, als in die von ihm bewunderte Bezugsgruppe (reference group) aufgenommen zu werden, unterscheidet sich der Dandy durch sein Selbst-Bewußtsein, d. h. durch eine kritisch-reflexive Einstellung zur eigenen Subjektivität, die ihn den anderen als überlegen erscheinen läßt: „Die ‚éternelle supériorité du Dandy‘, von der BaudelaireBaudelaire, Ch. spricht (…), liegt in der Überwachheit eines Bewußtseins, das sich zum Beobachter des fühlenden, denkenden Ichs macht.“10
Der grundsätzliche Widerspruch des Dandyismus besteht darin, daß seine Protagonisten einerseits von Distinktion und Distanz leben, andererseits aber auf Kommunikation und die bewundernden Blicke der anderen angewiesen sind. Ja, sie leben geradezu von der Kommunikation. Das Schlimmste, was einem Dandy widerfahren kann, ist eine Verbannung in die Provinz, in der niemand sein Auftreten und seine Konversation goutiert. Er verdankt seine – in jeder Hinsicht – narzißtische Subjektivität der mondänen Kommunikation. Von ihr sagt aber AdornoAdorno, Th. W.: „Denn Kommunikation ist die Anpassung des Geistes an das Nützliche, durch welches er sich unter die Waren einreiht, und was heute Sinn heißt, partizipiert an diesem Unwesen.“11 Hier wird die Sackgasse des Dandyismus sichtbar: Durch seine Abhängigkeit von der mondänen Nachfrage, durch sein Für-Andere-Sein liefert sich der Dandy dem Tauschprinzip der Marktgesellschaft aus, gegen das er revoltiert.
Zu Recht stellen deshalb FavardinFavardin, P. und BoüexièreBoüexière, L. fest, daß BaudelaireBaudelaire, Ch.als Schriftsteller zum Dandy nicht taugte: „BaudelaireBaudelaire, Ch. ist vor allem Dichter.“12 Der Dandy hingegen hat mit Dichtung als Produktion und Arbeit nichts im Sinn: „Die Kunst ist nur ein liebenswerter Zeitvertreib: Der Dandy verabscheut jede Art von Spezialisierung.“13 Nicht nur vor der Spezialisierung schrickt er zurück, sondern vor dem produktiven poein, dem kreativen Dasein.
In diesem wesentlichen Punkt unterscheiden sich die Schriftsteller der Spätmoderne vom Dandy. Anders als der mondäne Held, der von der Kommunikation lebt, erhoffen sie sich von der künstlerischen Produktion, die nur fernab vom mondänen Treiben möglich ist, eine Rettung der Subjektivität. Freilich würde man die modernistische Problematik grob verzerren, wollte man alle ihre Vertreter als Verfechter einer Kunstideologie verstehen. Weder D.H. LawrenceLawrence, D. H. noch James JoyceJoyce, J., weder CamusCamus, A. noch SvevoSvevo, I. sind im Rahmen einer solchen Ideologie interpretierbar.
Wichtige Autoren der Spätmoderne haben aber das Schicksal des individuellen Subjekts mit dem literarisch-ästhetischen Entwurf verknüpft. In ihren Augen erscheint eine Verwirklichung von Krležas programmatischem Ausruf nur jenseits der gesellschaftlichen Kommunikation möglich.
Sie brechen mit dem Realismus-Naturalismus des 19. Jahrhunderts, verabschieden sich vom mimetischen Projekt ihrer Vorgänger und fassen die Konstruktion einer mit der Wirklichkeit konkurrierenden ästhetischen Welt ins Auge, deren Entstehung sie kritisch-selbstkritisch reflektieren. Ihre Literatur ist einem reflexiven Konstruktivismus verpflichtet, dem zusammen mit der individuellen Subjektivität das anekdotische Erzählen der Klassik, der Romantik und des Realismus zum Problem wird.
Eines der wichtigsten Modelle dieser anbrechenden Spätmoderne (als Selbstkritik der Moderne) ist zweifellos Joris-Karl HuysmansHuysmans, J.-K.’ essayistischer Roman A Rebours (1884), dessen literarhistorische Zuordnung zum „Ästhetizismus“ („esthétisme“) nicht über seine Verwandtschaft mit ProustsProust, M.Recherche, MallarmésMallarmé, S. Dichtung und SartresSartre, J.-P.La Nausée hinwegtäuschen sollte. Zugleich erscheint HuysmansHuysmans, J.-K.’ existentielle Suche, die vom Naturalismus über den Ästhetizismus und den Satanismus (Là Bas, 1891) zum Katholizismus (La Cathédrale, 1898) verläuft, als eine modernistische Suche par excellence: eine recherche, die nicht nur ProustsProust, M. großen Roman ankündigt, sondern auch die Werke Joyces, Svevos, der Surrealisten und Existentialisten.
Wird A Rebours in diesem Kontext gelesen, so treten drei Komponenten des Romans in den Vordergrund: die soziale Isolierung und Vereinsamung des Subjekts (des Erzählers und seines Helden des Esseintes), die Suche nach einer ästhetischen Identität und die komplementäre Suche nach einer zeitgemäßen (modernen) Kunst.
Im ersten Punkt treffen sich Erzähler und Held mit dem Dandy. Während der Erzähler in einer personalen Erzählsituation in entscheidenden Augenblicken den Standpunkt seiner „Reflektorfigur“14 des Esseintes einnimmt, tritt mit des Esseintes ein Dandy als Romanheld auf den Plan, der, angeekelt von der mondänen Gesellschaft und der Erotik, mit der sozialen Welt bricht und sich in eine stark ästhetisierte, mit schönen Gegenständen ausgeschmückte Privatsphäre zurückzieht. Es scheint ein Konsens darüber zu bestehen, daß er dem Dandy und Dichter Robert de MontesquiouMontesquiou, R. de (1855–1921) nachempfunden ist, dem auch Marcel ProustsProust, M. Baron de Charlus wesentliche Charakterzüge verdankt.15
Erschöpfte sich der Roman in der Ästhetisierung der Wirklichkeit durch einen Dandy, so wäre er längst in Vergessenheit geraten. Seine Bedeutung besteht jedoch nicht in seinem „Ästhetizismus“ oder seiner „Dekadenz“, sondern in seiner modernistischen Fragestellung, die die erste Komponente (Isolierung des Dandy-Subjekts) mit den beiden anderen Komponenten (Suche nach der eigenen Identität, Suche nach einer zeitgemäßen Kunst) verknüpft. Die Ästhetisierung der Wirklichkeit (der Privatspähre) ist als Metapher für eine literarische recherche zu lesen, die auf intertextueller Ebene fortschreitet.
Denn des Esseintes umgibt sich in seinen vier Wänden nicht nur mit schönen, exotischen Objekten, sondern auch und vor allem mit Büchern, mit älteren und zeitgenössischen Texten, von denen manche ausführlich zitiert und kommentiert werden. Es ist sicherlich kein Zufall, daß er sein Augenmerk vor allem auf die Werke BaudelairesBaudelaire, Ch. und MallarmésMallarmé, S. richtet. Es handelt sich jedoch keineswegs um den Blick eines passiv genießenden Ästheten, sondern um den eines kreativen Künstlers. Dies ist François LiviLivi, F. aufgefallen, der des Esseintes’ (und indirekt HuysmansHuysmans, J.-K.’) Stellung zwischen den beiden Dichtern schildert: „Zwischen dem Subrealismus der Naturalisten und dem Surrealismus, den die Dichtung MallarmésMallarmé, S. ankündigt, wird der einzig begehbare Weg von BaudelaireBaudelaire, Ch. gewiesen, ‚denn jener war fast der einzige, dessen Verse unter ihrer prachtvollen Rinde ein wohltuendes und nahrhaftes Mark enthielten‘. (…) Wenn des Esseintes von einem neuen BaudelaireBaudelaire, Ch.-Werk träumt, so träumt er in Wirklichkeit von einer Lösung für den zeitgenössischen Roman.“16
Mit BaudelairesBaudelaire, Ch. Hilfe soll hier die Sackgasse des realistisch-naturalistischen Romans aufgebrochen werden: und zwar durch ein auf das Prosagedicht ausgerichtetes Sprachexperiment, aus dem ein Roman hervorgeht, der aus einigen wenigen Sätzen besteht („roman concentré en quelques phrases“)17 und wie MallarmésMallarmé, S. Dichtung alles Redundante rigoros tilgt. Ein solcher Roman ist utopisch – wie MallarmésMallarmé, S.Livre.
Aber diese ästhetische Utopie ist von der Suche des Subjekts nach seiner Identität nicht zu trennen. Gegen Ende des Romans (Kap. XIV) zeichnet sich eine Symbiose zwischen Subjektivität und literarischer Produktion ab, die in ProustsProust, M.Recherche und SartresSartre, J.-P.La Nausée intensiviert wird: „Il voulait, en somme, une œuvre d’art et pour ce qu’elle était par elle-même et pour ce qu’elle pouvait permettre de lui prêter; il voulait aller avec elle, grâce à elle, comme soutenu par un adjuvant (…).“18 Zwar geht es hier immer noch um die Suche des raffinierten und blasierten Lesers nach dem zeitgemäßen modernen Kunstwerk, das die Comédie humaine ersetzen könnte; zugleich spricht hier aber der Ästhet als Produzent und als Vorläufer ProustsProust, M. und SartresSartre, J.-P..
Der HuysmansHuysmans, J.-K. von A Rebours ist insofern ein Vorläufer ProustsProust, M., als er die unwillkürliche Erinnerung und deren Gegenstände antizipiert. Ein Briefbeschwerer setzt den Erinnerungsprozeß in Bewegung: „Ce presse-papiers remua, en lui, tout un essaim de réminiscences.“19 Er ist auch ein Vorläufer des jungen SartreSartre, J.-P., dessen antibürgerliche Gesellschaftskritik er zusammen mit dessen Existenzekel vorwegnimmt. Ähnlich wie in La Nausée werden die Bürger als „utilitaires et imbéciles“20 definiert. Wie in SartresSartre, J.-P. Erstlingsroman lösen Kontakte mit dem Natürlich-Weiblichen Ekelanfälle aus, die sich am Ende des achten Kapitels zu einem Alptraum verdichten.21 In dieser Hinsicht ist des Esseintes ein Erbe BaudelairesBaudelaire, Ch., der in „Mon cœur mis à nu“ in der Frau den Antipoden des naturfremden Dandy zu erkennen meint: „La femme est le contraire du Dandy. Donc elle doit faire horreur.“22 Zugleich erscheint er aber auch als Vorläufer Roquentins, der alles Natürliche und Weibliche mit der sinnlosen existence assoziiert.
Es zeigt sich hier, wie verschiedene Komponenten der modernistischen Problematik auf literarischer Ebene eine Einheit bilden: Naturfeindschaft, Misogynie, Ästhetizismus und die Erforschung des Unbewußten begleiten die Suche des männlichen Subjekts nach dem Kunstwerk, dem literarischen Schreiben, das seine Identität sichern soll. Auf den ersten Blick wird hier Hans Robert JaußJauß, H. R.’ These über die „Austreibung der Natur aus der Ästhetik der Moderne“23 bestätigt. Doch diese These wird der Komplexität der literarischen Spätmoderne nicht gerecht, der so „naturzugewandte“ Autoren wie NietzscheNietzsche, F., HesseHesse, h. und CamusCamus, A. angehören. André Gides Werk läßt erkennen, wie sehr asketische Naturfeindschaft (La Porte étroite) und Natureuphorie (L’Immoraliste, Les Nourritures terrestres) im Modernismus zusammengehören.
Auch Marcel ProustsProust, M.Recherche ist als „naturfeindlicher“ Roman nicht zu verstehen, denn sie knüpft nicht an die Naturallergie von A Rebours, sondern an die Experimente dieses Romans mit dem Unbewußten, mit der unwillkürlichen Erinnerung an. Wie sehr dieser Bereich des instinct artistique (ProustProust, M.) zur Grundlage einer neuen literarischen Subjektivität wird, zeigt sich in Le Temps retrouvé, wo der Erzähler mit Hilfe bestimmter onirischer Gegenstände (der „serviette empesée“, der „pavés inégaux“) seine Identität als Künstler findet. Das Ende des Romans ist dem Nachdenken über die Verbindung zwischen unwillkürlicher Erinnerung, künstlerischem Instinkt und künstlerischer Identität gewidmet: „Que ce fût justement et uniquement ce genre de sensations qui dût conduire à l’œuvre d’art, j’allais essayer d’en trouver la raison objective (…).“24 Dieser Grund ist in der Zufallsbedingtheit der unwillkürlichen Erinnerung zu suchen, die sich durch ihre Kontingenz dem Einfluß des kalkulierenden, räsonierenden Intellekts der mondänen Gesellschaft entzieht. Damit wird ProustsProust, M. Entdeckung der unbewußten Grundlagen von Kunst und Literatur zum Ausgangspunkt seiner Gesellschaftskritik: Die mondäne Gesellschaft, die nur den brillanten Intellekt des Causeurs gelten läßt, muß zwangsläufig den Künstler verkennen, der im Gegensatz zum Dandy die Einsamkeit sucht: „Silence contact avec/soi-même“25, heißt es in ProustsProust, M. nachgelassenen Schriften, wo auch zwischen den authentischen „Ecrivains solitude“ und den falschen „Ecrivains société“26 unterschieden wird.
Wie ProustsProust, M.littérature richtet sich auch das Schreiben des jungen SartreSartre, J.-P. gegen die bürgerliche Gesellschaft, die schon in A Rebours als „utilitaristisch“, „korrupt“ und „verdummt“ gegeißelt wird. Wie HuysmansHuysmans, J.-K.’ und ProustsProust, M. Erzähler wendet sich SartresSartre, J.-P. Ich-Erzähler Antoine Roquentin von der bürgerlichen Gesellschaft ab, um im ästhetisch-literarischen Bereich eine Identität zu finden. Auf die Frage, ob es möglich sei, seine Existenz zu rechtfertigen, antwortet er mit einem fiktionalen Entwurf, der über der Wirklichkeit der nicht zu rechtfertigenden, kontingenten existence der Bürger von Bouville liegt. Von der Geschichte, die er jenseits der sozialen Wirklichkeit erfinden will, sagt er: „Il faudrait qu’elle soit belle et dure comme de l’acier et qu’elle fasse honte aux gens de leur existence.“27
Von ProustsProust, M. Erzähler unterscheidet sich Roquentin wesentlich durch seine Ablehnung von Zufall, Kontingenz und Natur, die er mit der negativ konnotierten existence assoziiert. Mit ProustsProust, M. Erzähler meint er aber, im literarisch-fiktionalen Bereich die authentische Subjektivität zu finden, die dem Bürgertum von Bouville ebenso fehlt wie ProustsProust, M. mondäner Welt des Faubourg Saint-Germain. Mit HuysmansHuysmans, J.-K. und ProustProust, M. vertritt der junge SartreSartre, J.-P. die Ansicht, daß Literatur nicht realistisch-mimetische Wiedergabe ist, sondern Konstruktion im fiktionalen Sinn. Es geht nicht um die Wiedergabe von Wahrnehmung (perception), sondern um eine „Nichtigung“ der Welt, die ihre Rekonstruktion im Imaginären vorbereitet, um eine „constitution et néantisation du monde“.28
Entscheidend ist nun, daß diese Neukonstitution der Welt mit einer Selbstkonstruktion des Subjekts einhergeht. Ja, sie ist Grundlage dieser Selbstkonstruktion, die zum zentralen Anliegen der literarischen Spätmoderne als Selbstreflexion der Moderne wird. In einer gesellschaftlichen und sprachlichen Situation, in der alle tradierten Werte von der Ambivalenz und vom „Zerfall der Werte“ (BrochBroch, H.) erfaßt werden, erscheint eine Rekonstruktion der Wertskala als Selbstkonstruktion des Subjekts vielen als der einzige Ausweg. Freilich kann diese Rekonstruktion auch einen politischen (BrechtBrecht, B., MalrauxMalraux, A.) oder religiösen (BernanosBernanos, G., ClaudelClaudel, P.) Charakter annehmen und weit über den ästhetischen Bereich hinausgehen; aber die Selbstsuche als literarisch-ästhetische Suche ist für den Modernismus besonders charakteristisch. Wenn nicht die Kunst als solche, so wird doch das Schreiben immer wieder zur Grundlage schriftstellerischer Subjektivität.
Von Italo SvevoSvevo, I. kann sicherlich nicht behauptet werden, er habe Sinn, Subjektivität und Identität mit dem Schicksal der Kunst liiert. Aber auch sein Ich-Erzähler Zeno sagt schließlich einer als inauthentisch empfundenen sozialen, familiären und psychoanalytischen Wirklichkeit ab, um sich dem Schreiben zuzuwenden: „Per rimpiazzare la psico-analisi, io mi rimetto ai miei cari fogli.“ („Um die Zeit auszufüllen, die sonst der psychoanalytischen Behandlung gewidmet war, widme ich mich von neuem meinen geliebten Blättern.“)29
In dem hier konstruierten Kontext erscheint es keineswegs als Zufall, daß die Psychoanalyse vom Schreiben abgelöst wird. Denn die parole pleine oder parole vraie, die nach LacanLacan, J. am Ende der Behandlung ertönen sollte30, scheint eher ein Privileg des neurotischen Dichters zu sein. Die Psychoanalyse hingegen wird von Svevos Erzähler mit einer abenteuerlichen Waldwanderung verglichen, während der wir nicht wissen, ob wir einem Räuber oder einem Freund begegnen werden. Beides ist stets möglich, und die von der Ambivalenz geprägte Psychoanalyse zeugt – wie Svevos Roman – von der Krise des sozialen Wertsystems und des Wertbewußtseins des Subjekts. Dieses versucht schließlich, im Schreiben, in der literatischen Produktion, eine neue Identität zu finden.
Auch in Virginia WoolfsWoolf, V.Orlando-Roman, dessen Hauptthema die konstitutive Ambivalenz des androgynen Subjekts ist, steht das literarische Schreiben am Ende einer essayistischen Identitätssuche, die den anekdotischen Aufbau des realistischen Romans als nebensächlich erscheinen läßt. Orlando verzichtet (wie MusilsMusil, R. Ulrich) auf die vita activa und setzt ihr/sein Leben im Imaginären fort. Die Erzählerin stellt diesen Abschied vom anekdotischen Romandiskurs ironisch dar: „If then, the subject of one’s biography will neither love nor kill, but will only think and imagine, we may conclude that he or she is no better than a corpse and so leave her.“31 Aus modernistischer Sicht gibt es aber Wichtigeres als das „wahre Abenteuer“ des 18. oder 19. Jahrhunderts: „It was her manuscript. ‚The Oak Tree‘.“32 Wie in ProustsProust, M. Text Le Temps retrouvé (1927), der ein Jahr vor Orlando erschien, zeichnet sich am Ende von WoolfsWoolf, V. Roman im literarischen Schreiben eine Alternative zur kommerzialisierten sozialen Wirklichkeit und vor allem zum Literaturbetrieb ab: „She was reminded of old Greene getting upon a platform the other day comparing her with Milton (save for his blindness) and handing her a cheque for two hundred guineas. She had thought then, of the oak tree here on its hill, and what has that got to do with this, she had wondered? What has praise and fame to do with poetry?“33 Nicht der vom Dandy begehrte bewundernde Blick der anderen erscheint hier wesentlich, sondern das Schreiben, das zur Grundlage des spätmodernen Subjekts wird.
Dieses Schreiben ist jedoch alles andere als apolitisch, wie die Romane ProustsProust, M., MusilsMusil, R. und WoolfsWoolf, V. zeigen. Es ist nicht nur gesellschaftskritisch, weil es sich gegen die entstehende Kulturindustrie, gegen Ideologie und Herrschaft wendet, sondern auch deshalb, weil es ein Jenseits der bestehenden Verhältnisse anpeilt. In A Rebours geschieht dies gleichsam ex negativo, etwa wenn des Esseintes einem unerfahrenen Burschen die Lust der käuflichen Liebe finanziert in der Hoffnung, aus ihm einen Feind der Gesellschaft zu machen: „un ennemi de plus pour cette hideuse société qui nous rançonne“.34 Als Alternativen erscheinen später der Satanismus von Là-Bas und schließlich der Katholizismus von La Cathédrale.
Doch es gibt andere Lösungen: etwa die des Surrealismus, der Politik und Ästhetik auf explosive Art zusammenführt. Mit HuysmansHuysmans, J.-K.’ scheinbar apolitischem „Ästhetizismus“ verbindet ihn die modernistische Ablehnung einer bürgerlich-utilitaristischen Gesellschaftsordnung. Diese Ablehnung läuft bei André BretonBreton, A. auf eine spätmoderne Reflexion der neuzeitlichen Entwicklung hinaus, die den Surrealisten als Erben der Romantik mit Unbehagen erfüllt: „Ce monde dans lequel je subis ce que je subis (n’y allez pas voir), ce monde moderne, enfin, diable! que voulez-vous que j’y fasse?“35
Hier wird deutlich, wie sehr Astradur EysteinssonEysteinsson, A. recht hat, wenn er die surrealistische Avantgarde als Bestandteil der modernistischen Problematik auffaßt: Weit davon entfernt, sich „schroff vom Modernismus abzuheben“ wie FokkemaFokkema, D. W. meint (s. o.), ist Bretons Surrealismus ein „nach außen gekehrter“ MallarméMallarmé, S. oder ProustProust, M.. Während diese beiden Dichter im „einsamen Schreiben“ die einzig adäquate Antwort auf frühe Kulturindustrie und mondäne Kommunikation erblickten und die authentische Subjektivität mit der literarischen Produktion identifizierten, meinten die Surrealisten, in der Politisierung der Kunst die richtige Antwort auf die spätmoderne Problematik zu erkennen. In dieser Hinsicht sind sie Geistesverwandte BrechtsBrecht, B., der sich als Marxist unter „politischer Kunst“ freilich etwas anderes vorstellte als BretonBreton, A. oder SoupaultSoupault, Ph..
Wenn Scott LashLash, S. unbekümmert feststellt: „I take the avant-garde of the 1920s to be postmodernist“36, so setzt er sich über die Tatsache hinweg, daß die Surrealisten – ähnlich wie MallarméMallarmé, S., ProustProust, M., SartreSartre, J.-P. oder WoolfWoolf, V. – die individuelle Subjektivität im literarischen Schreiben verankern wollten, während die postmoderne Literatur die Frage nach dem Subjekt entweder negativ beantwortet (das Subjekt als Einheit gibt es nicht) oder gar nicht stellt. Er übersieht ferner, daß die Surrealisten die bei MallarméMallarmé, S., HuysmansHuysmans, J.-K., ProustProust, M. oder WoolfWoolf, V. implizite oder resignierende Gesellschaftskritik offen und auf militante Art gegen die Gesellschaft („société qui nous rançonne“, HuysmansHuysmans, J.-K.) wenden. Die Dichtung wird zur revolutionären Kraft. Von ihr sagt BretonBreton, A.