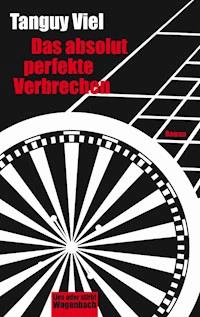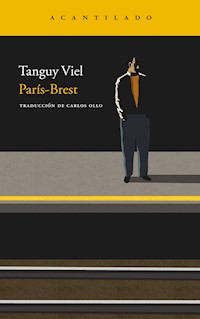Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Max Le Corre war in jüngeren Jahren ein bekannter Boxer. Er konnte einstecken und austeilen; schenken ließ er sich nichts. Heute arbeitet er als Chauffeur, und eines Tages wagt er es, den Bürgermeister um einen kleinen Gefallen für seine Tochter Laura zu bitten. Laura, bildschön und Anfang zwanzig, ist wieder in die Bretagne zurückgekehrt. Nun braucht sie erstens eine Wohnung und zweitens einen Job. Dass der Bürgermeister persönlich bei seinem alten Freund im Casino ein gutes Wort für sie einlegt, bleibt nicht folgenlos. Ihr Vater Max, einst französischer Boxmeister, steigt nach Jahren wieder in den Ring. Es sind noch einige alte Rechnungen offen in der kleinen bretonischen Stadt am Meer, in der diese Tragödie um Sex und Macht, Schicksal und Gerechtigkeit die Figuren unausweichlich zu Dominosteinen macht. Als Laura Monate später den nun ehemaligen Bürgermeister schließlich anzeigt, ist das Urteil längst gesprochen. Denn: Sie wollte es doch auch … Tanguy Viel macht ein brutales, aktuelles Thema konkret, indem er es in die Provinz verschiebt. Er vergrößert, indem er verkleinert. Sein einzigartiger Stil erzwingt eine beunruhigende Untergrundspannung, fokussiert genau, lässt Bewegungen und Blicke sprechen. Ein Roman über Ohnmacht und Macht, ein stilistisches Kunstwerk, ein politisches Statement.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die französische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel unter dem Titel La fille qu’on appelle bei Les Éditions de Minuit in Paris.
Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des Institut français und des französischen Außenministeriums, vertreten durch die Kulturabteilung der Französischen Botschaft in Berlin.
E-Book-Ausgabe 2022
© 2021 by Les Éditions de Minuit
© 2022 für die deutsche Ausgabe:
Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung Julie August unter Verwendung einer Fotografie © Jaroslaw Blaminsky / Trevillon Images.
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 9783803143358
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 3345 8
www.wagenbach.de
ERSTER TEIL
1
Niemand hat sie gefragt, wie sie an jenem Tag gekleidet gewesen war, aber ihr lag daran, zu betonen, dass sie überhaupt nur weiße Sneaker besaß, dafür aber seit dem frühen Morgen darüber nachgedacht hatte, welcher Rock oder welche Jeans für den Anlass passten, aber auch, dass sie brillantroten Lippenstift tragen würde. Da saß sie dann vor dem Café Univers, auf dem großen Platz, Fußgängerzone mitten in der Altstadt, hinter ihr war in übergroßen Lettern weit oben an der Wand das Wort RATHAUS zu lesen, noch höher oben als die Trikolore, die in der lauen Luft ruhte wie ein eingeschlafener Wachsoldat. Bald würde sie durch das große Portal gehen und den gepflasterten Innenhof queren, der zum Schloss führte, zum früheren, schon lange als Rathaus genutzten Schloss, obwohl das für sie, so würde sie sagen, auf dasselbe rauskam: Ob sie vom Bürgermeister erwartet werde oder vom Gutsherrn, das mache in ihrem Kopf keinen Unterschied — dieselbe fiebrige Erregtheit, dasselbe gewisse Herzklopfen angesichts der großen Eingangshalle, die sie zum ersten Mal betrat, beinah überrascht, dass die Automatiktür sich beim Näherkommen öffnete, als hätte sie eine Zugbrücke erwartet, die sich über einen Burggraben senkte, und als hätte sie mit einem Soldaten im Kettenhemd zu tun und nicht mit einem schwarz gekleideten Wachmann. So ist das in dieser Stadt, man könnte meinen, die Jahrhunderte seien an den Mauern vorübergeglitten, ohne sie je zu verändern, ebenso wenig wie das Meer, das jeden Tag zweimal gegen sie anrennt und dann seinerseits aufgibt und sich zurückzieht, geschlagen, wie ein Hund mit eingeklemmtem Schwanz.
Sie saß weiter vor dem Univers, natürlich war sie zu früh dran, noch Zeit für einen Kaffee und um die Zeitung zu lesen, den Ouest-France, also nicht wirklich zu lesen, sondern eher die Überschriften und Farbfotos zu überfliegen, und dann doch auf der Sportseite hängenzubleiben und nachzuschauen, ob sich da vielleicht ein Artikel über ihren Vater fand, den Boxer — ihn, der trotz seiner stattlichen vierzig jüngst den fünfunddreißigsten Sieg errungen hatte; unaufhörlich rühmte die Lokalpresse die Langlebigkeit seiner Karriere, um nicht zu sagen, seine Wiedergeburt — ja, Wiedergeburt, das war das Wort, das sie freigebig verwendeten, seit Max Le Corre wieder ganz oben auf den Plakaten stand, von denen er eine Weile lang verschwunden war —, deshalb würde sie sicher lächeln, wenn sie das x-te Foto von ihm sähe, im Ring, die Arme hochgereckt, dazu die fette, in die Zukunft strahlende Überschrift, »Wird er wieder übers Wasser wandeln?« Dann schaute sie auf ihrem Telefon nach der Uhrzeit, schlug die Zeitung zu, legte zwei Euro auf die Untertasse und stand auf. Ein letzter prüfender Blick auf sich selbst in der großen Fensterscheibe des Cafés, sie war sicher, würde sie später sagen, dass sie eine gute Wahl getroffen hatte, diese schwarze Lederjacke, die über ihrer Hüfte endete, darunter das recht körperbetonte Wollkleid, der Wind fuhr nur gerade so zwischen die Maschen, wenn sie an dem Stoff zupfte.
Ja, sagte sie zu den Polizisten, das überrascht Sie vielleicht, aber ich fand das eine gute Wahl, das und die weißen Sneaker, die wir Zwanzigjährigen alle haben, so dass keiner erkennt, ob ich Studentin bin oder eine Krankenschwester oder eben das Mädchen, das man ruft.
Das Mädchen, das man ruft?, fragte einer der beiden.
Ja, so heißt es doch? Call girl? Sie lachte nervös, nachdem sie das gesagt hatte, weder der eine Polizist lachte noch der andere, der eine mit verschränkten Armen, der andere etwas zu ihr vorgebeugt, aber beide wie auf der Lauer nach jedem Wort, das sie gebrauchte, sie schienen sie wie eine exotische Frucht auf einer Lebensmittelwaage abzuwägen.
Dann nahm sie ihren Bericht wieder auf, wie sie den Wachmann am Eingang fragte, wo sich das Büro des Bürgermeisters befinde, nicht darauf gefasst, dass der Mann marmorstatuenhaft unbewegt bleiben und nichts tun würde, als mit einer Kopfbewegung auf den großen Tresen hinten in der Halle zu deuten und den Blick fast automatisch über ihre Gestalt wandern zu lassen, von Kopf bis Fuß. Daran war sie gewöhnt: Die Blicke der Männer verweilten auf ihr, sie nahm das schon lange gar nicht mehr wahr, ganz einfach wegen der tausend Gelegenheiten, bei denen sie feststellen konnte, wie attraktiv sie wirkte, wegen ihrer Größe vielleicht oder wegen ihrer dunklen Haut, egal, sie wusste es schon lange, und die eigene Anziehungskraft war ihr gleichgültig — an diesem Tag genauso wie sonst, das anliegende Kleid bedeckte also ihre Knie nicht, an den Füßen die Sneaker, nicht mehr ganz so weiß wegen des abgeschabten Oberleders.
Am Empfang des Rathauses erklärte sie abermals, sie habe einen Termin beim Bürgermeister, ein wenig enttäuscht, dass niemand sie nach dem Zweck ihres Besuchs fragte, sie hätte geantwortet, es gehe um etwas Persönliches — ja, wirklich, sagte sie, die Frage hätte mir gefallen, nur damit ich antworten könnte: Es geht um etwas Persönliches. Doch niemand, weder oben an der breiten steinernen Treppe, die man sie hinaufwies, noch auch die schmächtige Sekretärin, die vor der Tür des Bürgermeisterbüros postiert war wie ein Schrankenwärter früherer Zeiten, niemand sollte sich nach dem Zweck ihres Besuchs erkundigen — wobei diese Sekretärin sich doch die nötige Verachtung oder auch Eifersucht anmerken ließ, um die Besucherin mit einem solchen Blick zu messen, falls dieses Wort hier denn passte, messen, wenn der Blick vom Kopf zu den Füßen runtersaust wie eine Guillotine.
Sie seufzte kurz, diese Sekretärin, wie eine Hausdame in einem hochherrschaftlichen Anwesen, die sich das Recht anmaßt, die Besucher, die man dort empfängt, zu beurteilen, dann geruhte sie sich zu erheben, öffnete die schwere Holztür, die sie zu bewachen schien, einen Spalt weit, steckte den Kopf hindurch und sagte: Ihr Termin ist da. Und auch Laura konnte es hören, die Männerstimme, mit der geantwortet wurde: Ah ja, danke, während die alte Sekretärin die junge Frau durch die Öffnung hindurchließ, durch den absichtlich schmalen Spalt zwischen Tür und Rahmen, als ob sie, die Jüngere der beiden, sich den Zugang erzwingen müsste, dieser Eindruck sollte sich jedenfalls für lange in ihr einprägen, ja, etwas in der Art, sagte sie, als ob ich zwar hineinging, aber sie mir nicht öffnete. Aber ich schwöre Ihnen, wenn ich sie dafür hätte wegschubsen müssen, fügte sie hinzu, ich hätt’s getan.
Und vielleicht wegen der plötzlich hochgezogenen Augenbrauen des Polizisten ihr gegenüber hielt sie es für richtig hinzuzufügen: Ich erinnere Sie daran, ich bin mehr oder weniger im Boxring groß geworden.
Und gewiss hatten die Männer den Eindruck, dass in diesem Satz ein Teil ihrer Geschichte steckte und damit die ganze Ruppigkeit dieser Kindheit, zugleich deutete die junge Frau bereits an, welch ein Abgrund sie von dem Mann da trennte, dem Typen mit dem Riesenbüro, und dass nichts, weder der kalte Empfang durch die Sekretärin noch die übertriebenen Ausmaße dieses Raumes, an ihre Welt, ihre eigene rühren konnte.
Nein, wirklich, sagte sie dann noch zu den Polizisten, in einer normalen Welt wären wir uns nie begegnet.
In einer normalen Welt … was ist für Sie denn eine normale Welt?, fragten die beiden Männer.
Ich weiß nicht … Eine Welt, in der jeder an seinem Platz bleibt.
Und während sie versuchte, sich diese Welt vorzustellen, diese normale, feststehende, in der jeder, einer mechanischen Figurine gleich, seinen eigenen maximalen Bewegungsradius hätte, verloren ihre Blicke sich in dem blauen Stoff der Jacke ihr gegenüber, und dann sprach sie unwillkürlich diesen aus der Tiefe aufgestiegenen Gedanken aus, sie sagte:
Meinem Vater schien so viel daran zu liegen.
2
Vielleicht wäre es besser gewesen, mit ihm zu beginnen, dem Boxer, wenn ich schon nicht weiß, welcher der beiden, Max oder Laura, zu diesem Bericht den Anstoß gegeben hat, aber ich weiß, ohne ihn, so viel ist sicher, hätte die junge Frau niemals die Schwelle des Rathauses überschritten, wäre noch viel weniger wie eine gerade erblühende Blume in dieses Bürgermeisterbüro getreten, aus dem einfachen Grund, dass er, ihr Vater, diese Begegnung betrieben, zunächst ihr gegenüber darauf gedrungen hatte, dann beim Bürgermeister selbst, denn er war dessen Fahrer. Seit drei Jahren schon kutschierte er ihn quer durch die Stadt, allmählich kannten sie einander ein wenig — der Bürgermeister vielleicht rund zehn Jahre älter als sein Fahrer, dessen Lächeln er tagein, tagaus im Rückspiegel sah, oder nicht wirklich Lächeln, eher die immer etwas besorgt zusammengekniffenen Augen, die seine, des Bürgermeisters, Aufmerksamkeit suchten, des stets hinten Sitzenden, der das so häufig nicht einmal bemerkte, weil er nur auf die draußen vorüberziehenden Fassaden oder erleuchteten Schaufenster blickte, als wäre es, da er der Bürgermeister der Stadt war, seine Schuldigkeit, sämtliche Häuser mit Blicken zu streifen, sämtliche Gestalten auf den Bürgersteigen, als ob sie ihm gehörten. Dass er wenige Monate zuvor wiedergewählt worden war, seine Konkurrenten sozusagen vernichtend geschlagen hatte auf dem Weg in seine zweite Amtszeit, hatte wohl nicht gerade zur Entwicklung einer demütigen Haltung beigetragen, die er ohnehin nie besessen hatte — jedenfalls hatte er nie eine Kardinaltugend daraus gemacht, sondern erkannte in seinem Erfolg vielmehr seine fleischgewordene Hartnäckigkeit, die er in Worte wie »Mut« oder »Verdienst« oder »Arbeit« kleidete, Worte, die er nach Lust und Laune in die tausend Ansprachen der letzten sechs Jahre eingestreut hatte, bei Grundsteinlegungen oder vor den Fernsehkameras, ohne dass man je hätte ermessen können, ob sie einem militanten Glauben entsprangen oder ein Selbstportrait sein sollten, Worte jedoch, aus denen man schon seit langem heraushören konnte, dass er seine Begehrlichkeiten sehr viel weiter richtete als auf seine jeweiligen Zuhörer, in der Hoffnung, dass der Widerhall seiner Worte bis nach Paris reichen möge, wo bereits das Gerücht umging, er habe das Zeug für ein Ministeramt. Und einer, der dieses Gesicht jeden Tag im Rückspiegel sah, brauchte kein Handbuch der Physiognomie, um genau diese Glut oder Entschlossenheit zu erkennen, unter den schwarzen, dichten und doch beinahe sanften Augenbrauen, die einen umso größeren Kontrast bildeten zu jenem kalten, verschlossenen Blick aller Machtmenschen. Im Laufe von drei Jahren hatte Max gelernt, sämtliche Nuancen und Brüche dieses Blicks aufzuspüren, oder eher nicht Brüche, sondern ganz bewusst gesetzte Öffnungen, da ja die Macht angeblich nicht auf Starre gründet, sondern stattdessen auf deren kalkuliert eingesetzter Aufweichung, wie ein unablässig eingesetztes Stockholm-Syndrom, wenn jede Aufweichung der Strenge im ergebenen Auge des Gegenübers eine Fallgrube aus falscher Sanftheit entstehen lässt, von verführerischem Sog.
Und soweit ich zu wissen glaube, war Max Le Corre ein geeignetes Opfer dieser Masche, wie ein Pferd, das dankbar ist, sobald man die Zügel etwas locker lässt, wozu noch die Schulden kamen, die er zu haben glaubte, denn dieser selbe Bürgermeister hatte ihn zu einer Zeit angesprochen und eingestellt, als Max, wie man so sagt, ganz unten war. Denn das hatte es in Max’ Leben auch gegeben: eine Welle zunächst, die ihn wie einen eleganten Surfer hoch auf ihrem Kamm trug, um ihn dann in den immer dunkleren zylindrischen Schatten zu werfen, ein Erlebnis, das noch Jahre später in seiner Erinnerung an die Oberfläche gespült wurde, wie ein Schattenspiel auf einer von sprühender Gischt vernebelten Windschutzscheibe, einerseits die strahlenden Jahre, in denen er sein Talent als Boxer ausgelebt hatte, andererseits die dunkleren Zeiten, die jene guten wie ein Gewitterhimmel überwölkten. Und er hoffte, über sie, die dunklen Jahre, eine dicke Wolldecke gezogen zu haben, die er nicht mehr anheben würde, wegen dieser langen Nacht ohne Boxen, die er durchlebt hatte, als die Lichter des Boxrings für ihn erloschen waren, die unsteten Lichter, schlimmer als ein Leuchtturm an einer Küste. Das kennen alle Boxer, dass der Ring etwas ist wie ein Leuchtturm, dessen Blinken man von der Brücke des Schiffes aus abzählt, um die Gefahr zu ermessen, und als sie dann kam, sah er sie nicht, die Gefahr, sondern ließ sich gegen die Klippen treiben, wie es beim Boxen häufiger geschieht als bei jedem anderen Sport: weil hier die Hell-Dunkel-Kontraste einer Laufbahn erschütternder sind als auf einem Gemälde von Caravaggio.
Überhaupt schon, dass es ihm gelungen war, wieder im Ring zu stehen und zu boxen wie in seinen besten Zeiten, konnte er kaum glauben, wenn er auf den Plakaten in der Stadt sich selbst erblickte, den großen Plakaten, die wie Alleebäume die vierspurigen Straßen säumten und den Schaukampf am kommenden 5. April ankündigten, vor sternenglitzernden Lichtern die Körperfotos der beiden Kontrahenten, die Hände auf Gesichtshöhe, alle Muskeln angespannt — er selbst mit kahl rasiertem Schädel, die Augenbrauen bereits in Richtung des Sieges gespannt, wie er die ganze Stadt mit seiner Wut oder seiner beherrschten Kraft herauszufordern schien, darunter in feurigen Lettern »Le Corre gegen Costa: Die Herausforderung!« Und wer abwechselnd das Plakat und den Mann am Steuer der Dienstlimousine betrachten würde, würde denken, ja, tatsächlich, das war er, Max Le Corre, die schiefe Nase, die von den Schlägen verunstalteten Lider, die glänzende Kopfhaut, genau derselbe Mann, der in wenigen Wochen den anderen Lokalmatador herausfordern würde, der ihm seit langem den Rang abgelaufen hatte.
Nicht mehr so lang hin, sagte der Bürgermeister.
In zwei Monaten um die Tageszeit, sagte Max, steh ich auf der Waage.
Dann jetzt bloß nicht zunehmen, bemerkte der Bürgermeister.
Abnehmen aber auch nicht, antwortete Max.
Und wieder einmal beschworen sie seine letzten Siege herauf, die enorme Freude, mit der er, der Bürgermeister, Max mehrmals den Gürtel des Siegers überreicht hatte, die enorme Freude, hatte er jedes Mal gesagt, zu Ehren eines echten Sohnes der Stadt zu sprechen, der hier zu dem geworden war, der er jetzt war, vor dem restlos begeisterten Saal das zu sagen! Sie alle so stolz auf ihre Verbindung zu einem, der immer hier gelebt hatte, in einem eher unauffälligen Viertel am Stadtrand, dessen Ruhm aber ein wenig in allen Fenstern sämtlicher Wohnblocks zu glitzern schien, wo jene lebten, die ihm in seiner Kindheit begegnet waren, auf den Bänken zwischen den Häusern, im Treppenhaus und dann natürlich im Boxclub, dessen schwere Metalltür sie alle mindestens einmal aufgedrückt hatten, sie alle hatten im Ring die Handschuhe übergestreift, um sich einen Augenblick lang zu fühlen wie Mike Tyson. Und dort, wo Hunderte vergebens darauf gehofft hatten, es würde irgendwann mal einer hinter einem Pfeiler verborgen sie beobachten und mit dem Finger auf sie deuten, wie wenn ein unsichtbarer Gott seine Propheten erwählt, dort war nur einer von ihnen unvermittelt erwählt und wie mit einem Baukran über das gewöhnliche Leben hinausgehoben worden — und das war Max Le Corre.
Denn man musste kein großer Gelehrter sein, um zu erkennen, dass hier, in Max’ schwerem und gespanntem Körper, eine das übliche Maß überragende Kraft ruhte, so dass es gar nicht ein so großes Wunder war, als eines Tages ein Mann im weißen Anzug, der sich plötzlich zum Manager berufen sah, die kleine Trainingshalle betrat, in der Max seine Partner so leichthändig zu Boden schickte, und wo dieser Mann beschloss, sich um seine Karriere zu kümmern, die ihn schnell an die nationale Spitze brachte, so dass Max bald den Titel einheimsen konnte, auf den Pokal graviert, der immer noch auf seinem Kaminsims thronte, »Französischer Meister 2002, Halbschwergewicht«. Fünfzehn Jahre später, in so fortgeschrittenem Alter, staunte er natürlich darüber, erneut in der Presse Wörter wie »Wiedergeburt« oder sogar »Auferstehung« zu lesen — Auferstehung, ja, das war das andere Wort, das manchmal in den Zeitungen stand und das er auch nicht lieber hörte als »Wiedergeburt«, denn beide mit Bedacht gewählten Wörter verursachten denselben Luftzug hin zum Abgrund, der ihnen vorausgegangen war.
Wenn mir einer gesagt hätte, dass ich mit vierzig noch boxen werde, sagte er zum Bürgermeister.
Es heißt ja, antwortete der Mann auf der Rückbank, der immer noch nach draußen schaute, Boxen wäre vor allem eine Kopfsache.
Und den Blick fest auf die Straße gerichtet, verzog Max unmerklich den Mund, was vielleicht bedeuten mochte, »Wenn ich dir eine verpasse, wirst du schon sehen, was das mit dem Kopf macht« — aber so unmerklich, mit beinahe innerlich geschürzten Lippen, dass sein Schweigen zugleich als Zustimmung gelten konnte, denn natürlich hatte der Bürgermeister recht, Boxen ist vor allem eine Kopfsache, beim Boxen geht es um Nerven und mentale Stärke, ja, da würde Max als letzter das Gegenteil behaupten.
Jedenfalls ganz schön mutig, Costa herauszufordern, setzte der Bürgermeister wieder an.
Jetzt oder nie, antwortete Max, die Zeit spielt nicht für mich. Womit er recht hatte, denn der Boxsport war in seinem Alter, jedenfalls empfand er das so, wie ganz spät im Winter auf einem zugefrorenen See Schlittschuh zu laufen, und trotz seiner Siege täuschte er sich nie über den dünnen Eisfilm hinweg, auf dem er sich weiterbewegte, wo er ohne Angst immer noch die heikelsten Figuren vollführte, aber bereits ergeben damit rechnete, dass das Eis eines Tages unvermittelt brechen und er im allzu kalten Wasser ertrinken würde.
Sie werden gewinnen, Max, da bin ich ganz sicher.
Und da nutzte Max den Augenblick, in dem er die Aufmerksamkeit des Bürgermeisters zu haben schien, und sagte endlich, was ihm seit Tagen im Kopf herumging und was er heute ansprechen wollte, das hatte er sich beim Aufstehen vorgenommen, es hatte nichts mit Boxen zu tun, nein, es ging um seine Tochter, er wollte dem Bürgermeister etwas zu seiner Tochter sagen: Herr Bürgermeister, ich wollte Sie um einen kleinen Gefallen bitten, es geht um meine Tochter, sie ist hierher zurückgezogen und …
Ja, selbstverständlich, sagen Sie ruhig.
Also, es ist so, sie hat sich beim städtischen Wohnungsunternehmen beworben, aber Sie wissen ja, wie das ist, das dauert seine Zeit, da habe ich gedacht, vielleicht, wenn es von Ihnen kommt …
Und der Bürgermeister hatte ihm erspart, sich noch weiter erklären zu müssen, hatte seine Bitte abgeschnitten:
Selbstverständlich, Max, sagen Sie ihr, sie soll bei mir im Rathaus vorbeischauen, ich werde sehen, was ich tun kann.
Und während sich der Wagen an den alten Masten und Segeln vorbeibewegte wie an einem Freiluftmuseum, hatte Max innerlich aufgeatmet, als würde er aus einem Prüfungssaal kommen, mit dem Gefühl, bestanden zu haben, zugleich sagte er immer wieder zu dem Mann auf der Rückbank, es sei wirklich sehr freundlich von ihm, sie zu empfangen, er sei nicht verpflichtet, das für ihn zu tun, während dieser selbst, der Mann auf der Rückbank, unterdessen seine Krawatte zurechtrückte oder seine Jackenärmel abklopfte und Max antwortete, nicht doch, in einem gewissen Sinn gehöre das zu seinen Pflichten, dafür sei er ja gewählt worden, um Dienst zu leisten. Und Max hoffte, es würde gut gehen. Sie würde der Situation gewachsen sein. Das sagte er später, Max, dass er diesen Satz gedacht hatte: Ja, es ist wahr, ich hoffte, sie würde der Situation gewachsen sein.
3
Dass sie der Situation gewachsen war, wird man wohl annehmen können; als jedenfalls die Tür hinter ihr zugefallen war und sie vor dem Bürgermeister stand, konnte auch er sich nicht dieses typischen vertikalen Blicks von oben nach unten auf ihre Gestalt enthalten. Aber das beachtete sie gar nicht, abgelenkt durch die immensen Ausmaße des überaus luxuriösen Büros, in dem sie jetzt stand. Kurz kam sie sich vor wie im Amtssitz des Staatspräsidenten oder etwas in der Art, wegen all der alten Sessel und der mittelalterlichen Wandteppiche mit Jagdszenen, wegen des wuchtigen Schnitzwerks an der bunt bemalten Kassettendecke, denn in Frankreich ist es ja so, in den Amtszimmern der Bürgermeister lebt das Ancien Régime fort. Er hatte eben noch auf seinem Ledersessel gesessen, schon stand er auf, bahnte sich einen Weg zwischen den alten Möbeln hindurch, um sie zu begrüßen und ihr die Hand zu drücken, im selben Schwung sagte er: Bonjour Laura! Geht es Ihnen gut?
Ja, als ob wir uns seit Adam und Eva kennen würden, sagte sie, er hat mich gleich beim Vornamen genannt. Sie war ihm kaum jemals begegnet, vielleicht irgendwann mit ihrem Vater, aber noch vor seiner Zeit als Bürgermeister, jedenfalls erinnerte sie sich nicht daran. Aber vielleicht trat er aller Welt so entgegen, vielleicht bedachte er alle Welt mit diesem Lächeln und sprach alle mit dem Vornamen an, wie ein Entgegenkommen, das für ihn mit seinem Amt einherging, damit zwischen ihm und ihnen, den Bewohnern, den Bürgern, den Verwalteten, nie ein tieferer Graben bestehe als die Verantwortung, die man ihm ganz und gar vorübergehend übertragen hatte. So etwas hätte er jedenfalls zu ihr sagen können, wortwörtlich — und vielleicht auch, weil nichts ihn so sehr erfüllte wie diese Empfindung, sich zum normalen Leben herabzulassen, sofern das normale Leben in seinen Augen die indifferente Masse der Menschen war, will heißen derer, die er selber »die Menschen« nannte und es seit seiner Wahl als seine Rolle ansah, »die Menschen« zu kennen, sie zu lieben, glauben zu machen, dass er sie liebte, es sei denn, ja, auch das war möglich, dass er vor allem sich selbst liebte, wenn er sie liebte.
So was in der Art wird sie wohl gespürt haben, Laura, der ihre Klarsicht nie ganz verloren ging, und auch, wenn sie seit dem Vortag darüber nachgrübelte, was sie sagen oder wie sie sich kleiden würde, auch wenn etwas in ihr so zitterte wie ein kleines Mädchen, das zum Schuldirektor beordert worden ist, wusste sie doch sehr gut, dass er, als er an diesem Morgen aufgestanden war, seine Agenda für den Tag nicht einmal kannte. Und ganz sicher lag es daran, dass sie beide sich von Anfang an nicht auf Augenhöhe begegneten, sie, Laura Le Corre, zwanzig Jahre alt, Studentin, und er, Quentin Le Bars, achtundvierzig Jahre, Bürgermeister der Stadt.
Studentin?, fragte der Polizist.
Ja, das heißt nein, also das habe ich zu ihm gesagt, Psychologiestudentin, Masterstudiengang Psychologie, ich hab gefunden, das klingt gut, vor allem war es glaubwürdig, für Psychologie hab ich mich immer interessiert. Sie rutschte auf ihrem Stuhl nach hinten: Das bedeutet ja aber nicht, dass man besser durchblickt, nicht wahr?
Er, derjenige der beiden Polizisten, der sie mehr als der andere zu verstehen suchte und ihren Bericht in geschriebene Sätze umzuformulieren hatte, mit einem Auge bei ihr, dem anderen auf der Tastatur seines Computers, er also unterbrach sie einfach, statt, wie es möglich gewesen wäre, weiter über das eben Gesagte nachzudenken:
Mit anderen Worten, Sie haben gelogen?