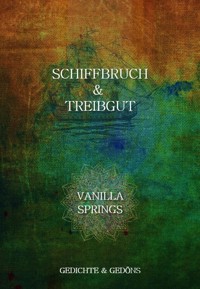1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein junger Mann befindet sich auf dem Weg zu seiner Freundin. Während der Zugfahrt hat er Gelegenheit, die Anfänge ihrer Beziehung Revue passieren zu lassen. Als die Vergangenheit in seinem Kopf wieder zum Leben erwacht, beginnt in ihm ein Gedanke zu reifen, dessen Tragkraft er sich bis zum Ende nicht einzugestehen traut. Vor der Tür seiner Freundin angekommen, trifft er eine Entscheidung, die ihr beider Leben von einem auf den anderen Moment auf den Kopf stellen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Vanilla Springs
Das Mammut unter dem Teppich
Inhaltsverzeichnis
Teil I: Die alte Leier von der jungen Liebe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Teil II: Das Mammut unter dem Teppich & Teil III: Im Fadenkreuz des Wohlwollens
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Impressum
Teil I: Die alte Leier von der jungen Liebe
1
Es gibt ein schmales Zeitfenster im Leben, in dem man es sich erlauben kann, altklug zu sein. In dem es einem nicht nur gestattet wird, sondern manchen geradezu Bewunderung abringt, wenn man die einfachen Wahrheiten des Lebens auf der Zunge trägt. In dem einem fatale Verfehlungen als Jugendsünden verziehen werden. Doch wie alles hat auch dieses Dasein ein Ablaufdatum. Es gibt einen Kipppunkt, an dem Du bist sehr weit für dein Alter von einem Kompliment zu einer Beleidigung wird.
Ich habe diesen Kipppunkt noch nicht erreicht.
Ich befinde mich gerade in jenem schmalen Zeitfenster.
Ich muss es nutzen.
2
Ich habe mich immer in eine Emily verlieben wollen und so ist es dann auch gekommen. Vielleicht habe ich mich vielmehr in die Idee einer Emily verliebt. Den Anteil ihres Namens an meiner Verliebtheit kann ich nicht bemessen. Ich bin froh, dass ich nicht danach gefragt werde.
Ihre Eltern haben ihr den Namen gegeben, weil sie jemanden wollten, der sich zu einer Emily entwickelt. Wer sieht als Baby schon aus wie eine Emily? Wessen fötale Ausstrahlung verschafft den Eltern die Eingebung, dass es ohne Zweifel eine Emily und nur eine Emily werden kann? Nein, es ist eine bewusste Entscheidung der Eltern gewesen: Dieses Mädchen sollte sich wie eine Emily verhalten und später sollte aus diesem Mädchen eine Frau werden, die von sich behauptet, in ihrem tiefsten Wesenskern eine Emily zu sein.
Ich sitze im Zug. Ich bin auf dem Weg zu ihr. Ich habe ein Buch im Gepäck, doch ich bin zu lustlos. Zu lustlos es auszupacken. Zu lustlos, mich auf ein Leben einzulassen, das nicht das meine ist.
Doch andere Leben dringen permanent in das eigene ein. Im Zug gilt dies im Besonderen. Sei es durch Gespräche von anderen Fahrgästen oder die Geschehnisse in der Welt, die auf den Bildschirmen im Zug nach Aufmerksamkeit gieren.
Es erscheint ein Bild: Ein Altrocker nimmt das Bundesverdienstkreuz entgegen. Die Rebellion gegen das Bürgertum hat sich längst eingebürgert. Man ist solange gegen das System, bis es einem Preise verleiht.
Wäre Emilys Vater hier, so hätte er an der Aufregung, die ihm dieses Bild bescheren würde, seine helle Freude. Oft schon hat er die Ikonen seiner Jugend in Gesprächen mit mir gestürzt. In Gedanken an seine ehemaligen Idole, von denen der Mann auf dem Bildschirm eines gewesen ist, spricht aus Emilys Vater nurmehr die Enttäuschung. Sie seien müder geworden, balladiger, meint er. Sie bemühten sich zu betonen, endlich angekommen zu sein. Im Leben. Doch nichts langweiligeres könne es geben als einen zufriedenen Künstler. Ein Hauch von Groschenroman wehe nun durch ihre Songtexte. Wenn sie sich früher zuweilen im Ton vergriffen, so vergriffen sie sich heute am Wort. Und in einem muss ich ihm zustimmen: Hässliche Worte für schöne Dinge zu finden, ist unverzeihlich.
Im Gegensatz zum landläufigen Klischee der anstrengenden Schwiegereltern verstehe ich mich mit Emilys Eltern hervorragend. Sie sind weder zu verklemmt und formell im Umgang, noch versuchen sie betont locker zu sein. Ich unterhalte mich gern mit ihnen, verbringe gern Zeit mit ihnen und ihrer Tochter.
Auf dem Bildschirm im Zug reihen sich nun in völliger Gleichgültigkeit weitere Nachrichten aneinander.
Ein Attentat.
Eine Prinzessin ist schwanger.
Ein Erdbeben.
Ein Video eines Welpen geht viral.
Eine Frontlinienverschiebung in einem Kriegsgebiet.
Der Film „Es ist nie zu spät, ein Original zu sein“ kommt in die Kinos.
Er ist ein Remake.
3
Noch etwas mehr als eine Stunde soll es dauern, bis ich den Bahnhof erreiche. Von dort muss ich noch ein wenig durch die Stadt, um zu Emilys Wohnung zu gelangen. Sie hatte angeboten, mich vom Bahnhof abzuholen. Genauer gesagt, hatte sie es gar nicht zur Debatte gestellt. Es war kein Vorschlag oder Angebot gewesen. Es war ihr als Selbstverständlichkeit erschienen. Ich hatte es ihr ausreden müssen.
Ich begebe mich zur Zugtoilette. Ich bin früh aufgestanden und habe die daraus resultierende Müdigkeit mit Kaffee zu kompensieren versucht. Dies rächt sich nun.
Die Kabine ist voll von Kritzeleien. Der Toilettengang scheint einige Menschen sentimental zu machen. Möglicherweise rufen die eigenen Ausscheidungen bei manchen alte Trennungs- und Verlustängste hervor. Eventuell konfrontieren sie die Menschen mit der Vergänglichkeit aller Dinge. was unwillkürlich die Frage Was bleibt von mir? aufwirft. Und dann entschließen sie sich, dass etwas von ihnen bleiben soll, auch wenn es nur ein Zweizeiler an einer Wand oder eine ungespülte Toilette ist. Freud hatte mit Sicherheit etwas dazu gesagt.
Meine Zugfahrt zu Emily ist auch eine Zugfahrt in die Heimat. Von meiner Familie weiß allerdings niemand, dass ich diese Reise unternehme. Ich habe mir offen halten wollen, ob ich ihnen einen Besuch abstatte oder nicht. Das kann man als einigermaßen egoistisch oder gesunde Grenzsetzung betrachten. Das ist jedem selbst überlassen. „Es ist noch nicht lange her, dass ich das letzte Mal zu Besuch war.“, versuche ich mir mein schlechtes Gewissen auszureden. Die Beschwichtigung zeigt Wirkung. Ich finde mein Verhalten nach wie vor nicht vorbildlich aber mehr und mehr akzeptabel. Beinahe menschlich.
Ich sitze wieder auf meinem Platz. Ein Mann geht schnellen Schrittes durch den Gang. Er hat ein zerfurchtes Gesicht, das von einem übermäßigen Vorkommen von Wutanfällen zeugt. Mit zusammengekniffenen Augen marschiert er an mir vorbei. Wer kann sagen, was in seinem Leben vor sich geht? Vielleicht bin ich zu rasch in meinem Urteil? Doch woher sollen Zornesfalten kommen, wenn nicht vom Zorn?
Emily ist der Grund, aus dem ich es mir hin und wieder erlaube, oberflächlich zu sein. Das mag sich uncharmant anhören, doch so ist es nun einmal. Emily sieht aus wie eine Träumerin und Emily ist auch eine Träumerin. „Nur, wer träumen kann, kann auch aufwachen.“, hat sie vor einer Weile in einem Buch gelesen und sogleich zu ihrem Mantra gemacht. Man sei auch nur ein echter Mensch, wenn einen all der Wahnsinn um einen herum noch wahnsinnig mache. Zumindest ein wenig. Sie meint, ich solle sie darauf hinweisen, wenn sie diese Fähigkeit zu verlieren drohe.
Emily ist der Literatur jedoch nicht nur als Leserin zugetan. Sie schreibt selbst. Eines meiner liebsten ihrer Gedichte umschreibt die Schönheit der Nacht. Ich bin nicht imstande, es vollständig zu zitieren, aber es endet mit den Worten „Die Sonne lässt den Himmel verwitwet zurück, so tröstet er sich mit dem Mond“.
Wenn man sich eine Frau vorstellt, die Gedichte schreibt, dann sieht man Emily vor seinem inneren Auge. Emily sieht wie eine Dichterin aus. Deshalb erlaube ich mir hin und wieder ein wenig Oberflächlichkeit.
4
Es geht im Leben vor allem darum, sich selbst zu überleben. Diesen Eindruck habe ich gewonnen. Die Zumutungen anderer können einem den Glauben an die Menschheit austreiben, doch wenn man über die eigenen Fehltritte den Glauben an die eigene Menschlichkeit verliert, sich selbst keine Würde mehr zugesteht, dann steht man dem Tod näher als dem Leben.
Mehr noch als sich gegenseitig hatten meine Eltern sich jeweils selbst zum Feind auserkoren. Seit ich mich erinnern kann, bestand ihre Beziehung aus Streit. Man kann sich fragen, welches Band sie zusammenhielt. Ob ihr Festhalten aneinander dem bloßen Umstand geschuldet war, dass es ein noch unzumutbarer Zustand gewesen wäre, sich wieder nur noch selbst zum Feind zu haben?
Als Kind fragte ich mich solche Dinge nicht. Ich nahm das Verhalten der Erwachsenen um mich herum hin wie eine Naturgewalt.
So sind meine Eltern. So sind Erwachsene. So ist das Leben. So ist das eben alles.
Im Gegensatz zu anderen Kindern habe ich mich jedoch nie schuldig gefühlt für die Streitigkeiten meiner Eltern. Gleichzeitig erkannte ich ihre Unzulänglichkeiten nicht als solche und vermutete, dass das ihre wohl ein gewöhnliches Erwachsenenleben sei. Vielleicht war es das sogar zu einem gewissen Grad. Kein erstrebenswertes aber doch ein gewöhnliches.
Ich hinterfragte nichts. Ich hinterfragte nicht die Ängstlichkeit meiner Mutter beim Überqueren der Straße auch bei grüner Ampel. Ich hinterfragte nicht das allabendliche Wanken. Ich hinterfragte nicht das Zuschlagen von Türen. Ich hinterfragte nicht die vielen ungeöffneten Briefe auf der Kommode im Flur. Ich hinterfragte nichts. Weder erzählte ich Klassenkameraden davon, noch wollte ich von ihnen wissen, wie sich ihr Leben zuhause gestaltete. Welchen Sinn hätte es ergeben, sie danach zu fragen? Ich nahm an, dass meine erlebte Welt dem Lauf der Dinge entsprach und mir keiner etwas darüber erzählen konnte, was ich nicht bereits selbst erfahren hatte.
Sie stritten sich gewohnheitsmäßig. Man fand Mittel und Wege, sich davon abzulenken. Man sang ein Lied, das die durch die Wände dringenden Stimmen übertönen sollte. Man klapperte mit allen Dingen, die einem in die Hände fielen. Man sprang wie wild herum, sodass der eigene Atem und Puls in den Ohren dröhnten. Ablenken konnte man sich, doch ausblenden konnte man es nie. Auch wenn ich den Scheinwerfer meiner Aufmerksamkeit kurz auf etwas anderes richten konnte, so war mir immer bewusst, dass ich dies gerade nur tat, weil es nötig war. Dass da noch etwas im Hintergrund lauerte, das sich meiner Aufmerksamkeit bemächtigen wollte, gegen das ich mich wehren musste. Dass da noch ein Monster unter dem Bett schlummerte.
Sie stritten sich gewohnheitsmäßig. Als ich anfangs noch versuchte zu lauschen, hatte ich den Gegenstand ihrer Auseinandersetzungen ausfindig machen wollen. Die Wortfetzen konnte ich jedoch nie in einen Zusammenhang bringen. Es waren Vorwürfe, die keine Antwort, sondern einen Gegenvorwurf hervorbrachten. Es waren Vorwürfe, die nach keiner Antwort suchten.
Sie stritten sich gewohnheitsmäßig, doch eines Tages, da wusste ich, dass es ihr letzter Streit sein würde. Denn einer von beiden brach aus der Gewohnheit aus. Einer von beiden ging nicht in den Angriff über. Einer von beiden ließ sich nicht auf den Austausch von Gemeinheiten ein. Einer von beiden erhob seine Stimme nicht, um den anderen zu übertrumpfen. Einer von beiden klopfte an meine Tür, um mir zu sagen, dass er eine Weile fortgehen müsse, aber bald wiederkomme. Ganz sicher.
Ich sah meine Mutter nie wieder.
5
Wenn ich es recht bedenke, hatte es sich abgezeichnet. Etwas hatte sich verändert. Meine Mutter hatte das Feuer verloren. Es war nicht in einer einzigen übermächtigen Sturzflut gelöscht worden, es war langsam abgebrannt. Sie war bereits zuvor ruhiger geworden. Nur an jenem Abend ihres Fortgehens war ihr Erloschensein so augenfällig gewesen, dass man diesen Prozess für ein Ereignis halten konnte. Nein, sie war nicht auf einen Schlag ihrer Kräfte beraubt worden, es war ein zäher Kampf gewesen.
Ihre Schwester übernahm die Abholung ihrer restlichen persönlichen Gegenstände. Ich gehörte nicht dazu.
Ich stand im Türrahmen und beobachtete, wie meine Tante die Schubfächer eines nach dem anderen durchging. Wie sie ein paar Kleidungsstücke in einem Rutsch von der Stange des großen Kleiderschranks im Schlafzimmer fegte, um sie zum Transport in einer großen Mülltüte zu verstauen. Sie war ganz auf ihre Aufgabe fokussiert. Nur ein einziges Mal blickte sie zu mir herüber, verzerrte ihr Gesicht für den Bruchteil einer Sekunde zu einem qualvollen Lächeln und ließ den Kopf ruckartig wieder in Richtung des Schrankes schnellen, um ihr Werk fortzuführen.
War dies ein Ereignis? Es fühlte sich an wie eines. Es fühlte sich an wie der Beginn des Schweigens. Doch er war es nicht. Schweigen hatte es bereits vorher gegeben. Seit ihrem Aufbruch eine Woche zuvor hatte sich meine Mutter nicht bei mir gemeldet. Mein Vater hatte nicht von ihr gesprochen. Das Schweigen war bereits eingetreten, es hatte am Tag des Besuchs meiner Tante jedoch Endgültigkeit erreicht. Es war eine Naturgewalt geworden. Dieser Tag war nicht der Beginn des Schweigens, er war das Ende der Hoffnung.
Leichtfertig kann man sagen, dass es von jenem Zeitpunkt an so war, als wäre sie nie dagewesen. Doch das war es nicht. Es war verheerender als das. Ein Stück ihrer selbst hatte sie in Form meiner Erinnerungen bei mir zurückgelassen. Ein Stück meiner selbst hatte sie unwiederbringlich mit sich genommen. Wie sollte man noch der Gleiche sein, wenn alles anders war?
Denkt sie noch manchmal an mich? Wenn ja: Wen sieht sie? Den kleinen Jungen, den sie zurückgelassen hat? Sieht sie meinen Gesichtsausdruck bei ihrem Abschied vor sich? Oder zählt sie die Jahre und fragt sich, wie ich nun wohl aussehe und beschwört das Bild eines jungen Mannes herauf, der es trotzdem irgendwie geschafft hat? Ohne sie. Würde sie mich auf der Straße erkennen? Würde ich ihrer Fantasie standhalten können, sollten sich unsere Wege jemals wieder kreuzen?
Wenn ich an sie denke, kommt mir nicht unmittelbar das Bild meiner letzten Erinnerung an sie in den Sinn. Nein, es ist nicht das Bild des Ereignisses, sondern eben jenes Prozesses, der sich vorher vollzogen hatte, das sich in meinem Kopf zusammensetzt. Ihr Gesicht wurde irgendwann zu einer Collage aus all ihren Gesichtern.
Doch egal aus welcher Situation das Mosaikstück ihres Gesichts entstammt, welche Emotion sie auch in ihr durchlebt hat, welche Worte sie an mich gerichtet hat: Ihr Gesicht hat einen Ausdruck, der unter allen anderen hindurchschimmert, unabhängig davon, wie stark sie ihn zu kaschieren versucht hatte. Ein Ausdruck, den auch das liebevollste Lächeln nicht zu übertünchen vermag.
Ihr Gesicht sah immer nach gepackten Koffern aus.
6
„Ist dieser Platz hier noch frei?“
Ich schrecke aus meinen Gedanken hoch.
Ich nicke dem Herrn hastig zu. Er erwidert ebenfalls mit einem Nicken, das jedoch im Gegensatz zu meinem wesentlich gelassener ausfällt. Er nimmt mir gegenüber Platz und legt seinen Mantel, den er zuvor über den Arm geworfen hatte, auf dem Sitz neben sich ab.
Seine Ruhe weicht jedoch im Verlauf der Fahrt einer langsam anschwellenden Nervosität. Sein Blick, der zuvor im sanften Fokus auf die Welt außerhalb des Fensters gerichtet war, wechselt immer öfter zwischen verschiedenen Fixpunkten innerhalb des Zuges hin und her.
Dem vorausgegangen war eine Nachricht auf seinem Telefon. Diese hatte sich mit einem Klingeln bemerkbar gemacht, das in seiner schrillen Übersteuerung nur knapp die Grenze zur Lärmbelästigung verfehlt hatte. Dies war ihm sichtlich unangenehm gewesen und mutmaßlich galt sein erstes Tippen dem Abstellen des Signaltons. Beim Betrachten der Nachricht hatte er sich dann ein Grinsen nicht verkneifen können.
Die Kommunikation über Distanz ist doch eine merkwürdige Angelegenheit: Ein völlig Fremder kann gegenüber sitzend Vermutungen anstellen, welchen Anlass es für ein Lächeln gibt. Doch die Person, der das Lächeln gilt, kann es nicht einmal sehen, geschweige denn ihre Schlüsse daraus ziehen.
Trotz seiner sichtlichen Freude über die Nachricht, scheint irgendetwas an ihr ihn aufzuwühlen. Er reibt seine Hände an seinen Oberschenkeln, als seien sie schwitzig. Seine hektischen Blicke werden auffälliger. Er atmet flach. Ist die gute Nachricht Hand in Hand mit einer schlechten gekommen? Löst die gleiche Tatsache nach einiger Überlegung mehr Unbehagen aus, als es die anfängliche Überraschung vermuten ließ? Kann man die gleichen Worte ohne die dazugehörende Tonlage auf unterschiedliche Weise deuten?
Ich kann nicht anders, als ihn ein wenig zu beobachten. Er hat leicht angegraute Schläfen. Dies kann einen leicht dazu verleiten, Menschen für älter zu halten, als sie eigentlich sind. Man muss auch andere Aspekte in die Wertung einbeziehen: Die Augenpartie, den Hals, die Hände. Doch unter Berücksichtigung aller Kriterien komme ich zu dem Schluss, dass das Ergrauen seiner Schläfen altersgemäß ist. Er muss wohl in etwa im Alter meiner Eltern sein.
Ich habe ihn offenbar einen Augenblick zu lang gemustert. Möglicherweise habe ich ihn sogar angestarrt. Ausschließen kann ich das nicht. Er hat Notiz von meiner Begutachtung genommen, denn nun erwidert er meinen prüfenden Blick. Es blitzt jedoch kein Argwohn oder Groll in seinen Augen auf. Es wirkt, als sei ihm verständlich, dass er mit seinem nervösen Verhalten Aufsehen erregen kann.
„Sie denken anscheinend ganz schön angestrengt nach.“, eröffnet er mit sanfter Stimme das Gespräch.
„Ja, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ein Buch zu lesen, aber ich würde doch eh nur immer wieder abschweifen.“, erwidere ich in der Hoffnung, dass er nicht darauf zu sprechen kommt, dass meine Gedanken wie mein Blick auf ihn geheftet waren, sondern er mich stattdessen etwas Belangloses zum Buch fragt.
„Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe.“
Mein Ablenkungsmanöver zeigt Wirkung.
„Es ist nicht so, dass ich am Lesen nie Freude gefunden hätte, aber irgendwann habe ich das Gefühl bekommen, dass ich praktisch alles schon einmal gelesen habe.“
Ich glaube zu wissen, worauf er hinauswill. Liebe, Tod, Verrat, Freundschaft: Dinge, über die es sich zu lesen und zu schreiben lohnt. Doch sind sie schon aus jedem erdenklichen Winkel beleuchtet worden und es grenzt wohl an Größenwahn, wenn ein Autor glaubt, noch einen wichtigen Beitrag zum Verständnis dieser Motive leisten zu können.
„Es sind doch am Ende die immergleichen Geschichten. Die Namen werden ausgetauscht. Vielleicht fällt noch eine witzige Bemerkung, die einem noch nicht untergekommen ist, aber im Großen und Ganzen...“
Ich nicke zustimmend. Auf das Wie kommt es bei einer Geschichte vielmehr an als auf das Was. Ich habe ihm nichts hinzuzufügen. Ich bin peinlich berührt davon, dass er mein wortloses Nicken als Unlust zu einem Gespräch fehlinterpretieren könnte. Ich bin einer Unterhaltung grundsätzlich nicht abgeneigt, doch weiß ich nicht so recht, wie ich ihm meine Zustimmung verbal vermitteln kann, ohne seine Aussage nur mit anderen Worten zu wiederholen und dadurch wie ein nachplappernder Jasager zu wirken.
„Aber Sie sind noch jung. Für Sie halten die Geschichten noch erste Male bereit.“, nimmt er glücklicherweise das Gespräch selbst wieder in die Hand.
„Das hoffe ich doch.“, sage ich mit einem Lachen, das vor allem aus der Erleichterung darüber entsteht, dass mir diesmal mehr als ein Nicken eingefallen war.
„Wohin fahren Sie, wenn ich fragen darf?“, fragt er höflich.
„Zu meiner Freundin.“, antworte ich ebenso höflich.
Er muss lachen: „Nein, ich meinte, bis zu welcher Station Sie fahren. Aber Ihre Antwort ist spannender. Wie heißt sie?“
In Verlegenheit über das Missverständnis bringe ich nur kurz ihren Namen hervor: „Emily.“
„Ah, eine Emily.“, sagt er mit schwärmerischem Unterton.
„Wissen Sie, ich treffe mich auch mit jemandem. Vielleicht kann ich sie auch irgendwann meine Freundin nennen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen. Wir treffen uns heute zum ersten Mal.“
„Oh, zum ersten Mal?“, sage ich meine Augenbrauen hochziehend. „Dann haben Sie...“, will ich fortfahren.
„Ja, wir haben uns über das Internet kennengelernt.“, beantwortet er meine ungestellte Frage.
„Wenn man in meinem Alter ist, dann kommt man aus seinem Umfeld nicht mehr so oft heraus. Man geht zur immergleichen Arbeit, geht mit seinen Freunden in das immergleiche Lokal, verbringt sein Wochenende mit dem immergleichen Hobby. Da kann das Internet einem schon eine Hilfe sein.“
Es wirkt so, als wolle er sich für die Tatsache, dass sie sich im Internet kennengelernt hatten, zu rechtfertigen versuchen, weil ich es für verzweifelt oder anrüchig halten könnte. Dass dem nicht so ist, versuche ich ihm mitzuteilen, indem ich in sachlichem Tonfall weitere Informationen erfrage: „Sie haben aber schon eine Weile miteinander geschrieben?“
„Ja ja, seit ein, zwei Wochen, würde ich sagen.“
„Und wissen Sie schon, wie sie aussieht oder haben Sie sich gegenseitig ein Erkennungsmerkmal mitgeteilt?“
„Fotos sind auf der Plattform praktisch Pflicht. Also man ist nicht gezwungen Fotos hochzuladen, aber ohne kann man es gleich vergessen. Dann kann man sich die Anmeldung direkt sparen. Da kauft keiner die Katze im Sack.“
Das Gespräch mit mir scheint ihn zu beruhigen. Über den Grund seiner Aufregung zu sprechen, scheint ihm die selbige etwas zu nehmen.
„Ich kann mir gar nicht erklären, wie sie Probleme haben kann, einen Verehrer zu finden. Natürlich bin ich zunächst durch ihr Aussehen auf sie aufmerksam geworden. So ist das auf solchen Portalen nun einmal. Vielleicht auch im echten Leben. Das kann man finden, wie man will. Abfinden muss man sich damit. Also sie ist hübsch, bildhübsch, aber ich hatte noch nie zu jemandem einen solchen Draht wie zu ihr. Zumindest beim Schreiben. Ich kann mir wirklich nicht erklären, wie sie noch allein sein kann. Vielleicht hat sie auch nur Probleme, unter all den Verehrern den richtigen auszuwählen. Aber wahrscheinlich hat sie auch nur so festgefahrene Routinen wie ich, wer weiß. In einer halben Stunde bin ich vielleicht schlauer.