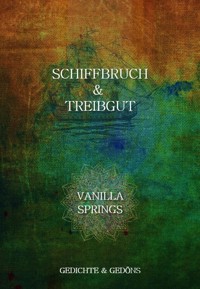1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dass man das Leben nur rückwärts verstehen kann, wird dem kleinen Theodor allzu früh bewusst. Dass man es vorwärts leben muss, wird ihm zum Verhängnis. Getrieben von der Frage, wer er am Ende seines Lebens gewesen sein wird, eingezwängt von den Erwartungen, die an ihn gestellt werden, kann er sich auf nichts und niemanden wirklich einlassen, während die Jahre wie kalte Schneeschauer an ihm vorüberziehen. Doch irgendwann erscheint ein Silberstreif am Horizont: eine Traumwelt, in der all seine Wünsche in Erfüllung gehen und die ihn am Ende doch zu ihrem Gefangenen macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
0.1
0.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Impressum
0.1
Mädchen* wachte auf, weil sie nicht wusste, ob sie allein in ihrer Wohnung war. Sie schwang die Decke beiseite, stieg aus dem Bett und tappte durch ihre Wohnung.
„Hallo?“, fragte sie in die dunkle Stille hinein.
Sie wusste nicht, ob sie allein war. Für einen Außenstehenden konnte es so wirken, als fürchtete sie sich vor ungebetener Gesellschaft. Doch sie war sich nicht sicher, wovor sie mehr Angst haben sollte: Dass sich noch jemand in ihrer Wohnung befand, oder dass sie tatsächlich allein war. Manchmal – in seltenen Fällen – kommt es zu einer Gleichzeitigkeit von Ängsten, die sich wie Feuer und Eis sind. Man fürchtet sich vor dem Unheimlichen wie vor dem Heimlichen.
„Hallo?“, fragte sie noch einmal in die stille Dunkelheit hinein.
Die eine Herzkammer wartete auf Antwort, die andere auf Schweigen.
*Ihre Eltern hatten einen Jungen erwartet. Es war ihnen ganz undenkbar erschienen, dass es anders kommen könnte. Auf ein Mädchen hatten sie sich nicht vorbereitet. Als es kam, wie es kam, als ein Mädchen sich zu ihnen gesellte, da wussten sie sich nicht anders zu helfen, als ihrer Tochter die schmucklose wie wahre Bezeichnung Mädchen zu geben.
0.2
„Ich würde gern eine Zahnspange haben.“
„Sie sind 78.“
„Das weiß ich.“
„Sie haben 78 Jahre ohne eine Zahnspange gelebt.“
„Schlimm genug.“
„Wissen Sie, ich finde es durchaus charmant, wenn die Zähne einer Person nicht in Reih und Glied stehen wie Zinnsoldaten. Gewiss erspare ich einigen Menschen Schmerz und Hänselei, aber da Sie von beidem nicht betroffen scheinen, besteht aus ärztlicher Sicht keine Notwendigkeit einer Zahnspange. Wenn Sie bisher keine medizinischen Probleme mit der Position Ihrer Zähne hatten, sollten Sie auch jetzt keine bekommen. Und wie ich Ihnen eben versuchte zu erklären, ist eine Zahnspange in Ihrem Fall auch in kosmetischer Hinsicht ein durchaus streitbares Anliegen. Dass Sie in diesem Alter noch all Ihre echten Zähne haben, grenzt bereits an ein Wunder. In dieses fromme Werk der Natur einzugreifen, wäre mir beinahe, wie mich daran zu versündigen.“
„Ich habe ein Leben krummer Schneidezähne gelebt. Einmal möchte ich noch erfahren, wie sich ein anderes Leben angefühlt hätte. Ich bin eine erwachsene Frau. Sie sind mein Arzt, nicht mein Lehrer, Herr Dr. Fähnrich.“
***
„Mama, warum hat die alte Frau da eine Zahnspange?“
„Psst, sei nicht so unhöflich. Das geht uns nichts an. Entschuldigen Sie bitte.“
„Das ist eine sehr interessante Frage. Ich möchte dir auch eine stellen: Warum sollte ich keine haben?“
„Weil du alt bist. Alte Menschen haben keine Zahnspangen.“
„Hör auf! Es tut mir wirklich leid.“
„Und warum haben alte Menschen keine Zahnspangen?“
„Weil sie bald tot sind.“
„Theodor, es reicht! Wissen Sie, das ist mir so furchtbar unangenehm, ich...“
„Vielleicht lebe ich noch hundert Jahre.“
„Das geht nicht.“
„Theodor...“
„Warum geht es nicht?“
„Weil es unmöglich ist. Du bist doch jetzt schon hundert Jahre alt. Zweihundert Jahre alt wird kein Mensch.“
„Sei bitte still! Du bist wirklich sehr ungezogen.“
„Vielleicht hast du recht und ich bin wirklich schon einhundert Jahre alt. Mein Bus kommt. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dich kennenzulernen, Theodor.“
„Wie heißt du?“
„Das geht uns nichts an...“
„Mein Name ist Mädchen.“
„Das gibt es wirklich nicht. Ein hundertjähriges Mädchen.“
***
So kam es, dass das hundertjährige Mädchen und der siebenjährige Theodor eine Bushaltestellenfreundschaft kultivierten. Zuerst hatten sie sich einige Male zufällig an Haltestellen getroffen; dann beschlossen sie, sich absichtsvoll zu sehen.
„Morgen um 11.30 Uhr Ecke Wertherstraße/Lilienstraße?“
„Ich bin bis um 12.15 Uhr in der Schule. Ich habe meiner Mama schon gesagt, dass ich mit Freunden zum Fußballspielen verabredet bin. Um 12.30 Uhr könnte ich Ecke Wertherstraße/Lilienstraße sein.“
„Nein, 12.30 Uhr ist keine Zeit für Wertherstraße/Lilienstraße. 12.30 Uhr ist eine Zeit für den Glockenthalerplatz.“
Sie trafen sich am Glockenthalerplatz und sie trafen sich an allen anderen Haltestellen der Stadt. Theodor lauschte Mädchens Lebensgeschichte und wie er sie zum ersten Mal hörte, war ihm klar, dass sie sie zum ersten Mal erzählte. Jeden Tag schritt ihre Erzählung weiter voran und näherte sich der Gegenwart, bis Mädchen eines Tages an dem Punkt in ihrer Geschichte angekommen war, an dem sie einen kleinen siebenjährigen Jungen namens Theodor an einer Haltestelle getroffen hatte.
Theodor, nun mittlerweile acht Jahre alt, hatte voll Faszination auf diesen Moment hingefiebert. Er hatte es kaum erwarten können.
„Ich würde dir auch gern mein Leben erzählen. Aber ich habe noch nicht so viel davon. Ich wünschte, ich wäre schon älter. Ich wünsche mir, ich hätte nicht alles noch vor mir. Ich wünschte, ich könnte schon darauf zurückblicken. Und anderen davon erzählen. So wie du, Mädchen.“
„Diesen Wunsch kann ich dir nicht erfüllen.“
„Ich wünschte, ich könnte für dich mitaltern. Dann bleibst du mir erhalten. Für immer.“
„Das können wir versuchen.“
So gaben sie sich ein Versprechen: Für jeden Tag, der verging, sollten es Theodor wie zwei und Mädchen wie keiner sein.
Während Mädchen nicht älter wurde, wuchs Theodor schnell zu einem jungen Mann und seiner Mutter wie allen anderen bis auf Mädchen zu einem Rätsel heran. In der Schule wussten sie nicht, wie sie mit seinen Fortschritten umzugehen hatten, kein Arzt konnte seine rasante Entwicklung erklären. Mädchen wurde für ihre guten Gene gelobt.
Nach fünf weiteren Jahren der Freundschaft mit Mädchen in althergebrachter Zeitrechnung war er ein erwachsener Mann. Mädchen stand ihm mit Rat zur Seite und doch spürte er, wie sich ein Schatten über sie legte. Er spürte, wie ihr der Pakt zur Qual wurde, wie sie sich nur seinetwillen noch an das Versprechen hielt. Sie ließ sich nicht in die Karten schauen. Doch ihre Fassade begann zu bröckeln.
Er konnte sie nicht von ihrem Versprechen entbinden. Zu sehr drängte in ihm der Wunsch, ein hohes Alter zu erreichen, von dem er auf alles zurückblicken konnte, was er geschafft hatte.
Eines Tages fand er Mädchen tot in ihrer Wohnung auf. Er wagte nicht, die Todesursache in Erfahrung zu bringen. Für ihn war nur eines von Belang: Sie war gestorben und mit ihr eine ganze Welt. Ihr Versprechen jedoch hielt sie über den Tod hinaus. Der Bann war durch ihren Tod nicht gebrochen worden. Sie hinterließ einen jungen Mann, der sich fortan wie ein Waise fühlen sollte. Sie vermachte ihm die Armbanduhr, die sie immer getragen hatte und es sollten keine zwei Tage in seinem Leben vergehen, an denen er sie nicht trug.
1
„Also dann, Lilly. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht.“
„Vielen Dank, es war ein schöner Abend.“
Sie küssen sich nicht zum Abschied.
„Theo? Möchtest du vielleicht doch noch mit hinaufkommen? Für einen Tee zum Beispiel?“
Theodor dreht sich wieder zu ihr um und schaut dann auf seine Uhr.
„Ja. Das sollte passen.“
***
Am nächsten Morgen verlässt er ihre Wohnung, sich beim Abtreten noch seinen Hemdkragen zurechtrückend. Als er hinaufschaut, erkennt er hinter ihrem Fenster ein Winken, das er erwidert.
Er schaut auf seine Uhr und muss unwillkürlich an Mädchen denken. Die Zeit heile alle Wunden, sagt man. Nein. Gar nichts macht die Zeit. Die Zeit heilt absolut gar nichts.
2
Er trinkt einen Schluck. Er trinkt und doch wird sein Durst nicht gelöscht. Er stellt seine Weinschorle ab, greift zu seinem Buch, doch wollen die Saiten in ihm heute nicht klingen. Als Lesezeichen dient ihm ein Brief einer gewissen Hannah. Ein Name, den er ohne den dazugehörigen Brief längst vergessen hätte und dem er auch kein Gesicht, keinen Geruch, kein Gefühl mehr zuordnen kann. Er legt den Brief an eine beliebige Stelle ins Buch und schließt es.
Er versucht, den Ausblick zu genießen, der sich ihm von der Terrasse bietet, doch es gelingt ihm nicht. Genuss ist keine Frage des Willens. Genuss ist eine Frage des Könnens und nur die Gesellschaft einer Frau konnte ihn bisher kurzlebig aber weich in die Illusion der Genussfähigkeit betten.
Er notiert sich: Genießen ist eine Frage des Könnens. Manche merken gar nicht, dass sie es nicht können. Manche leben ihr gesamtes Leben, ohne dass es ihnen je auffällt. Doch wenn man es merkt, dann frisst es einen auf.
3
„Ich fühle mich wie ein Strohfeuer.“
„Sie fühlen sich also, als würden Sie schnell abbrennen?“
„Ja, das habe ich eben gesagt. Das ist, was sich wie ein Strohfeuer zu fühlen, bedeutet.“
„Wodurch brennen Sie ab?“
„Na, durch ein Feuer.“
„Wie ist das Feuer entstanden?“
„Durch einen Funken vermutlich.“
„Woher kam der Funke?“
„Durch Hitze, schätze ich.“
„Wissen Sie, manchmal stelle ich bei Ihnen einen gewissen Widerstand fest. Als würden Sie sich nicht öffnen wollen. Das ist vollkommen verständlich und in Ordnung. Das ist sehr menschlich. Vielen geht es so. Nur müssen Sie auf lange Sicht, wenn Sie Fortschritte machen wollen, gemeinsam mit mir daran arbeiten, diesen Widerstand aufzulösen. Würden Sie das tun?“
„Was?“
„Mit mir gemeinsam daran arbeiten?“
„Warum arbeiten Sie nicht gemeinsam mit mir daran?“
„Ich fürchte, das läuft auf dasselbe hinaus.“, antwortet sein Therapeut.
„Ich fürchte nicht.“
***
Als er das Praxisgebäude verlässt, sieht er das erste Mal seit Jahren einen Eiswagen, der neben einem Spielplatz die Kinder herbeiklingelt. Für den Bruchteil einer Sekunde klingelt er auch das Kind in ihm herbei. Kurz kann er sich wieder wie etwas fühlen, von dem er einen Begriff hat. Davon, wie es sich jetzt anfühlt, er zu sein, hat er gar keinen Begriff.
4
„Also dann, Luisa. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht.“
„Möchtest du nicht noch mit hinaufkommen?“
Theodor schaut auf seine Uhr.
„Ja, das sollte möglich sein.“
***
Nachdem sie miteinander geschlafen haben, streicht sie ihm durchs Haar.
„Liebst du mich?“
„Nein.“, sagt er nüchtern.
„Gott sei Dank.“
5
„Die meisten Leute behaupten, dass Liebe blind macht. Aber ich glaube das nicht. Das genaue Gegenteil trifft zu, wenn ich mir die Menschen betrachte. Sie sehen viel mehr. Wenn sie verliebt sind, dann sehen sie Dinge im andern, die gar nicht da sind.“
„Das ist eine sehr interessante Sichtweise. Sind Sie im Moment verliebt?“
„Nein.“
„Wann waren Sie das letzte Mal verliebt?“
„Ich weiß es nicht.“
„Waren Sie überhaupt schon einmal richtig verliebt?“
„Ich weiß es nicht.“
„Ich denke, wir haben hier etwas gefunden, woran wir arbeiten können. Könnte es sein, dass Sie Probleme damit haben, Nähe zuzulassen? Ich glaube, dass Sie eine stabile Bindung zu einem Menschen brauchen. Was löst es in Ihnen aus, wenn ich das sage?“
„Ich weiß nicht.“
„Könnte es sein, dass Ihre Unzufriedenheit auch daher rührt, dass Sie keine feste Beziehung zu anderen oder auch nur einem anderen Menschen haben? Sie haben niemanden, dem Sie sich öffnen können.“
„Ich möchte das auch gar nicht. Das Geheimnis ist die letzte Bastion der Erotik.“
„Warum glauben Sie, dass das so ist?“
„Sie glauben immer, dass alles einen bestimmten Grund haben muss. Sie selbst haben doch eine höllische Angst. Sie haben so eine verfluchte Angst, etwas mal nicht erklären zu können. So eine Angst, mal die Kontrolle zu verlieren. Für Sie gibt es immer einen Grund. Für mich gibt es nur das Resultat. Vielleicht war der Gedanke einfach da.“
„Haben Sie nicht selbst Angst, die Kontrolle zu verlieren?“
„Das hat Sie erwischt, oder?“
„Sich in eine Beziehung zu begeben, bedeutet auch immer ein Stück weit einen Kontrollverlust zu erleben. Sie können die Gefühle einer anderen Person nicht bestimmen. Sie können das Verhalten einer anderen Person nicht vollständig vorhersagen.“
„Sie wollen doch die ganze Zeit etwas vorhersagen. Meistens, indem Sie mir etwas nachsagen. Sie wollen wissen, warum ich so bin, wie ich bin. Wie ich zu dem geworden bin, der ich bin. Aber vielleicht bin ich nur ein Gedanke. Vielleicht war ich einfach irgendwann da. Vielleicht hat der Teufel mit den Fingern geschnippt und dann war ich einfach da.“
„Sie haben mir erzählt, dass Sie sich gestern mit dieser Frau getroffen haben. Wie war ihr Name noch gleich?“
„Was spielt das für eine Rolle?“
„Keine. Nun, wie wäre es denn, wenn Sie sich probeweise mal ein wenig längerfristig mit ihr einlassen würden?“
„Ich sehe sie schon eine Weile.“
„Aber es schien mir, als wäre Ihr Kontakt eher oberflächlicher Natur, oder täusche ich mich da?“
„Ich weiß nicht.“
„Probieren Sie es doch einfach mal. Versuchen Sie, mit ihr über Ihre Gefühle zu reden. Sich ihr als fühlendes Wesen zu zeigen. Und schauen Sie, wie sie reagiert.“
6
„Luisa?“
„Ja?“
„Ich glaube, ich habe mich beim letzten Mal geirrt. Ich glaube, ich liebe dich doch.“
„Was? Wie kommst du denn auf einmal darauf?“
„Einfach so.“
„Einfach so? Das fällt dir jetzt einfach so ein?“
Theodor zeigt sich über ihre Verwunderung verwundert.
„Ja. Ich dachte mir, dass ich mit dir gern mehr über meine Gefühle reden würde. Und eines dieser Gefühle ist wohl die Liebe zu dir, so nehme ich an.“
„Du bist dir also nicht sicher?“
„Nein. Wir kennen uns ja kaum.“
„Aber trotzdem glaubst du, du liebst mich?“
„Ja. Bestimmt.“
***
Theodor weiß, wie man sich als Mann zu pflegen hat. Er weiß, wie man gängigen Schönheitsidealen entspricht. Am Anfang weiß er, was er zu sagen hat. Von Gesprächen, die sich nach einem fünften Treffen ergeben, weiß er wenig. Er weiß, ein Bild von sich zu malen, das ansprechend ist. Kratzt jemand jedoch etwas an der Oberfläche, so findet dieser jemand nichts vor, als eine weiße Leinwand.
7
„Ich fühle mich wie eine dünn bestrichene Leinwand.“
„Meinten Sie nicht neulich, dass Sie sich eher wie ein Strohfeuer fühlen?“
„Können diese Gefühle nicht nebeneinander existieren?“
„Wenn Sie das sagen. Jedes Gefühl ist legitim.“
„Es ist, als hätte der Maler zu wenig Farbe gehabt.“
„Malen Sie gern?“
„Vom Malen verstehe ich nichts. Doch im Zeichnen war ich früher nicht schlecht. Es ist lange her. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Ich kann nicht sagen, ob ich es überhaupt noch kann.“
„Vielleicht versuchen Sie es mal. So als Ausgleich.“
„Als Ausgleich wozu?“
„Der inneren Unruhe, von der Sie mir einmal berichtet haben.“
„Ich habe auch immer sehr unruhig gezeichnet.“
8
„Wie gefällt es dir?“
Theodor reicht Luisa einen Block herüber. Sie erkennt, dass es sich um einen Zeichenblock handelt. Sie erkennt, dass auf der ersten Seite eine Zeichnung prangt. Sie erkennt, dass es eine Zeichnung von ihr ist.
„Theo, ich wusste gar nicht, dass du zeichnen kannst.“
„Zeichnen kann doch jeder.“
„Lass es mich präziser sagen: Ich wusste nicht, dass du gut zeichnen kannst.“
„Ich wusste es auch kaum mehr.“
Luisa klemmt das Bild an den Spiegel im Flur ihrer Wohnung.
***
Als er nach ein paar Tagen wieder in ihre Wohnung kommt, fällt ihm sofort auf, dass sie das Bild abgehängt hat.
„Das Bild: Wo ist es? Gefällt es dir doch nicht?“, fragt er sie.
Sie holt die Zeichnung aus dem obersten Schubfach des Schränkchens unter dem Spiegel hervor und schaut es an.
„Nein, ganz im Gegenteil. Ich konnte nicht aufhören, es anzustarren. Ich weiß, dass ich die Frau auf dem Bild sein soll. Glauben kann ich es nicht. Sie sieht zu perfekt aus. Du hast nicht mich gemalt. Du hast mich gemalt, wie ich sein sollte. Selbst der Leberfleck auf der Wange bekommt in deinem Bild noch etwas Anmutiges.“
Sie streicht sich sanft über den Leberfleck auf der linken Wange. Dann lässt sie ihre Hand wieder von der Zeichnung gleiten und fährt fort: „Immer, wenn ich danach in den Spiegel geschaut habe, fühlte ich mich so unvollkommen. Ich versuchte, mich so zu schminken, dass ich aussah, wie die Frau in deiner Zeichnung. Ich versuchte die Strähne so an meiner Stirn herabfallen zu lassen, wie sie es auf der Zeichnung tut und das Gesicht einrahmt. Ich versuchte, den verträumten Blick zu imitieren, den du ihr eingehaucht hast. Doch immer, wenn ich für einen winzigen Moment begann, mich wie die Frau in der Zeichnung zu fühlen, dann fiel mir auf, dass ich ihr in so vielen Belangen, in ihrem gesamten Wesen, doch so unähnlich war.“
„Für mich bist du die Frau in der Zeichnung. Ich sehe dich so.“
Sie weint.
„Dann siehst du nicht mich.“
9
„Haben Sie es geschafft, zu dieser Frau eine tiefere Bindung aufzubauen, so wie ich es Ihnen empfohlen habe?“
„Ja, ich denke schon.“
„Woran machen Sie das fest?“
„Ich habe sie letztens zum Weinen gebracht.“
10
„Theodor, meinst du noch immer, dass du mich liebst?“
„Ja.“
„Weißt du, ich habe mich immer an Männer gehalten, die nach dem Sex plötzlich Heimweh bekommen. Zuerst machtest du den Eindruck, auch zu ihnen zu gehören. Dann meintest du auf einmal, dass du mich liebst. Erst habe ich es für eine Masche gehalten. Ich habe gedacht, dass du irgendein Spiel spielst, um mich emotional an dich zu binden, damit du von mir bekommst, was du willst. Was immer das auch sein sollte, denn meinen Körper hattest du ja schon. Dann dachte ich mir, dass du wissen müsstest, dass ein solches Geständnis mich eher verschrecken als mich zu dir hinziehen würde. Von Anfang an hatte ich dir klargemacht, dass ich keine Verbindlichkeiten eingehen wollte. Dann dachte ich langsam, dass du es vielleicht doch ernst meinen könntest. Und dann hat es mich auf eigenartige Weise doch zu dir hingezogen. Dass du mir einfach zuwidergehandelt hast. Dass du mich liebst, obwohl ich es dir verboten habe. Dennoch ängstigt mich das alles. Ich habe mich nie als eine Frau gesehen, bei der das Lieben und das Geliebtwerden zusammenfallen.“
„Was willst du mir damit sagen?“
„Ich brauche Zeit. Gib mir ein Jahr. Ein Jahr, in dem wir uns nicht sehen. Lass uns sehen, ob unsere Liebe die Prüfung der Zeit übersteht. Ob wir uns vermissen. Lass uns die Zeit anderen schenken. Lass uns sehen, ob kein anderer den Hunger stillen kann, den wir spüren. Ob wir mit keinem anderen das haben können, was wir miteinander haben. Wenn wir in niemandem finden, was wir in einander finden, dann lass es Liebe sein. Was hältst du davon?“
„Nicht viel. Aber wenn du es so möchtest, soll es so sein.“
„Wir müssen uns räumlich trennen. Wir dürfen uns nicht sehen. Auf keinen Fall. Wir können verreisen. Sehen, wie in andernorts geliebt wird. Und dann in einem Jahr treffen wir uns wieder. Genau an diesem Tag um diese Uhrzeit.“
Theodor schaut auf seine Uhr.
„Wir treffen uns genau an diesem Tag um diese Uhrzeit am Alten Markt. Wenn einer von uns nicht erscheint, dann weiß der andere, dass er sein Glück woanders gefunden hat. Theo, sag mir, wollen wir es so machen?“
„Ein Jahr lang fortgehen? Dann muss ich die Termine mit meinem Therapeuten absagen.“
Er würde es sich leisten können. Er hatte genug verdient, sich genug zurücklegt. Wenn er nicht auf allzu großem Fuß lebte, wenn er nicht in den prachtvollsten Hotels nächtigte und in den vornehmsten Restaurants speiste, würde er es sich leisten können.
„Also ist es beschlossene Sache?“
„Ja, wenn du es so willst, wollen wir es so machen.“
„Willst du es denn auch?“
„Ja.“
„Dann lass uns den Abschied nicht hinauszögern.“
Sie küssen sich, doch lassen sie schnell voneinander ab, um den Abschied nicht zu erschweren. Theodor läuft die Treppen im Hausflur hinunter, Luisa sieht ihm durch den Türspalt nach. Sein kurzes Aufblicken zu ihr durch die Stäbe des Geländers ist das letzte, was sie von ihm sieht.
Sie flüstert leise.
„Du hättest auch einfach sagen können, dass du bleiben willst, du Dummkopf.“
11
Theodor stellt seinen Koffer neben dem Barhocker ab. Er fragt den Ober nach einer Serviette. Mit ihr wischt er sich den Schweiß von der Stirn. Eine so heiß sich in einen einbrennende Sonne ist ihm zuvor nie begegnet. Er führt mit dem Ober ein Gespräch über das ortsübliche Wetter und bestellt sich einen Cuba Libre. Er lauscht den in fremder Sprache ablaufenden Gesprächen. Aus den Stimmungen und Zwischentönen versucht er, sich die Gesprächsinhalte zu erschließen.
Er will einen zweiten Cuba Libre bestellen. Es hat ein Schichtwechsel stattgefunden. Er wird nun von einer jungen Schwarzhaarigen bedient, die durch ihr Aussehen wohl viele Gäste dazu verleitet, ihr Getränk so schnell wie möglich zu leeren, nur um bei ihr die nächste Bestellung aufgeben zu dürfen.
Sie merkt an, dass sie erkennt, dass er nicht von hier ist. Sie fragt ihn nach seiner Herkunft und auch nach seinem Namen.
„Mein Name ist Robert. Ich komme eigentlich aus einem kleinen verschlafenen Dorf in England. Sie werden sicher nie davon gehört haben.“
„Sagen Sie es mir trotzdem.“
„Castle Combe.“
„Sie hatten recht. Ich habe wirklich noch nie davon gehört. Aber es klingt nach einem schönen Ort.“
„Die nächste größere Stadt ist Bristol. Davon haben sie sicher einmal gehört.“
„Gehört schon, aber ich verbinde damit nichts. Was verschlägt Sie dann aber aus Ihrem kleinen, schönen Castle Combe hierher in unsere nicht minder schöne Provinz?“
„Berufliches. Nun können Sie sich sicher denken, dass es nichts hier im Ort ist. Doch ich bevorzuge es, früher anzureisen und mich in einem kleinen Dorf in der Nähe einzuquartieren. Morgen fahre ich dann zu meinem Termin nach Barcelona.“
„Das klingt nach einer außerordentlich schönen Angewohnheit. Was für Geschäfte machen Sie?“
„Keine Geschäfte, wie Sie wohl denken. Ich bin Gutachter. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber angeblich sei vor Kurzem ein bislang unbekanntes Gemälde von Picasso entdeckt worden, das sich jahrzehntelang heimlich in jemandes Privatbesitz befunden haben soll. Wenn dem tatsächlich so wäre, würde es sich um eine wahre Sensation handeln. Ich bin hier, um die Echtheit des Gemäldes zu überprüfen. Denn Menschen, die mit der Unwahrheit ihr Leben bestreiten wollen, gibt es überall.“
„Das ist sehr spannend. Wie erkennen Sie, ob es ein echter Picasso ist?“
„Es gibt verschiedene Anhaltspunkte. Zuerst kann man ganz banal die Feinheiten der Unterschriften miteinander abgleichen. Man prüft, ob die Angaben, die vom jetzigen Verwalter mit eventuell vorhandenen Dokumenten über das Gemälde getroffen werden, mit der Biografie des Künstlers übereinstimmen können. Ob der angebliche Zeitpunkt der Entstehung mit dem Stil des Malers in der Phase zusammenpasst. Man entnimmt Farbproben, um zu analysieren, ob die verwendeten Farbmischungen zur Zeit Picassos so bereits existiert haben.“
„Dann sind Sie wohl ein richtiger Experte, wenn es sich lohnt, Sie extra dafür aus einem kleinen Dorf in England einfliegen zu lassen?“
„Ob es sich lohnt, wird sich morgen zeigen.“
Sie wird von einem anderen Gast gerufen, der ob des längeren Wartens schon etwas ungehalten ist.
„Wir sprechen später weiter!“, vertröstet sie Robert und bahnt sich ihren Weg zwischen den Tischen hindurch.
Sie hat an diesem Abend wenig Zeit, sich weiter mit ihm zu unterhalten. Er holt seinen Block aus seinem Koffer und beginnt, eine Zeichnung von ihr anzufertigen.
Er bleibt solange, bis die Stühle auf die Tische gestellt werden. Er hat nichts mehr getrunken, er ist bereits wieder nüchtern. Sie händigt ihm die Rechnung aus. Mit dem Geld überreicht er ihr seine Zeichnung.
„Oh, vielen Dank! Das ist wunderschön! Nicht, dass Sie es am Ende selbst waren, der den Picasso gefälscht hat? Aber bei diesem Bild kann ich mir ja ganz sicher sein, dass es ein echter Robert ist.“
„Für gewöhnlich benenne ich Porträts immer ganz schlicht nach der Person, die dafür Modell gestanden hat. Diese Zeichnung hat noch gar keinen Titel.“
„Nennen Sie es einfach Luna.“
„Luna? Dann kann ich ja kaum anders, als dich zu fragen, ob du dir mit mir noch den Mond anschauen willst.“
„Wirklich? Wie alle anderen Männer vor dir es auch gefragt haben? Ich dachte schon, du wärst etwas Besonderes.“
„Das habe ich nie behauptet.“
Er wartet, bis sie alles hergerichtet hat und sie das Lokal abschließen kann. Sie spazieren durch kleine Gassen, lauschen in der Ferne rufenden Tieren. An einem Haus bleibt sie plötzlich stehen.
„Das ist mein Zuhause.“
„Oh. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht.“
„Wo schläfst du heute Nacht?“
„Ich weiß noch nicht. Ich werde schauen, wo ich eine Unterkunft finde.“
„Ich glaube nicht, dass du um diese Uhrzeit noch viel Glück haben wirst. Die einzige Pension, die ich hier in einem Umkreis von 20 Kilometern kenne, ist die von Pablo und so wie ich ihn wiederum kenne, schlägt er sich nicht die Nächte um die Ohren, nur damit sich eine einsame Künstlerseele noch zu ihm verirren kann.“
Robert schaut auf seine Uhr.
„Oh, dann muss ich wohl warten, bis es wieder hell wird.“
„Ich kann dir anbieten, dass du bei mir auf dem Sofa schlafen kannst.“
„Das klingt nach einer guten Lösung.“
***
Aus einer Truhe holt sie Bettzeug. Sie setzt sich im Schneidersitz auf den Teppich vor die Couch und stopft ein Kopfkissen in einen Bezug. Während sie den Bezug zuknöpft, setzt sich Robert ebenfalls in den Schneidersitz vor sie. Ihre Augen haften an den Knöpfen, seine Augen an ihren. Sie merkt, wie er sie betrachtet und lässt es sich nicht anmerken. Sie wagt es nicht, zu ihm aufzublicken. Sie will den Moment hinauszögern, bis die Spannung nicht mehr zu ertragen ist.
Mit den Fingerkuppen seiner rechten Hand fährt er ihr nun ganz sanft durch ihr Haar. Er berührt sie so zart, dass es ihr fast wie eine Einbildung vorkommt. Er fährt in geraden Linien ihren Kopf hinab, er kreist mit seinem Daumen an ihrem Haaransatz. Er greift sacht ihr Ohr und geht mit den Fingern die Wölbungen bis zum Ohrläppchen entlang. Sie betastet die Knöpfe des Kissenbezugs und imitiert seine Bewegungen. Er streichelt ihre Wangen so behutsam, als fürchte er, sie könne zerbrechen.
Seine Bewegungen werden schneller, kräftiger, nehmen Gestalt an. Nun kann kein Zweifel mehr an seinen Berührungen bestehen. Umso kräftiger seine Hand nach ihr greift, desto mehr droht sie sich wirklich dem Zerspringen zu nähern.