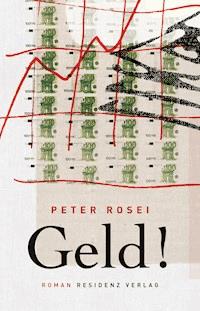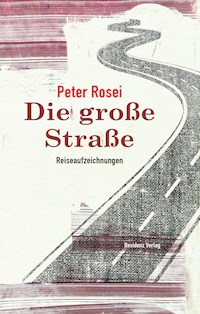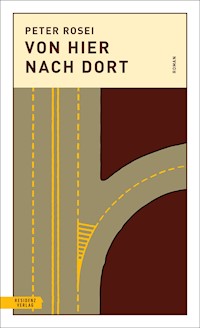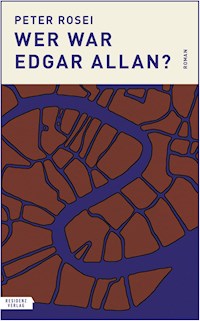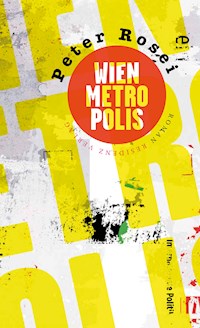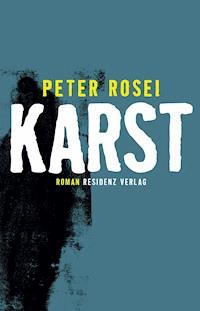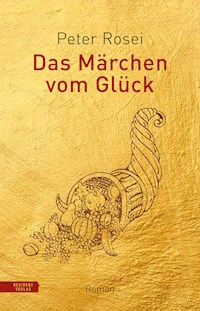
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Lena aus dem steirischen Dorf, Andràs aus dem ungarischen Plattenbau, Eva Bartuska aus der Brünner Vorstadt – sie alle suchen in Wien ihr Glück. Angetrieben von den Versprechen sozialen und ökonomischen Aufstiegs und dem Traum von der großen Liebe, lassen sie sich durch die große Stadt treiben. Doch was ist dieses vielbeschworene Glück? Manchmal ein Filialleiterposten, manchmal eine rauschhafte Nacht, und oftmals eine fadenscheinige Illusion, die an der alltäglichen Gemeinheit zuschanden geht. Und doch wäre dieser Roman kein "Märchen vom Glück", wenn Rosei hier nicht erstmals fast versöhnlich würde: Und so hat, wer den Niederungen des Lebens ins Auge schaut und alle Hoffnung fahren lässt, am Ende doch Anrecht auf, ja, das ersehnte Glück …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Rosei
Das Märchenvom Glück
Roman
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
© 2021 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Umschlaggestaltung: buero 8/Thomas Kussin
Lektorat: Jessica Beer
ISBN eBook 978-3-7017-4654-5
ISBN Print 978 3 7017 1741 5
Wir danken für die Unterstützung:
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Es wird mir ganz angst um die Welt,wenn ich an die Ewigkeit denke.
Georg Büchner
1
Lena arbeitete als Altenpflegerin. Sie war nicht diplomiert und machte ihren Job nur so. Wie sie später dem András erzählen sollte: »Meine erste Stelle hatte ich bei einer alten Dame in der Inneren Stadt. Ich musste ihr fast jeden Tag aus den Liebesbriefen vorlesen, die sie als junge Schönheit einmal bekommen hat. Wir saßen so da am Fenster, ich ihr gegenüber, drunten der Verkehr. Da hat sie geweint – und ich bald mit ihr, was vielleicht dumm von mir war. Aber schön war es.« Dann setzte Lena gern mit verstellter Stimme nach: »Machen Sie mir bitte eine neue Windel, Frau Lena! So hat die alte Dame nach dieser Vorleserei öfter gesagt. Ich musste sie ja wickeln. Schließlich, sie war über neunzig! Sie hat mir dann eine Menge Kleider vermacht – aber was hätte ich damit schon anfangen sollen?«
Für gewöhnlich war Lena nicht sehr gesprächig. »Das Schweigen und Stillhalten hab ich mir im Beruf angewöhnt. Schließlich reden die Angehörigen laufend herein, die regen sich auf: Machen S’ dies, machen S’ das, Lena! – Da sagst du am besten gar nichts und arbeitest weiter. – Haben S’ das schon gemacht, Lena? Und jenes? – Gehst du für die alten Leute auch einkaufen, heißt es: Sie waren doch gestern erst einkaufen! Wer isst denn die vielen Semmeln, wer trinkt denn so viel Kaffee – und so weiter: Ich kann dir vielleicht ein Lied singen! Wie geizig und kleinlich manche Leute sein können.«
Lena stammte aus der Steiermark her, aus einer Ortschaft im Süden, an der slowenischen Grenze. Die Kirche am Ende der Hauptstraße war das einzige Gebäude, das da aus der Reihe tanzte: Alle anderen Gebäude glichen einander aufs Haar. Mit dem sonntäglichen Kirchegehen war Lena groß geworden, beim Kirchegehen blieb sie. Ein Sonntag ohne Kirche, das wäre kein rechter Sonntag für sie gewesen. In der Stadt fiel sie damit auf: Regelmäßig kommen doch nur ganz alte Frauen zum Gottesdienst, zu den diversen Andachten und Vespern. Lena war fünfunddreißig, als sie den András kennenlernte. Der hatte mit dem Kirchegehen aber nicht so viel am Hut.
Der Raum war etwa vier auf drei Meter groß, wobei eine der Langseiten vollverglast war: ein großes, breites Fenster, allerdings bis auf Brusthöhe mit milchigweißer Sichtschutzfolie abgeklebt. Von der Straße her, einer stillen Nebenstraße, fiel nicht allzu viel Licht herein, sodass meist die Beleuchtung, ein einfacher Neonbalken, eingeschaltet war.
Der Raum war Teil der Lagerräumlichkeiten eines großen Supermarktes, die insgesamt fast genauso groß waren wie das Geschäft selbst: Auf Regalen oder Paletten, aber auch in den Transportkörben, in denen sie angeliefert wurden, standen die Waren herum. Das Lager war ein Labyrinth, wenn auch ein planmäßig angeordnetes. Freilich, jedes Labyrinth hat seine Ordnung. – Ferner gab es einen Umkleideraum für das Personal, eine winzige Teeküche und eben diesen Raum zur Straße hinaus, der, wenn er denn überhaupt benannt wurde, Manipulationsraum hieß – meist sagten die Angestellten einfach: hinten.
Der Raum war auch dadurch besonders, dass man von dort, über einen anschließenden Gang, an dem auch die Toiletten lagen, auf die stille Nebenstraße hinaustreten konnte: Ideal für die Raucher, die da immer einmal hinausschlüpften, um bei einem kurzen Plausch rasch eine durchzuziehen: »War gerade auf der Toilette!«, sagten sie dann zum Filialleiter, wenn sie ihm auf dem Rückweg in die Quere kamen.
Steinamanger, zu Ungarisch Szombathely, liegt etliche Kilometer von der Grenze zu Österreich ab, am Rand der großen ungarischen Ebene. Steinamanger ist keine kleine, wenn auch keine große Stadt. Im Kern alt und früher auch wohlhabend und geschäftig, hatten die Kommunisten allerhand Industrien hier angesiedelt. Solange der Ostblock bestand und also auch der nicht zuletzt durch den Eisernen Vorhang separierte und abgeriegelte Wirtschaftsraum, florierten diese Industrien. Heute sieht man, fährt man aus der Stadt hinaus, die Mauern der stillstehenden oder schon zu Ruinen zerfallenen ehemaligen Fabriken hinter Unkrautstauden, daneben die aufsprießenden neuen Niederlassungen ausländischer Konzerne.
»Was hätten wir früher drüben in Österreich auch schon zu suchen gehabt, mit unserem Geld – ganz abgesehen von der gesperrten Grenze?«, stellte András denn auch gern die rhetorische Frage, wenn einmal die Rede auf seine Herkunft kam.
Zu Anfang war András meist im Manipulationsraum beschäftigt. Um ehrlich zu sein: Das war ihm auch am liebsten so. Er arbeitete gern für sich allein. Sein Deutsch war nicht allzu gut. Unterbrach er dann hin und wieder, trat er vor die Tür hinaus, um eine zu rauchen.
Vor allem die Obst- und Gemüsevitrinen waren das Revier des András. Die meiste Ware kam ja fertig abgepackt herein, brauchte also nur ein- und nachgeschlichtet zu werden. Gelegentlich allerdings, insbesondere zur Haupterntezeit gewisser Obst- und Gemüsesorten, kamen die Früchte auch in großen Containern und wurden erst in der Filiale abgepackt: Äpfel, Birnen, Orangen, Zitronen – aber auch Kartoffeln, Zucchini oder Karotten.
Im Manipulationsraum werkte András an einem großen Tisch: Er hatte da eine Metalltrommel, von der er die Plastiknetze abzog, mit einem Metallklip verschloss, sie mit eingewogener Ware füllte, zuletzt auf der anderen Seite wieder verschloss und auf einer Palette verstaute. Daneben war es seine Aufgabe, die in den Vitrinen ausgelegte Ware laufend zu überprüfen, etwa faul oder unansehnlich Gewordenes auszusortieren und hinten das noch Brauchbare neu abzupacken – um es dann frisch wieder auszulegen.
Freilich, war in seinem Revier nichts zu tun, wurde er auch zu anderer Arbeit eingeteilt, meist aber im Lager: Da hieß es, Lattenkisten und Emballagen möglichst klein zusammenzustauchen, um sie für den Abtransport ins Recycling platzsparend in Rollcontainern unterzubringen. András war kräftig, eher gedrungen die Statur, beinah bullig: der Nacken kurz, der Kopf fast rund, das Gesicht breit. Ein wenig sah er mit seinen dichten, schwarzen Haaren wie ein kleiner Stier aus. András hatte dunkle Augen, die bei Gelegenheit, insbesondere wenn er zornig war oder sich für etwas begeisterte, feurig auf blitzen konnten – Letzteres kam allerdings selten vor. Meist war er still und in sich gekehrt, was man so nennt: »Ich weiß nicht, was die Leute so viel zu reden haben«, sagte er gern. »Bist halt kein richtiger Wiener!«, sagten darauf die Leute, die ihn insgeheim wohl für ein wenig belämmert hielten.
Wenn ihn aber etwas beschäftigte und wirklich echt anging, schaute einem der András direkt in die Augen. Er hielt dann fast stur den Blick. Offenbar glaubte er, dass Ehrlichkeit sich so zeigt: im direkten Blick. Es wäre ihm wohl nie eingefallen, dass man auch so, auf diese Art, lügen kann – die anderen belügen oder, was vielleicht schlimmer ist, sich selbst.
Visvary András, wie er mit vollem und richtigem Namen und nach ungarischer Schreibung hieß, war gleich nach der Schule in eine Konservenfabrik, am Stadtrand von Steinamanger gelegen, eingetreten. Nicht in der eigentlichen Produktion war er beschäftigt gewesen, vielmehr hatte er als Lager- und Platzarbeiter mit dem Zusammenstellen von Lieferungen, ihrer ordnungsgemäßen Verpackung und Verladung zu tun gehabt.
Man muss sich ein von einer Ziegelmauer umgebenes Areal vorstellen, etliche Lagerhallen, dazu das eigentliche Werk, das sich als zweigeschossiger, glatt verputzter Bau deutlich und prominent abgehoben hatte. Außerhalb der Umfassungsmauern unbebaute Grundstücke, wo zwischen allerhand Unkraut öfter Raubvögel aufgeflogen waren. Steil und senkrecht stiegen die auf: Ging gegen Ende des Winters der Schnee weg, sah man im jauchigen Boden die Gänge der Mäuse, die diese wirr und planlos unter dem Schnee gegraben hatten, freilich, was die Raubvögel anging, doch wohl eher umsonst.
András wohnte in einem der Plattenbauten am Stadtrand. Er hatte da ein Zimmer, noch bei den Eltern, die auch in der Konservenfabrik gearbeitet hatten, der Vater als Maschinenmeister, die Mutter am Fließband. Die Wohnung war nicht schlecht gewesen, im Sommer vielleicht ein wenig heiß, hatte sogar einen Balkon gehabt, der freilich als Abstellraum benutzt wurde und mit allerhand Zeug vollgestellt gewesen war.
»Bei meinem Gehalt hätte ich mir eine eigene Wohnung auch gar nicht leisten können. Was verdienst du denn schon – als ungelernter Anfänger? So habe ich gehofft, dass einmal eine andere Zeit kommt. Und sie ist ja auch gekommen!«, schloss András derlei Berichte mit einem in gewisser Weise triumphierenden Unterton ab, wenn er auch gleichzeitig den Kopf senkte, als gäbe es da doch einen Haken.
»Warst ja ein richtiges Muttersöhnchen! Bist an der Kittelfalte gehangen, was?«, bekam er dann öfter von den Kollegen zu hören. Er zuckte bloß mit den Schultern, machte eine bärbeißige Miene, sagte aber nichts darauf.
Der Haken, der András bei solcher Gelegenheit auf kam und sich spießte, war der: Wie lange hatte er die Eltern nicht gesehen! Wie lange hatte er ihnen nicht geschrieben! Zwar gingen gelegentlich Briefe hin und her. Mühsam stoppelte er ein paar Zeilen am Tisch in seinem Wiener Untermietzimmer zusammen. Was sollte er schreiben? Was könnte die Eltern denn interessieren? Es ging so gar nichts vor in seinem Leben. Ein Tag wie der andere. Zwar, der letzte Brief lag Wochen zurück … – Las er die Briefe der Eltern, und er las sie öfter, war ihm, als kämen diese Briefe aus einer Welt, die ihm jetzt verschlossen war, die es, so richtig, für ihn gar nicht mehr gab. Und dort habe ich einmal gelebt? Sie würden bald sterben, die beiden Alten. Was dann? War dann alles vorbei und versunken? Aber es gibt doch ein Erinnern, es gibt doch etwas, das bleibt? András stellte sich diese Fragen nicht so direkt, wie das jetzt hier steht. Bloß so dem Sinn nach. Die Eltern tauchten ihm dann undeutlich auf, klein und fortgerückt – gingen sie nicht gerade über einen großen Platz, auf dem es Abend wird, wo die Lichter schon anspringen? Wohin und wozu? – Was für Ideen!
Spät erst war András von der allgemeinen Aufbruchstimmung erfasst worden. Viele seiner Landsleute arbeiteten schon im Westen. Manche pendelten, manche gingen ganz fort. Auf einmal fühlte der András ganz deutlich: Würde er jetzt nicht gehen, es wäre zu spät. Es wäre dann zu spät. Es war Zeit. Der richtige Moment! Bestimmt würde alles jetzt besser für ihn werden: hell und kugelrund! Ihn hielt doch nichts in Szombathely. Was auch? Selbst die Eltern hatten ihm zugeredet: »Bist doch jung, András!«, sagten sie. Er war dagestanden, den Blick zu Boden gesenkt, unschlüssig. – Es kam der Tag, wo er das Nötige rasch zusammenpackte, eine Bahnkarte kaufte und nach Wien fuhr.
Zuerst hatte er schwarz gearbeitet, was eben gerade so anfiel. Schnelles Geld! Er und seinesgleichen standen an der Stadtausfahrt Richtung Süden, Triester Straße, unter der großen Bahnbrücke: Der Verkehr rollt heran. Dieser oder jener schert aus der Kolonne aus, bleibt stehen: Es wird verhandelt, gefeilscht, und wenn es passt, steigt man ein.
Man schien auf ihn, András, tatsächlich gewartet zu haben. Es lief gut, ja bestens.
Eines Tages im Frühling, es war einer dieser ersten Sonnentage gewesen, ein Samstag dazu, hatte er beschlossen, nicht an die Triester Straße zu gehen, er hatte Geld in der Tasche, und also: Da nahm sein Leben eine wundersame, eine jähe und ganz unerwartete Wende.
An diesem Tag war er, verlockt vom Sonnenschein und den Stimmen der Vögel, die aus den Bäumen der Grünanlagen und Parks zu ihm herdrangen und die ihm vorkamen wie rosa Primeln oder gelbe Himmelsschlüsseln, die frech aus dem Himmelsblau sprangen, da war er in den Prater gefahren – was er öfter schon getan hatte: Im Prater konnte man sich richtig ausgehen, da war man frei. Überkommt einen der Hunger, isst man irgendwo eine Grillwurst oder ein Schnitzel. Legt sich danach gemütlich in eine Wiese, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, schläft oder träumt einfach vor sich hin. Kommt der Abend, kann man das eine oder andere Bier trinken gehen, vielleicht einen Schnaps dazu.
Später sollte András, dachte er an diesen besonderen Tag zurück oder erzählte er davon, gern die Formulierung verwenden: wie im Roman. Dabei dachte er gar nicht an einen Roman, er las keine Bücher, sein Deutsch war ja zu schlecht, ungarische Bücher fanden sich in Wien nicht, er dachte an Fernsehserien, die er sich gelegentlich abends in seinem Zimmer ansah. Der Fernseher war überhaupt eine seiner ersten Anschaffungen gewesen. Vor allem wegen der Sportübertragungen. In den Filmen, in die er so hineinrutschte, kam es zu den buntesten, zu den seltsamsten Verwicklungen, meist gegen Schluss. Oft ging alles ganz unerwartet aus. So etwas wäre ihm nie eingefallen. Da führte, was geschah, oft gerade zu seinem Gegenteil! Man stellt sich doch etwas vor, rechnet sich etwas aus: nichts da!
Ohne Ziel oder besondere Absicht ging er zwischen den Bäumen des Praters. Unscharf erinnerte ihn alles an früher, an Szombathely. Gab es nicht auch dort einen großen Teich – mit einer Insel dazu – und auf dem Teich fuhren Boote? Auwald. Weiden, Pappeln und Erlen. Wie dunkel und ernst waren die aufragenden Bäume. Wie ehrwürdig und feierlich. Glitzernde Schnüre sanken aus der Blätterkuppel herab, die oben, zwischen den Zweigen, von Sonnenlicht durchwirkt war.
Eine Weile ging András so dahin. Ihm war, als könnte er das Lachen, die Rufe und Ausrufe vergnügter Menschen, aus dem Hintergrund hören, dabei war es, wenn er recht hinhorchte, nur das Raunen und leise Klingeln der Blätter.
Unversehens kam er an einen Wasserarm. In breiter Schleife bog er sich davor ihm weg. – Noch nie war András so weit in den Wald hineingegangen.
Wie war das nur gewesen? Er hatte den Bootssteg und das daran liegende Boot entdeckt, und gleich war der Wunsch da gewesen, eine Ruderpartie zu machen.
Ich bin ans Ufer hinunter, zum Steg. Es lag nur ein Boot am Steg – andere Boote konnte man, klein und bunt, weit unten in der Schleife des Flussarmes sehen. Zwei Frauen verhandelten gerade mit dem Bootsverleiher, die eine blond, die andere schwarz. Seltsam: Wenn ich mich zu erinnern suche, sehe ich bloß die Haare, als Wolken – und die Gesichter: rosa.
Der Mann, der Bootsverleiher, hat gesagt: »Na, vielleicht kann euch der Herr da ja rudern, euch beide? Wie wäre denn das?«
Sie haben gelacht, der Mann half den Frauen ins Boot. Dann war es an mir. Ich sprang hinein, setzte mich, nahm die Ruder – und wie ich ruderte.
Man macht sich miteinander bekannt. Also, Lena und Sonja, sie sitzen hinten im Boot, auf der Bank, die Beine überschlagen. Stretchjeans. Stöckelschuhe, Tattoos: Die eine hat ein Herz am Knöchel tätowiert, die andere einen Kussmund am Hals.
»Wo kommt ihr denn her?« Aus Straß in der Steiermark die Lena, die Blonde. Sie hat ein rundes, offenes Gesicht, wie ein Bub eigentlich, und klare, helle Augen. »Wo ist denn das, dieses Straß – irgendein Kaff?« Sie lacht laut heraus. »Kein Kaff! Straß – das ist der berühmte Grenzort. Liegt an der Grenze. Noch nie gehört? – Und du, du bist ein Ungar!«, sagt sie dem András direkt auf den Kopf zu. »Woher weißt du?« – »Das hört man doch!« – »Und was machst du, ich meine, was arbeitest du – hier in Wien?« – »Altenpflege.« Alles kommt ein wenig atemlos, schnell, es gibt ja so viel zu erzählen, viel wird auch gelacht, und András schaut, während er die Ruder durchzieht, mit schief gelegtem Kopf zu den Frauen hinauf.
»Und du?« Die andere, Sonja, die Dunkle, ist Putzfrau in einer großen Firma. »Und du, wo kommst du her?« – »Na, rat’ einmal!« – »Weiß nicht.« – »Ich bin aus Wien. Hört man das nicht?« Gelächter.
»Da macht ihr euch einen schönen Tag?«
»Ja. Wir machen uns einen schönen Tag.«
Freilich, es ist wirklich ein schöner, ein wunderschöner Tag, vom Wasser her ist es noch kühl, aber vorn, wo der Flussarm sich biegt, kommt breit die Sonne über die Bäume herein, die Frauen lassen ihre Hände ins Wasser hängen, plantschen darin.
Es war wie ein Tor, wie ein großes Tor, durch das wir so in den Tag und die Stunde hineingefahren sind.
Später, im Volksprater, die Märchenbahn, die Geisterbahn, das Wasserschloss, die Hochschaukel, wir lassen nichts aus, wir sind jetzt ein Trio, wir fahren und fliegen hoch, da sind wir einander ganz nah, unter Gelächter und kleinen Schreien der Frauen.
Und ich bin der Mittelpunkt, ich, András.
Ich schau der Lena kurz in die Augen, es ist am großen Ringelspiel, ich erinnere mich, an der Kassa, sie sucht in ihrer Handtasche nach der Börse, und ich sage: »Nein, nein – ich mach’ das schon!«, und ganz unbedacht schau ich ihr dabei in die Augen: in dieses Helle, Klare, das ein wenig wie Eis ist – und, kehr um die Hand, wieder warm, wie Honig.
Wir sitzen im Biergarten, die Sonne steht schon tief, blitzt nur gelegentlich zwischen den Baumstämmen und Ästen durch, Kastanien mit weißen, ein wenig schon abgeblühten Kerzen, den dunklen Wedeln, der Tisch vor uns voll leerem, dreckigem Geschirr. Wir haben es uns gut sein lassen.
»Ich lass’ euch jetzt allein, euch zwei«, sagt Sonja da, steht einfach auf, zwinkert uns zu und geht.
»So bleib doch!«, rufen wir wie mit einer Stimme – aber ganz ehrlich gemeint ist das nicht.
Wie aus schlechtem Gewissen reden wir zwei dann über nichts anderes als gerade über die Sonja, was die für eine ist, wo sie arbeitet, dass sie Pech in der Liebe gehabt hat, dass sie ein feiner Kumpel ist und so weiter – wir reden und reden.
Es gab da ein kleines Problem, das ich erwähnen muss. Aber was heißt da: Problem? – Als ich nach Wien kam, hat mich ein Landsmann bei sich unterkommen lassen, ich hatte ja keine Wohnung, kein Zimmer – und keine Ahnung, wie man sich über kurz eine beschafft. Also, der Lajos hat mich auf der Couch schlafen lassen, der war so nett.
Was soll ich viel erzählen? Es war ein Abend, der war auch im Prater. Der Lajos und ich waren ganz bierselig, ich weiß nicht, wie viel wir getrunken hatten. Es war gerade so ein Abend wie der mit der Lena. Ein Sommerabend. Vor der großen Schaukel, der Schiffsschaukel, wir stehen da und schauen zu, wie die große Schaukel hin und her geht, da legt mir der Lajos den Arm um die Schultern.
Der Himmel war schwarz, warm und dicht die Luft, und die Sterne waren wie Löcher, durch die es hell heruntergeblitzt hat.
Nach Straß, in Lenas Heimatort, komme ich erst Jahre später, da sind Lena und ich längst ein Paar. Mittlerweile sind wir zusammengezogen, wir haben jetzt eine gemeinsame Wohnung, in Ottakring draußen, in einer Parallelstraße zum Gürtel.