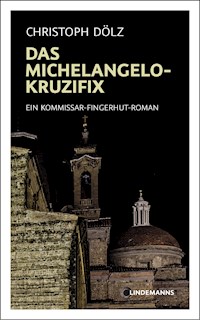
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: INFO Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lindemanns Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Der Historiker Mateusz Zelter wird neben seinem brennenden Wagen aufgefunden. Ein Pathologe stellt fest, dass der Autounfall nicht ursächlich für seinen Tod war. Kriminalhauptkommissar Isidor Fingerhut ermittelt in der zu plötzlichem Reichtum gekommenen Kleinstadt Schnait am See, wo Zelter für die Biografie eines lang verstorbenen Priesters und Kriegshelden recherchiert hatte. Was hatte der Historiker entdeckt? Die Antworten darauf liegen im irrwitzigen Schicksal eines Nürnberger Juden im Italien des Zweiten Weltkriegs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Dölz
Das
Michelangelo-
Kruzifix
Ein Kommissar-Fingerhut-Roman
LINDEMANNS
Alle geschilderten Handlungen
und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig.
Christoph Dölz, geboren in Berlin, aufgewachsen in Bad Vilbel bei Frankfurt am Main, beschäftigt sich seit früher Jugend intensiv mit Geschichte, Kunst und Literatur. Er studierte Kunstgeschichte in Bamberg und Frankfurt sowie Englische Literatur und Kunstgeschichte in Florenz. Dort war er einige Jahre Direktor einer Privatschule. Neben leitenden Funktionen im Bildungstourismus promotete er in Zusammenarbeit mit der britischen Royal Society of Arts die vom »Erasmus-Programm« der Europäischen Union finanzierte Fortbildung der Englischlehrer*innen aus den neuen Bundesländern. Im Anschluss war er für große Unternehmen im Event- und Incentive-Bereich international unterwegs. Dölz lebt und arbeitet in der Toskana.
Prolog
Hauptkommissar Isidor Fingerhut, Chef des Dezernats 11, Tötungsdelikte, Entführungen, erpresserischer Menschenraub am Polizeipräsidium Bayreuth, ist Mitte fünfzig und von mächtiger Statur. Seine Körpergröße von ein Meter dreiundneunzig ist proportional zu seinem Leibesumfang, den eine erwachsene Frau nicht mit beiden Armen vollständig umfassen kann. Isidor Fingerhuts Schädel sitzt auf einem kurzen Hals, der aus breiten Schultern hervorkragt. Wäre sein quadratisches Gesicht Teil einer Portraitbüste aus Stein oder Holz, so würde jeder Betrachter sie als grob gemeißelt und für das Werk eines missgelaunten Bildhauers halten.
Fingerhuts sprichwörtlich sprechenden Augen oszillieren in Sekundenbruchteilen von gütig und verständnisvoll zu misstrauisch und zweifelnd, manchmal anklagend. Seiner bisweilen fesselnden Wirkung auf Menschen ist er sich bewusst und behauptet, dass dieser Umstand in manch akuten Gefahrensituationen Schlimmeres verhütet, weil er potentielle Täter von ihrem Handeln abhält.
Ein Täter muss deine Autorität als verlässlich erkennen, er muss sie anerkennen, geradezu verinnerlichen. Das passiert in Akutsituationen in den ersten Sekunden, manchmal in einem Bruchteil davon.
Wie der Sohn seinem Vater, der Angestellte seinem Boss, der Soldat dem Offizier, der Gläubige seinem Gott, so muss der Täter sich deiner Autorität beugen, dir folgen, dir vertrauen, ist eine zentrale Fingerhut’sche These. Manche Menschen folgen, andere befolgen und wieder andere gehorchen gerne. Es ist in ihrer DNA. Es nimmt ihnen Verantwortung ab und gibt ihnen so etwas wie Würde zurück, weil sie wieder Teil einer Gemeinschaft werden, die durch Respektierung grundsätzlicher Werte, Normen und Tugenden zusammengehalten wird und deshalb funktioniert.
Fingerhut ist ein Mann von großer Empathie für die Opfer und unermüdlichem Interesse für die Motive der Täter, die er in sozioökonomischen und psychischen Abhängigkeiten zu lesen versteht.
Nach seiner Überzeugung gibt es eine grobe Unterscheidung von Täterpersönlichkeiten. Da sind jene, die ihren Anspruch auf materielle Güter über den Anspruch anderer stellen und sich somit im Recht sehen zu betrügen, zu rauben, zu erpressen und, in Extremfällen, auch zu töten. Unter ihnen sind die schrecklichsten Gewalttäter, die die Befriedigung, wenn nicht materieller Ansprüche, auch ihrer Lust, über den Schmerz der anderen stellen. Diese Täter sind die Gefährlichsten, die du nicht erreichen kannst, weil die Rechtfertigung ihrer Handlungen in ihrer Persönlichkeit liegt. Sie können nichts Unrechtes tun, weil sie immer im Recht sind. Sie sind selbstherrlich und, bei Bestrafung, selbstgerecht.
Dann gibt es die Täter, die es beruflich tun, das Klauen, Hinterziehen, Fälschen, Betrügen. Man findet sie in den Institutionen, die zu den tragenden Säulen unserer Gesellschaft zählen, genauso wie in den Bars rund um den Hauptbahnhof, in Banken, in Bordellen. Sie betreiben ihr Geschäft und wissen, dass sie gegen das Gesetz und zum Nachteil anderer arbeiten. In ihrer Hybris halten sie das Risiko der Entdeckung, Festnahme und Verurteilung für kalkulierbar, weil ausgerechnet auf sie nicht anwendbar. Lange Haftstrafen, und, bei einer Vielzahl von Wiederholungen, die Sicherungsverwahrung bleiben für diese Täter abstrakt, bis die Tür plötzlich hinter ihnen ins Schloss fällt.
Und dann gibt es den Verzweiflungstäter, der aus einer seelischen Notlage heraus handelt, die sich ihm akut darstellt, der die Tat nicht plant, sondern im Moment des Affekts auch für den Splitter einer Sekunde sein physisches, materielles oder psychisches Überleben von dieser Tat abhängig macht. Wenn Menschen ihren »breaking point«, ihre Bruchstelle, erreichen, werden sie zu Tätern.
»Das kann allen passieren und mir sowieso!«, erklärt Fingerhut von Zeit zu Zeit. »Moral wird bei vielen Menschen von den Zuständen konditioniert, in denen sie leben. Die Ausnahmen sind Heilige.«
Vor seiner Karriere im Polizeidienst hatte Isidor Fingerhut einige Semester Katholische Religion und Deutsch für Lehramt an der Universität Augsburg studiert. Er ist ein musischer Mensch, nicht im Sinne eigener künstlerischer Begabung, eher in seiner Aufgeschlossenheit für Musik und Malerei. Fingerhut hat eine Schwäche für Fruchtgummis, besonders für Gummibärchen, und eine Vorliebe für erlesene Teesorten.
Polizeihauptmeisterin Philomena Miyakawa, die Assistentin von Fingerhut, ist ein drahtiger, behänder Typ mit asiatischen Wurzeln. Ihre Mutter ist Deutsche, der Vater Japaner. Sie trägt ihr Haar kurz und besitzt, was Fingerhut besonders schätzt, einen wachen Geist und viel Humor.
»Humor brauchst du in diesem Job!«, wiederholt Fingerhut allzu gerne.
Philomena siezt ihren Chef und schafft es, entsprechend einer Sitte aus dem Land ihres Vaters, das immer wieder angebotene »Du« nur im privaten Rahmen zu benutzen.
Fingerhut hingegen variiert seine Anreden. Meistens siezt er seine Assistentin, duzt sie im Dienst in wenigen Ausnahmesituationen, meist in imminenter Gefahr, im privaten Zusammensein sowieso; manchmal nennt er sie auch »meine liebe Miyakawa«.
I
Ein Mann liegt neben einem Alfa Romeo 2600 Spider, vielleicht 64er-Baujahr, auf einer steil abfallenden Streuobstwiese unterhalb des Schafskopfs, der 333 Meter über Normalhöhennull erreicht, unweit des Schnaiter Horns steht und von einem Bildstock mit Marienfigur und Christuskind-Darstellung bekrönt wird. Ein Bauer steigt von seinem Traktor und läuft zum Unfallort. Er zieht den Mann von dem brennenden Fahrzeug weg. Feuerwehr und Krankenwagen treffen ein.
II
Professor Wedekind und Kriminalhauptkommissar Fingerhut gehen über den Parkplatz des Pathologischen Instituts am Klinikum in Bayreuth. Wedekind hantiert im Gehen umständlich mit einem Trenchcoat, wobei er seine Aktenmappe erst in der einen, bald in der anderen Hand hält, um endlich stehen zu bleiben, sie zwischen die Knie zu klemmen und das Kleidungsstück, das vom Wind gleich einem Segel aufgebläht wird, ruckartig überzuziehen.
»Der Unfall ist nicht ursächlich für den Tod des Mannes«, sagt der Professor.
»Also eine Kohlenmonoxid-Intoxikation«, erwidert Fingerhut reflexartig.
»Nein. Auch keine Rußeinatmung«, sagt Wedekind. Er nimmt seine Aktenmappe und läuft weiter. »Der Mann war bereits tot.«
»Die Todesursache?«, fragt Fingerhut, wobei er sein Schrittmaß an das des feingliedrigen Mediziners anpasst.
»Eine fortgeschrittene Exsikkose. Er ist regelrecht ausgetrocknet, umgangssprachlich verdurstet. Komplett dehydriert. Die Blutprobe hat eine extrem hohe Kaliumkonzentration ergeben. War also massiv salzhaltig«, erklärt Wedekind, während er auf einen weißen Fiat 500 zuläuft und das Auto beinahe entschuldigend als den Wagen seiner Tochter deklariert, »Der Mann ist einen schrecklichen Tod gestorben. Durst ist schlimmer als Schmerzen«, fügt er hinzu. »Die Nieren versagen. Harnstoff und Harnsäure können nicht mehr ausgeschieden werden. Der Körper vergiftet sich selbst. Die Haut wird braun und riecht nach Urin. Die Kaliumkonzentration steigt weiter an, das Herz gerät aus dem Takt«, erklärt Wedekind, während er sich hinter das Steuer des Fiat setzt und den Motor anlässt.
»Es kommt zum Herzstillstand«, vervollständigt Fingerhut nachdenklich.
»Spätestens nach sechs Tagen. Oft früher«, ergänzt Wedekind. »Sie haben den kompletten Obduktionsbericht morgen auf Ihrem Rechner«, sagt der Pathologe noch, als er die Wagentür langsam zuzieht, das Fenster herunterlässt und Isidor Fingerhut im Abfahren zuwinkt.
III
Der Verleger Richard Tauber steht in seinem Büro, das durch die sparsame Ausstattung mit Möbeln aus blitzenden Edelstahlgestellen unter weißen Lederkissen eine, wenn nicht sakrale, so doch reine Atmosphäre ausstrahlt. Fingerhuts Assistentin, Philomena Miyakawa, sitzt ihm gegenüber.
»Hatte Hauptkommissar Fingerhut keine Zeit?«, fragt Tauber nervös, steht auf und misst zunächst zaghaft, dann entschieden den Raum mit immer gleich großen Schritten ab.
»Er ist bereits auf dem Weg nach Schnait«, antwortet Miyakawa ungerührt.
»Mateusz Zelter ist ermordet worden«, sagt Tauber wiederholt in einem Decrescendo der Stimme, um gleich darauf überaus erregt zu erklären, dass Zelters letztes Buch einen Shitstorm ausgelöst hatte.
»Haben Sie es gelesen?«, fragt Tauber und, ohne Philomenas Antwort abzuwarten, fährt fort, dass es in Zelters Buch um die Nachfahren der braunen Eliten ging, die heute wieder Rechtsextreme mit Finanzspritzen päppeln.
»Nach 1945, in der Adenauer-Zeit, waren es originäre Nazi-Seilschaften, die sich Positionen und Erträge zuschacherten. Heute sind deren Enkel unterwegs, unsere Demokratie mit ihrem rechten Gift zu kontaminieren.«
Tauber bleibt vor einem wandhohen, weißen Regal stehen. Er zieht zwei prall gefüllte Ordner heraus und legt sie vor Philomena auf seinen Schreibtisch.
»Zelter nennt in seinem Buch illustre Namen«, sagt der Verleger leise, beinahe konspirativ, wobei er den Aktendeckel einer der beiden Ordner aufschlägt. »Und das ist deren Reaktion: Morddrohungen, dutzendweise.«
Philomena liest die oben aufliegende, erste von vielen hundert abgehefteten Mails, die voller Hass ist und dem »innigsten« Wunsch Ausdruck gibt, der Autor von »Das Braune Erbe. Wie die Enkel prominenter Nationalsozialisten den aktuellen Rechtsextremismus finanzieren« solle in einem Verkehrsunfall schwerste Verletzungen erleiden, die ihn nicht töten, ihm aber ein qualvolles, Jahrzehnte andauerndes Wachkoma bescheren.
»Das ist ja grauenhaft!«, ruft Philomena aus und stößt den Ordner ein Stück von sich weg. »Haben Sie das nicht angezeigt?«
Natürlich hatten Tauber und Zelter Strafanzeige um Strafanzeige gestellt. Derselbe Staatsanwalt, der jetzt die Ermittlungen leitet, hatte immer wieder die Auskunft gegeben, dass man als Autor und Verleger vieles aushalten müsse, dass zuerst zu prüfen sei, ob die eine oder andere Äußerung nicht doch unter dem Schutz von Artikel 5 Grundgesetz, also der Meinungsfreiheit, stehe und, dass es sich bei den Absendern oft um Fake- oder Wegwerf-Adressen handele, die über internationale Anbieter von 10-Minuten-Mails laufen, dass die Nachverfolgung der IP-Adresse theoretisch möglich sei, doch sehr aufwändig, auch kostspielig, und die Personalressourcen einfach nicht vorhanden seien.
Philomena zieht den Ordner wieder zu sich heran. Sie blättert mit spitzen Fingern Seite um Seite um, als wolle sie verhindern, von der Druckerschwärze dieser menschenverachtenden Parolen beschmutzt zu werden.
IV
Fingerhuts Fahrt nach Schnait am See gestaltet sich schwierig. Auf der Landstraße, wenige Kilometer vor Zellach, der größeren, Schnait vorgelagerten Kreisstadt, fängt der Motor von Fingerhuts Mercedes 220 SE Cabriolet plötzlich an zu stottern. Da Fingerhut an seinem alten Benz hängt, gibt er konzentriert und vorsichtig Gas. Der Motor heult zwar auf, verweigert sich dann doch, ruckelt wieder. Der Kommissar klopft leicht, immer wieder aufmunternd, auf das Lenkrad, streichelt es bald. »Komm! Baby. Nicht schlappmachen. Nicht in dieser Pampa. Auf geht’s!«
Fingerhut lässt seinen Oldtimer schließlich in einer Haltebucht ausrollen. Als er sein Smartphone vom Beifahrersitz nimmt, um im Netz nach einem Abschleppdienst zu suchen, muss er feststellen, dass, natürlich, kein Netz in dieser Pampa vorhanden ist.
»Im Funkloch. Und jetzt?«
Da hört er ein deutliches Fiepen, das aus dem angrenzenden Getreidefeld kommt. Er dreht sich um, den Kopf hin und her, kann aber nichts entdecken. Er steigt aus, klappt die Motorhaube auf, wie jemand der, ganz im Gegensatz zu seiner Inkompetenz in punkto Technik, KFZ-Expertise besitzt. Er sieht nichts als diesen perfekt restaurierten, wenige Jahre zuvor komplett überholten silberglänzenden Motorblock. Er geht zum Kofferraum, zieht sich eine Warnweste an, nimmt das Warndreieck heraus und läuft einhundert Meter auf der Landstraße zurück, wo er es aufstellt. Als er sich umdreht, sieht er in einiger Entfernung eine Frau mit einer großen Umhängetasche in seine Richtung kommen. Sie sucht ganz offensichtlich etwas. Die Frau biegt das hochgewachsene Getreide beiseite. Fingerhut winkt ihr zu. Erst als Fingerhut zu rufen beginnt, schaut die Frau auf und hält den ausgestreckten Zeigefinger an die gespitzten Lippen als Zeichen, still zu sein. Fingerhut sieht die Frau eine Decke aus der Umhängetasche nehmen, sich bücken, zwischen den hohen Ähren verschwinden und bald wieder auftauchen. Sie hat ein Bockkitz in die Decke eingeschlagen und kommt damit auf Fingerhut zu. Das Kitz ist wie versteinert. Es bewegt sich nicht.
»Da haben wir noch mal Glück gehabt! Glück im Unglück.«
Die Frau erzählt, dass sie am selben Morgen eine tote Ricke neben der Landstraße gefunden habe. »Gleich da hinten«, sagt sie und zeigt auf einen breiten, gepflasterten Weg, »an der Zufahrt zu meinem Hof.«
Auf Fingerhuts vielleicht unüberlegte Nachfrage, woher sie wusste, dass das tote Reh ein Junges zu versorgen hatte, antwortet die Frau, dass das Reh ein deutlich dickes Gesäuge hatte.
»Da konnte das Kitz nicht weit sein.«
Fingerhut bemerkt, dass auch er das Fiepen gehört habe, während er im Netz nach einem Abschlepp ... Die Frau schneidet Fingerhut das Wort ab, lacht die Worte »Smartphone« und »Internet« mit deutlichen, spöttischen Fragezeichen in der Stimme heraus und bietet dem Kommissar an, von ihrem Festnetz aus zu telefonieren. Fingerhut schließt sogleich das Verdeck seines Cabriolets, schlägt die Motorhaube und den Kofferraum zu und dreht die Schlüssel in beiden Türschlössern.
Kaum eine halbe Stunde später sitzt Fingerhut im Führerhaus eines Abschleppwagens. Zwischen dem Fahrer und ihm liegt ein kleiner, schwarz-weißer Hund, der mit seiner Schnauze Fingerhut an dessen Hand stupst, damit auffordert, ihn am Kopf zu kraulen, um sich bald darauf auf dem Rücken zu räkeln und das Streicheln auch für seinen Bauch zu reklamieren. Als Fingerhut sich anerkennend beim Fahrer bedankt, dass es ja wirklich schnell gegangen sei, streckt der ihm die Hand entgegen und stellt sich vor: »Kein Problem! Ich bin Azikiwe.«
»Isidor, Isidor Fingerhut.«
Azikiwe zeigt auf den bauchseitigen Hund und erklärt, dass dieser Isabella heiße, worauf Isabella sich plötzlich dreht, aufspringt und Fingerhut das Gesicht ableckt, was wiederum Azikiwe veranlasst, Isabella zu ermahnen.
»Isabella. Basta! Stai giù!«
»Ah, eine Italienerin!«, bemerkt Fingerhut erstaunt.
Azikiwe bestätigt, dass die kleine Hündin aus Italien stamme, aus Orbetello in der Toskana. Isabella schaut den Kommissar an, als wolle sie zustimmen.
Fingerhut erwähnt noch, dass er Orbetello kenne, mehrmals auf der Fahrt nach Porto Santo Stefano dort durchgefahren sei, wo an der gegenüberliegenden Insel Giglio vor zehn Jahren ein Kreuzfahrtschiff auf Grund gelaufen sei.
Es stellt sich heraus, dass Azikiwe die Tochter des Zellacher Abschleppunternehmers und Werkstattinhabers in der Toskana kennengelernt hatte, als er noch Pareos, Hüte und andere Sachen auf den dortigen Stränden verkaufte.
Fingerhut zieht eine Tüte Gummibärchen aus seiner Jacketttasche, öffnet sie und hält sie Azikiwe hin.
»Nein danke! In den Gummibärchen ist Gelatine aus Schweineschwarten drin. Ich esse kein Schwein.«
Im Hof der Autowerkstatt angekommen, senkt Azikiwe die Ladefläche des Abschleppwagens ab und lässt Fingerhuts Wagen an Seilen gesichert über Teleskopschienen auf den Hof rollen. Fingerhut nimmt sein Gepäck aus dem Kofferraum. Ein älterer Mann und eine junge Frau in Overalls kommen aus der Werkstatthalle. Sie gestikulieren, dass ihre Hände schmutzig seien, und strecken Fingerhut ihre Ellenbogen hin, die auch schmutzig sind.
»Wir müssen Ihren Wagen heute Nacht auf dem Hof stehen lassen. In der Werkstatt stinkt alles nach dem ausgebrannten Unfallwagen«, erklärt der ältere Mann.
»Ausgebrannter Unfallwagen? Der Alfa von Doktor Zelter steht bei Ihnen?«
»Ja! Aber woher wissen Sie ... ich meine den Namen?«, fragt Azikiwe überrascht.
»Ich leite die Ermittlungen.«
Es folgt ein Moment des Schweigens.
»Ermittlungen?«, fragt die junge Frau im Overall. Ohne darauf einzugehen, bittet Fingerhut, das Unglücksfahrzeug sehen zu dürfen.
»Natürlich!«, antwortet der ältere Mann und geht einen Schritt zur Seite.
Der Alfa Romeo Spider ist zu einer Karkasse verkommen, vom Verdeck ist allein das Gestänge erhalten, der rote Lack in tellergroßen Schuppen weggeplatzt, in den Sitzen stecken verrußte Metallfedern. Der Geruch von verbranntem Gummi und Kunststoff wabert in der Luft.
»Ich veranlasse das! Spätestens übermorgen wird das Kriminaltechnische Institut das Wrack abholen«, sagt Fingerhut und fragt nach einer Busverbindung nach Schnait. Azikiwe, der den Kommissar noch überrascht mustert, bietet an, ihn zu fahren. Fingerhut lehnt mit der Begründung ab, dass er Land und Leute kennenlernen will und gerne öffentliche Verkehrsmittel nutzt.
»Na dann!«, sagt Azikiwe und zeigt auf eine Bushaltestelle gleich gegenüber dem Werkstatttor. »Seit dem Hype mit dem Michelangelo-Kruzifix fahren die Busse hier viertelstündlich.«
V
Azikiwe sollte Recht behalten Der Überlandbus kommt nach wenigen Minuten. Tickets gibt es beim Fahrer, der zu Fingerhuts Erstaunen auf ein OnlineTerminal zeigt und meint, dass Fingerhut auch mit Kreditkarte zahlen könne, dass das einfacher sei.
Wie in aller Welt hatte der eine Verbindung, wo er mit seinem Smartphone doch gerade noch im Funkloch gesessen hat? »Only God knows«, denkt Fingerhut und setzt sich neben einen Zeitungsleser, was sich als äußerst unbequem erweisen soll, weil der Mann sich bei jedem Umblättern umständlich zu ihm herüberbeugt. Der Kommissar wechselt daraufhin den Platz und setzt sich neben einen Typ in Arbeitskleidung mit Bierdose, der erst rülpst, bald aufsteht und aussteigt, worauf Fingerhut sich auf den Fensterplatz setzt und endlich die Landschaft genießen kann. Der Bus erreicht schließlich einen belebten Parkplatz, wo asiatische Reisegruppen aus Touristenbussen strömen, zahlreiche Taxen und Shuttle-Limousinen halten, Privatwagen parken und Fahnen schlaff von hohen Masten hängen.
Als Fingerhut aussteigt, scheint ihm die Sonne so stark ins Gesicht, dass er seine Augen mit der Hand abschirmen muss. Er fingert mit der anderen, der rechten Hand, in seiner Brusttasche, zieht eine Sonnenbrille heraus, senkt den Kopf und setzt sie auf. Erst jetzt kann er das reizvolle Panorama des historischen Städtchens, denn das ist Schnait ohne Zweifel, bewundern. Erhöht steht da das mächtige Schloss, um welches sich die Häuser der Altstadt wie Küken um die Henne scharen. Etwas entfernt glitzert silbern das Wasser im See. Vom Turm der Sankt-Nicolai-Kirche ertönen zwei Glockenschläge.
Fingerhut überquert den Parkplatz und läuft mit den Menschenströmen Richtung Altstadt und weiter auf den sehr schmalen Bürgersteigen hinein in die verkehrsberuhigte Zone. Unter den vielen Fußgängern, die ihm in den Gassen entgegenkommen, fast ausnahmslos mit beseelten Gesichtern, einige eilig, geschäftig, andere verträumt bummelnd, fällt ihm eine junge Frau auf, die sehr einfach mit taubenblauem Kittel und grauer Schürze gekleidet ist, beinahe wie eine Dienstbotin aus dem neunzehnten Jahrhundert. Sie hält einen vielleicht zwölfjährigen Jungen an der Hand. Sie bleibt vor Fingerhut stehen, lächelt ihn an, während der Junge den Kopf gesenkt hält, ihn bald nach oben dreht und Fingerhut mit leeren Augen anblickt, ihn aber nicht wahrzunehmen scheint. Im nächsten Moment weicht die junge Frau Fingerhut aus, zieht das Kind hinter sich her und läuft weiter. Fingerhut ist schon ein gutes Stück entfernt, als ihm eine innere Stimme zuflüstert, sich noch einmal umzudrehen. Im selben Augenblick dreht sich auch die junge Frau zurück und blickt zwischen all den Menschen zu Fingerhut herüber.
Der Kommissar erreicht den Gasthof »Zum Goldenen Einhorn«. Am Eingang hängt ein Schild aus Emaille, worauf die Öffnungszeit für das Abendessen angegeben ist: »ab 18:30 Uhr«. Darunter steht der Hinweis für Hotelgäste, den linken Eingang zu benutzen und die Angabe »10 Meter«.
Auf Fingerhuts Läuten einer Türglocke öffnet ihm ein grün beschürzter, etwa sechzig Jahre alter Mann, der Hausdiener, wie er annimmt. Er trägt Fingerhuts Trolley über eine steile Stiege in den ersten Stock und weiter einen Flur entlang und über eine Spindeltreppe mit schmiedeeisernem Handlauf Stufe um Stufe hinauf bis zu einem Absatz vor einer Zimmertür mit der Aufschrift »Turmzimmer«, die der grün beschürzte Mann wortkarg, allein von einem einfachen »Bitte!« begleitet, aufstößt. Fingerhut blickt auf historische Möbel und weiter durch das Fenster auf das Schloss und hinunter in den blühenden Garten des Gasthofs, wo Sonnenschirme stehen und Stimmen unsichtbarer Menschen zu ihm heraufdringen.
Fingerhut gibt ein Trinkgeld. Der Mann lächelt nicht, zwinkert matt aus wässrig grauen Augen. Fingerhut stellt sich vor, dass er in seinem Leben, vielleicht seit früher Jugend, immer zu Diensten gewesen ist, und seine Lehrmeister ihm antrainiert haben, immer dankbar zu sein und diese Dankbarkeit stets deutlich zu zeigen. Und der Mann war in der Tat zeitlebens dankbar gewesen, vielleicht seit seinem vierzehnten Lebensjahr unendlich dankbar gegenüber tausenden und abertausenden von Gästen, nein, nicht in Schnait am See, vielleicht in großen Hotels in der Welt. Und jetzt, nach weit mehr als 40 Beitragsjahren kann er von seiner Rente nicht leben und muss sich als Hausdiener in einem alten Gasthof ein paar Euro dazuverdienen. Jedoch, nur als Hausdiener, nicht als Kellner, weil man ihn im Restaurant nicht mehr will, zu alt, zu gebückt, grau und langsam. Da hat sich die Dankbarkeit etwas gelegt, die mit dem Mann in die Jahre gekommen ist, sie ist müde geworden, unmerklich.
VI
Don Prospero steht in der Sakristei von Sankt Nicolai. Er nimmt sein Birett vom Kopf, legt es neben die liturgischen Gewänder, die auf einer zentralen Kredenz fein säuberlich aufgestapelt sind, und hält inne. Er stützt sich mit beiden Händen gegen das mächtige Möbel, als wolle er es aus dem Mittelpunkt des Raumes schieben. Don Prospero verharrt in dieser Position einige Sekunden, stößt sich ab und zurück ins Lot, geht in eine Ecke der Sakristei und wäscht sich die Hände über einem kleinen Wasserbecken, dessen Abfluss direkt ins Erdreich führt.
»Gib Tugend, o Herr, meinen Händen, dass jeder Makel abgewaschen werde, damit ich Dir ohne Befleckung des Leibes und der Seele zu dienen vermag«, meditiert er laut, bald singend.
Don Prospero geht zurück an die Kredenz, nimmt das Amikt, ein rechteckiges Tuch aus weißem Leinen, von dem zwei lange Bänder hängen, küsst es, legt es kurz auf seinen Kopf.
»Setze, o Herr, auf mein Haupt den Helm des Heiles, um alle teuflischen Anfechtungen zu bezwingen.«
Don Prospero legt das Amikt auf seine Schultern, steckt den Saum unter den weißen Kragen seiner Soutane und befestigt es mit den Bändern, die er um seinen Oberkörper schnürt und mit einer Schleife vor seiner Brust verschließt. Er streift die knöchellange Albe über, die an ihren Ärmeln und an ihrem Saum mit feiner Spitze versehen ist. In der Spitze des Saums sind Strahlenkränze zwischen Kreuzen, Herzen und drei Kreuznägeln sowie die Kurzform des Namens Jesu »IHS« eingearbeitet.
»Läutere mich, o Herr, und reinige mein Herz, da- mit ich, im Blut des Lammes weiß gewaschen, die ewigen Freuden genieße.«





























