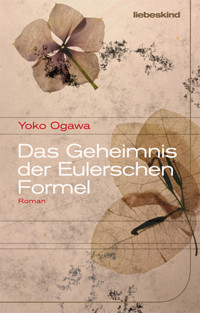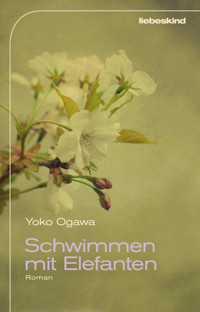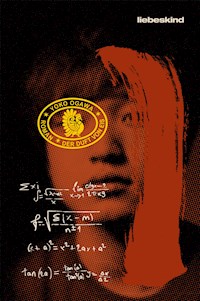9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlagsbuchhandlung Liebeskind
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein junger Mann kommt in ein abgelegenes Dorf in der Provinz. Unter Anleitung einer alten Dame soll er dort ein Museum einrichten, das eine Sammlung von Alltagsgegenständen beherbergt. All diese Gegenstände wurden von ihr gestohlen, um die Erinnerung an verstorbene Dorfbewohner zu bewahren: die Heckenschere eines Gärtners, das Diaphragma einer Prostituierten, das Skalpell eines Arztes, das Glasauge eines Organisten ... Aufgabe des jungen Mannes ist es zunächst, alles zu erfassen, zu ordnen und zu katalogisieren. Doch bald schon wird er von der alten Dame bedrängt, an ihrer Stelle den Erinnerungsstücken der Dorfbewohner nachzujagen. Als jedoch eine junge Frau ermordet und der junge Mann am Tatort gesehen wird, verdächtigt ihn die Polizei, die Tat selbst begangen zu haben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Yoko Ogawa
Das Museum der Stille
Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe und Kimiko Nakayama-Ziegler
Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Chinmoku Hakubutsukan« im Verlag Chikuma Shobo, Tokio.
© Yoko Ogawa 2000
© Verlagsbuchhandlung Liebeskind 2005
Alle Rechte vorbehalten
Yoko Ogawa wird durch das Japan Foreign-Rights Centre vertreten
Umschlagmotiv: Getty Images
Umschlagkalligrafie: Danai Afrati
Umschlaggestaltung: Robert Gigler, München
eISBN 978-3-95438-164-7
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
1
Bei meiner Ankunft im Dorf hatte ich nichts weiter bei mir als eine kleine Reisetasche. Ein paar Kleidungsstücke, Rasierzeug, Schreibutensilien, ein Mikroskop und zwei Bücher – eines über Museumskunde und das Tagebuch der Anne Frank. Mehr war nicht darin.
Im Schreiben meiner Auftraggeberin stand, ich würde vom Bahnhof abgeholt, aber da ich ihr nichts über mein Äußeres mitgeteilt hatte, fragte ich mich etwas beunruhigt, ob wir uns womöglich verfehlen könnten. Ich verließ das Gleis über eine Treppe und ging durch die Bahnsteigsperre. Außer mir war niemand an dieser Station ausgestiegen.
»Herzlich willkommen.«
Die Frau, die sich von einer Bank im Wartesaal erhob und auf mich zukam, war erheblich jünger, als ich es erwartet hatte, eigentlich noch ein Mädchen. Ihre Umgangsformen wirkten so fein und höflich, dass mir vor Verlegenheit keine passende Begrüßung einfiel.
»Wenn Sie mir bitte folgen wollen«, sagte sie, meine Unsicherheit übergehend, und brachte mich zu einem Wagen.
Nachdem wir eingestiegen waren, wies sie den Chauffeur an loszufahren.
Obwohl die Luft des beginnenden Frühlings noch recht frisch war, trug sie über ihrem leichten ausgestellten Baumwollkleid nicht einmal eine Strickjacke. Der Himmel war wunderbar klar, und der Wind blies nur ein paar dünne Wölkchen vor sich her. An sonnigen Flecken blühten Krokusse, Narzissen und Margeriten.
Vom Bahnhof aus fuhren wir eine breite Straße am Marktplatz entlang und erreichten bald eine offene Landschaft aus Feldern und Gärten. Rechts von der Straße wucherte Gestrüpp, links breiteten sich Kartoffeläcker aus, hinter denen sich Wiesen und Weiden erstreckten. Wo am Horizont Hügel und Himmel aufeinandertrafen, ragte ein Glockenturm auf. Die gesamte Szenerie war gleichmäßig von der Sonne überflutet, die sich offenbar vorgenommen hatte, sämtliche Überreste des kalten Winters wegzuschmelzen, die sich noch im Schatten des Unterholzes verbargen.
»Es ist schön hier«, sagte ich.
»Es freut mich, dass es Ihnen gefällt.«
Mit geradem Rücken, beide Hände sittsam auf die Knie gelegt und den Blick nach vorne gerichtet, saß die junge Frau da. Nur wenn sie etwas sagte, neigte sie den Kopf und senkte den Blick in Richtung meiner Schuhe.
»Ich glaube, wir werden gut mit der Arbeit vorankommen.«
»Ja, meine Mutter hofft das auch.«
Erst jetzt dämmerte es mir, dass sie die Tochter meiner Auftraggeberin war.
Sooft der Wagen um eine Kurve bog, schwang ihr Haar zur Seite und verbarg einen Teil ihres Profils. Es wirkte so glatt und natürlich, als wäre sie noch nie bei einem Friseur gewesen.
»Meine Mutter ist ein bisschen sonderbar, also wundern Sie sich bitte nicht«, sagte das Mädchen nun etwas zutraulicher.
»Da machen Sie sich mal keine Sorgen.«
»Es ist aber schon mehrfach vorgekommen, dass jemand wegen Unstimmigkeiten die Arbeit mittendrin abgebrochen hat.«
»Man merkt es mir vielleicht nicht an, aber ich arbeite schon zu lange in diesem Beruf, um mich derart unprofessionell zu verhalten.«
»Ja, das weiß ich aus dem Lebenslauf, den Sie uns geschickt haben.«
»Meine Arbeit besteht darin, möglichst viele von den Dingen, die über den Rand der Welt geglitten sind, wieder aufzusammeln und ihren Wert trotz der Disharmonie, die sie vielleicht umgibt, zur Geltung zu bringen. Meine Auftraggeber sind in der Regel starke Persönlichkeiten. Würde ich sie aufzählen, käme eine recht interessante Liste zusammen. Ein paar Schrullen können mich jedenfalls nicht mehr schrecken. Seien Sie unbesorgt.«
Das kleine Lächeln, das ich auf ihrem Gesicht zu entdecken glaubte, wich sofort wieder einem beherrschten und sittsamen Ausdruck.
Nach einer Weile ging die asphaltierte Straße in eine schmale Schotterpiste über. Meiner Einschätzung nach hatten wir das Dorf in westlicher Richtung verlassen. Die Umgebung bestand noch immer aus niedrigem Gestrüpp, und kleine Tiere wie Wiesel oder Eichhörnchen huschten durchs Gras. In meiner Tasche schlugen mit leisem Klicken die Einzelteile des Mikroskops gegeneinander.
Nachdem wir über eine Steinbrücke einen Bach überquert hatten, fuhren wir einen sanften Hügel hinauf, bis ein pompöses schmiedeeisernes Tor vor uns aufragte. Es stand weit offen, und der Wagen glitt mit unverminderter Geschwindigkeit hindurch. Im Halbschatten der riesigen Pappeln schlängelte sich ein schmaler Weg, dessen Kiesel unter den Reifen hervorsprangen und gegen die Scheiben prasselten.
»Wir sind da. Dort ist es.«
Das Mädchen deutete aus dem Fenster. Unvermutet öffnete sich der Blick, und auf einer Anhöhe vor uns lag eine Villa. Der Finger, den das Mädchen gegen die Scheibe drückte, war feingliedrig, weiß und wirkte geradezu zerbrechlich.
Das Gespräch fand in der Bibliothek statt. Meine Auftraggeberin thronte in der Mitte des Raumes auf einem mit Samt bezogenen Sofa, das vermutlich einmal cremefarben gewesen war. Mit der Zeit hatten sich jedoch Schweiß, Fingerspuren, Speichel, Staub, irgendwelche Getränke und fettige Süßigkeiten zu einem schmuddeligen Farbton vermengt. Das Polster war durchgesessen, und an den abgewetzten Armlehnen war schon die Füllung sichtbar.
Meine Auftraggeberin war unglaublich schmächtig. Sie wirkte so mager und knochig, als würde ihr Körper sämtliche Nahrungsaufnahme verweigern. Ihre Hüften waren beinahe rechtwinklig. Ich hätte sie mit Leichtigkeit in den Armen wiegen können. Ihre Statur war eigentlich nicht mehr als klein und zierlich zu bezeichnen. Sie war geradezu winzig.
Ihre Aufmachung war – sei es aus Gründen ihrer Statur oder des Geschmacks – sehr exzentrisch. Auf dem Kopf hatte sie eine Wollmütze, dazu trug sie eine Menge ohne erkennbaren Stil zusammengewürfelter karierter, gestreifter und geblümter Kleidungsstücke, sodass sie Ähnlichkeit mit einem der zahllosen Flecken auf ihrem Sofa hatte.
Am meisten verwunderte mich jedoch, dass die Frau die Mutter des Mädchens sein sollte, das mich abgeholt hatte, denn dazu war sie viel zu alt. Sie musste mindestens auf die Hundert zugehen und war vom Alter völlig ausgezehrt. Es war undenkbar, dass ein derart vertrockneter Leib das junge Mädchen geboren hatte.
Eine Weile sprach niemand. Die Greisin ließ gleichgültig die Schultern hängen und hielt den Blick gesenkt. Sie räusperte sich nicht einmal. Diese starre Haltung ließ ihren Körper noch eingeschrumpfter, älter und kraftloser erscheinen.
Vielleicht wollte sie mich mit ihrem Schweigen prüfen oder meine Persönlichkeit ergründen. Oder hatte ich womöglich bereits einen Fehler begangen und damit die Missbilligung der alten Frau auf mich gezogen? Zum Beispiel, indem ich es versäumt hatte, ein Gastgeschenk mitzubringen, oder die falsche Krawatte trug …
Es gab da viele Möglichkeiten. Hilfe suchend sah ich zu dem Mädchen hinüber, das an einem Erkerfenster saß. Aber sie schenkte mir nicht einmal das kleinste aufmunternde Lächeln und strich nur beflissen den Saum ihres Kleides glatt.
Eine Hausangestellte servierte Tee. Das Klappern der Tassen und Untertassen lockerte die steife Atmosphäre ein wenig auf, gleich darauf breitete sich jedoch wieder Stille aus.
Die Bibliothek hatte eine hohe Decke, und ich fröstelte. Kein Sonnenstrahl drang in den Raum, denn ungeachtet des schönen Wetters waren die dicken Vorhänge zugezogen. Das Licht, das durch die verstaubten Lampenschirme drang, war schwach, sodass der ganze Raum im Halbdunkel lag. Die Bücher in den Regalen, die die nördliche Wand bedeckten, verströmten einen eigentümlichen Geruch nach Leder und Papier.
Auf den ersten Blick handelte es sich um eine gut bestückte Sammlung. Natürlich konnte ich nichts Bestimmtes sagen, ehe ich sie nicht genauer in Augenschein genommen hatte. In der Eingangshalle, im Treppenhaus und im Korridor waren mir einige Gemälde und Skulpturen aufgefallen, und auch die Bibliothek hatte einige Raritäten zu bieten: Standuhren, Vasen, Lampen und Kunstwerke aus Glas. Das Problem war nur, dass ihr Zustand nicht gerade der beste war und sich Kostbares willkürlich mit irgendwelchem Trödel abwechselte. Neben einem silbernen Lampenfuß in Form eines Hirsches aus dem vergangenen Jahrhundert stand ein Aschenbecher, den offenbar jemand aus einer billigen Kneipe hatte mitgehen lassen. All diese Objekte zu sichten, zu ordnen und zu reparieren würde viel Zeit und Mühe in Anspruch nehmen. Verglichen mit meinen bisherigen Projekten stand hier ein wesentlich größerer Aufwand bevor.
Schließlich konnte ich die Stille nicht mehr ertragen. »Das könnte ein gutes Museum werden«, sagte ich. Abrupt hob die alte Frau den Kopf und sah mich zum ersten Mal an.
»Für eine Privatsammlung ist das Niveau ausgezeichnet. Nicht nur die Kunstwerke und das Kunsthandwerk, auch das Mobiliar, der Garten und das Anwesen als Ganzes sind wie geschaffen für ein Museum.«
»Wovon reden Sie?«
Verblüfft über die Lautstärke und Kraft der Stimme, die unvermutet aus diesem schwächlichen Körper ertönte, geriet ich ins Stottern.
»Nun ja, natürlich wird alles vorher mit Ihnen abgesprochen. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind. Angefangen damit, im Rathaus eine Ecke einzurichten und einige Objekte der Sammlung mit Ihrem Namen dort auszustellen, bis hin zur Errichtung eines neuen Museumsgebäudes hier auf dem Anwesen …«
»Ich habe Sie gefragt, wovon Sie vorhin geredet haben.«
»Ja, also vorhin, was war das noch …? Auf jeden Fall irgendetwas über das Museum.«
»Oh, wie ich so was hasse! Sie müssen ja ein schwaches Gedächtnis haben, wenn Sie nicht einmal wiederholen können, was Sie vor ein paar Sekunden gesagt haben. Nicht zu fassen! Und Sie wollen Museumsexperte sein? Wenn ich etwas nicht ausstehen kann, sind es Schlafmützen. Lahmarschige Kerle. Es ist mir zuwider, wenn etwas nicht präzise und ohne Zeitverlust erledigt wird. Es ist ja wohl nicht zu übersehen, dass ich keine Zeit zu verlieren habe.«
Stakkatoartig schossen die Worte zwischen ihren tief in den Kiefer eingesunkenen Lippen hervor und zischten durch den Raum. Dabei bebten die Finger, Schultern und Kniescheiben der alten Frau wie von den Schwingungen ihrer Worte in Bewegung gesetzt.
»Ich erinnere mich nicht, Sie darum gebeten zu haben, den ganzen Schrott hier in ein Museum zu stellen. Also reden Sie nicht so eigenmächtig daher. Wer hat schon Lust, sich den Krempel anzugucken, für den irgendwelche Vorfahren von mir ihr Geld aus dem Fenster geschmissen haben? Niemand! Im besten Fall kommen irgendwelche dämlichen Trottel, kreischen ›Oh, wie interessant‹ oder ›Oh, welch Verschwendung‹ und begrabbeln mit ihren klebrigen Fingern die Vitrinen.«
Die Alte krümmte sich immer mehr, bis sie mich gewissermaßen von unten ansah. Ihre Wangen waren eingefallen, die Augenbrauen spärlich, und auf dem schmalen Stück Stirn, das unter der Mütze hervorlugte, hatte sie einen eitrigen Abszess.
Beherrscht wurde ihr Gesicht jedoch von den Falten. Ihre Augäpfel, ihre Nasenlöcher und ihre Lippen, alles versank in tiefen Schluchten. Ihre Haut erinnerte mich an die eines arktisches Walrosses aus dem Naturkundemuseum, in dem ich einmal gearbeitet hatte.
»Für kein Stück von dem Plunder, der hier rumsteht, habe ich selbst einen Finger krumm gemacht. Alles von meinen Vorfahren. Warum sollte ich mich darum kümmern? Für nichts in der Welt! Aus Prinzip tue ich nie das, was alle tun. Das ist mein wichtigster Grundsatz. Es gibt bis jetzt also zwei Regeln, die Sie beherzigen müssen. Wiederholen Sie gefälligst!«
Ich sammelte meine Gedanken, wobei ich einen Knopf meines Jacketts öffnete und meinen Blick auf den erkaltenden Tee richtete.
»Die Dinge effizient vorantreiben und tun, was sonst keiner tut …«
Die Alte schnaubte nur, und es war nicht auszumachen, ob meine Antwort richtig oder falsch gewesen war.
»Was ich im Auge habe, ist ein grandioses, bedeutungsvolles Museum, das einzigartig ist und das ein Grünschnabel wie Sie sich gar nicht vorstellen kann. Und wenn Sie einmal angefangen haben, unterstehen Sie sich, mittendrin aufzuhören! Mein Museum wird sich unendlich und unaufhaltsam vergrößern. Man könnte es eine bedauernswerte, zur Ewigkeit verdammte Existenz nennen. Aber seine Ausstellungsstücke mit der Begründung, dass sie sich endlos vermehren, im Stich zu lassen, hieße, die Ärmsten ein zweites Mal sterben zu lassen. Man könnte sie ja einfach unbeachtet lassen, dann würden sie in ihrer Ecke verfallen, ohne Ansprüche zu stellen. Aber wenn man sie einmal hervorgeholt und neugierigen Blicken und zeigenden Fingern ausgesetzt hat, dann darf man sie nicht wieder im Stich lassen. Das wäre grausam. Finden Sie nicht? Das heißt, Sie dürfen auf keinen Fall mittendrin aufhören. Das ist die dritte Regel.«
Die Stille, die nun eintrat, war ebenso unvermittelt wie der Beginn ihrer Rede. Kaum hatte sie ihren Mund geschlossen, verwandelte sie sich sogleich wieder in eine winzige Greisin. Das Zittern ihrer Glieder legte sich, sie senkte den Blick, und die Stille des Raums sog die Energie auf, die sie eben noch zusammen mit ihrem Speichel versprüht hatte.
Wie sollte ich an diese Sache herangehen, um sie zu einem guten Ende zu bringen? Es hätte mir schon geholfen, wenn das Mädchen mir wenigstens – und wenn auch nur mit einem Blick – Verständnis signalisiert hätte, aber es versteckte sich weiter in der Zimmerecke.
Trotz der zugezogenen Vorhänge merkte ich, dass die Sonne unterging und der Wind auffrischte, denn von ferne war das Rauschen der Bäume zu hören. Die Kühle, die vom Boden aufstieg, verlieh der Stille eine noch größere Dichte.
»Geben Sie mir doch mal eine Kostprobe Ihrer museumskundlichen Kenntnisse.«
Ihr Gebiss drohte herauszufallen, und Speichel flog durch die Luft.
»Ja, gern.«
Mir war klar, dass jeder Versuch, auf sie sympathisch zu wirken, ohnehin sinnlos gewesen wäre, und ich beschloss, einfach zu sagen, was mir in den Sinn kam.
»Ein Museum ist eine ständige Einrichtung, die ohne Profitstreben der Öffentlichkeit zugänglich ist und auf selbstlose Weise der Gesellschaft und ihrer Entwicklung dient. Außerdem führt ein Museum verschiedene Projekte durch, die in relevantem Zusammenhang mit den Menschen und ihrer Umwelt stehen. Es werden Nachweise erbracht, gesammelt und archiviert, um sie in den Dienst von Forschung, Bildung und Unterhaltung zu stellen.«
»Hm, das klingt ziemlich öde. Sie beten ja bloß die internationalen Museumsrichtlinien runter«, krächzte die Alte und rückte, nachdem sie einmal geniest hatte, ihr Gebiss zurecht.
»Also gut. Vergessen wir jetzt mal diesen kleinkarierten Regelkram. In meiner Jugend habe ich mir Museen auf der ganzen Welt angeschaut, von riesigen Nationalmuseen, in denen man drei Tage rumlaufen kann, bis zur letzten Scheune, die irgendein starrsinniger alter Querkopf für seine Sammlung von landwirtschaftlichen Geräten umgebaut hat. Aber nicht eines davon hat mich überzeugt. Keines war mehr als eine Abstellkammer. Sie besaßen nicht einen Bruchteil der Inbrunst, die ein Opfer an die Göttin der Weisheit erfordert. Was ich schaffen will, ist ein Museum, das über die menschliche Existenz hinausreicht. Sogar in den faulenden, wertlosen Gemüseabfällen in einer Mülltonne finden sich noch Spuren vom Wunder des Lebens, etwas, das alle Reichtümer dieser Welt im Keim enthält … Ach, es lohnt sich nicht, das zu erklären. Und schon gar nicht jemandem, der etwas von ›Einrichtungen ohne Profitstreben‹ daherfaselt. Übrigens, welches Datum ist heute? Der 30. März? Das ist doch der Tag, an dem der Feldhase geopfert wird. Wo bin ich nur mit meinen Gedanken? Da muss ich doch einen Hasenschenkel essen. Die Sonne ist auch schon untergegangen. Also dann.«
Die alte Frau griff nach ihrem Stock und erhob sich. Als ich ihr helfen wollte, winkte sie mit einer unwirschen Bewegung ihres Stocks ab und humpelte, gefolgt von dem jungen Mädchen, aus der Bibliothek. Sprachlos starrte ich den beiden nach. Auf dem Sofa, auf dem die Alte gerade noch gesessen hatte, war eine kleine Kuhle zu sehen.
Für die Nacht wies man mir ein hübsches Zimmer in einem Doppelhaus an, das im rückwärtigen Garten lag. Das zweistöckige Gebäude bestand aus zwei symmetrischen Flügeln, und neben mir wohnte das Gärtnerehepaar. Der Mann war der Fahrer, der mich mit dem Wagen vom Bahnhof zur Villa gebracht hatte, und die Frau die Hausangestellte, die in der Bibliothek den Tee serviert hatte.
»Sie sind neu hier?«, sprach der Gärtner mich freundlich an, als wir uns vor dem Eingang begegneten.
»Ja, aber ich vermute, dass es mit meiner Anstellung nichts wird. Das Vorstellungsgespräch ist nicht besonders gut gelaufen.«
»Das kann man nie wissen.«
»Ich glaube nicht, dass ich der alten Frau besonders gefallen habe.«
»Wie kommen Sie auf die abwegige Idee, dass irgendjemand ihr gefallen könnte? Machen Sie sich nichts daraus. Gehen Sie früh zu Bett, Sie müssen von Ihrer langen Reise müde sein.«
Der Gärtner hatte die robuste Statur eines Menschen, der jahrelang körperliche Arbeit verrichtet hat. Auch seine sonnenverbrannten Arme, die unter seinen aufgerollten Ärmeln zum Vorschein kamen, vermittelten diesen Eindruck. Die Villa war zu groß, das Mädchen zu jung, die alte Frau zu alt – in dem ganzen widersprüchlichen Chaos wirkten seine Bescheidenheit und seine unkomplizierte Fürsorglichkeit ermutigend auf mich.
Nach Sonnenuntergang war die gesamte Szenerie vor meinem Fenster in Dunkelheit gehüllt. So angestrengt ich auch starrte, ich vermochte nicht den mindesten Lichtpunkt zu entdecken. Die Villa, die hinter Bäumen lag, verwandelte sich langsam in einen schwarzen Klotz, bis sie schließlich ganz in der Finsternis versunken war.
Nachdem ich das Abendessen verzehrt hatte, das mir von der Haushälterin gebracht worden war, gab es für mich nichts mehr zu tun. Die Küche und das Wohnzimmer waren im Erdgeschoss, im ersten Stock befanden sich Schlafraum und Bad. Alle Möbel und Dinge des täglichen Gebrauchs waren funktional, von guter Qualität und im Vergleich zum Haupthaus mit viel Sachverstand angeordnet. Da ich vermutlich am nächsten Tag wieder abreisen würde, beschloss ich, so wenig wie möglich in Unordnung zu bringen.
Meine Reisetasche stellte ich ungeöffnet neben dem Bett ab. Weil ich im Bad kein Durcheinander hinterlassen wollte, nahm ich nur ein Handtuch, um mich abzutrocknen, und spülte mir noch den Mund aus. Auf dem Nachttisch lag ordentlich zusammengefaltet ein gebügelter Schlafanzug. Bestimmt hatte die Haushälterin ihn vorsorglich für mich bereitgelegt. Ich zögerte zuerst, entschied aber dann, ihn nicht anzuziehen, und kroch in meiner Unterwäsche ins Bett.
Nur das Tagebuch der Anne Frank holte ich aus meiner Tasche. Seit vielen Jahren gehörte es zu meinen Gewohnheiten, vor dem Einschlafen darin zu lesen. Welche Stellen und wie viel ich las, entschied ich spontan. Meist waren es ein oder zwei zufällig aufgeschlagene Seiten, manchmal las ich mir auch die ganze Eintragung eines Tages laut vor.
Warum ich damit anfing, weiß ich heute nicht mehr. Das Tagebuch der Anne Frank war ein Andenken an meine Mutter. Sie starb, als ich achtzehn war.
Ich bin noch keinem von ihnen begegnet, doch gibt es genug Menschen auf der Welt, die vor dem Einschlafen in der Bibel lesen. Sooft ich in einem Hotel in der Nachttischschublade eine Bibel fand, fragte ich mich, ob diese Menschen und ich vielleicht ähnliche Empfindungen hatten. Natürlich war meine Mutter nicht Gott. Aber die Methode, sich durch Zwiesprache mit etwas Unsichtbarem, Fernem zu beruhigen, kurz bevor sich das Bewusstsein vom Körper löst, erschien mir verwandt.
Sowohl der Einband als auch die Seiten des Buches waren mittlerweile bräunlich verfärbt. Die Ecken waren teils geknickt, das Lesebändchen war zerfranst, stellenweise waren die Heftfäden gerissen, und einige Seiten drohten herauszufallen. Daher musste man behutsam damit umgehen und durfte es nur sachte aufschlagen, indem man es ohne überflüssigen Kraftaufwand mit beiden Händen festhielt.
Innen stand noch der Name meiner Mutter, den sie hineingekritzelt hatte, um ihr Eigentum zu kennzeichnen – natürlich ohne daran zu denken, dass das Büchlein für ihren Sohn später zu einem Andenken werden würde. In all den Jahren war die Tinte verblasst und mit ihr allmählich auch der Name. Der Gedanke, dass er eines Tages ganz verschwinden würde, konnte mich in Panik versetzen. Ich fürchtete mich nicht nur vor der Trauer angesichts des fortschreitenden Verlusts der Erinnerungen an meine Mutter, sondern vor einer Verletzung, die noch tiefer gehen würde. Meine Furcht war so groß, als sollte das Buch mit all den Fingerabdrücken von mir und meiner Mutter mit Messern zerfetzt und ins Feuer geworfen werden.
Plötzlich fiel mir wieder ein, was die alte Frau am Nachmittag über den zweimaligen Tod gesagt hatte. »Eine bedauernswerte Existenz, zur Ewigkeit verdammt.« Ich schüttelte rasch den Kopf, um den Klang ihrer Stimme zu verscheuchen.
Ich schlug das Buch auf. Donnerstag, 17. Februar 1944. Anne liest Frau van Daan und Peter vor, was sie geschrieben hat. Die Stelle, an der ihre Liebe zu Peter aufkeimt und die mir sehr gefällt. Die Zeile »Du brauchst wirklich nicht zu glauben, dass ich verliebt bin, denn das ist nicht wahr« vom 18. Februar war mit einer Wellenlinie unterstrichen. Sie wirkte so zart, als könne der geringste Hauch sie fortwehen.
Anstatt laut zu deklamieren, flüsterte ich deshalb in eine kleine dunkle Höhle im Inneren meines Gehörgangs hinein. Ich spürte, wie die Worte Anne Franks sich über die Dunkelheit senkten wie nächtlicher Tau. Da es ruhig war und die Luft klar, eignete sich das Schlafzimmer gut zum Vorlesen. Obwohl es meine erste Nacht in einem fremden Bett war, schlief ich ausgezeichnet.
Am nächsten Morgen traf ich gleich nach dem Aufstehen die Vorbereitungen für meine Abreise, auch wenn Vorbereitungen vielleicht zu viel gesagt ist. Ich wusch mir das Gesicht, zog meine Sachen vom Vortag an und packte das Tagebuch der Anne Frank wieder in die Tasche.
Blendend hell schien die Morgensonne ins Zimmer. Der aus dem Wäldchen aufsteigende Nebel verdunstete allmählich unter ihren Strahlen und löste sich bald ganz auf. Das schöne Wetter würde anhalten. Am Abend hatte ich es nicht bemerkt, aber im hinteren Teil des Gartens, wo das Gärtnerhaus stand, schienen früher Pferde gehalten worden zu sein. In der Mitte gab es einen Brunnen, der gleichzeitig als Tränke dienen konnte, und auf der anderen Seite stand ein imposanter aus Steinen gemauerter Stall. In einem Gartenstück östlich davon wiegten sich bunte Blumen im Morgenlicht.
Ich zog die Bettdecke glatt und schaute mich nochmals im Schlafzimmer um, um sicherzugehen, dass ich nichts vergessen hatte. Ich war ein wenig nervös, weil ich nicht wusste, wann ein Zug fuhr. So wie der Bahnhof aussah, hielt dort wahrscheinlich höchstens einoder zweimal am Tag ein Express.
Sicher konnte der Gärtner mir weiterhelfen. Ich ging hinunter, um mich bei ihm zu erkundigen, und als ich die Haustür öffnete, vernahm ich die Stimme des jungen Mädchens.
»Guten Morgen! Ich dachte, Sie schlafen noch.«
Als sie mich mit meiner Reisetasche in der Hand sah, stutzte sie.
»Aber was ist denn los?«
»Ich reise ab, sobald ich mich von Ihrer Frau Mutter verabschiedet habe. Aber weil es noch so früh ist, wollte ich lieber noch ein Weilchen warten und habe mich so herumgedrückt.«
»Wieso wollen Sie denn abreisen?«
»Ihre Frau Mutter war so verärgert, und mir ist klar geworden, dass unser Gespräch nicht zum Besten verlaufen ist.«
»Meine Mutter war nicht verärgert. Auf ihre Art ist sie schüchtern und verhält sich immer so, wenn sie jemandem zum ersten Mal begegnet. Ich hatte Ihnen doch geraten, mit einigen Seltsamkeiten zu rechnen. Sie haben mit Erfolg bestanden und werden das Museum einrichten. Sie brauchen nicht abzureisen«, sagte sie, während sie sich mit den Fingern durchs Haar fuhr.
Wahrscheinlich war sie von der Villa durch den Garten gelaufen, denn ihre Wangen waren gerötet und ihre Waden, die unter dem Rocksaum hervorschauten, feucht vom Tau auf den Gräsern. Unschlüssig, ob ich mich über meinen Erfolg freuen sollte oder nicht, bedankte ich mich unbeholfen.
»Am besten machen Sie sich möglichst bald an die Arbeit. Zuerst einmal müssen Sie heute das Dorf kennenlernen. Ich führe Sie herum. Der Wagen wartet schon am Tor. Können wir gleich fahren? Erinnern Sie sich an die erste Regel meiner Mutter? Sie verabscheut Schlafmützigkeit.«
2
Der Gärtner setzte uns auf dem Hauptplatz ab, wendete und fuhr wieder zurück.
»Man kann fast überall zu Fuß hingehen. Es ist wirklich nur ein kleiner Ort«, sagte das Mädchen.
So früh am Morgen waren die Geschäfte rund um den Platz noch geschlossen. Dennoch führten schon eine ganze Menge Leute ihre Hunde spazieren oder war auf dem Weg zur Arbeit. In der Mitte des Marktplatzes stand ein Springbrunnen mit zwei einander gegenüberstehenden Löwen, die Wasser aus ihren Mäulern spien. Scharen von Tauben saßen am Rand.
Fünf Straßen mündeten auf den Platz: eine große, die zum Bahnhof führte, eine Ladenpassage und drei zweispurige Fahrbahnen. Auf unserem Rundgang ließen wir keine davon aus. An jeder Kreuzung schlug das Mädchen, ohne zu zögern, als hätte es alles gewissenhaft im Voraus berechnet, eine bestimmte Richtung ein. Als ich unsere Route später mit einem Farbstift auf dem Stadtplan nachzeichnete, zeigte sich, dass wir mit dem Marktplatz als Anfangs- und Endpunkt den ganzen Ort durchmessen hatten.
Das Mädchen hatte zwar von einer Führung gesprochen, hielt sich aber nicht mit langatmigen Erklärungen über historische Gebäude auf. Vielmehr kam es häufig zu Gesprächspausen, weil das Gehen all unsere Energie in Anspruch nahm.
Sie trug eine dünne Bluse mit rundem Kragen und rote Sandalen mit flachen Korksohlen, die ein rhythmisches Geräusch erzeugten, derweil sie mit erhobenem Kinn und schwingendem Haar ausschritt. Mit der Zeit fragte ich mich verunsichert, wie weit wir noch so gehen würden.
»Sagen Sie mir Bescheid, wenn ich auf irgendetwas achten soll«, sagte ich. »Vielleicht sollte ich mir zur Vorbereitung auf meine Arbeit Notizen machen oder fotografieren?«
»Nein, machen Sie sich keine Gedanken. Da Sie nun eine Weile bei uns leben werden, wäre es doch unpraktisch, sich im Ort nicht auszukennen, nicht wahr? Sie müssen wissen, wo der Fleischer ist und der Zahnarzt… Wenn etwas Sie interessiert, sagen Sie es mir. Dann halten wir an.«
»Etwas muss ich Sie unbedingt fragen. Was ist das eigentlich für ein Museum, das Ihre Frau Mutter da plant?«
»Das sollten Sie sich auf jeden Fall von ihr selbst erklären lassen.«
Das Mädchen stieß mit der Fußspitze gegen den Stamm eines Alleenbaums und vergrub dann die Hände in den Rocktaschen.
»Dann gehen wir mal weiter«, sagte sie.
Der Ort hatte nichts Besonderes vorzuweisen. Es gab eine Konzerthalle, ein Krankenhaus, einen Lebensmittelmarkt, einen Park mit einem Friedhof, eine Schule und ein öffentliches Bad. Anscheinend war alles Notwendige vorhanden. Auch die unbelebteren Seitenstraßen waren gepflegt, auf den Fenstersimsen der Häuser standen Blumenkästen, und die Menschen, denen wir begegneten, machten einen gelassenen Eindruck und waren geschmackvoll gekleidet. Einige, die das Mädchen kannten, grüßten im Vorübergehen.
Später sah ich auf der Karte, dass das Dorf auf drei Seiten von Bergen umschlossen war, zu deren Füßen verstreut mehrere kleine Seen lagen. Der Bach floss von Osten nach Westen. Der Umriss des Ortes glich einem Ahornblatt mit dem Bahnhof als Stiel.
Es gab viele steile Straßen, und von fast überall konnte man die Berge sehen. Als die Sonne höher stieg, kam von dorther Wind auf.
Hin und wieder blieb das Mädchen stehen und gab mit fast schüchtern gesenktem Kopf eine kurze Erklärung.
»Das ist der Botanische Garten. Das Gebäude vor uns dient der Erforschung von Heilpflanzen. In der Apotheke, die dort betrieben wird, kaufen wir immer das Gichtmittel für meine Mutter.«
Oder:
»Das hier ist die Bronzestatue eines hiesigen Agrarwissenschaftlers, der eine neue Kartoffelsorte gezüchtet hat. Eine Kartoffel mit dünner Schale, die beim Kochen nicht platzt. Leider ist der auf dem Sockel eingravierte Name verwittert, sodass man ihn nicht mehr entziffern kann.«
Sie sprach wie eine Erwachsene, konnte aber eine gewisse Kindlichkeit, die sich in kleinen Gesten offenbarte, nicht verbergen. Dieses Ungleichgewicht begleitete sie die ganze Zeit. Obwohl sie sich Mühe gab, die Rolle einer routinierten Fremdenführerin zu spielen, schien sie meinem Blick nicht ohne Verlegenheit begegnen zu können. Ihre schlanken Beine waren zwar die einer erwachsenen Frau, dennoch trug sie diese Sandalen mit roten Blümchen.
Dass sie wirklich noch ein Mädchen war, zeigte sich eindeutig, als wir hinter dem Rathaus an eine Mauer mit einer Reihe sonderbarer, gleich großer Öffnungen in einer lang gestreckten S-Form kamen, die in regelmäßigen Abständen auf mittlerer Höhe an der Mauer angebracht waren.
»Ganz, ganz früher dienten sie dazu, zu bestimmen, wer schon Steuern zahlen musste und wer noch nicht. Man glaubte, dass zwar das Körperwachstum irgendwann abgeschlossen sei, die Ohren jedoch das ganze Leben lang weiterwachsen würden. Also mussten die Leute ihr Ohr in eins dieser Löcher pressen, und wenn man die Geräusche darin unterscheiden konnte, brauchte man keine Steuern zu zahlen. Jedes Jahr am 30. September mussten sich die Steuerpflichtigen hier versammeln und sich dieser Prüfung unterziehen. Auf der anderen Seite der Mauer standen die Beamten, vergewisserten sich, ob die Ohren exakt in den Öffnungen lagen, und läuteten dann mit Glöckchen oder spielten Flöte oder Zither. Möchten Sie es mal versuchen?«
Sie lehnte sich gegen die Mauer, griff eins ihrer Ohrläppchen und passte ihr Ohr geschickt in eine der Öffnungen.
»Gucken Sie – so.«
Ihr linkes Ohr fügte sich in die Öffnung, als würde es von innen angesaugt. Ohne jede unnatürliche Gewaltanwendung passte es so vollkommen hinein, als wäre es eigens dafür gemacht.
Erfolglos versuchte ich, es ihr gleichzutun.
Die Löcher waren nur ein paar Zentimeter breit, und als ich mein Ohr mit Gewalt hineinpressen wollte, verzog es sich schmerzhaft.
»Um Steuern zu sparen, gingen einige sogar so weit, ihre Ohrknorpel abzuschaben. Es scheint eine Menge Ärzte gegeben zu haben, die solche illegalen Ohrverkleinerungen durchführten.«
Das Ohr in die Maueröffnung gelegt, beobachtete sie kichernd meine vergeblichen Bemühungen.
Am lebhaftesten ging es auf dem Marktplatz zu. Die verschiedenen Lebensmittel, die hier verkauft wurden, boten einen bunten Anblick. Mit Tüten beladene Menschen gingen ihren Einkäufen nach. Das junge Mädchen stellte mich dem Bäcker, dem Gemüsehändler, dem Fleischer und dem Fischhändler vor.
»Das ist der Museumsexperte, der von nun an bei uns arbeiten wird«, erklärte das Mädchen. Alle hoben freundlich die Hand zum Gruß, und einer schenkte mir sogar einen Apfel.
Obwohl es sich nicht um einen Touristenort handelte, gab es mehrere Souvenirgeschäfte. Das Einzige, was mir zwischen all den Postkarten, Puppen und Alben mit Gebirgsbildern ins Auge fiel, waren kleine eiförmige Gegenstände mit verschiedenen Mustern.
»Das sind Ziereier. Das einzige Kunsthandwerk, das hier im Dorf überlebt hat. Die Schale von ausgeblasenen Eiern wird mit einem Spezialpräparat verstärkt und dann dekorativ bearbeitet.«
Das Mädchen und ich drückten unsere Gesichter nebeneinander an die Schaufensterscheibe. Im Inneren des Ladens war eine Werkstatt, und auf einem Podest, das mit einem wahrscheinlich von zerbrochenen Eierschalen stammenden weißen Staub bedeckt war, arbeitete der Künstler. Einige Eier waren mit Edelsteinen verziert, eins diente als Tischglocke und ein anderes als Zuckerdose. Bei wieder anderen erschien das Muster, wenn man sie gegen das Licht hielt.
»Wir hatten einmal eine lange Dürreperiode, während der die Hühner keine Eier mehr legten. Als es aber zu einer vollkommenen Sonnenfinsternis kam, legten alle Hühner gleichzeitig goldfarbene Eier. Nachdem die überraschten Dorfbewohner die Eier vorsichtig eingesammelt und auf ihre Fensterbänke gelegt hatten, zog endlich Regen auf, und das Dorf war gerettet … So geht zumindest die Legende. Heutzutage haben wir keine Dürreperioden mehr, auch wenn wir die Götter noch so darum bitten würden. Im Herbst regnet es so viel, dass es kaum auszuhalten ist.«
Ich bat sie, mich beim Kauf eines Eis zu beraten.
»Oh, das hier ist hübsch.«
Nachdem wir uns eine Weile jedes einzelne angeschaut hatten, entschied sich das Mädchen für eins ohne überflüssige Verzierungen, nur mit einem transparenten Engel, der die Augen geschlossen hielt.
Als wir das Zentrum des Dorfes verlassen hatten, begegneten wir nur noch wenigen Menschen, und die Straßen wirkten langweilig. Kleine hübsche Häuser mit Vorgärten reihten sich aneinander, es gab viele Katzen, und immer wieder sahen wir Traktoren, die Gemüse, Dünger oder Heu beförderten.
Die ganze Zeit spürte ich zu meiner Linken die Anwesenheit des Mädchens. Eindrücke wie ihre Atmung und ihr im Wind wehender Rock rührten an mein Bewusstsein. Die schnellen, verstohlenen Blicke, die ich zu ihr hinüberwarf, trafen stets ihre seidigen Waden und Sandalen.
Als wir die nordöstliche Spitze des Ahornblatts erreichten, kamen wir in einen bewaldeten Park. Wir begegneten einem Paar auf Fahrrädern und einem Maler mit seiner Staffelei, aber sonst war alles ruhig. Außer dem vereinzelten Flügelschlag eines zwischen den Ästen aufflatternden Vogels drang kein Laut an mein Ohr. Auf einem Spazierweg gingen wir in den Wald hinein, bis er sich wieder öffnete und vor uns ein rundes Gebäude auftauchte – das Baseballstadion.
Es war schon älter und sehr schlicht, sein Umfang betrug wahrscheinlich nicht einmal 90 Meter. Die Betonwände waren rissig, die weißen Linien auf der Anzeigetafel verblasst und die Zahlen von 1 bis 9 beschädigt.
Wir kauften uns am einzigen Hotdog-Stand etwas zu essen und setzten uns auf die Tribüne am ersten Schlagmal, um unser Mittagessen zu verzehren.
»Wir sind vielleicht ein bisschen zu schnell. Wenn wir am Nachmittag noch eine Stunde herumgehen, haben wir den ganzen Ort gesehen«, sagte das Mädchen und leckte sich den Ketchup von den Fingern.
»Das macht doch nichts«, erwiderte ich.
Die Tribünen bestanden einfach aus mehreren Betonbänken, zwischen Innen- und Außenfeld gab es keinen Unterschied. Außer einem kleinen Dach hinter dem Netz gab es keinen Sonnenschutz, sodass die Sonne bis in den hintersten Winkel des Feldes drang. Obwohl es ein kleines Stadion war, wirkte es riesig, wenn man nur zu zweit darin saß. Es war der ideale Picknickplatz für einen schönen Tag.
Im Gegensatz zu dem in die Jahre gekommenen Stadion war das Spielfeld gut gepflegt. Der grüne Rasen war sorgfältig gemäht, und die Schlagmale waren so makellos weiß, als stünde unmittelbar ein Spiel bevor.
»Wer spielt denn hier?«, erkundigte ich mich.
»Alle möglichen Leute. Das große Kindersportfest findet hier statt. Außerdem spielen hier die Finanzbeamten gegen die Eier-Künstler. Die Dorfbewohner sind alle ganz wild auf Baseball.«
Als das Mädchen seinen Hotdog verputzt hatte, trank es die Limonade in einem Zug zur Hälfte aus und griff nach den Pommes frites.
Der Wald reichte direkt bis an die äußere Einfriedung des Stadions. Wenn der Ball bei einem Homerun aus dem Feld flog, war es unmöglich, ihn wiederzufinden. Über dem Wald breitete sich der Himmel aus, und in der Ferne ragten im Dunst die Umrisse der Berge auf. Der Wind fegte um die Stadionkurven, sodass das Mädchen und ich unser flatterndes Hotdog-Papier festhalten mussten.
»Wenn du möchtest, kannst du die auch noch essen.« Ich beschloss, sie zu duzen.
Sie nahm die Pommes frites, die ich ihr anbot, ungeniert an und bedankte sich leise.
»Gehst du noch zur Schule?«, fragte ich.
»Ich gehe nicht auf die höhere Schule, weil Mutter mich bei sich haben will. Aber ich belege Fernkurse«, erwiderte sie.
»Ich bin nicht sicher, ob ich in der Lage bin, den Erwartungen deiner Mutter zu entsprechen.«
»Sie brauchen sich nicht so viele Gedanken zu machen, glaube ich. Sie hat einen schwierigen Charakter, und der Umgang mit ihr kann mühsam sein, aber wenn Sie den Dreh ein bisschen raushaben, läuft bestimmt alles glatt.«
»Was für einen Dreh?«
»Das kann ich nicht gut erklären. Wir sind halt Mutter und Tochter. In Ihrem Fall ist es anders.«
»Ich hätte da eine etwas indiskrete Frage. Sie ist nicht deine Großmutter, sondern deine Mutter?«
»Nicht biologisch. Sie war schon alt, als sie mich adoptiert hat. Niemand würde uns für Mutter und Tochter halten. Machen Sie sich keine Sorgen, so eine Frage ist doch nicht indiskret. Die erste Hürde haben Sie ja schon genommen. Immerhin haben Sie ihr aufrichtig zugehört und konnten Ihren Ärger im Zaum halten, ohne ihn ihr zu zeigen. Das genügt. Deshalb hat Mutter Sie genommen.«
»Gab es außer mir denn noch andere Bewerber?«
»Natürlich. Jede Menge. Sie waren nicht der Einzige, der zur Auswahl stand.«
Das Grün des Waldes war so dicht, dass der Wind es kaum zum Schwanken brachte. Das feuchte Baseballfeld schien locker und weich, und seine Oberfläche war noch von Spuren des Rechens durchzogen. Es musste ein herrliches Gefühl sein, nach Herzenslust darauf herumzurennen.
»Aber eins will ich Ihnen deutlich sagen …«, fuhr sie fort, während sie in die Tüte mit den Pommes frites starrte.
»Meine Mutter ist kein böser Mensch. Auch kein guter, und besonders liebenswürdig ist sie auch nicht, aber auf keinen Fall ist sie bösartig. Sie schaut immer weit voraus. Sie reißt ihre Augen auf, knirscht mit dem Gebiss und sieht Dinge, die niemand je gesehen hat. Sie geht dabei bis zum Äußersten, wissen Sie? Ohne auf ihren altersschwachen Körper zu achten, geschweige denn Rücksicht auf andere zu nehmen … Aber könnten Sie mir nicht lieber von den Museen erzählen, die Sie bisher eingerichtet haben?«
Das Mädchen steckte sich das letzte Pommes frites in den Mund, indem es Zeigefinger und Daumen an die Lippen führte und dabei seine Augen langsam schloss und wieder aufschlug. Ich sah, wie ihre Haare sich auf dem verschwitzten Nacken ringelten. Auf einmal befürchtete ich, das gerade erst erworbene Zierei in meiner Hosentasche könnte zerbrochen sein, und betastete es vorsichtig.
Zum Nachtisch verspeisten wir den Apfel, den ich zuvor auf dem Markt geschenkt bekommen hatte. Währenddessen erzählte ich dem Mädchen von einigen meiner Erlebnisse in den Museen, in denen ich bisher zu tun gehabt hatte. Dazu gehörte, wie ich einmal auf einer Akquisereise eine einheimische Krankheit bekommen hatte; mit welcher Methode wir das Skelett eines Blauwals in einen Ausstellungsraum bugsiert hatten; die Entwicklung einer Beleuchtung, die keine chemischen Veränderungen bei Exponaten hervorruft; wie ein Obdachloser über ein Jahr lang unbemerkt in einem Magazin gelebt hatte; die Möglichkeiten neuer Ausstellungstechniken; meine Affäre mit einer Restauratorin von Metallobjekten …
Das Mädchen hörte aufmerksam zu, stellte Fragen, nickte und lachte. Noch nie hatte ich ein derartiges Interesse an meinen Erfahrungen erlebt. Die meisten Leute assoziieren mit dem Wort Museum einen düsteren, langweiligen Ort und sind nicht bereit, ihre Vorstellungskraft darüber hinaus zu bemühen. Das Mädchen indes war so hingerissen, als handle es sich bei einem Museum um ein geheimnisvolles Paradies in einem fernen Land. Dabei knabberte sie unentwegt an dem Apfel, von dem fast nur noch das Gehäuse übrig war.
Als wir zum Dorfplatz zurückkehrten, um unsere Nachmittagstour zu beenden, war es kurz vor drei. Es waren mehr Leute unterwegs als am Morgen, aber es ging nicht wirklich hektisch zu. Man sonnte sich in aller Ruhe auf den Bänken oder hielt ein gemütliches Schwätzchen bei einer Tasse Tee auf der Terrasse des Cafés.
Am Springbrunnen stand ein einzelner Mann, der völlig aus diesem Rahmen fiel. Er hatte ein weißes Fell um sich geschlungen, sein Haar war zerzaust, und er trug keine Schuhe. Anfangs hielt ich ihn für einen Bettler, aber es war nirgendwo eine Schale zu sehen. Außerdem schienen die Vorübergehenden ihn mit eher respektvollen als mitleidigen Blicken zu bedenken.
»Er ist ein Verkünder des Schweigens«, flüsterte das Mädchen mir zu. »Im Frühling kommt er aus den Bergen zu uns ins Dorf.«
»Was tut er da?«
»Man sieht ihn nur selten. Ich sehe ihn auch erst zum zweiten oder dritten Mal …«
Der Mann war groß, hager und etwas gebeugt, er schien ungefähr dreißig zu sein, also in meinem Alter. Das Fell war nichts weiter als ein Viereck mit einem Loch in der Mitte, das er sich wie einen Poncho über den Kopf gezogen hatte. Überdies schien er es schon lange zu tragen, denn es war zerschlissen und starrte vor Schmutz.
»Er geht den Weg des Schweigens. Er hat gelobt, sein ganzes Leben lang nicht zu sprechen, und dient dem Ideal, in vollkommenem Schweigen zu sterben. Das ist ein sehr harter Weg. Von Mutter weiß ich, dass er in einem Kloster nördlich des Dorfes lebt. Nur wenige sind schon einmal dort gewesen. Die Mönche tragen das Fell der weißen Bergbüffel als Kutte und kommen von Zeit zu Zeit in den Ort, um das Schweigen zu verkünden.«
Der Mann hatte die Hände vor dem Körper gefaltet und stand mit gesenktem Blick reglos da. Das Wasser aus dem Springbrunnen spritzte auf seine bloßen Füße, und seine rissigen Fersen waren schon ganz rot. Es sah aus, als erleide er schreckliche Schmerzen oder entziffere unsichtbare Zeichen. Eine dichte Stille umgab ihn. Offenbar war es nicht der Mann, auf den die Leute achteten, sondern seine Ausstrahlung.
»Er verkündet seine Lehre also nicht mit Worten.«
»Natürlich nicht. Er steht einfach nur bewegungslos da. Es ist aber nicht verboten, ihn anzusprechen. Im Gegenteil. Abergläubische behaupten, dass ein Geheimnis, das man dem Verkünder erzählt, niemals aufgedeckt wird. Da, schauen Sie, die Frau.«
Eine Frau mittleren Alters mit einem Kopftuch und einer Einkaufstasche trat ehrfurchtsvoll an den Mann heran. Mit gesenktem Blick blieb sie vor ihm stehen, um ihn nicht zu stören. Nach einigem Zögern legte sie ihre Handflächen auf die Brust und neigte den Kopf wie zum Gebet. Dabei verringerte sich die Distanz zwischen den beiden noch mehr.
Wir konnten ihre Stimme nicht hören, aber an den ruckartigen Bewegungen ihres Kopftuchknotens war zu erkennen, dass sie etwas erzählte. Die Haltung des Mannes änderte sich nicht. Die gefalteten Hände, das abgewetzte Fell, sein Schatten auf der Erde, alles behielt den gleichen Umriss. Dennoch erweckte er keinesfalls den Eindruck, als weise er die Frau zurück. Er nahm sie in seine kleine Welt des Schweigens auf und barg ihre geheimen Worte im Innern seiner Fellkutte.
Die Frau sprach lange. Sie redete und redete, wie aus einer Quelle sprudelte ihr Geheimnis hervor. Das Mädchen und ich standen nebeneinander auf dem Gehsteig und beobachteten die Gestalt des Verkünders. Natürlich nicht, um das Geheimnis der Frau zu erfahren, sondern um einen Blick auf die Welt des Schweigens zu erhaschen und um uns der Zeit, die wir heute gemeinsam verbracht hatten, nochmals zu vergewissern.
Vom vielen Herumlaufen waren die Sandalen des Mädchens ganz staubig geworden. Die Tauben flogen vom Brunnen auf, und Wasserspritzer funkelten im Sonnenschein. Wenig später näherte sich auf der großen Straße der Wagen, um uns abzuholen.
An diesem Abend stellte ich das Zierei auf die Fensterbank meines Schlafzimmers und schlief ein.
Die Arbeit wollte nicht recht in Gang kommen. Die alte Frau zeigte sich launisch, und jedes Mal, wenn ich dachte, wir könnten endlich loslegen, hatte sie einen Vorwand, um wieder von vorne anzufangen. Vor allem blieb weiterhin unklar, um was für eine Art Museum es sich überhaupt handeln sollte. Unablässig und herrisch verkündete die Alte ihre Ansichten, zog sich aber am Ende stets in ihre Villa zurück, weil sie beleidigt war, angeblich Hunger hatte oder zu müde war, ohne zum Kern der Sache zu kommen. Ihre Wollmütze, ihre exzentrische Kleidung, ihr faltiges Gesicht und die Intensität ihrer Stimme änderten sich dabei nie.
Wenn ich ihr direkte Fragen stellte, erklärte sie, sie folge nur ihrem eigenen Kalender, und das Ganze sei ein Projekt, das vom Schicksal des Universums bestimmt werde. Ihr Almanach lag in einem Geheimfach, das sich in einer Regalecke in der Bibliothek befand. Sie zeigte ihn mir nur ein einziges Mal.
Dazu schraubte sie die Spitze ihres Stocks auf, holte einen Schlüssel hervor und öffnete das Geheimfach.
»Strenge Sicherheitsvorkehrungen haben Sie da«, bemerkte ich.
»Was glauben Sie denn?«, erwiderte sie und drosch mit ihrem Stock gegen eine Außenwand des Regals.
Der Almanach war zu schwer, als dass sie ihn allein hätte heben können. Der Einband aus rotbraunem Leder glänzte, als wäre er jahrelang durch eine Vielzahl von Händen gegangen.
Jeweils zwei Seiten darin waren für einen Tag vorgesehen. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember waren in schöner Handschrift alle möglichen mündlich überlieferten Dinge, Verhaltensmaßregeln, die man beherzigen sollte, Tabus, Bauernregeln, Ratschläge zu allgemeinen Familienangelegenheiten, Empfehlungen, historische Ereignisse, Zaubersprüche, Gebete und Hausmittel festgehalten. Dazwischen bemerkte ich Illustrationen in zarten Farbtönen.
»Das ist ja Wahnsinn!«, entfuhr es mir unwillkürlich, als ich die ersten Seiten umblätterte.
»Habe alles ich geschrieben«, erklärte die alte Frau stolz.
»Sind die Zeichnungen auch von Ihnen?«
»Natürlich.«
In diesem Augenblick machte ich eine Entdeckung. Es überraschte mich kaum, dass sie diese eleganten, wunderschönen Zeichen geschrieben hatte, die in völligem Widerspruch zu ihrem Charakter zu stehen schienen. Was mich jedoch erstaunte, war ihr Gesichtsausdruck.