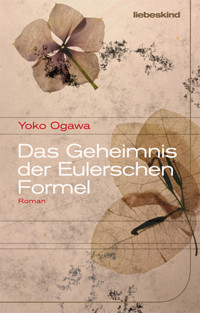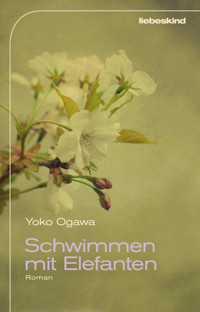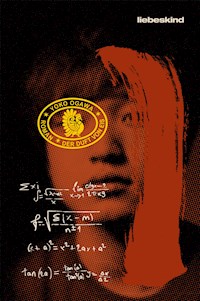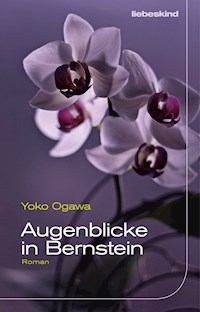12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlagsbuchhandlung Liebeskind
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf einer Insel, nicht weit vom Festland entfernt, prägen sonderbare Ereignisse das Leben. In regelmäßigen Abständen verschwinden Dinge, und zwar für immer. Zunächst sind es Hüte, dann alle Vögel, später die Fähre. Bald gibt es keine Haarbänder mehr und keine Rosen … Die Bewohner haben sich damit abgefunden, dass auch ihre Erinnerung immer weiter verblasst. Nur einige wenige können nichts vergessen. Deshalb werden sie von der Erinnerungspolizei verfolgt, die dafür Sorge trägt, dass alle verschwundenen Dinge auch verschwunden bleiben, nicht nur im alltäglichen Leben, sondern auch in den Köpfen der Menschen. Als eine junge Schriftstellerin herausfindet, dass ihr Verleger Gefahr läuft, von der Erinnerungspolizei festgenommen zu werden, beschließt sie, ihm zu helfen – auch wenn sie damit ihr Leben riskiert. Sie richtet im Untergeschoss ihres Hauses ein Versteck für ihn ein. Doch die Razzien der Polizei werden ständig ausgeweitet, und immer häufiger verschwinden Dinge. Die beiden hoffen auf die Fertigstellung ihres neuen Romans als letzte Möglichkeit, die Vergangenheit zu bewahren. Yoko Ogawas internationaler Bestseller ist eine faszinierende Parabel über den Verlust von Freiheit und die Bedeutung der eigenen Vergangenheit. Selten werden die drängenden Fragen unserer Zeit so poetisch verhandelt wie hier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Yoko Ogawa
Inselder verlorenenErinnerung
Roman
Aus dem Japanischenvon Sabine Mangold
Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel
»Hisoyaka na Kesshô« bei Kodansha in Tokio.
© Yoko Ogawa 1994
© Verlagsbuchhandlung Liebeskind 2020
Alle Rechte vorbehalten
Yoko Ogawa wird durch das Japan Foreign-Rights Centre vertreten
Umschlagmotiv: Taxi / Getty Images
Umschlaggestaltung: Tyler Comrie, New York
eISBN 978-3-95438-123-4
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
1
Manchmal frage ich mich, was auf der Insel zuerst verschwand.
»Lange bevor du auf die Welt kamst, gab es so vieles hier: durchsichtige und angenehm duftende Dinge, flirrende, schimmernde, wundersame Dinge, von denen du keine Vorstellung hast.«
Als ich ein Kind war, erzählte meine Mutter mir diese Geschichten.
»Es ist wirklich ein Jammer, dass die Inselbewohner nicht imstande sind, all das im Gedächtnis zu bewahren. Aber so ist es hier nun mal, nach und nach geht alles verloren. Bald schon wirst du zum ersten Mal erleben, wie etwas für immer verschwindet.«
»Ist das nicht furchtbar?«, fragte ich ängstlich.
»Nein. Hab keine Angst! Es tut nicht weh und macht auch nicht traurig. Du wirst es kaum wahrnehmen. Eines Morgens wachst du auf, und dann ist es auch schon geschehen. Während du mit geschlossenen Augen lauschst, um die Morgenstimmung einzufangen, wirst du merken, etwas ist anders. Dann weißt du, dass etwas fehlt, dass etwas nicht mehr existiert.«
Meine Mutter redete nur darüber, wenn wir uns in ihrem Atelier aufhielten, das im Keller lag. Es war ein großer, staubiger Raum mit unebenem Boden. Die Nordseite lag in der Nähe des Flusses, man konnte das Rauschen des Wassers hören. Ich saß auf meinem kleinen Schemel, und sie erzählte mit leiser Stimme, während sie einen Stein glatt feilte oder ihren Meißel schliff. Meine Mutter war Bildhauerin.
»Wenn etwas verschwindet, herrscht auf der Insel ein ziemlicher Tumult. Alle Einwohner versammeln sich auf den Straßen und tauschen Erinnerungen aus über das, was verloren gegangen ist. Wehmütig trauert man den Dingen hinterher und spendet einander Trost. Wenn es sich um konkrete Gegenstände handelt, die abhandengekommen sind, lesen wir deren Überreste auf, um sie zu verbrennen, zu vergraben oder in den Fluss zu werfen. Nach ein paar Tagen hat sich die Aufregung schon wieder gelegt. Man geht zur Tagesordnung über, als wäre nichts geschehen. Hinterher weiß man nicht einmal mehr, was eigentlich verschwunden ist.«
Dann unterbrach sie ihre Arbeit und führte mich hinter die Treppe zu einer alten Kommode mit zierlichen Schubladen.
»Komm, such dir eine aus und schau hinein.«
Ich war jedes Mal unschlüssig und betrachtete eine Weile die rostigen Griffe.
Ich zögerte, weil ich wusste, dass sich in den Kästchen wundersame Dinge befanden. Es war das geheime Versteck meiner Mutter. Dort bewahrte sie Gegenstände auf, die von der Insel verschwunden waren.
Wenn ich dann endlich meine Wahl getroffen hatte und eine Schublade aufzog, legte sie lächelnd den Inhalt auf meine Handfläche, die ich ihr entgegenhielt.
»Dieses Stück Stoff heißt ›Band‹. Es verschwand, als ich selbst noch ein Kind war. Man konnte damit seine Haare zusammenbinden oder es zur Zierde an Kleidungsstücke nähen.«
»Das hier ist ein ›Glöckchen‹. Du kannst es hin- und herschwingen. Hör nur, wie schön sein Klang ist.«
»Oh, heute hast du dir eine besondere Schublade ausgesucht. Das ist ein ›Smaragd‹. Es ist das Kostbarste in meiner Sammlung, ein Andenken an meine Großmutter. Einst war es der wertvollste Stein auf der ganzen Insel. Aber leider haben alle vergessen, wie schön er ist.«
»Das hier ist zwar klein, war aber von großer Bedeutung. Wenn man jemandem etwas mitteilen wollte, schrieb man es auf ein Blatt Papier und klebte dann diese ›Briefmarke‹ auf den Umschlag. Damit konnte das Schriftstück überallhin geschickt werden. Aber das ist schon lange vorbei.«
Band, Glocke, Smaragd, Briefmarke … Die Worte aus dem Mund meiner Mutter ließen mich wohlig erschaudern, wie es sonst nur Mädchennamen aus fernen Ländern oder exotische Pflanzenarten vermochten. Wenn ich ihren Geschichten lauschte, stellte ich mir vor, wie all die Dinge auf unserer Insel einst ihren Platz hatten.
Das war gar nicht so einfach. Denn die Gegenstände blieben reglos auf meiner Handfläche liegen, ohne ein Lebenszeichen. Sie verharrten wie kleine Tiere, die Winterschlaf halten. Ich fühlte mich dann unsicher, so als müsste ich aus Knetmasse Wolken formen. Während ich vor den geheimnisvollen Schubladen stand, fühlte ich, dass ich meine volle Aufmerksamkeit auf jedes Wort richten musste, das meine Mutter aussprach.
Meine Lieblingsgeschichte war die über das »Parfum«. Es handelte sich dabei um eine klare Flüssigkeit in einem Glasflakon. Als meine Mutter mir zum ersten Mal einen solchen Flakon überreichte, hielt ich den Inhalt für Zuckerwasser und hätte fast daraus getrunken.
»Nein, das ist doch nicht zum Trinken!« Meine Mutter hielt mich lachend zurück.
»Davon darfst du nur ein Tröpfchen hinters Ohr tun.«
Sie tupfte behutsam eines auf die entsprechende Stelle.
»Aber wozu soll das gut sein?«, fragte ich erstaunt.
»Parfum ist zwar unsichtbar, aber trotzdem lässt es sich in solch einen Flakon sperren.«
Ich musterte neugierig den Inhalt.
»Wenn man Parfum aufträgt, dann duftet es. Damit kannst du jemanden verzaubern. Als ich jung war, haben alle Mädchen vor einem Rendezvous Parfum aufgetragen. Um einem Jungen, für den man schwärmte, zu gefallen, war die Wahl des Dufts genauso wichtig wie die passende Kleidung. Das hier ist das Parfum, das ich getragen habe, wenn ich mit deinem Vater verabredet war. Wir trafen uns meistens im Rosengarten, der am Fuße des Hügels im Süden der Stadt liegt, und ich hatte Mühe, einen Duft zu finden, der es mit den Blumen aufnehmen konnte. Wenn der Wind durch mein Haar strich, musterte ich ihn verstohlen von der Seite, weil ich wissen wollte, ob er mein Parfum wahrnahm.«
Meine Mutter war immer sehr aufgeregt, wenn sie davon erzählte.
»Damals kannte jeder solche duftenden Essenzen. Und alle fanden Gefallen daran. Aber jetzt sind sie fort. Nirgendwo wird mehr Parfum verkauft, und niemand verlangt mehr danach. Es verschwand im Herbst desselben Jahres, als dein Vater und ich heirateten. Alle versammelten sich daraufhin am Fluss, jeder brachte seinen Lieblingsduft mit. Die Flakons wurden geöffnet und der Inhalt ins Wasser geschüttet. Am Ende rochen einige mit wehmütigem Bedauern an ihren leeren Flakons, aber niemand konnte sich mehr an den Duft erinnern. Damit war Parfum bedeutungslos geworden. Es hatte sich im Wasser aufgelöst und spielte keine Rolle mehr. Noch einige Tage später raubte einem der Geruch am Fluss fast den Atem, und viele Fische starben. Aber das fiel niemandem mehr auf. Das Parfum war bereits aus den Herzen der Menschen verschwunden.«
Als sie zum Ende kam, blickte meine Mutter traurig vor sich hin. Dann nahm sie mich auf ihren Schoß und ließ mich an ihrem Hals riechen.
»Und?«, fragte sie.
Ich wusste nicht recht, was ich antworten sollte. Ein gewisser Duft schwebte in der Luft, jedoch nicht so wie getoastetes Brot oder der Chlorgeruch im Schwimmbad. Sosehr ich mich auch anstrengte, mir fiel nichts dazu ein.
Sie wartete, und als ich keine Antwort gab, stieß sie einen Seufzer aus.
»Es ist nicht schlimm. Für dich sind das eben nur ein paar Tropfen Flüssigkeit, daran ist nichts zu ändern. Man kann sich unmöglich an alle Dinge erinnern, die von unserer Insel verschwunden sind.«
Mit diesen Worten legte sie den Flakon wieder in die entsprechende Schublade.
Als die Wanduhr neun schlug, musste ich hoch auf mein Zimmer. Meine Mutter nahm Hammer und Meißel und machte sich wieder an die Arbeit.
Später, als sie mir einen Gutenachtkuss gab, wagte ich endlich die Frage zu stellen, die mir schon lange auf der Seele brannte.
»Sag, wieso erinnerst du dich an all die verschwundenen Dinge? Warum kannst du den Duft eines Parfums riechen, den alle anderen längst vergessen haben?«
Meine Mutter blickte durch mein Fenster hoch zum Mond, bevor sie sich den Staub von der Schürze strich.
»Es liegt wohl daran, dass ich ständig daran denke.«
Ihre Stimme klang belegt.
»Das verstehe ich nicht. Wie kommt es, dass du nie etwas vergessen hast? Erinnerst du dich immer an alles? Bis in alle Ewigkeit?«
Meine Mutter schlug die Augen nieder, als würde es sich um eine traurige Angelegenheit handeln. Ich gab ihr einen Kuss, um sie zu trösten.
2
Meine Mutter starb zuerst, dann mein Vater. Seitdem wohne ich allein in diesem Haus. Vor zwei Jahren erlag auch die Kinderfrau, die sich, seit ich klein war, um mich gekümmert hatte, einem Herzinfarkt.
Angeblich gibt es noch einige Cousins und Cousinen, die hinter den Bergen im Norden leben sollen, in einem abgelegenen Dorf nahe der Flussquelle, aber ich bin ihnen noch nie begegnet. Wegen der dornenreichen Vegetation in den Bergen, deren Gipfel ständig nebelverhangen sind, kommt es niemandem in den Sinn, sie zu überqueren. Außerdem existiert keine Landkarte – vermutlich waren sie schon vor langer Zeit verschwunden –, sodass niemand weiß, wie die Insel beschaffen ist oder was genau sich hinter den Bergen befindet.
Mein Vater war Ornithologe. Er forschte in einer Vogelwarte auf dem Hügel im Süden der Stadt. Jedes Jahr verbrachte er vier Monate dort, um Daten zu sammeln, Fotos zu machen und die Brut zu beaufsichtigen. Ich besuchte ihn so oft wie möglich, immer unter dem Vorwand, ihm sein Mittagessen bringen zu müssen. Seine jungen Kollegen waren sehr freundlich zu mir und verwöhnten mich mit Keksen und heißer Schokolade.
Ich durfte dann auf den Schoß meines Vaters klettern und durch sein Fernglas schauen. Die Schnabelform, die Färbung der Augenringe, die Art und Weise, wie die Vögel ihr Gefieder spreizten – ihm entging nicht das geringste Detail, wenn es um die Bestimmung der jeweiligen Vogelart ging.
Das Fernglas war eigentlich zu schwer für ein kleines Kind wie mich, und meine Arme wurden schnell müde. Dann half mir mein Vater, indem er sie mit einer Hand abstützte.
Wenn wir so Wange an Wange die Vögel beobachteten, war ich immer versucht, meinen Vater zu fragen, ob er wisse, was sich in den Schubladen der alten Kommode unten im Atelier befindet.
Aber sobald ich die Worte aussprechen wollte, hatte ich das Gesicht meiner Mutter vor Augen, wie sie durchs Fenster die Mondsichel betrachtete, und ich brachte es nicht übers Herz. Stattdessen begnügte ich mich damit, ihm auszurichten, er solle sein Mittagessen zu sich nehmen, solange es frisch sei.
Auf dem Rückweg begleitete er mich bis zum Bus. Immer wenn wir am Futterhaus der Vögel vorbeikamen, zerbröselte ich einen der Kekse.
»Wann kommst du wieder nach Hause?«, fragte ich.
»Samstagabend, wahrscheinlich …«, erwiderte er dann ausweichend. »Grüß deine Mutter von mir!«
Er winkte so heftig, dass beinahe die Utensilien aus seiner Brusttasche herausfielen – Rotstift, Textmarker, Lineal, Kompass und Pinzette.
Ich hielt es für eine glückliche Fügung, dass die Vögel erst nach dem Tod meines Vaters von der Insel verschwanden. Die meisten Bewohner finden schnell eine neue Arbeit, wenn Dinge verschwinden und sie dadurch arbeitslos werden, aber für meinen Vater wäre das unmöglich gewesen. Seine einzige Begabung bestand darin, Vögel zu bestimmen. Unser Nachbar von gegenüber, der von Beruf eigentlich Hutmacher ist, fertigt nun Regenschirme. Der Mann meiner Kinderfrau, ehemals Mechaniker auf der Fähre, arbeitet als Wachmann in einem Lagerhaus. Die ältere Schwester einer Mitschülerin war nicht mehr als Kosmetikerin tätig, sondern als Hebamme. Keiner von ihnen hatte je protestiert. Selbst wenn ihre neue Arbeit nicht so gut bezahlt wurde, trauerte niemand der Vergangenheit hinterher. Es wäre auch viel zu gefährlich gewesen, sich dagegen zu sträuben, denn dann würde vermutlich die Erinnerungspolizei auf sie aufmerksam werden.
Es fällt tatsächlich allen leicht, die Dinge um sich herum zu vergessen, mich eingeschlossen. So als könnte diese Insel gar nicht anders existieren, als auf einem weiten, leeren Meer dahinzutreiben.
Die Vögel verschwanden eines Morgens, ganz plötzlich, wie alles andere auch. Als ich im Bett die Augen aufschlug, spürte ich eine gewisse Spannung in der Luft. Es war ein untrügliches Zeichen dafür, dass etwas passiert war. In meine Wolldecke gehüllt, schaute ich mich aufmerksam im Zimmer um. Die Schminksachen auf der Frisierkommode, die auf dem Schreibtisch verstreuten Büroklammern, der Notizblock, die Spitzenvorhänge, das Regal mit den CDs … es hätte alles sein können. Man musste Geduld aufbringen und sich konzentrieren, um feststellen zu können, was genau verschwunden war.
Ich stand auf, zog mir eine Strickjacke über und ging hinaus in den Garten.
Die Leute aus der Nachbarschaft standen bereits draußen und inspizierten mit besorgten Mienen die Umgebung. Der Hund von nebenan knurrte leise.
Da entdeckte ich einen Vogel, der hoch am Himmel flog. Er war klein und rund und hatte ein braunes Gefieder mit weißem Bauch.
Just in dem Moment, als ich mich fragte, ob er nicht einer von den Vögeln war, die ich zusammen mit meinem Vater auf der Warte beobachtet hatte, merkte ich, dass alles, was mit ihnen zu tun hatte, in mir verblasste. Das Wort »Vogel«, meine Gefühle für diese Tiere, die Erinnerungen an sie – alles war weg.
»Diesmal sind es die Vögel«, sagte mein Nachbar, der ehemalige Hutmacher. »Meinetwegen gern! Auf die kann man verzichten. Sie fliegen sowieso bloß nutzlos in der Gegend rum.«
Er nieste und zog sich den Schal fester um den Hals. Dann fiel sein Blick auf mich. Ihm war wohl eingefallen, dass mein Vater Ornithologe gewesen war, denn sein Mund verzog sich zu einem verkniffenen Lächeln, bevor er hastig an seine Arbeit zurückkehrte. Jetzt, wo alle wussten, was gerade im Begriff war zu verschwinden, wirkten sie erleichtert. Ein jeder kümmerte sich wieder um seine Angelegenheiten. Nur ich blieb stehen und starrte weiterhin in den Himmel.
Nachdem der kleine braune Vogel einen großen Kreis gezogen hatte, flog er in Richtung Norden davon. Ich konnte nicht sagen, zu welcher Art er gehörte. Wäre ich damals nur aufmerksamer gewesen und hätte mir die Vogelnamen gemerkt, als ich gemeinsam mit meinem Vater durch das Fernglas geschaut hatte! Zumindest seinen Flügelschlag, den Klang seines Zwitscherns und die Farbe des Gefieders wollte ich mir einprägen, aber es war sinnlos. Der Vogel, der eigentlich mit der Erinnerung an meinen Vater verwoben sein sollte, weckte keine Gefühle mehr in mir. Er war bloß noch eine Kreatur, die sich durch das Auf und Ab seiner Flügel durch den Himmel bewegte.
Als ich am Nachmittag auf dem Markt einkaufen ging, traf ich Menschen, die Vogelkäfige mit sich trugen, in denen Sittiche, Javafinken und Kanarienvögel aufgeregt umherflatterten. Vermutlich spürten sie, was ihnen bevorstand. Ihre Besitzer waren verstummt und wirkten leicht benommen, als hätten sie sich noch nicht an die neue Situation gewöhnt.
Jeder versuchte auf seine Weise, sich von seinem Vogel zu verabschieden. Manche flüsterten ihren Namen, andere rieben die Wange an ihnen oder boten ihnen mit den Lippen Futter an. Nach dieser kleinen Zeremonie öffneten sie die Käfigtüren. Verwirrt flatterten die Vögel eine Weile um ihre Besitzer herum, doch bald waren sie nicht mehr zu sehen. Es schien, als hätte die Weite des Himmels sie aufgesogen.
Als alle Vögel davongeflogen waren, herrschte Totenstille, sogar der Luft stockte der Atem. Die Menschen nahmen ihre leeren Käfige und gingen nach Hause.
Damit war das Verschwinden der Vögel besiegelt.
Am nächsten Tag geschah etwas Unerwartetes. Ich saß beim Frühstück und hatte gerade den Fernseher eingeschaltet, als es an der Tür klingelte. Dem aggressiven Schellen nach ahnte ich bereits, dass sich etwas Unheilvolles anbahnte.
»Führen Sie uns zum Büro Ihres Vaters!«
Im Eingangsbereich stand ein Spezialkommando, insgesamt fünf Männer. Sie trugen grüne Uniformen, breite Pistolenhalfter, aus denen ihre Waffen herausragten, schwarze Stiefel und Lederhandschuhe. Die Beamten sahen alle gleich aus und waren nur über verschiedene Abzeichen am Kragen auseinanderzuhalten. Aber mir blieb sowieso keine Zeit, sie genau anzusehen.
»Führen Sie uns zum Büro Ihres Vaters!«, wiederholte ein zweiter Beamter, im gleichen Tonfall wie der erste. Er hatte drei Abzeichen – Raute, Bohne, Parallelogramm.
»Mein Vater ist seit fünf Jahren tot.«
Ich sprach ganz langsam und versuchte, Ruhe zu bewahren.
»Das wissen wir«, sagte ein weiterer Mann. Seine Abzeichen hatten die Form eines Keils, eines Sechsecks und eines Ts. Wie auf ein Signal hin drangen die Männer ins Haus. Das Trampeln von fünf Paar Stiefeln und das Klirren der Waffen hallten den Flur entlang.
»Ich habe gerade erst den Teppich gereinigt. Ziehen Sie doch bitte Ihre Stiefel aus!«
Ich wusste selbst, dass ich energischer hätte reagieren sollen, aber mir fielen nur diese törichten Worte ein. Es war auch nicht von Bedeutung, denn sie stürmten bereits die Treppe hinauf, ohne mich weiter zu beachten.
Sie schienen die Anordnung der Zimmer im Haus genau zu kennen. Zielstrebig gingen sie ins Arbeitszimmer meines Vaters, wo sie sich sogleich mit einer bemerkenswerten Routine an die Arbeit machten.
Zunächst riss einer von ihnen sämtliche Fenster auf, die seit dem Tod meines Vaters nicht mehr geöffnet worden waren. Ein anderer benutzte ein längliches, skalpellartiges Werkzeug, um die Schubladen des Sekretärs und des Schreibtischs aufzubrechen, während die übrigen Beamten die Wände nach Geheimfächern abtasteten. Danach durchwühlten sie gemeinsam die Papiere meines Vaters: Dokumente, Notizen, Fotoalben und Briefe. Sobald sie auf etwas Verdächtiges stießen – wozu lediglich das Wort »Vogel« vorkommen musste –, warfen sie das Schriftstück achtlos auf den Boden. Ich lehnte am Türrahmen und fingerte nervös am Knauf herum, während ich ihrem Treiben zuschaute.
Ich hatte bereits davon gehört, wie gut ausgebildet sie waren. Ihren Einsatz erledigten sie gründlich und mit großer Effizienz. Sie arbeiteten schweigend und fokussiert, es gab keine überflüssige Geste. Allein das Rascheln der Papiere erinnerte an Vogelflattern.
Auf dem Fußboden türmte sich im Nu ein großer Papierberg. Es gab praktisch nichts in diesem Raum, was nicht mit Vögeln zu tun hatte. Fotos, die mein Vater während der Tage und Nächte im Observatorium aufgenommen hatte, Schriftstücke mit seiner vertrauten, leicht nach rechts geneigten Handschrift, alles flog wild durch die Gegend.
Sie richteten ein riesiges Chaos an, gingen dabei aber so präzise vor, dass es den Eindruck einer sorgfältig geplanten Aktion erweckte. Ich wollte sie daran hindern, aber mein Herz klopfte so heftig, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte.
»Bitte geben Sie acht!«
Mein zaghafter Versuch zeigte keinerlei Wirkung.
»Das sind die einzigen Andenken an meinen Vater.«
Die Männer ignorierten mich. Meine Stimme wurde von dem riesigen Haufen aus Erinnerungsstücken förmlich verschluckt.
Dann zog einer von ihnen die unterste Schublade des Schreibtischs auf.
»Da ist nichts drin, was mit Vögeln zu tun hat.« Ich versuchte noch, ihn daran zu hindern.
Ich wusste, dass mein Vater dort Familienfotos und Briefe aufbewahrt hatte. Der Beamte mit den Abzeichen Doppelkreis, Rechteck und Tropfenform ließ sich nicht davon abhalten, auch diese Schublade zu durchwühlen. Lediglich ein Foto wurde aussortiert: eine Aufnahme, die meine Eltern und mich mit einem seltenen, bunt schillernden Vogel zeigte, der im Institut geschlüpft war und an dessen Namen ich mich schon nicht mehr erinnern konnte. Der Beamte stapelte die restlichen Fotos und Briefe ordentlich auf dem Tisch und verstaute sie dann wieder in der Schublade. Dies war die einzige respektvolle Geste des Säuberungskommandos an jenem Tag.
Als sie mit dem Aussortieren fertig waren, zogen sie große schwarze Plastikbeutel aus ihren Jackentaschen, um alles vom Boden aufzusammeln. Dabei gingen sie so rücksichtslos vor, dass mir klar wurde, alles würde vernichtet werden. Sie suchten nichts Bestimmtes, sondern beseitigten lediglich alle Spuren, die auf Vögel hindeuteten. Die Erinnerungspolizei hatte zu gewährleisten, dass ein Verschwinden endgültig und allumfassend war.
Ich dachte, dass diese Aktion weitaus einfacher durchzuführen war als jene, bei der ein Spezialkommando meine Mutter verschleppt hatte. Da die Männer nun alles, was ihnen verdächtig vorgekommen war, in die Plastiksäcke gestopft hatten, würden sie wohl nicht wiederkommen. Durch den Tod meines Vaters wäre die im Haus schwebende Erinnerung an die Vögel ohnehin nach und nach verblasst.
Die ganze Aktion hatte nur eine Stunde gedauert und zehn volle Plastiksäcke ergeben. Die Morgensonne schien ins Büro und hatte den Raum merklich aufgeheizt. Am Kragen der Männer funkelten die blank polierten Abzeichen, aber kein Einziger von ihnen geriet außer Atem oder vergoss einen Tropfen Schweiß.
Jeder warf sich mühelos zwei Säcke über die Schulter und brachte sie zu einem Lastwagen, den sie draußen vor dem Haus geparkt hatten.
Nach nur einer Stunde hatte sich das Zimmer völlig verändert. Die Spuren meines Vaters, die ich so sorgsam zu bewahren versucht hatte, waren wie ausgelöscht. Stattdessen herrschte eine Leere, die nicht mehr auszufüllen war. Und inmitten dieser Leere stand ich. Sie war wie ein tiefer Abgrund, der mich zu verschlingen drohte.
3
Meinen Lebensunterhalt verdiene ich mit Schreiben. Bisher habe ich drei Bücher veröffentlicht. Mein erster Roman handelt von einem Klavierstimmer, der durch Musikalienhandlungen und Konzertsäle irrt, um nach seiner verschwundenen Geliebten, einer Pianistin, zu suchen, wobei er sich allein auf die von ihr gespielten Töne verlässt, die noch in seinen Ohren klingen. Das zweite Buch dreht sich um eine Ballerina, die bei einem Verkehrsunfall ein Bein verliert und dann gemeinsam mit einem Botaniker in einem Treibhaus lebt. Die Protagonistin meines dritten Romans pflegt ihren jüngeren Bruder, der an einer seltenen Krankheit leidet und bei dem sich nach und nach alle Körperzellen auflösen.
Es sind alles Geschichten, in denen etwas verschwindet. So etwas mögen die Leute.
Auf unserer Insel ist die Schriftstellerei eine Tätigkeit, die nicht besonders hoch angesehen ist. Man kann nicht behaupten, dass es hier von Büchern nur so wimmelt. Die Bibliothek neben dem Rosengarten ist eine schäbige Holzbaracke, wo es allenfalls eine Handvoll Besucher gibt. Die vermoderten Bücher kauern in den Regalen, aus lauter Angst, sich in Staub aufzulösen, sobald jemand sie aufschlägt, geschweige denn liest. Die alten Bände werden nicht restauriert, sondern irgendwann entsorgt. Deshalb wird der Bestand in dieser Bibliothek auch niemals wachsen. Aber keiner beklagt sich darüber.
Mit der Buchhandlung ist es das Gleiche. Im Einkaufsviertel gibt es keinen Laden, der so gespenstisch leer ist. Mit fahlem Teint hockt der Buchhändler mürrisch hinter Stapeln von unverkauften Büchern mit vergilbten Schutzumschlägen.
Hier leben nur wenige Menschen, die Romane lesen wollen. Meistens arbeite ich von vierzehn Uhr bis Mitternacht an meinem Manuskript. In dieser Zeit schaffe ich etwa fünf Seiten. Ich genieße es, die Kästchen auf dem Papier sorgfältig mit Zeichen auszufüllen. Es gibt schließlich keinen Grund zur Eile. Ich lasse mir sehr viel Zeit, das passende Schriftzeichen für das jeweilige Kästchen zu finden.
Mein Arbeitsplatz ist das ehemalige Büro meines Vaters. Anders als zu seiner Zeit ist heute alles viel ordentlicher. Denn für meine Romane brauche ich weder Notizen noch irgendwelche Nachschlagewerke. Auf dem Schreibtisch liegen nur ein Stapel Papier, ein Bleistift, eine Klinge zum Anspitzen sowie ein Radiergummi. Aber sosehr ich mich auch anstrenge, es gelingt mir nicht, die Leere zu füllen, die die Erinnerungspolizei hinterlassen hat.
Gegen Abend mache ich einen einstündigen Spaziergang. Dabei laufe ich an der Küste entlang zum Fähranleger, während ich auf dem Rückweg den Pfad über den Hügel nehme, der an der Vogelwarte vorbeiführt.
Die Fähre, die bereits seit langer Zeit vertäut im Hafen liegt, ist völlig verrostet. Niemand besteigt sie mehr, um irgendwo hinzufahren. Auch sie gehört zu den Dingen, die von der Insel verschwunden sind.
Eigentlich sollte der Schiffsname auf dem Bug zu erkennen sein, aber durch die Salzluft ist die Farbe abgeblättert und der Schriftzug nicht mehr lesbar. Die Bullaugen sind blind, der Rumpf, die Ankerkette und die Schiffsschraube von Muscheln und Algen überzogen. Das Schiff sieht aus wie der Kadaver eines riesigen Seeungeheuers, das langsam versteinert.
Der Mann meiner Kinderfrau hat früher als Mechaniker hier gearbeitet. Als der Fährbetrieb eingestellt wurde, war er eine Zeit lang als Wachmann in einem Lagerhaus am Hafen beschäftigt, heute lebt er an Bord des Schiffs, allein und zurückgezogen. Auf meinem täglichen Spaziergang schaue ich regelmäßig vorbei, um mit ihm zu plaudern.
»Wie geht es Ihnen?«, fragt der alte Mann und bietet mir einen Stuhl an. »Kommen Sie mit dem Schreiben voran?«
Auf der alten Fähre gibt es viele verschiedene Sitzgelegenheiten, sodass wir uns je nach Witterung und Laune auf einer Bank an Deck niederlassen oder es uns im Salon auf einem Sofa gemütlich machen.
»Nun ja, es braucht seine Zeit«, antworte ich dann.
»Passen Sie gut auf sich auf!«, sagt er jedes Mal. »Nicht jeder kann den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und sich komplizierte Sachen ausdenken. Wenn Ihre Eltern noch am Leben wären, wären sie bestimmt sehr stolz.«
Er nickt, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen.
»Einen Roman zu schreiben ist keine großartige Angelegenheit. Ich denke, es ist viel schwieriger, einen Schiffsmotor zu zerlegen, einzelne Teile auszutauschen und ihn dann wieder zusammenzubauen.«
»Ach, woher! Da die Schiffe verschwunden sind, gibt es ja sowieso nichts mehr für mich zu tun.«
Für einen Moment herrscht Schweigen.
»Übrigens, heute habe ich ein paar erstklassige Pfirsiche bekommen. Ich werde sie für uns aufschneiden.«
Der Alte verschwindet in der Kombüse neben dem Maschinenraum. Die Pfirsichscheiben serviert er auf einem mit Eis gekühlten und mit Minzblättern dekorierten Teller. Dazu hat er eine Kanne schwarzen Tee gebrüht. Er ist nicht nur sehr geschickt im Umgang mit Maschinen, sondern auch mit Speisen und Pflanzen.
Er ist immer der Erste, dem ich ein gedrucktes Exemplar meiner Bücher überreiche. »Ah, sieh an, das ist also Ihr neuer Roman«, sagt er dann, wobei er das Wort »Roman« voller Ehrfurcht ausspricht. Sobald er das Buch in Händen hält, verbeugt er sich. Er behandelt es, als wäre es eine Reliquie.
»Vielen Dank, haben Sie vielen Dank.«
Seine Stimme klingt belegt, als wäre er den Tränen nah, was wiederum mich verlegen macht. Leider hat er nie eine Seite meiner Romane gelesen.
Einmal habe ich ihn gefragt, wie ihm meine Bücher gefallen. Er gab mir eine verblüffende Antwort.
»Ich kann es nicht sagen. Das wäre sehr unvernünftig. Wenn ich ein Buch lesen würde, wäre ja die Geschichte aus und vorbei. Was für eine Verschwendung! Ich verwahre das Buch lieber und halte es in Ehren.«
Dann legte er es auf den Altar, der sich in der Kapitänskajüte befand und der den Göttern des Meeres gewidmet war, und faltete die Hände zum Gebet.
Beim Essen unterhalten wir uns über alles Mögliche, oft schwelgen wir einfach nur in Erinnerungen. Wir sprechen über meinen Vater, meine Mutter, über seine Frau, die sich um mich gekümmert hatte, über die Vogelwarte, über die Skulpturen meiner Mutter, über die alten Tage, als man noch mit der Fähre zu anderen Orten fahren konnte … Aber unsere Erinnerungen daran verblassen von Tag zu Tag, denn wenn Dinge verschwinden, gehen auch unsere Gedanken daran verloren. Wir teilen uns die Pfirsiche und lassen sie uns auf der Zunge zergehen, so wie die alten Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen.
Wenn die Abendsonne im Meer versinkt, gehe ich von Bord. Obwohl die Gangway nicht sehr steil ist, geleitet mich der alte Mann stets an Land. Er behandelt mich immer noch wie das kleine Mädchen, das ich einst war.
»Passen Sie gut auf sich auf und kommen Sie heil nach Hause!«
»Ja, bis morgen dann.«
Er schaut mir so lange nach, bis ich außer Sichtweite bin.
Nach meinem Besuch im Hafen klettere ich für gewöhnlich den Hügel hinauf zur Vogelwarte. Aber dort halte ich es nie lange aus. Beim Anblick des Meeres hole ich ein paar Mal tief Luft, dann steige ich wieder hinab. Auch hier haben die Erinnerungspolizisten ganze Arbeit geleistet und eine Ruine hinterlassen. Nichts erinnert mehr an die Vogelwarte, die wissenschaftlichen Mitarbeiter haben sich in alle Winde zerstreut.
Wenn ich vor dem Fenster stehe, aus dem ich zusammen mit meinem Vater durch das Fernrohr blickte, kommen auch heute noch Vögel angeflattert, aber sie führen mir vor Augen, dass sie für mich keine Bedeutung mehr haben.
Wenn ich unten angekommen bin und die Stadt durchquere, ist die Sonne bereits untergegangen. Abends wird es ruhig auf der Insel. Nach Dienstschluss verlassen die Menschen ihren Arbeitsplatz, die Kinder laufen nach Hause, Lieferwagen, die Waren zum Markt gebracht haben, rumpeln leer und mit knatterndem Motor vorbei. Und dann kehrt Stille ein. Als würde sich die ganze Insel darauf vorbereiten, dass morgen wieder etwas verschwindet.
So bricht die Nacht über uns herein.
4
Als ich am Mittwochnachmittag mein Manuskript in den Verlag brachte, begegnete ich unterwegs einem Spähtrupp. Es war das dritte Mal in diesem Monat.
Sie wurden zusehends rücksichtsloser und gewalttätiger. Seit fünfzehn Jahren schon trieben sie ihr Unwesen, denn so lange war es her, dass meine Mutter verschleppt wurde.
Damals gab es außer ihr noch andere unbeugsame Menschen, die ihre Erinnerungen an Verlorenes nicht aufgeben wollten. Einer nach dem anderen wurde von der Erinnerungspolizei aufgespürt und weggeschafft. Niemand wusste, wohin man sie brachte.
Ich war gerade aus dem Bus gestiegen und wartete auf das Signal zum Überqueren der Straße, als drei grüne Armeelastwagen sich der Kreuzung näherten. Die anderen Fahrzeuge verlangsamten ihr Tempo und fuhren an die Seite, um sie vorbeizulassen. Die Lastwagen hielten vor einem Gebäude, in dem sich eine Zahnarztpraxis befand, eine Versicherungsgesellschaft sowie ein Tanzstudio. Etwa zehn bewaffnete Männer sprangen heraus und stürmten ins Haus. Den Leuten auf der Straße stockte der Atem. Einige versteckten sich ängstlich in Seitenstraßen. Alle schienen inständig zu hoffen, dass das, was sich vor ihren Augen abspielte, möglichst bald vorbei sei, ohne dass sie selbst in die Sache hineingezogen wurden. Eine gespenstische Stille umgab die Lastwagen, die ganze Umgebung war wie erstarrt.
Ich selbst stand stocksteif hinter einem Laternenpfahl, den Umschlag mit dem Manuskript an die Brust gedrückt. Die Ampel sprang derweil von Grün auf Gelb, dann auf Rot und wieder auf Grün. Niemand überquerte den Fußgängerüberweg. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blickten zu uns nach draußen. Der Umschlag an meiner Brust war mittlerweile ganz zerknittert.
Kurz darauf hörte man Schritte. Es waren energische, rhythmische Schritte von Armeestiefeln, begleitet von Schritten, die eher schleppend waren, zögerlich. Verschiedene Leute traten aus dem Gebäude, einer nach dem anderen. Zwei ältere Herren, eine etwa dreißigjährige Frau mit rotbraun gebleichtem Haar, ein mageres Mädchen von etwa zwölf Jahren. Obwohl die kalte Jahreszeit noch nicht angebrochen war, trugen sie mehrere Hemden und Blusen unter ihren Mänteln und hatten mehrere Tücher um den Hals geschlungen. Außerdem hatten sie prall gefüllte Reisetaschen und Koffer bei sich. Anscheinend wollten sie so viele nützliche Sachen wie möglich mitnehmen. Ihr Anblick – die hastig übergeworfenen Kleidungsstücke, die schlecht geschlossenen Taschen, aus denen der Inhalt herausquoll, die offenen Schnürsenkel –, alles deutete darauf hin, dass sie völlig unvorbereitet und auf die Schnelle hatten packen müssen. Mit der Waffe im Rücken wurden sie aus dem Haus getrieben. Dennoch wirkten die vier keineswegs verzweifelt. Ruhig schweifte ihr Blick in die Ferne. Darin lagen Erinnerungen verborgen, von denen wir nichts wussten.
Wie üblich erledigten die Uniformierten mit den blitzenden Abzeichen am Revers ihre Arbeit, ohne auch nur eine Sekunde zu verschwenden. Vier Beamte schritten an uns vorbei. Der stechende Geruch von Desinfektionsmittel stieg mir in die Nase. Vielleicht hatte man jemanden aus der Zahnarztpraxis festgenommen.
Die Verhafteten wurden einer nach dem anderen auf die mit Planen verhängte Ladefläche des Lastwagens gestoßen. Die Waffen waren die ganze Zeit auf sie gerichtet. Als Letzte war das Mädchen dran, das seine orangefarbene, mit einem Teddybär bestickte Tasche auf die Ladefläche warf, um dann selbst hochzusteigen, aber der Tritt war offensichtlich für die Kleine zu hoch und sie rutschte ab.
Mir entfuhr ein Schrei, und der Umschlag fiel zu Boden. Manuskriptblätter flatterten über den Bürgersteig. Die anderen Passanten drehten sich ruckartig um und warfen mir missbilligende Blicke zu. Sie alle fürchteten, es könnte Ärger geben, wenn man die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zog.
Ein Junge, der in der Nähe stand, half mir beim Aufsammeln der Manuskriptblätter. Einige waren in Pfützen gelandet und durchnässt, ein paar zertrampelt, aber wir rafften sie hastig zusammen.
»Haben Sie alles?«, flüsterte der Junge mir ins Ohr.
Ich nickte und blickte ihn dankbar an.
Der durch mich verursachte Zwischenfall hatte keinerlei Auswirkungen auf das Vorgehen der Polizei. Keiner der Männer blickte in meine Richtung.
Einer der Beamten, der schon auf die Ladefläche geklettert war, reichte dem Mädchen die Hand und half ihm hinauf. Seine spitzen Knie, die unter dem Rock hervorschauten, wirkten noch ganz kindlich.
Man ließ die Planen herunter, der Motor wurde gestartet.
Es dauerte eine ganze Weile, bis die Zeit wieder ihren normalen Gang nahm. Als die Motorengeräusche verklungen und die Lastwagen außer Sicht waren, fuhr die Straßenbahn wieder an. Erst da war ich mir sicher, dass der Einsatz vorbei und ich unbeschadet davongekommen war. Die Passanten zerstreuten sich und gingen wieder ihren Geschäften nach. Der Junge überquerte den Fußgängerüberweg.
Beim Anblick der nun verschlossenen Tür des Gebäudes fragte ich mich, wie sich der Griff des Polizisten für das Mädchen angefühlt haben musste.
»Unterwegs habe ich eine schreckliche Szene erlebt«, erzählte ich meinem Lektor R in der Lobby des Verlags.
»Etwa die Erinnerungspolizei …?«
R zündete sich eine Zigarette an.
»Ja. Es ist wieder schlimmer geworden.«
»Daran wird man nichts ändern können.«
Er stieß langsam den Rauch aus.
»Aber heute sind sie anders vorgegangen als sonst. Gegen Mittag haben sie auf einen Schlag vier Personen aus einem Gebäude in der Innenstadt geführt. Bislang habe ich nur erlebt, dass in einem abgelegenen Wohnviertel ein einzelnes Familienmitglied verhaftet wurde.«
»Vielleicht hatten die vier sich dort in einem geheimen Unterschlupf versteckt.«
»Einem Unterschlupf?«
Kaum hatte ich das unbekannte Wort ausgesprochen, biss ich mir auf die Lippen. Es hieß, man solle in der Öffentlichkeit tunlichst vermeiden, über heikle Themen zu sprechen. Man müsse immer damit rechnen, dass in der Nähe ein Zivilbeamter lauert. Über die Erinnerungspolizei kursierten allerhand Gerüchte.
Doch in der Lobby herrschte kaum Betrieb. Außer drei Männern in Anzügen, die über einen Aktenstapel gebeugt miteinander diskutierten, saß bloß noch die Empfangsdame an der Rezeption und schaute gelangweilt drein.
»Ich schätze, sie haben einen Raum im Gebäude als Unterschlupf genutzt. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, um sich zu verstecken. Angeblich soll ein großes, verdeckt operierendes Netzwerk existieren, das diese Leute unterstützt. Man nutzt Verbindungen, um ihnen eine sichere Unterkunft, Geld und Verpflegung bereitzustellen. Aber wenn die Polizei nun auch schon solche Verstecke ausfindig macht, dann gibt es keinen sicheren Zufluchtsort mehr.«
R schien noch etwas hinzufügen zu wollen, griff jedoch stattdessen nach seiner Kaffeetasse und ließ den Blick schweigend über den Innenhof schweifen.
Dort stand ein kleiner Brunnen aus Ziegelsteinen. Es war ein einfaches Modell, ohne spezielle Vorrichtungen. Seit wir schwiegen, konnte man durch die Glasscheibe hindurch leise das Wasser plätschern hören. Es war ein zarter Klang. So als spielte jemand in der Ferne auf einer Harfe.
»Ich habe mich schon immer gewundert«, sagte ich und schaute ihn von der Seite an, »wie gelingt es der Polizei, die Leute aufzuspüren? Ich meine diejenigen, die keine Auswirkungen spüren, wenn etwas verschwindet. Äußerlich unterscheiden sie sich doch kein bisschen von anderen Menschen. Es sind Männer und Frauen, aus allen Altersgruppen, aus unterschiedlichen Familien. Wenn sie also auf der Hut sind und sich unauffällig unter die Leute mischen, dürfte ihnen doch nichts anzumerken sein. Es kann doch nicht so schwer sein, so zu tun, als würde auch ihr Bewusstsein beeinträchtigt werden, wenn etwas verschwindet.«
»Ich glaube nicht …« R dachte einen Moment lang nach und fuhr dann fort: »Es ist nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Unser Bewusstsein ist schließlich in ein weitaus umfangreicheres Unbewusstes eingebettet. Deshalb ist es nicht leicht, etwas vorzutäuschen. Die Betroffenen können sich ja nicht ausmalen, wie sich das Verschwinden von Dingen auf ihr Gedächtnis auswirkt. Sonst würden sie wohl nicht untertauchen.«
»Das ist richtig.«
»Es ist zwar nur ein Gerücht, aber angeblich lässt sich durch das Entschlüsseln der Gene bestimmen, wer von Geburt an über einen besonderen Bewusstseinszustand verfügt. Sogenannte Gen-Ingenieure sollen heimlich in Universitätslaboren ausgebildet werden.«
»Das Entschlüsseln von Genen?«
»Genau. Rein äußerlich mag es bei Personen keine Identifikationsmerkmale geben, aber wenn man sie auf der genetischen Ebene analysiert, lassen sich Gemeinsamkeiten finden. Wenn man bedenkt, wie rücksichtslos die Erinnerungspolizei neuerdings vorgeht, müssen die Forschungen ziemlich fortgeschritten sein.«
»Aber wie kommen die an unser Genmaterial?«, fragte ich.
»Sie haben doch gerade aus der Tasse getrunken, nicht wahr?«
R drückte seine Zigarette aus und hielt mir meine Tasse dicht vor die Nase. Seine Finger waren so nah, dass ich sie hätte anhauchen können. Aber ich kniff die Lippen zusammen und nickte.
»Es ist so einfach. Man braucht nur eine Tasse, und schon kann man mithilfe einer Speichelanalyse Ihren Genabdruck ermitteln. Die Erinnerungspolizei ist überall. Sogar in der Teeküche hier im Verlag. Ehe man sichs versieht, haben sie die genetischen Profile aller Inselbewohner entschlüsselt und in Datenbanken gespeichert. Dabei lässt sich unmöglich abschätzen, wie viel sie bereits archiviert haben. Egal, wie sehr wir achtgeben, ständig hinterlassen wir irgendwelche Partikel von uns. Haare, Schweiß, Fingernägel, Tränen … all das kann getestet werden. Es lässt sich nicht verhindern.«
Er stellte seine halb volle Tasse vorsichtig auf die Untertasse zurück und warf einen Blick hinein.
Wir hatten nicht bemerkt, dass die Männer ihre Besprechung beendet und die Lobby verlassen hatten. Ihre drei Kaffeetassen standen noch auf dem Tisch. Die Empfangsdame räumte sie mit ausdrucksloser Miene ab.
Ich wartete, bis sie außer Sichtweite war.
»Aber warum verhaften sie diese Leute? Sie haben sich doch nichts zuschulden kommen lassen …«
»Anscheinend soll auf dieser Insel alles nach und nach verschwinden. Insofern ist das, was bestehen bleibt, unangemessen und irrational.«
»Glauben Sie, meine Mutter wurde umgebracht?«
Dieser Satz war mir unversehens herausgerutscht. Ich wusste, es war sinnlos, R danach zu fragen.
»Auf jeden Fall wird man sie verhört und medizinisch untersucht haben.«
R wählte seine Worte mit Bedacht.
Wir verstummten. Nur das Plätschern des Brunnens drang an meine Ohren. Zwischen uns lag unangetastet der zerknitterte Umschlag.
R nahm ihn und zog das Manuskript heraus.
»Es ist schon merkwürdig, dass wir auf einer Insel, wo früher oder später alles verschwinden soll, mit Worten etwas erschaffen können.«
Fast zärtlich strich er den Schmutz von den Blättern.
Es kam mir vor, als wären in diesem Moment unsere Gedanken eins. Jetzt, von Angesicht zu Angesicht, konnte ich die Angst spüren, die sich vor langer Zeit in unseren Herzen eingenistet hat. In den Tropfen des Springbrunnens brach sich das Licht und fiel auf seine Gesichtszüge.
Ich fragte mich, was wäre, wenn eines Tages die Wörter verschwinden würden. Aber nur im Stillen. Weil etwas wahr werden kann, sobald man es laut ausspricht.
5
Der Herbst ging schnell vorüber. Die Wellen brandeten kalt und unnachgiebig gegen die Küste, und von den Bergen her wehte ein schneidender Wind, der Winterwolken vor sich hertrieb.
Der alte Mann stattete mir einen Besuch ab, um mir bei den Wintervorbereitungen behilflich zu sein. Wir brachten die Heizung in Gang, dämmten Wasserrohre ab und rechten das Laub im Garten zusammen.
»Diesen Winter soll es nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder schneien«, sagte der Alte, während er im Lagerraum, der auf den Hinterhof hinausging, an der Decke Zwiebeln aufhängte.
»Es schneit nämlich immer dann, wenn die Schalen der im Sommer geernteten Zwiebeln diesen schönen Bernsteinton haben und zart wie Schmetterlingsflügel sind.«
Er zog eine Schicht der Zwiebelhaut ab und zerrieb sie zwischen den Fingern, was angenehm knisterte.
»Es wäre erst das dritte Mal in meinem Leben. Das würde mich sehr freuen. Wie viele weiße Winter haben Sie schon erlebt?«
»Ich habe nie gezählt. Als ich mit der Fähre auf dem Nordmeer gefahren bin, hatte ich von dem endlosen Schneegestöber schnell die Nase voll. Aber das war lange, lange vor Ihrer Geburt«, erwiderte der Alte und machte sich wieder daran, die Zwiebelbunde aufzuhängen.
Als wir mit den Vorbereitungen fertig waren, machten wir im Ofen Feuer und aßen in der Küche Waffeln. Der frisch gereinigte Ofen zog nicht sogleich und bullerte laut vor sich hin. Draußen am Himmel hinterließ ein Flugzeug einen Kondensstreifen. Im Garten schlängelte sich aus der Asche des verbrannten Laubhaufens eine zarte Rauchsäule empor.
»Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Wenn der Winter naht, macht es mir immer ein wenig Angst, auf mich allein gestellt zu sein. Übrigens, ich habe Ihnen einen Pullover gestrickt. Probieren Sie doch mal, ob er passt.«
Nachdem ich meine Waffel verspeist hatte, holte ich den grauen Wollpullover, der ein aufwendiges Strickmuster hatte, hervor und überreichte ihn dem alten Mann. Geräuschvoll schluckte er seinen Tee hinunter und nahm das Geschenk andächtig entgegen.
»Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Aber das ist nicht der Rede wert. So ein wertvolles Geschenk kann ich nicht annehmen …«
Er legte seine schäbige Weste ab und verstaute sie, zusammengeknüllt wie ein gebrauchtes Handtuch, in seiner Tasche, bevor er vorsichtig in die Ärmel des Pullovers schlüpfte, als wäre er ein zartes Gespinst, das gleich auseinanderreißen würde.
»Oh, er ist schön warm! Und so leicht, als könnte man damit durch die Luft schweben.«
Die Ärmel waren ein wenig zu lang geraten und der Halsausschnitt war zu eng, aber der alte Mann scherte sich nicht darum. Er aß eine zweite Waffel und war so angetan von dem neuen Pullover, dass er es gar nicht merkte, als ein bisschen von der Cremefüllung an seinem Kinn hängen blieb.
Nachdem er seine Utensilien – Zange, Schraubenzieher, Sandpapier, Ölkännchen – im Werkzeugkasten auf dem Gepäckträger seines Fahrrads verstaut hatte, radelte er zur Fähre zurück.
Am nächsten Tag kam der erwartete Wintereinbruch. Ohne Mantel konnte man nicht mehr nach draußen gehen. In dem kleinen Fluss hinter dem Haus trieben Eisstücke, und auf dem Markt gab es viel weniger Auswahl an Gemüse.
Ich blieb zu Hause und arbeitete an meinem vierten Roman. Die Hauptfigur war diesmal eine Stenotypistin, die ihre Stimme verloren hatte. Zusammen mit ihrem Geliebten, einem Dozenten an einer Schreibmaschinenschule, setzt sie alles daran, sie wiederzuerlangen. Sie holt sich Rat bei einem Logopäden. Der Geliebte massiert ihr die Kehle, wärmt ihre Zunge mit seinen Lippen und spielt ihr Lieder vor, die sie beide vor langer Zeit aufgenommen haben. Aber ihre Stimme kehrt nicht zurück. Sie teilt ihre Gefühle mit ihm, indem sie Texte auf der Schreibmaschine tippt. Das mechanische Klacken der Tasten schwingt zwischen den beiden, als wäre es Musik …
Ich wusste noch nicht, wie die Geschichte weitergehen sollte. Bisher verlief alles unkompliziert und friedlich, aber die Geschichte konnte genauso gut eine bedrohliche Wendung nehmen.
Nach Mitternacht, als ich immer noch an meinem Roman arbeitete, hörte ich ein Geräusch. Es war, als klopfte jemand gegen eine Glasscheibe. Ich hielt inne und horchte genau hin, aber draußen rauschte nur der Wind. Nachdem ich eine weitere Zeile geschrieben hatte, klopfte es abermals. Klack, klack, klack … Es war ein regelmäßiges, aber zögerliches Klopfen.
Ich zog den Vorhang auf und schaute nach draußen. Die umliegenden Häuser waren allesamt dunkel, die Straße menschenleer. Ich schloss die Augen und horchte aufmerksam hin, um herauszufinden, woher das Klopfen kam, bis mir klar wurde, dass es aus dem Keller nach oben drang.
Nach dem Tod meiner Mutter war ich nur selten in ihrem Atelier gewesen. Die Tür war stets verschlossen. Weil ich den Schlüssel fast nie brauchte, dauerte es eine Weile, bis ich ihn fand. Es schepperte mächtig, als ich in einer Schublade nach der Metalldose mit dem Schlüsselbund kramte. Ich wusste, es wäre besser gewesen, ruhig und behutsam vorzugehen, aber das gleichmäßige Klopfen war so beharrlich, dass es mich zur Eile trieb.
Schließlich öffnete ich die Kellertür und stieg die Treppe hinab. Als ich die Taschenlampe anknipste, sah ich durch die Glastür, die zum Waschplatz am Flussufer führte, menschliche Gestalten.
Der Waschplatz diente seit dem Tod meiner Großmutter nicht mehr zum Wäschewaschen, hatte seinen Namen jedoch beibehalten. Meine Mutter hatte dort manchmal ihre Werkzeuge gereinigt, aber das war nun auch schon fünfzehn Jahre her. Die in die Uferböschung eingelassene und mit Ziegelsteinen befestigte Stelle war etwa zwei Meter breit. Man gelangte durch die Glastür im Keller dorthin. Über den lediglich drei Meter breiten Wasserlauf führte ein Holzsteg, den mein Großvater einst errichtet hatte, der nun aber völlig morsch war.
Was hatten diese Leute dort zu suchen?
Ich überlegte, was ich tun sollte.
Waren es Einbrecher? Nein, Einbrecher würden nicht anklopfen. Irgendwelche Sittenstrolche? Nein, dann wären sie nicht so zurückhaltend.
Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und rief: »Wer ist da?«
»Entschuldigen Sie vielmals die späte Störung. Wir sind’s, die Inuis.«
Als ich die Tür öffnete, stand dort die Familie von Professor Inui. Die Eheleute waren alte Freunde meiner Eltern gewesen. Er arbeitete als Professor für Dermatologie im Universitätskrankenhaus.
»Was ist passiert?«, fragte ich erschrocken und bat sie sogleich ins Haus.
Das Rauschen des Flusses machte die hereinströmende Kälte noch durchdringender.
»Verzeihen Sie bitte. Mir ist vollauf bewusst, dass wir ungelegen kommen …«
Der Professor entschuldigte sich mehrmals, während sie eintraten. Seine Frau war ungeschminkt, ihre Wangen wirkten durchsichtig und die Augen feucht, entweder von der Kälte oder ihren Tränen. Die fünfzehnjährige Tochter stand mit verkniffenem Mund da, während ihr achtjähriger Bruder sich neugierig umschaute. Die vier klammerten sich förmlich aneinander. Das Ehepaar hatte sich untergehakt, wobei der Professor einen Arm um die Schultern seiner Tochter gelegt hatte. Die Geschwister hielten sich an der Hand, und der Kleine hing am Mantelsaum seiner Mutter.