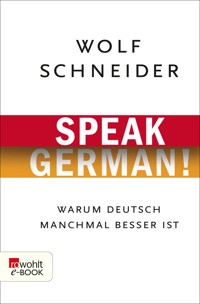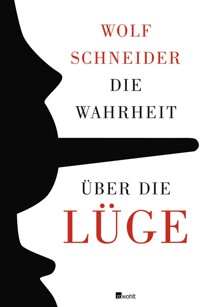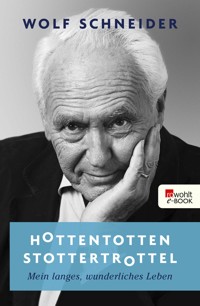12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit Jahrzehnten ist «Das neue Handbuch des Journalismus» die ideale Orientierung für Berufseinsteiger, Volontäre und Jungredakteure. Aber auch für den erfahrenen Schreiber ist es immer wieder hilfreich, um Fallstricke des journalistischen Handwerks zu umgehen und über Neues auf dem Laufenden zu bleiben. Dieses bewährte Handbuch versammelt das Wissenswerte über den Print-Journalismus und den immer wichtiger werdenden Online-Journalismus sowie die Arbeit in und mit «PR und Pressestellen». Journalismus ist ein Modeberuf, und noch nie waren Journalisten für die demokratische Gesellschaft so wichtig wie in diesem Zeitalter der explodierenden Information. Also war es auch noch nie so dringlich, kundig, kritisch und anschaulich in dieses schwierige und großartige Handwerk einzuführen. In klaren Schritten werden die Formen des Journalismus und die Probleme des Journalisten dargestellt, anschaulich, prall von Beispielen aus der Praxis. Zur Praxis gehört exakte Information: Was erwartet mich in diesem Beruf? Wie unterscheidet sich die Arbeit in der Zeitung von der in der Zeitschrift, im Fernsehen, in der Online-Redaktion, im Internet? Wie sieht der Alltag in den Redaktionen aus? Wo eigentlich kann ich mich bewerben? Was sollte ich vorher schon wissen, damit ich mich nicht blamiere? Das Buch gibt die Antworten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Wolf Schneider
Paul-Josef Raue
Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Was dieses Buch will
Die Journalisten
2 Welche Journalisten wir meinen – und welche nicht
3 Warum die Gesellschaft bessere Journalisten braucht
4 Was solche Journalisten können sollten
Online-Journalismus
5 Die Internet-Revolution
6 Der Teaser – alte Regeln, neuer Nutzen
7 Die Online-Redaktion
8 Podcast – Fürs Hören schreiben
9 Video-Journalismus
10 Was Journalisten von Bloggern lernen können
Schreiben und Redigieren
11 Verständliche Wörter
12 Durchsichtige Sätze
13 Der heilige Synonymus
14 Konkret geht vor abstrakt
15 Das Redigieren
16 Lexikon unbrauchbarer Wörter
Wie Journalisten recherchieren
17 Die eigene Recherche
18 Wie man eine Recherche organisiert
Wie Journalisten informiert werden
19 Die Nachrichtenagenturen
20 Waschzettel und Verlautbarungen
21 Die Pressekonferenz
Wie Journalisten Leser und Hörer informieren
22 Warum alles Informieren so schwierig ist
23 Was ist eine Nachricht?
24 Woraus wird eine Nachricht?
25 Wie schreibt man eine Nachricht?
26 Das Interview
27 Vorsicht, Zahlen!
28 Die meisten Journalisten sind unkritisch
29 Viele Journalisten manipulieren
30 Analyse – Synthese – Hintergrund
Die unterhaltende Information
31 Das Feature
32 Die Reportage
33 Wie man eine Reportage schreibt
34 Das Porträt
35 Der Boulevardjournalismus
36 Der Zeitschriftenjournalismus
Die Meinung
37 Der Kommentar
38 Die Satire
Wie man Leser gewinnt
39 Ein heikler Souverän
40 Das Layout
41 Das Foto
42 Die Bildunterschrift
43 Die Infographik
44 Die Überschrift
45 Lead, Vorspann und Teaser
Die Redaktion
46 Wer hat die Macht?
47 Newsdesk und Ressorts
Presserecht und Ethik
48 Wie Journalisten entscheiden
49 Wie Journalisten entscheiden sollten
50 Presserecht
Pressesprecher und PR
51 Wie man in der PR arbeitet
52 Wie Öffentlichkeitsarbeiter informieren
Die Zukunft der Zeitung
53 Was die Leser wollen
54 Die neue Seite 1
55 Der neue Lokaljournalismus
56 Service und Aktionen
57 Wie können Zeitungen überleben?
Ausbildung und Berufsbilder
58 Die Ausbildung zum Redakteur
59 Die journalistischen Berufe
60 Der freie Journalist
Welche Zukunft hat der Journalismus?
Service
A. Literatur
B. Medien-Kodizes
C. Erste Adressen
D. Die deutschen Zeitungen
E. Die meistbesuchten Nachrichtenseiten im Internet
F. Journalistenschulen
G. Hochschulausbildung
H. Lexikon journalistischer Fachausdrücke
Namen- und Sachregister
Fußnote
[LovelyBooks Stream]
Einleitung
1Was dieses Buch will
Wir wollen Orientierung bieten: jungen Menschen, die erwägen, Journalist zu werden, aber von diesem Beruf noch keine realistische Vorstellung besitzen; angehenden Journalisten, die dabei sind, dieses großartige und schwierige Handwerk zu erlernen; und ebenso gestandenen Redakteuren, wenn sie den Wunsch haben, sich zu vervollkommnen oder über die Fallstricke und die Tücken ihrer Tätigkeit einmal nachzudenken.
Dabei nehmen wir, wo immer es sich anbietet, eine Unterteilung vor, die im Beruf und auch in solchen Büchern nicht geläufig ist: zwischen den herrschenden Gebräuchen und dem Versuch, ihnen dort, wo wir sie für schlecht halten, bessere Modelle entgegenzusetzen. Die Einübung in das überwiegend Übliche schulden wir den Berufsanfängern; die Kritik daran glauben wir uns selber und allen erfahrenen Redakteuren schuldig zu sein, ebenso der Rolle des Journalismus im demokratischen Staat.
Natürlich wird uns die Frage beschäftigen, warum Journalisten und Blogger einander oft verachten – und wie sie voneinander lernen könnten (Kapitel 10). Den Online-Journalismus dagegen behandeln wir als eine bloße Spielart des klassischen Handwerks – nur dadurch unterschieden, dass auf dem Bildschirm noch ungeduldiger gelesen wird als in der Zeitung; die letzte Zeile eines Textes erreichen die wenigsten.
Mit dieser Ausnahme gilt nach unserer Überzeugung für alle Sparten des Journalismus: Die Einstellung zum Beruf und die Grundzüge des Handwerks sind allen gemeinsam – mindestens sollten sie es sein: die saubere Recherche, die klare Darstellung, der Wille, unsere Mitbürger redlich und lebendig zu informieren.
Nicht einmal in der Sprache sollte es einen Unterschied geben, einer verbreiteten Irrlehre zum Trotz: Dem Rundfunkjournalisten wird gepredigt, dass er für die Ohren schreiben soll; wir predigen den Zeitungs- und Online-Redakteuren dasselbe, und wir werden ausführlich begründen, warum.
Wenn wir uns insoweit an alle wenden, die Journalisten sind oder werden wollen, so müssen wir doch eine technische Einschränkung machen: Diejenigen Teile des Handwerks, die allein für Funk und Fernsehen typisch sind – zum Beispiel Umgang mit Mikrophon und Kamera, Moderation, Drehplan und Schnitt–, die behandeln wir nicht; das ist ein eigenes Feld, das nach einem anderen Buch verlangt. Auch geriete man, zumal bei Hörfunk und Fernsehen, alsbald in Definitionsprobleme: Wer zieht die Grenze zwischen dem Journalisten und der bloßen Plaudertasche?
Die Journalisten
2Welche Journalisten wir meinen – und welche nicht
Wir meinen die nicht, bei denen man sich streiten kann, ob sie Journalisten zu heißen verdienen. Wer in der Branche nur einen Job finden, wer sich also lediglich marktgerecht verhalten will – muss nur wenig können und wenig wissen, und Verantwortungsgefühl schadet ihm nur.
So verlangen die privaten Hörfunk- und Fernsehsender nach dem Dampfplauderer, der jederzeit in der Lage ist, auf allen Kanälen die Lautsprecher zu verstopfen. Dazu muss er nur dreierlei beherrschen: niemals um ein Wort verlegen zu sein, seine eigenen Versprecher unheimlich komisch zu finden und auch schlechte Witze nicht zu unterdrücken.
Viele Zeitschriften wiederum setzen auf ihre begnadeten Tipp-Geber: «20Tipps, wie Sie einen Mann glücklich machen» zum Beispiel oder jene Diät-Ratschläge, deren Wirkungslosigkeit seit Jahrzehnten als erwiesen gelten kann. Etliche Billigblätter brillieren mit dem neuesten Klatsch aus Königshäusern. Dass der großenteils erfunden ist, bestreitet niemand; man fragt sich nur, ob die Redakteure eher naiv oder eher zynisch agieren.
Auch gibt es Zeitschriften-Chefredakteure, die ihre privaten Beobachtungen, Aha-Erlebnisse oder Schicksalsschläge in einen Artikel oder gar in eine Serie verwandeln lassen, gestützt auf den in der Branche sprichwörtlichen «Immermehrismus»: «Immer mehr Frauen gehen fremd» oder «Eifersucht – die neue Geißel».
Boulevardzeitungen erfinden seltener – sie jubeln hoch. Zu jener Wahnsinnsnachricht der Bildzeitung von 2009 zum Beispiel: «Oliver Pocher– Schweinegrippe!» Mit der ähnlich atemraubenden Unterzeile: «Wie gefährlich ist das für seine schwangere Sandy?»
Völlig ungefährlich! Alle Journalisten hätten das wissen können an diesem 29.November 2009: Denn am 9.Oktober hatte der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft öffentlich festgestellt: «Die Gesundheitsbehörden sind auf eine Kampagne der Pharma-Industrie hereingefallen», am 1.November warnte der Präsident der Bundesärztekammer vor «Panikmache», und am 9.November schrieb der Spiegel: «Würden die Medien die normale Wintergrippe genauso aufgeregt verfolgen, müssten wir im Winter täglich schreien: ‹Schon wieder 100Grippe-Tote!›»
Damit aber sind wir bei den Journalisten, die wir meinen: die von den seriösen Zeitungen und Sendern nämlich. In aberwitziger Überreizung der Bilder von hundert Atemschutzmasken auf den Straßen der Stadt Mexiko hatten auch sie die Panik herbeigeschrieben.
Wie schon beim Rinderwahnsinn, BSE: Null Tote in Deutschland – aber im Januar 2001 war diese englische Kuh-Seuche die größte Sorge der Deutschen, vor den damals vier Millionen Arbeitslosen. Bis die Süddeutsche Zeitung sich im August aufgerufen fühlte, die Hysterie, an deren Zustandekommen sie durch mehrere Aufmacher lebhaft mitgewirkt hatte, nun ihren Lesern vorzuwerfen: «Der Verbraucher neigt zur Hysterie – dabei ist das Infektionsrisiko beim Rinderwahn minimal.»
Ja, diese Journalisten meinen wir: Mit ihren ehrenwerten Absichten sind sie nicht gegen den Krawall gefeit, wenn er nur unter «vorrangig» aus den Agenturen donnert.
Und auch das Gegenstück meinen wir: die verknöcherten Journalisten. Ihre Kalkablagerungen finden sich immer noch in jenen saturieren Abonnementszeitungen, die jahrzehntelang mit journalistischen Mitteln nicht ruiniert werden konnten – und auch in der großen Auflagen- und Anzeigenkrise geduldig auf die kleiner werdende Leserschar hinabschauen. Diese Blätter tun das Äußerste, um ihre eifrig zitierten Vorzüge gegenüber dem Fernsehen– Analyse, Reportage, Hintergrund – entweder nur im Munde zu führen oder wenigstens im Inneren der Zeitung zu verstecken. Warum wir das für vorgestrig halten und wie – gerade in der Krise – alles anders werden kann, zeigen wir in den sechs Kapiteln zur «Zukunft der Zeitung».
Mit einer Handreichung also wollen wir’s versuchen: für alle, die diesen immer noch großartigen Beruf ergreifen – oder, obwohl längst im Geschirr, mal frisch über ihn nachdenken wollen.
3Warum die Gesellschaft bessere Journalisten braucht
Wenn die demokratische Gesellschaft funktionieren soll, dann ist sie auf Journalisten angewiesen, die viel können, viel wissen und ein waches Bewusstsein für ihre Verantwortung besitzen. Nur dann können sie ihrer zweifachen Aufgabe gerecht werden: Durch den Dschungel der irdischen Verhältnisse eine Schneise der Information zu schlagen – und den Inhabern der Macht auf die Finger zu sehen.
Das Zweite funktioniert schon ziemlich gut. Längst gehören die Journalisten zu den Mächtigsten im Lande. Sie selbst bestreiten das natürlich, und die Politiker hören es nicht gern und bestreiten es auch. Aber: Gegen die Schlagzeilen der Presse kann kein Politiker regieren. Mindestens ein Dutzend Vorhaben hat die deutsche Regierung in den letzten Jahren preisgegeben, weil die Presse kritisch und hämisch darüber berichtete.
Auch über Verfehlungen von Politikern lässt sich sagen: Die Presse hat so viele aufgedeckt, dass vermutlich kein hohes Risiko besteht, Verstöße gegen das Recht oder den politischen Ehrenkodex könnten lange unter der Decke bleiben. Zuweilen scheint eher die umgekehrte Sorge berechtigt: dass ihre Macht einige einflussreiche Journalisten dazu verführt, gegen einen Politiker auch wegen einer Lappalie ein Kesseltreiben zu veranstalten.
Was indessen höchst unzulänglich funktioniert, ist die Art, wie die Journalisten die wichtigere ihrer beiden Aufgaben wahrnehmen: ihre Mitbürger gescheit zu informieren. Hier lag von jeher viel im Argen; im Zeitalter der Info-Fetzen auf unzähligen Kanälen aber wird aus der Schwäche eine Katastrophe.
Von der Hälfte aller Journalisten deutscher Sprache lässt sich behaupten, dass sie sich für ihre Leser und Hörer eigentlich nicht interessieren. Wer in beamtenähnlichem Status bei einem öffentlichrechtlichen Sender oder wer bei einer Abonnementszeitung mit regionalem Monopol beschäftigt ist, der steht unter der Versuchung, seine Spalten oder seine Minuten so zu füllen, dass er sich möglichst wenig anzustrengen braucht. Der Anteil derjenigen Journalisten, die dieser Versuchung erliegen, schwankt von Redaktion zu Redaktion, manchmal von Ressort zu Ressort; erheblich ist er überall. Bei der Einübung in das Übliche, die wir den Benutzern dieses Buchs schulden, wird solcher Beamtenjournalismus immer wieder ausgeleuchtet werden.
Diejenigen Journalisten aber, die um ihre Leser oder Hörer kämpfen müssen, weil sie bei Privatsendern, Boulevardzeitungen oder überflüssigen Zeitschriften arbeiten – sie liefern überwiegend auch nicht gerade das, was sich als gescheite Information einstufen ließe.
Dazwischen gibt es eine ziemlich kleine Minderheit von solchen, die sich redlich plagen, das Unwichtige auszusondern und das Verworrene zu klären, wie sie es ihren Mitbürgern schuldig sind. Nur sie füllen die lebenswichtige Rolle aus, die das demokratische Staatswesen ihnen zuweist: Indem es die Wahlentscheidung in die Hand aller erwachsenen Bürger legt, baut es darauf, dass die Wähler wenigstens einigermaßen den Hintergrund und das Für und Wider ihrer Entscheidung kennen; die Journalisten sind die Instanz, deren Aufgabe es ist, ihnen zu diesem Informationsgrad zu verhelfen.
Also kann nichts wichtiger sein, als die Minderheit derjenigen Redakteure, die ihre staatsbürgerliche Rolle sauber spielen, so zu stärken, dass sie eines Tages zur Mehrheit wird. Dies umso mehr, als immer mehr Informationsbrocken auf uns niederprasseln, wodurch unser Bedarf nach dem Ordner und Sortierer dramatisch steigt.
Schon 1979 beklagte Hans Heigert in der Süddeutschen Zeitung den «Fetzenjournalismus», der in den Nachrichten von Zeitungen und Sendern dominiere; die Realität richte er als Büfett von Appetithäppchen an. Über die Tagesschau schrieb Heigert, sie kombiniere eine verwirrende Abfolge zusammenhangloser Bilder mit einer Wortsuada, «die dich zuerst nervös macht, dann gereizt, schließlich schlaff und endlich so stumpf, daß du mit allem zufrieden bist, was nun folgt».
1979! Da gab es noch kein Privatfernsehen und kein Internet, und die Tagesschau dauerte immer 14Minuten – nicht jene eine Minute, in der sie heute vor 20Uhr mehrfach über die Sender geht. Bald werden wir 200 oder 500Kanäle haben, und durchs Internet rasen Milliarden Info-Fetzen.
Die Zeitungen, die im 21.Jahrhundert prosperieren wollen, brauchten Journalisten, die das Talent besitzen, «eine endlose Vielfalt von Ereignissen zu bewerten und zu erklären», sagt Max Frankel, ehemaliger Chefredakteur der New York Times – bessere Journalisten also als bisher.
4Was solche Journalisten können sollten
Und wie kommt man zu besseren Journalisten? Kann man denn Menschen klüger machen, als sie sind? Und wenn nicht: Inwieweit lässt sich Journalismus lernen? Ist es nicht vielmehr ein reiner Begabungsberuf, wie viele Leute, ja gerade viele Journalisten behaupten?
Zunächst, vor aller Begabung: Es gibt einige Grundeigenschaften, die einer mitbringen sollte, der Journalist werden will – vor allem gute Nerven, Arbeitsdisziplin und ein Quantum Selbstvertrauen. Der Zeitdruck ist groß und allgegenwärtig, selbst in Monatszeitschriften, wenn der Redaktionsschluss naht; und in der Tageszeitung sind die letzten Minuten vor dem Abschluss oft die reine Nervenmühle.
Arbeitsdisziplin bedeutet: Wenn der Auftrag lautet, bis 18Uhr 60Zeilen geschrieben zu haben, so hat er ausgeführt zu werden, auch bei Kopfschmerzen, privatem Ärger oder dem Gefühl «Heute ist einfach nicht mein Tag».
Selbstvertrauen ist nötig: im Außendienst, weil der Journalist bereit sein muss, fremde Menschen zum Reden zu bringen und Politikern peinliche Fragen zu stellen; am Schreibtisch, weil der Redakteur fortlaufend Entscheidungen zu treffen hat, obwohl ihm oft nur unzulängliche Informationen vorliegen oder sein Hintergrundwissen dafür nicht ausreicht oder Platznot ihn zwingt, heute auch Minderwertiges zu drucken, morgen auch Wichtiges wegzulassen.
Die Langsamen, die Mimosen und die Schüchternen also sollten den Beruf wohl nicht ergreifen. Nun zu dem, was man im engeren Sinn als «Begabung» bezeichnet.
Natürlich: Ohne Begabung ist alles nichts. Aber ohne Lernen ist auch nichts. Selbstverständlich hätte Goethe nicht auf Anhieb eine gute Schlagzeile formulieren können, und auch Mozart war gut bedient damit, dass er einen Vater hatte, der ihm das Klavierspielen beibrachte. Noch besser bedient war Paganini: Der erwies sich nämlich als zu faul, um auf der Geige zu üben, und sein Vater zwang ihn dazu mit Schlägen und mit Essensentzug.
Woraus man sieht: Auch ein Genie muss noch lernen – und auch Nichtgenies können sehr viel lernen. Diese Einsicht ist die Basis einer seriösen Journalistenausbildung. Sie geht davon aus, dass guter Journalismus sich aus vier verschiedenen Quellen speist: der Begabung, dem Charakter, dem Wissen und dem Handwerk.
Begabung: Das ist ein Quantum Intelligenz, ein Quantum Sprachtalent und ein hurtig arbeitender Verstand. Diese Eigenschaften sind überwiegend angeboren, jedenfalls einem Erwachsenen nicht mehr zu vermitteln.
Charakter: Da braucht der Journalist vor allem fünf Eigenschaften, die teils angeboren sein, teils sich in der Kindheit entwickelt haben mögen:
Neugier lautet meist die erste Antwort von Chefredakteuren auf die Frage «Was braucht ein Journalist?» Werner Holzer, langjähriger Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, forderte «angeborene und durchtrainierte Neugier auf alles, was geschieht».
Aber auch Streitlust braucht der Journalist, Harmonie darf nicht sein oberstes Bedürfnis sein; lieber soll er Zwietracht säen, als versöhnliches Geschwätz zu produzieren.
Und Rückgrat soll er haben. Für Verleger und Intendanten ist das sicher manchmal unbequem, aber für Leser und Hörer ist es großartig, wenn der Journalist den vielfältigen Versuchungen und Pressionen widersteht, die auf ihn eindringen; wenn er bereit ist, sich Feinde zu machen und auch zu seinen Freunden kritische Distanz zu wahren, sobald er über sie schreibt.
Misstrauen ist eine zu selten geübte Königstugend. Der bereits angesprochene Rinderwahnsinn (BSE) von 2001 wie auch die Schweinegrippe von 2010 waren Seuchen, die nicht durch Viren und Bazillen, sondern durch Journalisten verbreitet wurden. An BSE starb in Deutschland nicht ein Mensch, aber Millionen lebten in Angst, ja im Januar 2001 galt den Deutschen der Rinderwahnsinn als ihre größte Sorge, vor der Arbeitslosigkeit.
An der Schweinegrippe starben weit weniger Deutsche als an der einheimischen Wintergrippe, und frühzeitig tauchten Indizien auf, dass die Pharma-Industrie hier eine Hysterie anheizte, um sich Milliarden in die Taschen zu schaufeln. Niemals gab es einen seriösen Grund, eine der beiden Nachrichten aufzumachen; ins Vermischte hätten sie gehört. In Kapitel 28 («Die meisten Journalisten sind unkritisch») wird das Thema noch einmal aufgegriffen.
Schließlich sollte der Journalist frei von Hochmut sein. Es gibt ungeheuer hochmütige Redaktionen, machen wir uns da nichts vor. Redakteure gibt es, die es nur schwer ertragen können, dass sie nicht im Nebenberuf auch noch Bundeskanzler sind; Redakteure, die in den Spiegel schauen und zu sich selber sagen wie Nestroys Holofernes: «Ich möcht’ mich einmal mit mir selbst zusammensetzen, nur um zu sehen, wer der Stärkere ist – ich oder ich.»
Das also waren erwünschte Talente und Charaktereigenschaften. Ehe der Journalist sein eigentliches Handwerk erlernt, sollte er aber schon zweierlei erworben haben: Fachkenntnisse und Weltkenntnis.
Fachkenntnisse werden nach einem verbreiteten Vorurteil an den Universitäten erworben. Gegen diese Ansicht vieler Chefredakteure haben wir drei Einwände.
Erster Einwand: Längst ist unser Erziehungssystem imstande, den ungebildeten Akademiker zu produzieren. Unter den Kandidaten in der Endauswahl zur Hamburger Journalistenschule haben im Durchschnitt drei Viertel einen akademischen Grad; aber auf die Wissensfrage «Welcher der drei Kriege, die Bismarck führte, war der wichtigste, und wann fand er statt?» gab es kaum zehn Prozent richtige Antworten (der gegen Frankreich 1870/71) – oft aber Kritik: So was brauche man nicht mehr zu wissen, dafür sei der Computer da.
Was ein mehrstufiger Unsinn ist. Denn: 1.Im Live-Interview kann man den Computer nicht befragen. 2.Wer auch die wichtigsten Daten und Zusammenhänge nicht im Kopf hat, muss für jeden Text dutzendfach ins Internet und versaut seine Termine. 3.Wenn es ihm an einem Mindestvorrat an Daten und einem universalen Hintergrundwissen fehlt, wird er die Fallstricke seiner Vorlage nicht erkennen und dutzendfach Unsinn in die Zeitung lassen. War es nicht genug, dass der Feuilletonchef der Zeit über Goethes gespanntes Verhältnis zum Frankfurter Güterbahnhof berichtete?
Wissenslücken also können Akademiker haben, dass es einer Sau graust. Dazu kommt ein zweiter Einwand gegen eine kritiklose Hochschätzung des Studiums: Seine meisten Befürworter sagen, es sei ganz egal, ob einer Germanistik, Astrophysik oder Zahnmedizin studiert habe; Hauptsache, er habe gelernt, gründlich zu recherchieren, wissenschaftlich zu arbeiten, Zusammenhänge herzustellen und darzustellen.
Ob er das wirklich gelernt hat, da haben wir unsere Zweifel. Aber selbst wenn er es gelernt haben sollte – spricht denn irgendetwas dagegen, dass er das wissenschaftliche Arbeiten an einem Thema übt, das journalistisch auch noch von Nutzen ist?
Natürlich, kein Studium ist gänzlich überflüssig, irgendein Vorteil springt immer heraus. Aber wenn jemand Germanistik studiert, dann kann er in derselben Zeit leider nicht Romanistik, Slawistik oder Sinologie studieren – und hätte nicht jede Redaktion viel mehr davon, dass ein Redakteur Polnisch, Chinesisch oder Portugiesisch spricht, als dass er sich mit Walther von der Vogelweide mittelhochdeutsch unterhalten könnte?
Irgendetwas studiert haben, Hauptsache «studiert» haben: Ist das wirklich eine wohlabgewogene Forderung – oder hat es am Ende eine psychologische Verwandtschaft mit jenen Heiratsanzeigen, in denen Akademikerwitwen herrisch fordern, auch ihr Künftiger müsse ein Akademiker sein?
Jura und Volkswirtschaft – das sind gute Studien für Journalisten, weil die wirtschaftlichen und juristischen Probleme allgegenwärtig sind. Naturwissenschaften sind hochwillkommen: Man denke an einen Physiker, der über Atomkraftwerke nicht nur mit Emotionen schreiben kann, sondern auch mit Sachkenntnis!
So lautet unser Rat an junge Leute, die Journalisten werden sollen: «Da die meisten Chefredakteure Akademiker bevorzugen, müsst ihr wohl studieren. Aber dann studiert erstens zügig und zweitens etwas Handfestes, worüber Bescheid zu wissen dem Journalisten und seinen Lesern nützt – also nicht Germanistik, Literaturwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Psychologie, Soziologie!»
Jenen Chefredakteuren, die auf einem akademischen Abschluss bestehen, möchten wir drittens zu bedenken geben: Wenn einer, statt vier bis sieben Jahre in Göttingen oder Tübingen zu studieren, vier bis sieben Jahre Entwicklungshelfer gewesen wäre – wäre der euch wirklich weniger wert? Der wüsste doch, wie es auf der Welt zugeht, und ist nicht ebendies eine journalistische Kardinaltugend? Wie viel Weltkenntnis erwerbe ich durch meinen innigen Umgang mit Wolfram von Eschenbach, verglichen mit sieben Jahren unter den Hungerleidern dieser Erde?
Weltkenntnis – das ist ein zentrales Stichwort. Denn es wimmelt von Journalisten, die nicht wissen, wie es auf unserer Erde aussieht. Und es wimmelt von Journalisten, die ihre privaten Aha-Erlebnisse mit einer Zäsur der Weltgeschichte verwechseln und sie mit diesem Anspruch als Leitartikel unter die Leute bringen.
Da gab es den Chefredakteur einer großen Zeitschrift, den mit plötzlicher Erschütterung die Einsicht traf, dass in Berlin «die große Verlogenheit» ausgebrochen sei. Verlogenheit ist aber nichts, was noch irgendwo ausbrechen könnte: Seit die Affen sprechen lernten und sich Menschen nannten, benutzten sie die Sprache zum Transport von Wahrheit, Irrtum, Lüge und Geschwätz, und daran hat sich seit zwei Millionen Jahren nichts geändert, auch nicht in Berlin; höchstens, dass Berufspolitiker mehr lügen als andere Menschen, aber dies nun auch schon dreitausend Jahre lang.
Auch kennen wir Kollegen, die bei dem Satz «Am schönsten waren auf Java immer die langen Sommerabende» nicht stutzen, obwohl es doch so dicht am Äquator weder einen Sommer noch einen langen Abend gibt. Und solchen Unsinn lassen sie dann stehen und verbreiten ihn unter fünfmal hunderttausend Lesern.
Natürlich, alles kann man nicht wissen. Deshalb wünschen wir von einem guten Journalisten, dass er neben seinem Fachwissen – in der Physik oder auf den Philippinen – eine universale Halbbildung besitzt. Wir sollten das Wort «Halbbildung» von seinem negativen Beigeschmack befreien und sie uns für den Journalisten ausdrücklich wünschen.
Universalbildung kann ja niemand mehr beanspruchen; Gottfried Wilhelm Leibniz war der Letzte, der sie für sich in Anspruch nahm, und der ist 1716 gestorben. Aber auf möglichst vielen Feldern wenigstens ein halbes Wissen, eine Ahnung zu haben: Das würde den Journalisten zieren. Fehler zu erkennen ist möglich und wertvoll, auch wenn man die richtige Antwort nicht weiß; nur wer den Fehler wittert, hat den Antrieb, die Wahrheit aufzuspüren. Das wäre fruchtbare Halbbildung.
Auch ziert es den Journalisten, sein Heimatland nicht für den Nabel der Welt zu halten; über Indianer oder Malaien nicht mit abendländischen Maßstäben herzufallen; und zu wissen, dass Grönland bei weitem nicht so groß ist wie Afrika, auch wenn es auf den meisten Weltkarten so aussieht.
Nachdenken überhaupt ziert den Redakteur, und zwischen Terminnot und Routine kommt das Denken häufig zu kurz. «Behaltet den Kopf über Wasser, Kollegen!», möchten wir allen jungen Journalisten zurufen. «Ihr seid für das alles zuständig, für das wenigste ausgebildet und durch fast nichts legitimiert. Aber ohne euch funktioniert sie nicht, die Demokratie. Ihr seid dazu da, eure Millionen Leser und Hörer so fair und so gründlich zu informieren, dass sie bei den nächsten Wahlen keine allzu schlimmen Dummheiten begehen. Also: Lernt – plagt euch – macht den Rücken steif – traut keinem, der euch etwas verkaufen will; und wenn ihr dann selber leidlich Bescheid wisst: Dann gebt euch Mühe, es euren Lesern und Hörern so mitzuteilen, dass sie es verstehen können und dass sie es lesen wollen.»
Eine solche Gesinnung zu wecken und jungen Journalisten das Handwerkszeug mitzugeben, mit dem sie dieser Gesinnung nachleben können – das ist die zentrale Aufgabe, die wir uns mit diesem Buch gestellt haben.
Was Redakteure für die Demokratie leisten müssen
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem «Spiegel-Urteil» am 5.August 1966 den Wert der freien Presse für eine Demokratie deutlich gemacht. Aus den Aufgaben der Presse sind die Verpflichtungen für Redaktionen und Redakteure ableitbar:
Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staates; insbesondere ist eine freie, regelmäßig erscheinende politische Presse für die moderne Demokratie unentbehrlich.
Soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muss er umfassend informiert sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwägen können, die andere sich gebildet haben. Die Presse hält diese ständige Diskussion in Gang; sie beschafft die Informationen, nimmt selbst dazu Stellung und wirkt damit als orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung.
In ihr artikuliert sich die öffentliche Meinung; die Argumente klären sich in Rede und Gegenrede, gewinnen deutliche Konturen und erleichtern so dem Bürger Urteil und Entscheidung. In der repräsentativen Demokratie steht die Presse zugleich als ständiges Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und seinen gewählten Vertretern in Parlament und Regierung. Sie fasst die in der Gesellschaft und ihren Gruppen unaufhörlich sich neu bildenden Meinungen und Forderungen kritisch zusammen, stellt sie zur Erörterung und trägt sie an die politisch handelnden Staatsorgane heran, die auf diese Weise ihre Entscheidungen auch in Einzelfragen der Tagespolitik ständig am Maßstab der im Volk tatsächlich vertretenen Auffassungen messen können.
So wichtig die damit der Presse zufallende «öffentliche Aufgabe» ist, so wenig kann diese von der organisierten staatlichen Gewalt erfüllt werden. Presseunternehmen müssen sich im gesellschaftlichen Raum frei bilden können. Sie arbeiten nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen und in privatrechtlichen Organisationsformen. Sie stehen miteinander in geistiger und wirtschaftlicher Konkurrenz, in die die öffentliche Gewalt grundsätzlich nicht eingreifen darf.
Der Funktion der freien Presse im demokratischen Staat entspricht ihre Rechtsstellung nach der Verfassung. Das Grundgesetz gewährleistet in Art. 5 die Pressefreiheit. Wird damit zunächst ein subjektives Grundrecht für die im Pressewesen tätigen Personen und Unternehmen gewährt, das seinen Trägern Freiheit gegenüber staatlichem Zwang verbürgt und ihnen in gewissen Zusammenhängen eine bevorzugte Rechtsstellung sichert, so hat die Bestimmung zugleich auch eine objektiv-rechtliche Seite. Sie garantiert das Institut «Freie Presse».
(BVerfG 20, 162ff.)
Online-Journalismus
5Die Internet-Revolution
Revolutionen wirbeln durcheinander. Das Internet ist eine solche Revolution.
Das Internet wirbelt das Leben durcheinander und den Alltag der Menschen.
Niemals zuvor hat ein neues Medium unser Leben so schnell verändert. Alle jungen Menschen und weit über die Hälfte der Älteren sind online. Sie verbringen täglich mehrere Stunden vor dem Computer- und Handy-Display, lesen und schreiben Mails, pflegen Bekanntschaften in virtuellen Gemeinschaften, lernen Menschen kennen, denen sie im wirklichen Leben nie in die Augen schauen werden, twittern mit Fremden über ein neues Buch oder die Marmelade zum Frühstück, informieren sich über Politik, das Wetter, die Börse und die Bundesliga, kaufen Bücher und Medikamente, durchforsten Suchmaschinen, führen im Wohnzimmer ihr Bankkonto, spielen und gewinnen Kriegsschlachten, schauen sich Amateurvideos aus Hawaii und Turkmenistan an.
Das Internet ist im engen Sinne kein Medium, sondern ein Vertriebsweg. Es hat keine Moral, ist weder gut noch schlecht; es transportiert alles, ohne Ansehen von Person und Sinn.
Das Internet wirbelt Demokratien durcheinander.
Im Internet findet der Bürger alle Informationen, die er lesen will, aber auch mehr, als er je lesen kann. Es wird gepriesen als Verwirklichung einer Sozialutopie, die allen Bürgern Zugang zu jeder Information und Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglicht; es wird verdammt als Weg zur Mediendiktatur, in der viele wenig lesen und wenige viel, in der die Kontrolle der Mächtigen leidet.
Die Fülle der Informationen verführt dazu, sich nur nützliche Nachrichten zeigen zu lassen. Eine Suchmaschine analysiert, für was sich ein Nutzer interessiert, sortiert es für ihn in Schubladen und bietet ihm immer mehr vom Gleichen an.
Das schade einer Gesellschaft, meint der amerikanische Blogger Eli Pariser. «Demokratie braucht Bürger, die Dinge von einem anderen Standpunkt aus betrachten. Stattdessen werden wir mehr und mehr in unsere eigene Blase eingeschlossen.»
Demokratie braucht Massenmedien. Alle sollen alles Wichtige kennen – und wenn schon nicht alle, dann möglichst viele. Das gelang Zeitungen und mit Abstrichen dem Fernsehen recht gut, bevor das Internet die Massen erreichte. Im Internet bewegen sich zwar Massen, aber es versteckt die wichtigen Nachrichten und bedient nur eine Minderheit, die sich noch informieren will.
Für Professor Dieter Rucht vom Wissenschaftszentrum Berlin taugt das Internet zur Beschaffung und Verbreitung von Informationen, aber nicht zum Wecken von politischem Interesse. «Vor allem die ohnehin schon Interessierten nutzen es für politische Information und Aktion.»
Das Internet wirbelt die Wahrheit durcheinander.
Das Internet gaukelt den Menschen vor, sie könnten alles erfahren, billig und schön. Doch sie erkennen nicht, was wahr ist und was falsch, sie kennen die Interessen nicht hinter der Auswahl, sie kapitulieren vor der schieren Fülle und langweilen sich über unattraktive Präsentationen mit flauen Bildern und irritierender Werbung.
Die meisten Bürger haben weder Zeit noch Lust, stundenlang nach der Wahrheit zu suchen. Sie nervt die ungefilterte Fülle an Lesermeinungen, die rechthaberisch wirken und aggressiv. Der Medienberater Markus Reiter kommentiert resignierend: «Die Hoffnung, allein die Kakophonie des Internets mache die Gesellschaft demokratischer und den Journalismus automatisch besser, erweist sich als eine Illusion.»
Das Internet wirbelt die Mächtigen durcheinander.
Die USA wählten einen Außenseiter zum Präsidenten, der seinen Wahlkampf intensiv über Internet führte. Als er gewählt war, musste er im Internet peinliche Geheimdepeschen lesen: Geheimakten aus dem Gefangenenlager Guantanamo und Kriegstagebücher aus dem Irak und Afghanistan.
In Diktaturen helfen Blogger, die Macht zu durchlöchern, Tyrannen zu stürzen und Demokratien zu etablieren. Sie geben Bürgern, die nur Propaganda kennen, ungefilterte Informationen über den wirklichen Zustand des Landes.
Doch auch Tyrannen nutzen das Netz zur Festigung ihrer Macht: Sie sperren Internet-Seiten wie in China oder bewegen sich in sozialen Medien wie Facebook, um an Namen von Oppositionellen zu kommen.
Auch in Demokratien nutzen die Mächtigen das Netz für ihre Desinformation. Da Gratisnachrichten, seriös verpackt, für viele attraktiv sind, wächst die Gefahr, dass sich viele Bürger nur so informieren und bevormunden lassen.
Das Internet wirbelt die Nutzung von Medien durcheinander.
Die einen sagen den Untergang der traditionellen Medien vorher und spotten über die «Holz-Medien», also Zeitungen und Zeitschriften. Die anderen preisen Zeitung und Zeitschrift als Oasen, in denen jeder konzentriert die wichtigen Nachrichten liest. Sie finden Unterstützung bei Hirnforschern, die herausfinden, dass unser Gehirn eine gedruckte Seite problemlos liest – der Bildschirm dagegen überfordert es: Schlechte Auflösung, kleineres Sichtfenster, deutlich langsameres Lesen.
Folgt man Wolfgang Riepl, vor hundert Jahren Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, verdrängt kein neues Massenmedium ein altes, sondern ändert nur seine Funktion. Nach dem Riepl’schen Gesetz dürfte die Zeitung überleben, indem sie sich nicht mehr aufs Aktuelle konzentriert, sondern auf Lokal- und Hintergrundberichte; vielleicht erscheint sie nicht mehr überall und nicht mehr täglich.
Ob Papier oder Bildschirm – den Journalisten muss es wenig stören, solange er gebraucht wird als verlässlicher und glaubwürdiger Wegweiser in der Demokratie. Gerade die Glaubwürdigkeit muss er deshalb hegen im Wettbewerb mit Facebook und Bloggern.
Das Internet wirbelt die Märkte durcheinander.
Den meisten Verlagen geht das Geld aus. Zeitungen und große Magazine bedienen die Massen, viele Unternehmen brauchen aber nur Minderheiten zur Werbung. Die finden sie im Internet leichter, genauer und billiger. Werbekunden bewegen sich dorthin, wo sie ihre Kunden am besten treffen.
Zunehmend zieht sich die Werbeindustrie aus Zeitungen und Zeitschriften zurück und lässt ihr Geld im Internet. Dort landet nur ein Bruchteil bei den Verlagen, der größte Teil bei Giganten wie Google oder Apple, die mit Nachrichten anderer reich werden.
Werbeagenturen, ebenso wie Parteien und Lobbyisten, benutzen Blogger, um ihre Botschaften zu verbreiten, oft fingiert, als Information getarnt – preiswert und effektiv. So stellten Wirtschaftsprüfer fest: Die Bahn hat in nur einem Jahr über eine Million Euro für Beiträge in Internet-Forum und Radio bezahlt – mit der Auflage, dass der Auftraggeber nicht erkennbar war.
So wird der Leser immer wichtiger. Machte ein Zeitungsverlag früher zwei Drittel seines Umsatzes mit Anzeigen, so hat sich das Verhältnis umgekehrt: Das meiste Geld verdienen die Verlage mit Abo und Einzelverkauf. Nicht mehr die Anzeigenabteilung, sondern die Redaktion, so sie Qualität liefern kann und will, wird zum Garanten der Rendite.
Das Internet wirbelt die Verlage durcheinander.
Noch nie haben so viele Menschen Zeitungen und Zeitschriften genutzt, zählt man die Zahl der Leser auf Papier und im Netz zusammen. Die Krise der Zeitungen und der Zeitschriften ist ein Vermarktungsproblem: Wie schaffe ich es, im Internet mit erstklassigem Journalismus so viel Geld zu verdienen wie mit bedrucktem Papier?
Als Verlagsmanager bei einem Medienforum über Geld statt über Inhalt sprachen, kommentierte Oliver Jungen in der FAZ: «Es war, als sei man unter elektronischen Bauern, die um jeden Preis die Milchquote steigern wollen, auch wenn dabei das Euter platzt: eine Milchmädchenrechnung.» Auch Verleger sehen die Gefahr, wie Michael Ringier aus der Schweiz: «Die meisten Verlage generieren ihre Umsätze im Internet nicht mit Journalismus, sondern mit Katzenfutter und Hot-Dog-Zangen.»
Die Einzigartigkeit des Journalismus, für die Ringier plädiert, müssen Journalisten schaffen. Als Zeitungen konkurrenzlos waren, konnten sie die Leser mithin auch mit langweiligen Texten, oberflächlichen Recherchen und unscharfen Bildern halten. Diese Verachtung des Publikums war immer schon verwerflich, aber lange folgenlos. Heute kann sie Zeitungen in den Ruin treiben.
Das Internet wirbelt die Redaktionen durcheinander.
Verlage sparen in den Redaktionen. So schrumpft die Zahl der Redakteure, aber die Größe der Redaktionsräume wächst. Statt in kleinen Büros mit überquellenden Schreibtischen sitzen Redakteure heute in großen Sälen, wie die Älteren sie nur aus Hollywood-Filmen kennen.
Angelsächsische Redaktionen haben schon immer in gigantischen Newsrooms gearbeitet. So wird die Organisation der Einzelkämpfer effizienter, die Organisation der Zeitung einfacher, die Technik komfortabler, die Recherche grenzenlos und das Gespräch mit Kollegen und Lesern leichter. Der Preis für dieses Paradies der unendlichen Möglichkeiten ist hoch: Immer weniger Redakteure müssen immer mehr leisten und alle Kanäle füllen, also Zeitung und Internet, Video, Radio, Twitter.
Das Internet wirbelt den Journalismus durcheinander.
Das Internet macht einen Traum wahr, den Traum der Unendlichkeit von Raum und Kommunikation:
Ist der Raum auf einer Zeitungsseite endlich, so sind die Räume im Internet unendlich. Jeder schreibt so lange und so viel, wie er will; er stellt alle Materialien, die er genutzt hat, neben seine Artikel und macht dem Leser das Wissen nutzbar, das er hat.
Ist die Zeitung eine Einbahnstraße der Kommunikation, so bietet das Internet die Chance des Dialogs mit der denkbar kleinsten Verzögerung: Ich schreibe, mein Leser reagiert sofort – und umgekehrt.
Doch der Weg vom Traum zum Albtraum ist kurz:
Die meisten Leser wollen gar nicht mehr lesen, sie verzweifeln vor der Masse der Informationen – und wenden sich im Internet gleich den Vergnügungen und Zerstreuungen zu, die einen Mausklick entfernt liegen.
Der Dialog im Internet besteht zum Großteil aus Schwachsinn oder Dampfplauderei, er kostet mehr Zeit, als er Gewinn bringt.
Die Regeln für klassischen Journalismus ändern sich im Internet nicht. «Grundlage der neuen Medien sind die Prinzipien der alten Medien», sagt der Journalistikprofessor Stephen Quinn aus Australien. Quinn steht nicht im Verdacht, den alten Medien nachzutrauern. Jungen Journalisten in seinen Seminaren rät er, sich als Redakteur täglich einige Stunden in den sozialen Netzen zu tummeln; in Werkstätten trainiert er mit ihnen, wie sie diese Netze nutzen.
6Der Teaser – alte Regeln, neuer Nutzen
Trotz aller Neuheiten, trotz Wikis und Microblogging, VoiceOverIP und Instant Messaging – im Internet geht es um das Alte, um Texte und Bilder. Mehr nicht.
Die Menschen wollen lesen und schauen und sich dabei informieren, so ergiebig und so lustvoll wie möglich. Seit Jahrhunderten kennen Schriftsteller, ob Mönche, Dichter oder Journalisten, die Techniken der Verführung – und die ist unabhängig davon, ob man eine Tintenfeder nutzt, Lettern aus Blei oder eine Computertastatur.
Der Mönch, der vor tausend Jahren die Bibel abschrieb, wusste genau: Schon im ersten Buchstaben muss er seine Leser locken. Er malte farbig die Geschichte der Brotvermehrung oder Auferstehung in den Anfangsbuchstaben, der über mehrere Zeilen lief. Dieses Initial malte er so kunstvoll, dass Sammler heute Unsummen für diese Handschriften zahlen. Dabei trieb den Mönch dasselbe an wie Journalisten heute: Locke gleich zu Beginn des Textes deinen Leser!
Die Kunst des Initials, des ersten Satzes, des Teasers oder Twitters ist über Jahrhunderte gleich geblieben: Es ist die Faszination von Buchstaben, die uns neugierig machen. Deshalb können Novizen, Praktikanten, Volontäre und Blogger nicht lange genug die Kunst des Anfangs üben, üben, üben.
Dabei sind die Anforderungen an einen Teaser höher als an Vorspann oder ersten Absatz: Das Auge kann ja nicht beiläufig weiterschweifen – anklicken muss ich!
Die Kunst des Anfangs ist jedoch Handwerk, somit ein Trost für alle: Erlernbar ist es, wenn auch mühsam. In den guten Journalistenschulen schreiben die Anfänger wochenlang nur Nachrichten, eben die kurzen Texte, ohne die Journalisten niemals erfolgreich sein können.
Sicher braucht der Journalismus auch lange Reportagen, Analysen und Leitartikel. Aber wem nützt die schönste Reportage, wenn der Leser in den ersten Zeilen nicht merkt, dass das Weiterlesen lohnt?
Deswegen ist der Teaser so entscheidend im Internet. Zum einen dominiert auf dem Bildschirm das flüchtige Lesen, das Scannen von Texten, zum anderen sind die Verlockungen im Netz ungleich größer als in einer mittelalterlichen Bibliothek oder auf einer Zeitungsseite. Gleich neben dem Textblock reizen im Netz Spiele und Dossiers, Fotostrecken und Filme, Bücherläden und Autotests, die hundert schönsten Bauwerke und die zehn günstigsten Schnäppchen.
Die mittelalterliche Handschrift, das Vorbild aller Verführung, verfolgt uns ins Internet-Zeitalter: Starkes Bild und erster Satz sind entscheidend. Auf einer Seite im Netz braucht der gut geschriebene Teaser ein Foto oder eine Graphik, damit er überhaupt wahrgenommen wird.
Wer einwirft, das sei nur für die wenig Gebildeten nötig, schaue noch einmal zu den Mönchen vor tausend Jahren: Die malten und schrieben für die wenigen Gebildeten, die Latein beherrschten und die seltsame Dialektik der Theologie. Ja, auch der Gebildete will verführt werden, den Redakteure gern anführen, wenn sie langweilige Texte voll Kauderwelsch als den wahren Journalismus ausgeben.
«Erzählt den Kern der Geschichte und macht Lust auf mehr», steht zum Teaser in den «Textstandards» von Spiegel Online. Diesen Aufbau erklärt die Spiegel-Redaktion als verbindlich für die ersten 270Zeilen eines Textes:
Reiz. Leser einfangen: gerade bei schwächeren Thesen um knackigen Einstieg bemühen
Kernthese. Nachricht mitteilen: kurz, klar und mit möglichst kraftvollen Worten benennen
Rampe. Lust auf mehr machen: öffnender Aspekt des Themas («Aber sehen Sie selbst»-Satz).
Wer das Handwerk der kurzen ersten Sätze lernen will, lese diese Kapitel:
«45Lead, Vorspann und Teaser» sowie die weiteren Kapitel in «Wie man Leser gewinnt»,
«25Wie schreibt man eine Nachricht?»,
«Klassische Zeitschriften-Vorspänne». (zu finden im Anhang von «36Der Zeitschriften-Journalismus»).
Wer auch über hundert oder fünfhundert Zeilen zum Lesen verführen will, lese das Kapitel «Schreiben und Redigieren».
Wer in den ersten Sätzen zum Lesen verführt, wird seinen Weg im Journalismus gehen, gleich welche Technik uns nach iPad und Web 4.0 noch überraschen wird. Er ist für alle Zeiten und alle Techniken gewappnet.
7Die Online-Redaktion
Wer in den Journalismus einsteigen will, beginne im Lokalen oder einer Online-Redaktion; am besten verbindet er beides. Er besucht am Samstag den Kreisparteitag, berichtet noch aus der Stadthalle mit einem Live-Ticker, fotografiert und dreht ein kleines Video; am Sonntag schreibt er für die Zeitung einen ausführlichen Bericht mit Hintergrund und Analyse und, wenn man ihn lässt, einen Kommentar.
Hat er seine Aussiedlerreportage am Samstag in der Zeitung nicht unterbringen können, versucht er es am Sonntag noch einmal. In der schwach besetzten Online-Redaktion dürfte er Erfolg haben. Allerdings liest kein Redakteur seinen Text. Die Chance, dass ein User kritisiert, ist höher, als dass ein Redakteur dies tut. Das Netz hat eben einen großen Bauch, es verschlingt selbst Texte und Bilder, die für eine Zeitung unverdaulich sind.
Online-Redaktionen sind meist chronisch unterbesetzt. Oft senden sie 18, bisweilen 24Stunden am Tag. Sie müssen so schnell, so zuverlässig und so verständlich sein wie Nachrichtenagenturen. Sie müssen in Städten und auf dem Land für einen stetigen Informationsstrom sorgen, obwohl es nur wenige Quellen gibt. Sie müssen unentwegt reagieren auf Kommentare von Lesern, die sie User nennen. Sie müssen schnell zwischen dem Nörgeln und nützlichen Hinweisen unterscheiden.
Nicht selten arbeiten Online-Redakteure mit schwächerer Technik als ihre Leser. Der Medienberater Joachim Blum beklagt veraltete und isolierte Redaktionssysteme für Zeitung und Online, schmalbrüstige Datenleitungen, angejahrte Computer und aberwitzige Sicherheitsrestriktionen. Ja: Für einen syrischen Bürgerrechtler ist es technisch einfacher, Videos verbotener Demonstrationen ins Netz zu stellen als für einen Lokalzeitungsredakteur die Fotos einer Bürgermeister-Ehrung.
Eigentlich müssten die Besten mit der besten Technik in der Online-Redaktion arbeiten, doch der Status der Online-Mitarbeiter ist bescheiden: wenig geachtet, schlecht bezahlt, hoch belastet. Zeitungsredakteure mögen Online sowieso nicht: Sie sind überzeugt, ihre Artikel würden im Netz schlecht präsentiert und verschenkt; sie fürchten, ein kostenloses Angebot treibe die Verlage in den Ruin. In der Tat subventionieren die Abonnenten der meisten Zeitungen den Online-Auftritt, der mit Werbung nicht zu finanzieren ist.
Wie arbeitet eine Online-Redaktion?
Es gibt Print-Redakteure, die behaupten, dass ihre Online-Kollegen nur für bessere Copy-and-Paste-Aufgaben zuständig sind und darüber hinaus wenig können. Ungeachtet der Arroganz solcher Urteile hat die Klage doch einen wahren Kern: Onliner schreiben unermüdlich Texte um, die sie als Rohfassung vom Newsdesk bekommen; sie kürzen, bearbeiten PR-Texte, indem sie zumindest die Quelle angeben; sie füllen eben das Internet, und nicht selten tun sie es ohne Sinn und Verstand.
Den Verstand haben sie – der Sinn kommt ihnen abhanden, wenn eine kleine Mannschaft, bisweilen nur ein Einzelner, das unersättliche Netz kontinuierlich füllen muss. Nur Nachrichtenseiten, die ständig Aktuelles bieten, werden immer wieder aufgerufen. Die eiligen Leser, die im Netz für die Klickzahlen sorgen, haben das Neue im Blick, nicht das Tiefgründige.
«Es ist ein fataler Irrtum, wenn Online-Redaktionen zu Erfüllungsgehilfen der Zeitungsredaktion degradiert werden», meint Harald Ritter, Ex-Chef-vom-Dienst der Sächsischen Zeitung und Badischen Zeitung. Er berät Verlage und Redaktionen und sagt ihnen: «Online-Redaktionen müssen sich profilieren können, um beim Überangebot im Internet Leser locken und binden zu können.» Für Ritter ist das auch mit kleiner Redaktionsmannschaft möglich, selbst mit nur einem Onliner – wenn Chefredakteure die Redaktion stets crossmedial arbeiten lassen und Tagebücher, Kolumnen, Podcasts, Videos von Redakteuren fördern und fordern.
Die Zugriffe auf den Online-Seiten der Zeitungen sind am höchsten, wenn sich die Welt schnell dreht, wenn Erdbeben und Bürgerkriege die Menschen erschüttern oder ein Mordprozess und schwere Unfälle im Lokalen. Dreht sich die Welt langsam, wird es schwierig. Zeitungsredaktionen haben noch Zeit, Recherchen zu planen, große Geschichten zu schreiben, Texte gegenlesen zu lassen. Online-Redakteure leben meist von der Hand in den Mund.
Auch Spiegel Online muss zuerst einmal schnell und aktuell sein. Der Chefredakteur Mathias Müller von Blumencron sagt in einem Interview:
Das Medium verlockt dazu, Texte einfach ins Netz zu stellen, und das birgt natürlich ein Risiko. Wir haben immer wieder bewusst unsere Geschwindigkeit gebremst: Wichtige Nachrichten müssen natürlich ganz schnell auftauchen, das erwarten unsere Leser völlig zu Recht; zentral ist aber, dass die Informationen in einer bestimmten Weise aufbereitet werden.
Auch im Netz muss die Qualität stimmen. Wer online weniger Qualität liefert als in der gedruckten Zeitung, der schadet seinem Ruf und beschädigt die Marke. Selbst Leser, die sich nur im Internet informieren, gehen zur Süddeutschen oder FAZ und den regionalen Marktführern.
Vorbild für die meisten Online-Redaktionen ist Spiegel Online. Aber nur große Zeitungen können sich den Aufwand leisten: eigener Chefredakteur, ein Online-Newsdesk (Balken genannt wie bei Bild), zwei Chefs vom Dienst, welche über die Themen der Homepage entscheiden; über Ticker-Redakteure für jedes Ressort, welche die Nachrichten verfolgen, Gegenleser, Fachredakteure; Super-Producer, die sich um die «Assets» kümmern, also Videos, Fotostrecken und Graphiken.
Zwei komplett getrennte Redaktionen sind sinnvoll bei einem wöchentlich erscheinenden Nachrichtenmagazin, weniger sinnvoll und unbezahlbar sind sie bei Tageszeitungen. Da die getrennten Redaktionen dieselben Informationen sichten, haben fast alle Regionalzeitungen die Planung und Auswahl für Zeitung und Internet am Newsdesk konzentriert. Alle Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an einem Tisch für alle Medien. Dazu mehr im Kapitel 47 (Newsdesk und Ressorts).
So sind die Online-Seiten der meisten Zeitungen ein Spiegel der gedruckten Seiten, nur erweitert um den permanenten Redaktionsschluss und die Vergrößerung des Angebots. Gibt es dennoch eine Online-Redaktion, hat sie kaum mehr den Titel «Redaktion» verdient. Sie arbeitet nicht eigenständig, sondern bekommt ihre Aufträge vom Newsdesk. Die Redakteure sind mehr Techniker als Blattmacher, nur selten Reporter und Rechercheure (es sei denn im Netz):
Sie schreiben die Eilmeldungen, wandeln Texte und Fotos der Redakteure fürs Internet um, da die meisten Redaktionssysteme zu kompliziert und langsam sind für das Online-Geschäft.
Sie erweitern die Texte der Redakteure, indem sie im Netz nach Hintergrundinformationen suchen, die elektronischen Archive durchwühlen und Links setzen.
Sie schneiden und besprechen Videos, die von Redakteuren oder Freien als Rohmaterial geschickt werden.
Sie moderieren die Kommentare und Mails der User.
Sie garantieren, dass sich ständig etwas bewegt: Neue Nachrichten, auch wenn es nur PR-Texte sind, neue Fotos, neue Videos. Im besten Fall redigieren sie, nicht selten gilt: Copy and paste, also: Kopieren und einfügen.
Wer schnell reagiert, muss aufpassen, dass er nicht überdreht. Nie wurde so viel voneinander abgeschrieben wie im Internet, nie waren Nachrichten so unsicher. Der Bluewater-Skandal ist ein Produkt der fatalen Maxime «Schnelligkeit vor Korrektheit»: Dpa und viele Online-Redaktionen meldeten ein Selbstmordattentat, das nie stattgefunden hat, in einer Stadt, die es gar nicht gibt, unter Berufung auf eine Radiostation, die nie gesendet hat.
Auch die Nachrichtenseiten von Google und anderen Suchmaschinen sind alles andere als verlässlich. Sie spüren mechanisch Nachrichten auf, richten sich nach Schnelligkeit und Masse, und niemand, wirklich niemand aus Fleisch und Blut sitzt in einer Redaktion und prüft. Da helfen nur ein solides Wissen und ein routiniertes Misstrauen, das spürt, wenn der Boden schwankt.
So schnell eine Falschmeldung ins Netz kommt, so schnell kann sie wieder korrigiert werden. Das ist ein Vorteil des Internets: Deutlich und für jedermann sichtbar erscheint die verbesserte Nachricht. Wer in einer Zeitung eine Falschmeldung druckt, braucht 24Stunden, am Wochenende gar 48Stunden für eine Korrektur. Wer am Samstag vor einer Wahl einen Kandidaten fälschlicherweise bezichtigt, richtet so einen unermesslichen Schaden an.
Wer als Redakteur das Internet sinnvoll nutzt, gewinnt auch Vorteile, die seinen Online-Auftritt ebenso attraktiver machen wie die gedruckte Zeitung:
Online-Redaktionen haben ständig Kontakt zu ihren Lesern. Interaktiv, Web 2.0 – hinter den Modewörtern steckt ein bisschen Sinn und viel Unsinn. Sinnvoll war es schon immer, das Wissen, die Erfahrung und Kritik der Leser zu nutzen, je schneller, desto besser. Durch das Netz bekommt die Redaktion noch vor dem Druck Hinweise und Kommentare von Lesern, Anregungen, Themen- und Recherchetipps; sie erkennt Kontroversen und kann zu Debatten auffordern.
Unsinnig ist es, jeder Besserwisserei und Nörgelei nachzugehen. So kann sich jede Redaktion verheddern, sich stundenlang mit wenigen Kritikern plagen und ihre eigentlichen Aufgaben vernachlässigen. Dagegen helfen nur Augenmaß und klare Regeln, die man auch den Nutzern mitteilt: Registrierung, um Fälschungen zu vermeiden; Prüfung und Freigabe von Kommentaren durch Redakteure; Blogs zu einem Thema nur über kurze Zeit.
Redaktionen kommen an Informationen, die sie früher nie oder zu spät erreichten. Ein Pakistaner twitterte von Hubschraubern über Abbottabad, Minuten bevor US-Soldaten Osama bin Laden erschossen haben. Auch lokale Redaktionen profitieren, wenn inmitten einer Massenkarambolage Augenzeugen twittern, fotografieren und telefonieren. Es muss nur einer in der Redaktion wach genug sein, den Wert der Nachrichten zu erkennen und ihre Glaubwürdigkeit zu beurteilen.
Redaktionen können aktuelle Geschichten so schnell und so umfangreich schreiben wie nie zuvor.In kürzester Zeit sind Texte und Bilder verfügbar von Orten, an denen sich keine professionellen Journalisten aufhalten. Wie sah Japan aus am 11.März 2011 – in den acht Stunden vor Erdbeben und Tsunami? Wer um Fotos und Mitteilungen per Mail oder Facebook bat und das Netz durchkämmte, bekam private Bilder von Japanern und Touristen. Diese Recherche mündete online in eine Dia-Schau und taugte zu einem 38-seitigen Schaustück im Magazin der Süddeutschen Zeitung: «Japan, wie es nicht mehr sein wird.»
Redaktionen können in Nischen gehen, die der Zeitung verschlossen bleiben. Selbst im Schwarzwald oder in der Uckermark können die Zeitungen nicht von jedem Dorf, jeder Hausmusik oder jedem Wettskat berichten. Online hat Platz für alle und alles und nutzt Texte und Bilder von Lesern, die den Ehrentitel «Bürger-Reporter» bekommen. Verlagsmanager hoffen, so die Zeitungen füllen zu können. Doch die Leser sind träger als gedacht, die wenigen Geschichten meist langweilig – und eine Auswahl durch einen Redakteur ist unerlässlich, auch damit nicht Rechtsradikale oder PR-Profis den Platz füllen.
Trotzdem ist jeder Redaktion zu empfehlen, systematisch in die hyperlokalen Tiefen zu tauchen. Die Chance nutzen sonst Journalisten außerhalb von Zeitungsredaktionen. Pionier der Lokalblogs, einer Lokalzeitung im Netz, ist Hardy Prothmann mit seinem Heddesheim-Blog. Diesen gründete er für die 10000Einwohner der Stadt Heddesheim in Nordbaden. So ärgert er sich über die Hofberichterstattung des Mannheimer Morgen:
«Während die handzahmen Regionalblätter überwiegend ‹Bratwurstjournalismus› bieten, gibt es, seitdem wir berichten, Hintergründe, die es vorher nicht gab. Und Meinungen, die es bestimmt gab, die aber nicht öffentlich wurden.»
Redaktionen haben Platz ohne Ende. «Der Online-Journalismus beginnt dort, wo der Print-Journalismus aufhört», sagt Oliver Michalsky, stellvertretender Chefredakteur der Welt. Der Onliner stellt Töne, Bilder, Graphiken und Filme zur Geschichte, er veröffentlicht die Materialien, die er bei der Recherche benutzt hat, oder verlinkt darauf, er diskutiert mit seinen Lesern, er bloggt und twittert. So verwandelt sich eine große Zeitungsreportage im Netz zu einem kleinen Buch, das sich durch die Hinweise der Leser ständig verändert. Doch hier gilt ebenfalls, was den Journalismus auszeichnet: Er schafft idealerweise eine sinnvolle Struktur, scheidet Wichtiges von Unwichtigem – bei Texten wie bei Bildern, aber auch bei den Links; er sortiert, damit sich der Leser nicht verirrt. Nischen, die für Spezialisten gedacht sind, muss er auch als Nischen ausweisen.
Redaktionen lassen sich von ihren Lesern kontrollieren. Ob es Journalisten wollen oder nicht: Leser wachen über ihre Arbeit und kritisieren sie. In den USA schauen Redakteure von Regionalzeitungen jeden Morgen in die Blogs, die ihre Arbeit kontrollieren. In Deutschland sind solche Blogs noch selten; allein der BILDblog hat viele Leser, gegründet 2004 von Spiegel-AutorStefan Niggemeier, früher Medienredakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Wer klug ist, integriert die Kritik der Leser in seinen Online-Auftritt, antwortet ihnen, diskutiert mit ihnen. Er legt seine Quellen offen, es sei denn sie sind vertraulich, und lässt Fragen zu wie: Ist die Pressemitteilung korrekt zusammengefasst? Fehlen wesentliche Aussagen? Ist die Quelle durch PR verschmutzt? Wie ist der Kontext eines Zitats?
Die Jury des Henri-Nannen-Preises erkannte 2011 einem Reporter des Spiegel die Auszeichnung ab, weil er seine Quelle nicht genannt und den Eindruck erweckt hatte, er habe alles selber gesehen und gehört. Hätte er zumindest im Internet seine Quelle offenbart, wäre ihm und dem Spiegel eine Debatte erspart geblieben. Wer noch klüger ist, nutzt das Wissen seiner Leser, unter denen viele Experten sind, für seine Recherche.
Online First
Sollen Redakteure ihre Texte und Fotografen ihre Bilder sofort ins Netz stellen? «Online First» bedeutet: Alles zuerst ins Netz, erst später in die Zeitung.
«Online First» ist das Geschäftsmodell der Jungfrau Zeitung in der Schweiz. Zehn Redakteure recherchieren in der 45000-Einwohner-Stadt Interlaken und schreiben nur fürs Internet; die wichtigsten Nachrichten werden zweimal in der Woche in der Abo-Zeitung gedruckt. Auch einige Regionalzeitungen statten ihre Reporter, vor allem im Lokalen, mit Notebooks oder Laptops aus, damit sie direkt eine Meldung fürs Netz schreiben können.
Der Springer-Verlag führte «Online First» für seine Tageszeitungen in Berlin ein, für Die Welt und die Berliner Morgenpost. Er will guten Journalismus schnell ins Netz stellen, neue und vor allem junge Nutzer locken und binden – zuerst kostenlos und später gegen Bezahlung.
Die meisten Verlage haben nicht nachgezogen, auch nicht Springers Bild, die deutsche Zeitung mit der größten Auflage. Auch die meisten Redakteure bleiben skeptisch: Wenn teure Stoffe im Netz verramscht werden, sinken die Erlöse, werden Redaktionen noch kleiner – und so sei Qualität kaum mehr zu schaffen.
Stefan Plöchinger, Online-Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, plädiert gegen «Online First» als generelle Regel und für einen Kompromiss: «Man muss je nach Geschichte entscheiden; jedes Thema ist ja anders. Generell: Eine Exklusivnachricht zum Beispiel muss nicht zuerst online erscheinen.»
Die Debatte um «Online First» wird enden, wenn die meisten Texte zu bezahlen sind – auf Papier wie im Netz. Was nicht einzigartig ist, wird kostenlos und unverzüglich im Netz stehen; das Einmalige liegt hinter einer Schranke, die sich nur nach dem Bezahlen öffnet.
Online-Redaktionen arbeiten wie Zeitungsredaktionen, nur viel schneller und viel härter. Wer sich vom Zeitdruck nicht drangsalieren lässt, wer die Technik souverän beherrscht, wer auch mal auf eigene Faust recherchiert und mit fertigen Texten und Bildern in die Redaktion kommt – der hat als Anfänger große Chancen, zumal viele Zeitungsredakteure Online wenig achten und beachten.
Hyperlokale Regeln
Bart Brouwers leitet das lokale Online-Angebot der niederländischen Zeitung Telegraaf. Er hat Gebote für hyperlokale Nachrichtenseiten aufgestellt, die er beim 19.Forum Lokaljournalismus 2011 vorgestellt hat. Das sind einige davon:
Wir Journalisten müssen raus aus unserer Burg, den Elfenbeinturm einreißen und einen Marktplatz daraus machen.
Wir müssen uns verabschieden von den typischen Journalistenattitüden: «Wir sind etwas Besonderes» und «Wir wissen mehr als unsere Leser».
Wir waren nie allwissend. Nun laden wir Leser ein, mit ihrem Expertenwissen die Berichterstattung besser zu machen.
Wir sind Teil des Publikums, sind mittendrin statt nur dabei. Wir machen uns gemein mit den Bürgern!
Wir holen Partner mit ins Netz, bevor wir das Rad selbst neu erfinden.
Wir erzählen auch von Fehlschlägen.
Wenn wir etwas wissen, veröffentlichen wir es sofort, verbessern es dann und reichern es weiter an.
Wir akzeptieren, wenn nur ein Bruchteil der Nutzer auch selbst Inhalt beisteuert.
Wir Journalisten müssen auch geschäftlich denken. Es gibt nicht mehr das eine große Geschäftsmodell wie bei der Tageszeitung. Ein Mix aus vielen Geschäftsmodellen muss den Umsatz bringen.
automatisieren so viel wie möglich.
8Podcast– Fürs Hören schreiben
Noch nie war es so einfach, Radio zu machen, wie im Internet. Nur heißt Radio im Internet nicht Radio, sondern Podcast. Jeder kann seine Texte sprechen, mit ein wenig technischem Geschick in eine MP3-Datei verwandeln und ins Internet stellen. Wer es anspruchsvoller will, geht für eine Reisereportage mit dem Mikrophon nach draußen und sammelt Originaltöne ein.
Das Podcast nutzen selbst die etablierten Rundfunksender für ihre besten und anspruchsvollen Stücke, für Features, Hörspiele, Lesungen oder Reportagen. Wer sie im aktuellen Programm verpasst hat, kann sie im Internet aufrufen wie beispielsweise Jürgen Wiebickes «Philosophisches Radio» von WDR 5, das so seine Hörerzahl fast verdoppelt.
Auch Zeitungsredakteure können ihre Texte sprechen und ins Netz stellen: den Aufmacher der Titelseite, Kolumnen, Features und Reportagen. Mit geringem Aufwand an Kosten und Raum kann jede Redaktion ein kleines Studio einrichten, in das der Leitartikler geht, um seine Meinung vorzulesen – nicht nur für sich selbst, sondern für ein paar tausend Hörer. Blinde und Sehbehinderte schätzen es, Autofahrer mögen es, Dauer-Kopfhörerträger können so Lust auf Zeitung bekommen.
Der Redakteur schreibt immer für die Ohren, er muss sich immer als Sprecher denken. Wir «hören» immer (so wie Beethoven seine späten Werke selbstverständlich hörte, obwohl er taub war).
Die Schrift ist eine späte Zugabe zur mündlichen Rede und das stumme Lesen wiederum ein sehr spätes Stadium ihrer Nutzung. In der Antike war die Schrift überwiegend eine bloße Unterlage für den Redner, bis an die Schwelle der Neuzeit war sie für Leser überwiegend die Einladung, sich den Text selber hörbar vorzulesen.
Noch aus dem 16.Jahrhundert ist überliefert, dass der Abt eine Klosterzelle betrat und den Mönch tadelte, dass er nicht in der Bibel lese. «Aber ich lese doch!», sagte der Mönch. «Ich höre ja nichts!», sagte der Abt. Und Kinder sprechen selbstverständlich, während sie lesen oder schreiben lernen.
Auch haben wir eine Lautschrift: Der Buchstabe «a» ist ein optisches Symbol, den unser inneres Ohr in den Laut «a» umsetzt (wie der Dirigent die Note «cis» hört, wenn er sie in der Partitur liest) – mit messbaren elektrischen Spannungen im Ohr, in der fürs Hören zuständigen Hirnregion und sogar in der Zunge.
Jeder Text ist also de facto für die Ohren geschrieben. Was sich nicht gut anhört, ist nicht angenehm zu lesen. Laut lesen ist für den Autor die beste Qualitätskontrolle, egal, ob der Text auf Hörer oder auf Leser zielt; das laute Lesen entscheidet auch über die zumutbare Länge des Satzes . In der Linguistik ist oft von der «Atemsyntax» die Rede, in Erinnerung an den römischen Rhetor Quintilian, der schon im 1.Jahrhundert n. Chr. forderte, die Sätze «atemgerecht» zu formulieren.
Und so haben denn fast alle Stilisten von Rang, die fürs Lesen geschrieben haben, ihren Text zuvor mit den eigenen Ohren getestet.
Der ideale Text für Hörer wie für Leser ist an die gesprochene Sprache angelehnt, durch Niederschrift diszipliniert und für die Ohren geschrieben.
Alles in allem: Soll man denn schreiben, wie man spricht? Ja – mit den Einschränkungen, die im Wort «angelehnt» zum Ausdruck kommen. Die Basis für alles, was wir schreiben, sei unsere natürliche Rede. Wir sollten dann nur
unsere Sätze zu einem grammatisch korrekten Ende bringen;
von unseren Wörtern die flapsigen wägen, die vulgären tilgen und das treffendste noch suchen;
auf schiere Wiederholungen verzichten (falls sie nicht zur schönen Redundanz gehören);
das mutmaßliche Übermaß an Füllwörtern beseitigen: Liest man die Abschrift einer freien Rede, so erschrickt man unwillkürlich über die vielen «ja» und «doch» und «nun».
Ein Grenzfall: Inwieweit darf man geläufige mündliche Verkürzungen ins Schriftliche übernehmen? Denk doch mal nach – Da tut sich was – Er wurde fünfzig. Das ist eine Ermessensfrage, bei deutlich zunehmender Sympathie (auch des Autors) für die mündliche Form.
Völlig falsch ist die in Journalistenzeitschriften oft aufgestellte Behauptung, einfache Sätze müsse man Hörern auch deshalb anbieten, weil Zuhören schwieriger sei als Lesen. Nicht, wenn der Sprecher gut ist. Die oft grandios verschachtelten Sätze Thomas Manns sind in einer guten Hörbuch-Version (wie der von Gert Westphal) leichter verständlich als bei stummer Selbstlektüre – indem der Sprecher die Nebensätze leiser als die Hauptsätze liest, indem er die Struktur des Satzes hörbar, erlebbar macht, weit über die dürftigen Chancen der sieben Satzzeichen hinaus.
Was ist nun trotzdem anders, wenn man schreibt, um gehört zu werden? In Radio und Fernsehen wird seit Jahrzehnten die Faustregel verkündet: «Da der Hörer nicht zurückhören kann, müssen wir einfache Sätze schreiben.» Die Regel ist richtig – ihre Begründung ist falsch: Einfach, durchschaubar sollten Sätze immer sein. Denn dem Nicht-zurückhören-Können des Hörers entspricht in 95Prozent der Fälle das Nicht-zurücklesen-Wollen des Lesers. Was liest man denn zweimal? Bedrohliche Schriftsätze von Rechtsanwälten – und in der Zeitung ausnahmsweise mal den Satz oder den Absatz davor, falls man das gerade Gelesene interessant findet, aber nicht einordnen kann. Dieser Minderheit zuliebe sollten Texte fürs Hören in der Tat die Quelle, das handelnde Subjekt häufiger als der Zeitungstext, wiederholen, im Grenzfall außerdem einen komplizierten Sachverhalt noch einmal verkürzt formulieren.
Der einzige weitere Unterschied zwischen Hören und Lesen ist das geringere Aufnahmevermögen des Hörers für Zahlen. Im Fernsehen erscheinen die Ergebnisse von Wahlen, Umfragen und dergleichen vernünftigerweise sofort auch in der Schrift, im Hörfunk endet die Aufnahmefähigkeit bei drei bis vier Zahlen, und die dürfen nicht kompliziert sein: 4,2Millionen Arbeitslose prägt sich leichter ein als 4221000Arbeitslose, und 4221650Arbeitslose wäre grotesk.
Für Texte zum Lesen und Texte zum Hören gelten dieselben Gesetze der Verständlichkeit und dieselben Regeln der Attraktivität: die konkreten, die schlichtesten möglichen Wörter in schlanken, transparenten Sätzen.
9Video-Journalismus
So einfach Podcast ist, so schwierig ist Fernsehen im Internet. Wer beim Vorlesen seiner Kolumne nuschelt, verbucht dies als Originalität und verweist auf Dichter wie Thomas Mann oder Gottfried Benn. Wer nicht weiß, wie er sich vor der Kamera bewegen kann, sollte es lieber sein lassen – es sei denn, er ist ein Naturtalent. Allerdings wird nichts so oft angeklickt wie Filme von lokalen Ereignissen, vorzugsweise im flackernden Blaulicht von Polizei und Feuerwehr.
Doch nebenbei ist Fernsehen im Internet nicht zu machen. Notwendig sind eine teure Kamera nebst Mikrophon und Kopfhörer, ein Laptop mit großem Speicherplatz, ein gutes Programm zum Schneiden des Rohmaterials, Routine und viel Zeit. Die Vorarlberger Nachrichten haben fünf «Mojos» als Redakteure angestellt, Mobile Journalisten, die täglich ein gutes Dutzend Videos aus dem österreichischen Bundesland produzieren müssen – komplett geschnitten und getextet. Zudem liefern sie Texte zu den Video-Beiträgen, die auf der Homepage zu lesen sind.
Dennoch sollte jeder Lokalreporter, erst recht jeder Fotograf, eine kleine Kamera mit sich führen. Einige Chefredakteure, wie Horst Seidenfaden von der HNA in Kassel, statten alle Lokalredaktionen mit kleinen, preiswerten Videokameras aus. Sein Ziel: «Jeden Tag aus jeder Redaktion ein interessantes Video auf unserem Portal.»
Ist der Lokalredakteur als Erster und Einziger am Unfallort, dann ist nicht so entscheidend, wie er filmt, sondern was er filmt. Wenn er zu einem Routinetermin fährt wie der Ehrung eines Bürgermeisters, dann lohnt nicht der Aufwand, eigens einen Video-Journalisten auf den Weg zu schicken. Der Lokalredakteur sendet den Video-Film mittels Laptop oder Handy in die Zentrale. Zumindest in größeren Redaktionen sitzt ein Profi oder jedenfalls Halbprofi, der aus dem Rohmaterial einen guten Beitrag schneiden kann und dafür ein bis zwei Stunden braucht.
Für den Anfänger lohnen dennoch Grundkenntnisse des Filmens und Schneidens – nicht nur weil Online-Redaktionen meist schwach besetzt sind. Wer mit der Video-Kamera gut umgehen kann, wer die Bedeutung von Totale und Nahaufnahme kennt, kennt die Bedeutung von Perspektiven; dies Wissen nützt ihm auch beim Gestalten von Seiten in der Zeitung und im Internet. Wer den Goldenen Schnitt beherrscht, produziert keine einförmigen Zeitungsseiten mehr, auf der alle Artikel auf der Mittelachse stehen, oder stellt bei einem Fotoporträt den Bürgermeister platt in die Mitte. Er lernt, Langeweile zu vermeiden durch ein wenig Unruhe auf einer Seite oder einem Foto.
Die «Five-Shot-Regeln», also die fünf wichtigsten Kamera-Einstellungen, orientieren sich an den W-Fragen der Nachrichten. Sie sollte jeder Amateur beherrschen, der auf YouTube seine Videos stellen will, erst recht jeder Redakteur, der sich eine Kamera schnappt:
Einstellung: WAS passiert? – Die Aktion in Großaufnahme
WER macht’s? – Der Akteur in Großaufnahme
WO findet es statt?
WIE gehören Aktion und Akteur zusammen – aus einer neuen Perspektive gefilmt?
WOW-SHOT: Ein eindrucksvolles Bild zum Schluss.