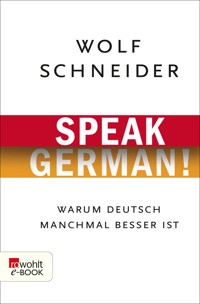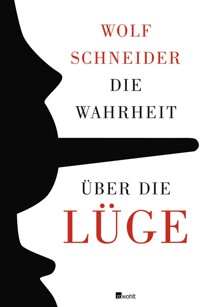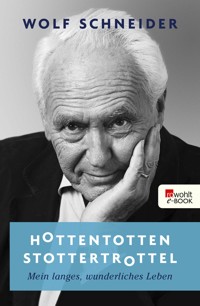9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Was macht es aus, das Glück, nach dem wir alles streben? Wie kann man es erlangen? Macht Geld eigentlich glücklich? Eine steile Karriere? Das einfache Leben? Muntere Kinder? Die Antworten auf diese Fragen sind vielfältig. Wem also kann man trauen, wem soll man folgen? Wolf Schneider nimmt in diesem Buch die florierenden Glücksversprechen unter die Lupe, von den hehren Lehren der Philosophen bis zu den angeblich todsicheren Tipps der um sich greifenden Ratgeberliteratur. Kenntnisreich und unterhaltsam unterscheidet er, welche Rezepte plausibel sind, welche eher strittig – und welche Sie getrost vergessen können. Wolf Schneider zieht die Summe aus 30 Jahren Beschäftigung mit der Frage, was das Glück ausmacht und wie man es steigern kann. Und deshalb sind seine Rezepte für ein glücklicheres Leben anders als die meisten: realistisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Für Lilo
Was ist das eigentlich – Glück?
1
Den Plan der Schöpfung überlisten
Das wird man erstaunlich finden dürfen: dass wir die Freiheit haben, unser Glück zu suchen, ja die Chance, es hie und da zu finden – auf diesem seltsamen Planeten, der mit 107000Stundenkilometern elliptisch um eine ferne Sonne rast, einsam in einem Universum aus Milliarden toten Sternen; bebend, feuerspeiend, von Wirbelstürmen überzogen und dennoch von kriechendem Leben bedeckt.
Was für Leben aber! Gefressen zu werden, ist das häufigste Schicksal aller Tiere auf Erden. Millionen Krebse und Tintenfische sind nur auf der Welt, um im Maul eines hungrigen Wals zu verenden. Schwarze Krähen hacken weißen Lämmern die Augen aus und verspeisen sie als Leckerbissen – «die sinnlose Grausamkeit der Natur», Albert Schweitzer hat sie beklagt, und Darwins Fazit hieß: «Über das stümperhafte, niedrige, schrecklich grausame Wirken der Natur» könnte ein Kaplan des Teufels ein Buch schreiben.
Und dann doch plötzlich irgendwo ein Lachen, ein Jubelschrei! Das hat der Mensch hineingetragen in die feindliche Welt. Aber er jubiliert nicht oft. Die meisten unserer Artgenossen waren zu allen Zeiten Arme und Elende, Hungernde und Hinkende, Geschundene und Getretene, und die halbe Menschheit ist es noch heute. «Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten», sagt Sigmund Freud.
Doch uns winkt die Chance, den Plan der Schöpfung – gesetzt, es gäbe ihn – dann und wann zu überlisten: durch Liebe, durch ein gelungenes Werk, durch einen fröhlichen Rausch, durch eine Stimmung des Einsseins mit uns und der Welt; und in den wohlhabenden Ländern sind die Aussichten, dass uns das manchmal gelingt, nicht einmal schlecht.
Da bleibt die Frage: Lässt das Glück sich mehren? Oder sind wir eingemauert einerseits in unsere Umwelt und andrerseits in unsere Erbanlagen? Kann, darf, soll der Staat Institutionen schaffen, die unsere Glückschancen verbessern? Können uns die Ratschläge etwas nützen, die uns aus den vielen schlauen Büchern entgegenschallen?
Zuerst allerdings müsste man sich darauf einigen, was das eigentlich ist, das Glück. Ist es Sex oder Nächstenliebe – das Bewusstsein edler Pflichterfüllung oder ein gelungener Coup? Ist es Romeos Leidenschaft für Julia oder Don Juans Erfolg bei 1003Frauenzimmern? Wohnt es in der Studierstube oder im Harem? Können wir denn etwas daran ändern, dass der eine Olympiasieger hundertfach Unglück stiftet – unter denen nämlich, die es leidenschaftlich gern geworden wären? Darf man den Satz wagen: «Zwei Glas Wein stiften mehr Glück als zwei Tassen Tee»?
Und macht Geld eigentlich glücklich? Damit fangen wir einfach mal an.
2
Macht Geld glücklich?
Wann sitzt man schon mit einem leibhaftigen deutschen Milliardär an einem Tisch und sieht ihm beim Geldverdienen zu? Ich hatte die Chance vor ein paar Jahren in Madrid, und der Eindruck war nachhaltig.
Seine Frau, vom verspäteten Flug erschöpft, verlangte nach Champagner. Ihr Mann, auf fünf Milliarden Euro geschätzt, studierte die Weinkarte und sprach die goldenen Sätze: «Champagner kostet fünfmal so viel wie spanischer Sekt. Er kann unmöglich fünfmal so gut sein. Wir nehmen spanischen Sekt.» Zu diesem erstaunlichen Tischgespräch drängen sich vier Gedanken auf:
1.Die Entscheidung des Milliardärs war rechnerisch durchaus vernünftig.
2.Unfehlbar provoziert sie die Großmutter-Weisheit «Seht ihr – so kommt man zu Geld!» Doch eine Weisheit ist das nicht. So bringt man es nämlich allenfalls zu einem Bausparhäuschen. Wenn das beispielsweise 300000Euro kosten würde, ließen sich für fünf Milliarden mehr als 16000 solcher Häuschen errichten; und nicht einmal Großmütter würden behaupten, dass die allesamt aus Champagnerverzicht finanziert werden könnten. Zu Milliarden bringt man es niemals durch Sparsamkeit – sondern durch glückliche Umstände und den Riecher für sie, durch Riskieren und Investieren, durch Habgier und Brutalität.
3.Überdies ist die Korrektheit des Sektvergleichs höchst vordergründig. Denn angenommen, der Milliardär hätte damit 50Euro eingespart, so hätte es sich um den einhundertmillionsten Teil seines Vermögens gehandelt – so, als packte ihn der Ehrgeiz, den Preis für eine Fünf-Millionen-Villa um fünf Cent zu drücken. Wenn es ihm jedoch gelänge, Tag für Tag bis an sein Lebensende 50Euro auf die Seite zu legen, so würde er 273972Jahre leben müssen, um fünf Milliarden aufzuhäufen. Anders gerechnet: Bei einer Verzinsung mit nur fünf Prozent würden die fünf Milliarden jährlich 250Millionen erbringen, das hieße 685000Euro pro Tag oder 50Euro in ebenjenen sechs Sekunden, die das Lob des spanischen Sekts ungefähr gedauert hat.
Die 50Euro sind also das, was man in der Mathematik eine zu vernachlässigende Größe nennt. Sich von einer solchen die Wahrung oder Mehrung eines Milliardenvermögens zu versprechen, ist etwa so sinnvoll, wie es die Absicht wäre, den Bodensee zu süßen, indem man ein Stück Würfelzucker in ihn würfe.
4.Warum dann, um Himmels willen, die Aktion spanischer Sekt, die die Mathematik bis zum Unsinn überreizte, die Ehefrau düpierte und dem Gast die Sprache verschlug? Weil man Milliardär nur wird, wenn man ein Besessener des Geldes ist; wenn man ein irrationales, ein erotisches, ein gefräßiges Verhältnis zu ihm hat; wenn man 50Euro so wenig missen will wie der Sultan auch nur eine seiner hundert Haremsdamen. Auf ihre Mitmenschen wirken Milliardäre folglich nicht sehr angenehm.
Doch fehlt die Antwort auf die Frage: Macht das viele Geld wenigstens sie selber glücklich? Einerseits nein: Beim verweigerten Champagner zahlen sie den Preis für die Zwangsvorstellung, die sie in keiner Sekunde ihres Lebens loslässt: Geld ist Gott! Diese Gesinnung hat sie reich gemacht, und nun siegt sie über alle Lebenskunst, alle Lebensart, allen Sinn für Proportionen und das kleine Einmaleins. Andrerseits ja: Denn Geld demonstriert Lebenserfolg, Geld heißt Macht – und Macht zu haben ist, traurig zu sagen, eines der höchsten Glücksgefühle (Kapitel 18). Deshalb finden Leute wie Rupert Murdoch, George Soros, Bill Gates es so dringend, weitere Milliarden heranzuschaufeln.
Reichtum gleich Macht: Entspricht dies der populären Vorstellung? Die ist eher als mit dem Geldscheffeln mit dem Geldausgeben verbunden – mit der Fähigkeit und mit der Lust, sich Luxus zu leisten, all das, wovon die meisten nur träumen: drei Villen, vier Autos, eine Yacht, Weltreisen erster Klasse und dabei nie ein sorgenvoller Blick aufs Konto. Erst von da an abwärts wird die Frage, ob Geld glücklich macht, wirklich interessant.
Unstrittig unter Psychologen ist nur eine höchst indirekte Art des Glücks am Geld: jene, die in der Abwesenheit von Unglück besteht. Es ist schön, nicht hungern zu müssen, nicht zu frieren, eine saubere, regenfeste Wohnung zu haben und für jede Krankheit einen Arzt zu finden. Aber wer in Mitteleuropa würde solche Grundbefriedigungen als «Glück» einstufen? Er müsste schon zuvor durch die Slums von Kalkutta gestreift sein, um seinen Wohlstand zu genießen – oder sich lebhaft an Phasen der Not im eigenen Leben erinnern. Doch da sind wir mitten in einem Wald von Problemen.
Zum Ersten: Ist es vernünftig, ist es vermittelbar, das Fehlen von Unglück mit dem Etikett «Glück» zu versehen? Empfinden wir irgendetwas dabei? Und doch scheint es, als sei eben dies die häufigste Annäherung ans Wohlbefinden: dass kein Leiden uns plagt.
Dies führt zur zweiten Schlüsselfrage: Haben Menschen mit einer lebendigen Erinnerung an Krankheit, Zwang und Not vielleicht eine höhere Chance, sich des Wohlstands, der Freiheit, der Gesundheit zu erfreuen als solche, denen es immer gut gegangen ist? Kann die Freuden voll nur der ausschöpfen, der die Leiden kennt? Die Butter dick aufs Brot zu streichen und nach Belieben ein heißes Bad zu nehmen ist für viele von der langsam wegsterbenden Generation der Weltkriegsteilnehmer immer noch ein Hochgenuss; Jüngere haben davon keine Vorstellung mehr (wie schön), und als Glücksquell stehen ihnen (wie schade) Bad und Butter einfach nicht mehr zur Verfügung. Oder: Hatte ein Schweizer je die Möglichkeit, seine Freiheit so zu genießen, wie Millionen Bürger der DDR die ihre genossen haben, damals, 1989, in den Tagen nach dem Fall der Mauer?
Solches Glück ist also ein Kontrast-Erlebnis, nur eines von vielen: Denn der Gegensatz und ein frisches Gefühl für ihn gehören zu fast jedem Lebensgenuss, Kapitel 10 wird es demonstrieren. Das Geld macht aus dieser zwiespältigen Einsicht ein hochpolitisches Dilemma: Als reich empfindet sich ja nur, wer entweder mehr davon besitzt als früher – oder mehr als jene Zeitgenossen, an denen jeder sich unwillkürlich und fast unentrinnbar misst: Nachbarn, Freunde, Kollegen, Konkurrenten.
Mehr als früher: Das wiederum wird uns nur dann zum Erlebnis, wenn sich der Aufschwung in Riesenschritten vollzieht. Dem einzelnen Glückskind mag das gelingen; eine ganze Volkswirtschaft kann nur im Extremfall ein Tempo vorlegen, das ein kollektives Wohlgefühl begünstigt: die deutsche in den fünfziger Jahren beispielsweise – aber dieses «Wirtschaftswunder» geschah auf der Basis einer vorangegangenen Katastrophe. Im Abendland hat sich die Kaufkraft des Durchschnittsbürgers seit 1945 verdrei- oder vervierfacht, aber niemand behauptet, damit wäre eine Verdreifachung, ja auch nur eine spürbare Steigerung des durchschnittlichen Glücksempfindens einhergegangen.
Immer präsent dagegen und politisch viel brisanter ist der unvermeidliche horizontale Vergleich: der mit den Nachbarn, den Kollegen. Er ist eine Urtatsache des menschlichen Zusammenlebens, und er setzt einen unheimlichen Mechanismus in Gang: Der steigende Wohlstand aller hebt das Wohlbefinden nicht. Die Cornell-Universität im Staat New York hat dieses Grundgesetz des sozialen Wohlbefindens 2003 in einem Experiment erhärtet: Würden die Testpersonen lieber 100000Dollar im Jahr verdienen, wenn alle Vergleichspersonen nur 80000 bekämen – oder 150000, also 50000 mehr, wenn die anderen es auf 200000 brächten? Die Mehrzahl entschied sich für den ersten Weg: Lieber verzichteten sie auf 50000Dollar, als unter Reicheren der Ärmere zu sein.
Da ist es, das «Wohlstandsparadox», die Hedonic Treadmill, wie die amerikanischen Sozialforscher sagen, die Tretmühle der Lebenszufriedenheit: Weil einer sich nur dann wohlfühlt, wenn er mindestens so viel verdient wie die, mit denen er sich vergleicht, muss er umso heftiger in die Mühle treten, je wohlhabender die anderen werden. Das Wirtschaftswachstum, das die meisten Staaten als ihr Lebenselixier betrachten, trägt also zum Ideal des «größten Glücks der größten Zahl» überhaupt nichts bei (mehr über dieses Staatsziel in Kapitel 30).
Wachstum ist willkommen, solange eine Gesellschaft noch unterhalb der Armutsschwelle lebt; Wachstum ist wohl auch nötig, damit eine Volkswirtschaft sich in der globalisierten Welt behaupten kann; mit der Zufriedenheit der Bürger hat weiteres Wachstum in der Wohlstandsgesellschaft nichts zu tun. Doch die Volkswirtschaft, sagt der Harvard-Psychologe Daniel Gilbert, «kann nur dann gedeihen, wenn die Leute fälschlicherweise glauben, dass die Produktion von Wohlstand sie glücklich macht».
Zusätzlich gerät das Hamsterrad dadurch in Bewegung, dass bei fast allen Menschen im Gleichschritt mit der Vermehrung ihres Einkommens ihre Ansprüche steigen – bei vielen bis zu dem Grade, dass sie an eine permanente Ratenzahlung gekettet sind, nur später für eine schönere Couch, ein schickeres Auto als früher. In den fünfziger Jahren, ja: Da fand die deutsche Familie es selbstverständlich, dass sie sich keine Italien-Reise leisten konnte, wenn sie schon für ein Auto bezahlte, und keinen Fernsehapparat, bis der Kühlschrank abgestottert war. Heute lächeln wir darüber. Glücklicher geworden sind wir nicht – so sagen es die Leute, und die Lebenserfahrung spricht dafür, dass man ihnen glauben kann.
Also: Wie viel trägt es zu unserm Glück, zu unserm Unglück bei, das Geld? Zum Unglück ziemlich viel – über die nackte Not hinaus durch das millionenfache Unbehagen der Ärmeren beim Anblick der Reichen, oft bis zum gelben Neid (einem klassischen Unglück, Kapitel 25 handelt davon); durch den Schock, sich finanziell ruiniert zu sehen; durch die Grausamkeit, mit der ein Schüler, der sich die gerade modischen Klamotten nicht leisten kann, heutzutage ausgegrenzt und erniedrigt wird.
Doch für Zufriedenheit mit dem Leben sorgt Geld ebenfalls millionenfach. Der reichen Oberschicht gewährt ihr Wohlstand eine nachhaltige Befriedigung, gespeist aus dem Bewusstsein des sozialen Abstands und der Freiheit zum Luxus. Der exzentrische Hollywoodstar Zsa Zsa Gabor fand dafür die Formel: «In einem Rolls-Royce weint es sich angenehmer als in der Straßenbahn.»
Damit beschrieb sie jenes Glück, von dessen Schmähung die Bibel widerhallt. Die Reichen kommen nicht in den Himmel (Matthäus 19,24), sie sollen alles verkaufen und unter die Armen verteilen (Lukas 18,22) und sie sollen heulen über das Elend, das über sie kommen wird (Jacobus 5,1). «Die Großen dieser Erde mögen den Vorzug vor den Geringen haben, zu schwelgen und zu prassen, alle Güter der Welt mögen sich ihren nach Vergnügen lechzenden Sinnen darbieten… Nur, mein Freund, das Vorrecht, glücklich zu sein, wollen wir ihnen nicht einräumen.» Kleist schrieb das 1799, und sein wollen wir nicht enthüllt das Tragikomische solcher Argumentation: An euerm Reichtum kann ich nichts ändern, aber euch das Prädikat «glücklich» zu missgönnen, dazu fühle ich mich stark genug.
«Traue denen nicht allzu sehr, die so tun, als ob sie den Reichtum verachteten», hatte Francis Bacon schon 1612 gemahnt: «Denn nur die verachten ihn, welche daran verzweifeln, zu ihm zu gelangen, und die sind die schlimmsten, wenn sie ihn einst doch erwerben.»
Unterhalb der Oberschicht machen es sich im Abendland Hunderttausende bequem, die ein sozialer Aufstieg dahin gebracht hat, dass sie den Euro nicht mehr dreimal umdrehen müssen und sich schöne Dinge leisten können. Ihre Freiheit, hie und da Geld auszugeben über den bloßen Bedarf hinaus, bringt ihnen vermutlich mehr Vergnügen, als kleinbürgerliche Sparsamkeit, hortender Geiz oder die Zufriedenheit des Milliardärs über die gesparten 50Euro es je vermöchten.
Ein dritter Weg, sein Lebensglück mit dem Geld zu versöhnen, ist, sich von ihm nicht tyrannisieren zu lassen, ob man es hat oder nicht. Schließlich führen Millionen arme Teufel in der Dritten Welt ein fröhlicheres Leben als bei uns manche Witwe mit Chauffeur, und es fehlt jedes Indiz dafür, dass ein Zehnjähriger von heute inmitten seiner Elektronik eine glücklichere Kindheit hätte als vor hundert Jahren die sieben Kinder eines Einödbauern.
«Wenn ich reich wäre», lässt der Schweizer Schriftsteller Robert Walser seinen Jakob von Gunten sinnieren, «so beginge ich irgendwelche Tollheiten und Torheiten. Zum Beispiel könnte ich ja ein wahnsinnig reiches und lustbeladenes Gastmahl geben und Orgien nie gesehener Art veranstalten… Ganz bestimmt müsste das Geld auf sinnverwirrende Art und Weise verbraucht werden, denn nur das echt vertane Geld wäre ein schönes Geld – gewesen. Und eines Tages würde ich betteln, und da schiene die Sonne, und ich wäre so froh – über was, das würde ich gar nicht zu wissen begehren.»
Bis dahin gilt der alte Satz: «Geld allein macht noch nicht unglücklich.»
Aber fragen wir doch die Leute, was eigentlich sie glücklich macht.