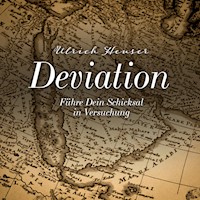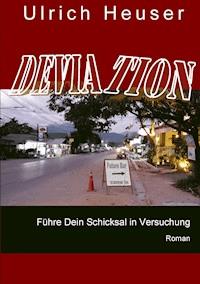5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In der Schweiz sieht sich Jeffrey urplötzlich Polizei-Ermittlungen aufgrund von Indizien in einem Tötungsdelikt ausgesetzt. Er ist sicher, dass der Täter die Indizien manipuliert hat, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Der Polizei traut er nicht, denn sie ist auffällig schnell bereit, ihn als Täter zu akzeptieren. Jeffrey flieht nach Sri Lanka, folgt damit der einzigen Spur und stellt dort mit seinen beschränkten Möglichkeiten Nachforschungen an. Es gelingt ihm kaum, an die Hintergründe der Tat zu gelangen, obwohl er Personen kennenlernt, die mit dem Tathergang in Verbindung stehen, darunter auch ein Schweizer Polizist, der dort erscheint und sich merkwürdig verhält. Eine schmutzige Affäre mit politischen Auswirkungen um eine Firma in Sri Lanka spielt offenbar ebenso ein wichtige Rolle, denn das Opfer der Tat, ein Schweizer Unternehmer, war Inhaber dieser Tochtergesellschaft. Zwischen Jeffrey, Lisa, der Ehefrau eines Bekannten aus seinem Sportklub, Susannah, einer engen Freundin von Lisa, und dem zwielichtigen Polizei-Ermittler Egkbarn entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel. Bei einem Unfall auf See kommt Lisa um, Jeffrey kann Susannah retten. Unter diesem Schock offenbart Susannah ihm die ganze Geschichte um den Tod des Unternehmers. Jeffrey erkennt, dass er als Instrument missbraucht werden sollte, ein weiteres Verbrechen zu begehen. Durch den Unfall entkommt er der Falle und ist von allen Verdachtsmomenten entlastet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ulrich Heuser
Das
Opfer-Täter
Paradoxon
Vernichtung per
gefälschtem Indiz
Thriller
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daen sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Texte: © 2024 by Ulrich Heuser
Umschlaggestaltung: © 2024 by Ulrich Heuser
◊
2. Auflage
E-Book-Ausgabe Januar 2025
Verlag: J.O. Logger Self-Publishing Ulrich Heuser,
Hinter der Feuerwache 3, 21720 Steinkirchen,
◊
Bildnachweise:
Peace Pagoda near Galle, Sri Lanka, photo by U. Heuser, Jan. 3, 2010.
Im Vordergrund eingefügt:
Coast Guard Ship, The Netherlands, photo by U. Heuser, Mar. 27, 2023.
Photos used and modified under lic.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
◊
Herstellung und Vertrieb:
epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin,
www.epubli.com
◊
Created in Germany
ISBN: 978-3-818742-43-0
Widmung
Dedicated to J.C.,
who is steady source of inspiration and teacher of fiercest observation to me, an authority of social awareness, and my favorite tutor in the exploration of human nature.
Gewidmet J.C.,
der beständige Quelle von Inspiration und Lehrer schärfsterBeobachtung für mich ist, eine Autorität sozialen Bewusstseins und mein bevorzugter Lehrmeister bei der Erforschung der menschlichen Natur.
Hinweis:
Die Handlung und alle Ereignisse in diesem Roman sind freierfunden. Jegliche Ähnlichkeiten der Charaktere mit realen, lebenden oder verstorbenen Personen und/oder deren Namen sind unbeabsichtigt und reiner Zufall. Übereinstimmungen zwischen Unternehmen, Institutionen o.ä. hinsichtlich Namen/Funktionen und real existenten Pendants sind ohne Relevanz in der Wirklichkeit und im Zweifelsfall unbeabsichtigt.
1
So las ich es später im Stadtboten über den Abend auf dem Weissenstein:
Zeitlupenszene mit einer Tanzkompanie dunkler Wolkenfetzen auf der weiten Bühne ihres luftigen Theaters, begrenzt nur durch den Horizont – und auftretend vor dem faszinierenden Prospekt der blass blauen Himmelsglocke. So bot sich die Choreografie der Ätherwesen dem Betrachter dar: geheimnisvoll, elegant, voll überraschender Entwicklungen, sphärisch schön, niemals trivial.
Der Reigen der Wolkengeister kündigte den Abend an, ein heißer Sommertag neigte sich dem Ende entgegen auf eine Weise, wie es seit mehr als einer Woche alle Tage getan hatten: in einem letzten Aufzug von außergewöhnlicher Brillianz, wohliger Wärme und lauer Brise, Verführungen also, die die Menschen aus den Häusern locken.
„Komm heraus, du wirst dir diesen Moment doch nicht entgehen lassen!“, liegt es wie ein Rufen in der Luft, und alle folgen ihm.
Man schlendert durch die Straßen oder sitzt gesellig vor den Wirtshäusern. Und während die Erwachsenen Anstrengung und Schweiß des Tagwerks mit viel Flüssigkeit herunterspülen, matt und zufrieden dahocken und sich mit wenigen Worten gegenseitig ihrer glückseligen Erschöpfung versichern, nutzen die Kinder die gewährte Freizügigkeit bis nach Anbruch der Dunkelheit für ihr lebendiges, geräuschvolles Spiel in den Gassen.
Auf die Art hatte ich diesen Sommerabend erlebt, von dessen Sorte es in unseren Breiten immer nur abzählbar viele pro Jahr gibt. Jedenfalls wäre der besagte Abend ohnehin weniger schnell in meiner Erinnerung verblasst als andere, denn durch den darauffolgenden Nationalfeiertag konnte ich mich seiner Stimmung bis in die Nacht hinein hingeben. Keine Arbeit oder Verpflichtung wartete am nächsten Morgen auf mich.
So hatte ich mich früh zum Dinner mit Freunden in einem Gartenlokal verabredet. Für den späteren Abend war dort der Auftritt von Musikern angekündigt, sodass wir nach der Mahlzeit am Platze blieben, uns in Gespräche über Alltägliches oder Tiefsinniges verstiegen, gerade so, wie sich die Themen entwickelten, und als der Stoff zum Austausch weniger wurde, mit einem Kartenspiel anfingen. Nach ein paar Runden – die Musiker hatten soeben auf der Freiluftbühne mit dem Aufbau begonnen – gesellte sich ein Bekannter von mir zu uns. Zum Kiebitzen schob er seinen Stuhl dicht hinter die Lücke zwischen mir und meinem Platznachbarn. Er begrüßte uns freundlich mit leiser Stimme, bat um unsere Erlaubnis, zuschauen zu dürfen, und verhielt sich von da an ruhig und unauffällig. Während wir immer wieder laut lachten, komisch schimpften, allerlei reißerische Sprüche herausbrachten, zuweilen grölend und vorwitzig prusteten, sodass sich andere Gäste nach unserem Tisch umsahen, blieb unser Zugang recht ernst und schweigsam.
Meinen Freunden war er nur flüchtig bekannt, ich traf mich seit gut einem Jahr häufiger mit ihm. Wir hatten etwa zur gleichen Zeit unsere Leidenschaft für das Tontaubenschießen entdeckt und begegneten uns wenigstens wöchentlich auf dem Übungsgelände des Klubs. Er war mir sympathisch wegen seiner besonnenen, geduldigen Art, seiner guten Manieren, seiner höflichen und stilvollen Sprache, seiner gepflegten Erscheinung. Und doch hätte ich ihn nicht in meinen Freundeskreis aufnehmen wollen. Etwas an ihm erregte in mir das Gefühl, ihm nicht vertrauen zu können. Dazu hatte er mir niemals Anlass gegeben, im Gegenteil: Sein Verhalten mir gegenüber war immer tadellos, freundlich, wohlwollend und rücksichtsvoll gewesen. Jedoch schlummerte nach meinem Empfinden etwas Unberechenbares in ihm. Ich wusste nicht, wie ich darauf kam, aber dieser Eindruck hatte mich während des ganzen Jahres seit unserer ersten Begegnung nicht verlassen.
Dass er an diesem Abend zu uns stieß, war wohl Zufall – ich nahm an, er sei wegen des Konzerts hergekommen und hatte mich unter den Besuchern entdeckt. Jedenfalls fand er offensichtlich Gefallen an unserem wenig ernsthaften Kartenspiel und amüsierte sich mit der ihm eigenen Zurückhaltung still über unseren Klamauk.
Schließlich begannen die Musiker zu spielen, und er taute noch ein wenig mehr auf. Das Konzert entwickelte sich mitreißend, Weltmusik als bevorzugtes Genre der Künstler kam bei dem Publikum und in der Atmosphäre dieser Sommernacht außerordentlich gut an. Die Besetzung der Combo sowohl mit Instrumenten wie auch mit drei Mitgliedern, die ihre Gesangsstimmen einbrachten, war in bester Weise geeignet, eine Reise um die Welt zu den musikalischen Traditionen vieler Völker zu unternehmen. Das Publikum kam aus diesem Zauber gar nicht heraus. Von indianischen Gesängen aus Nordamerika schwenkten die Musiker zu Bossa Nova, um dann mit dem nächsten Stück meditative indische Klänge anzustimmen. Weder fehlten die markanten Töne aus Australien, dargebracht von Didgeridoo und Maultrommel, noch orthodoxe Mönchsgesänge aus dem tiefen Russland.
Nie zuvor hatte ich eine Gruppe von Musikern erlebt, die so wandlungsfähig und doch in jedem Stil so authentisch daherkam. Dabei trugen sie keine bekannten Namen, traten hemdsärmelig auf, so, als ob sie eben noch Teil des Publikums gewesen seien, sich zugezwinkert hätten aus Spaß und Lust, um dann auf die Bühne zu klettern und dieses Konzert aus dem Handgelenk zu schütteln.
Die Begeisterung der Besucher drückte sich in minutenlangem, brandenden Applaus aus, und die Combo wurde erst nach drei Zugaben von der Bühne gelassen. Ich muss zugeben, dass ich ungeheuer beseelt war von diesem musikalischen Erlebnis. Und obwohl Mitternacht bereits verstrichen war, fühlte ich mich frisch und lebendig. Die Bewirtung sorgte noch eine Stunde lang für Nachschub an Getränken. Dann aber wurden die Gäste freundlich und bestimmt auf den Heimweg geschickt.
Hagen, mein Bekannter vom Tontaubenschießen, hatte keinen Anlauf unternommen, für sich den Abend zu beschließen. Ganz und gar gegen meine Erwartung war er treu bis zum Schluss mit uns zusammengeblieben. So überraschte es mich am Ende nicht, dass er vorschlug, den Heimweg zu Fuß anzutreten – er wollte seinen Wagen stehen lassen – und ein gutes Stück Weg gemeinsam zu gehen. Trotz meiner leichten Trunkenheit durch Wein und Musik entging mir nicht, dass er damit die Absicht verfolgte, mit mir allein zu sein. Ja, ich verstand nun, dass er auf diese Gelegenheit während des ganzen Abends gewartet hatte.
Inzwischen war es still geworden in den Gassen, die Müdigkeit hatte die meisten Nachtschwärmer letztendlich doch ins heimische Bett getrieben. Über die Straßen rollten nur noch wenige Autos, ab und zu rauschte ein Taxi im Eiltempo vorbei und nutzte die freie Fahrt an Ampelkreuzungen, die auf gelbes Blinklicht geschaltet waren. In leichten Stößen wehte ein warmer Wind durch die Straßenzüge, Falter umkreisten die Straßenlaternen, hinter den Fenstern der Wohnungen war es längst überall dunkel.
„Es kann gut sein, dass ich sie um Hilfe bitten muss“, begann Hagen schließlich, als er den Augenblick für ein vertrauliches Gespräch für geeignet hielt.
Ich forderte ihn auf, sein Thema ohne Umschweife zu offenbaren.
„Nun, ich will ihnen chronologisch beschreiben, was heute passiert ist“, leitete er seinen Bericht ein.
„Die Vorgeschichte folgt später, – wenn sie sie überhaupt hören wollen. Es begann damit, dass ich nach der Arbeit ins Sportzentrum gefahren bin, um, wie an diesem Wochentag üblich, mit einigen Kollegen aus anderen Abteilungen Badminton zu spielen. Allerdings blieb ich dort alleine, die anderen hatten wohl versäumt, sich abzumelden. Nun ja, das ist mir selbst schon passiert, und schlimm ist es auch nicht. Da ich schon einmal dort war, habe ich eine gute halbe Stunde Fitnesstraining absolviert, geduscht, und wollte mich dann – zwei Stunden früher als sonst – auf den Heimweg begeben. Am Auto kam mir in den Sinn, meine Ehefrau anzurufen, um sie zu fragen, ob wir uns an diesem Sommerabend nicht in der Stadt treffen wollen. Ich konnte sie telefonisch jedoch nicht erreichen.“
Er musste auffällig schlucken, bevor er fortfahren konnte.
„Die wundervolle Stimmung des hellen, sonnigen Sommerabends verleitete mich dazu, nicht den direkten Heimweg zu nehmen, sondern die reizvolle Strecke durch das Vorgebirge einzuschlagen. Irgendetwas bewegte mich dazu, an einem Platz anzuhalten, der mir früher einmal im Vorbeifahren als besonderer Ort, als ein Punkt mit außergewöhnlicher Fernsicht aufgefallen war. Also schritt ich von der Straße die kleine Anhöhe hinauf und setzte mich auf der Kuppe ins Gras. Der weitreichende Blick über das Vorgebirge hinweg in das Tal des großen Stroms gefiel mir gut, und ich genoss die Stille des Ortes, die nur ab und an von Vogelstimmen und dem Zirpen der Grillen unterbrochen wurde. Ich ließ mich in das hohe Gras zurückfallen und beobachtete den Zug der Wolkenschiffe am Himmel, sah, wie die untergehende Sonne ein faszinierendes Farbenspiel in die Wolken malte. So verzaubert in Licht getaucht sich auch die Wattebäusche am Himmel bewegten, Formen und Farben veränderten, so sehr wurde mir bewusst, dass ich dieses Schauspiel am Firmament in genau dieser Art niemals wiedersehen würde. Ein Gefühl des Verlusts ergriff von mir Besitz, und ich war plötzlich in dem Gedanken gefangen, dass sich etwas anderes in meinem Leben im gleichen Augenblick unumkehrbar gewandelt hatte.“
„Wollen sie nicht zur Sache kommen? Sie malen ihr Erlebnis aus wie ein Märchen, mein Lieber“, machte ich ihm klar.
„Oh, entschuldigen sie. Sie haben recht, es ist unangemessen. Wenn überhaupt, dann handelte es sich um ein böses Märchen.“
Hagen rieb sich im Weitergehen mit beiden Händen die Augen, so, als müsste er sich ungetrübten Blick auf das Geschehene verschaffen, über das er berichten wollte.
„Als ich mit dem Auto in unsere Straße einbog, fielen mir sofort die Wagen auf, die vor unserem Haus unorthodox geparkt waren. Unsere Einfahrt war versperrt, und so war ich gezwungen, durch die frei gebliebene Gasse zwischen den Wagen am Haus vorbeizufahren, im Schritttempo natürlich – ich wollte ja wissen, was dort los war. Auf zwei Fahrzeugen entdeckte ich ein magnetisches Blaulicht – das Wort Polizei schoss mir durch den Kopf. In unserer Einfahrt parkte ein Rettungswagen mit offenstehenden Hecktüren. Ich hielt an und sah in diesem Moment zwei Männer in Weiß einen Blechsarg durch unsere Haustür nach draußen tragen. Dann gab ich Gas und fuhr davon. Ich kann nicht sagen, warum ich nicht sofort hingelaufen bin und mir Aufklärung verschafft habe. Ich weiß es wirklich nicht.“
Hagens Stimme klang nun zittrig, und er musste mehrmals heftig schlucken. Nach einer Pause fuhr er fort.
„Eine geschlagene Stunde bin ich in der Gegend herum gerollt. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen, alles lief mechanisch ab. Ich war nicht in der Lage, heimzufahren und mich dem schrecklichen Ereignis zu stellen. Für mich war klar, dass Lisa, meine Frau, einem Verbrechen oder einem Unfall zum Opfer gefallen war. – Schließlich nahm ich allen Mut zusammen, parkte den Wagen und wählte die Telefonnummer von daheim auf dem Mobiltelefon. Sofort wurde abgenommen, und es erklang eine Frauenstimme, die ich vor Nervosität zunächst nicht erkannte. Endlich wurde mir bewusst, dass es sich um Susannah, eine enge Freundin meiner Frau, handelte. Von ihr erfuhr ich, dass Lisa schon morgens aus dem Haus gegangen war, wie Nachbarn beobachtet hatten, und dass sie die Verabredung mit ihr, Susannah, wohl vergessen hatte. Als Susannah zu unserm Haus gekommen ist, hat sie die Haustür offenstehend vorgefunden und ist wohl buchstäblich über eine männliche Leiche im Hausflur gestolpert. Sie habe die Polizei gerufen. Die Beamten hätten den Toten weder identifizieren können, noch besäßen sie eine Erklärung dafür, wie er in unser Haus gelangt ist. Natürlich bat mich Susannah, sofort zu ihr in unser Haus zu kommen. Das bringe ich im Moment jedoch nicht fertig. Stattdessen bin ich auf das Fest gegangen. Den Rest kennen sie ja.“
Nach dem genussvollen Abend erschien mir das Gehörte wie ein Fragment aus einem in Vergessenheit geratenen Kinofilm. Solche Dinge kommen doch in unserer Wirklichkeit nicht vor, dachte ich. Hagens Bericht sah ich an wie eine Mixtur aus meinem Bild von diesem Mann, seiner offensichtlich fabulierten Geschichte und der Ausschmückung, die meine dunklen Fantasien hinzudichteten. Ich konnte es in diesem Moment nicht ernst nehmen, und anstelle eines sachlichen Kommentars erwiderte ich nur:
„Machen sie sich keine Sorgen – sie können heute Nacht im Gästezimmer bei mir daheim schlafen.“
Er bedankte sich artig und nahm den Vorschlag sofort an, ja es war, als habe er damit gerechnet. Hatte er das von Anfang an im Sinn gehabt?
Die Straßenlaternen spendeten nicht genügend Licht, um Hagens Gesichtsausdruck erkennen zu können. Und es wurde mir jetzt auch gleichgültig, meine Müdigkeit gewann die Oberhand, ich sehnte mich nach Bett und Schlaf.
Wir trotteten folglich den Rest des Wegs schweigend, als seien wir, jeder für sich, tief in Gedanken versunken, nebeneinander durch die leeren Straßenzüge. Hagens Geschichte hatte ich nach hundert Schritten wieder vergessen.
Beim Frühstücken las ich im Stadtboten vom Vortag, und ich fand, dass die Redakteurin, die sich über die sommerliche Stimmung in ihrer Kolumne ausgelassen hatte, eine schwärmerische Seele besaß. Für eine Tageszeitung kam mir dieser Stil unpassend vor, obwohl sich gegen die Beobachtungen nichts einwenden ließ.
Zugegeben, mein Frühstück fand mittags statt, was mir jedoch kein schlechtes Gewissen verursachte. Bis ich meinen Gast auf dem Schlafsofa im Wohnzimmer untergebracht hatte und selbst in den Federn war, zeigte der unerbittliche Wecker auf meinem Nachttisch drei Uhr zwanzig an.
Nun saß ich im Pyjama alleine mit der Zeitung, einem Kaffee und den aufgebackenen Croissants da, blätterte ein wenig ziellos durch den Stadtboten und dachte an diesen komischen Kauz Hagen. Er war schon verschwunden, als ich aus meinem Schlafzimmer kam, hatte alles ganz ordentlich hergerichtet, war grußlos davongeschlichen und hatte nicht die Spur einer Spur zurückgelassen. Einen Zettel mit einem „Dankeschön“ darauf hätte ich schon erwartet.
Gut, wofür sollte er danken? Nichts ließ erkennen, dass er überhaupt hier gewesen war.
Das Telefon klingelte und riss mich aus meinen Gedanken zu Hagen und dieser Zeitung auf meinem Schoß.
„Hallo, spreche ich mit Herrn Jeffrey Ginslow?“
Ich hatte mich nicht mit Namen gemeldet, bejahte also.
„Kantonspolizei, mein Name ist Egkbarn. Entschuldigen sie die Störung am Feiertag. Ich bekam soeben ihre Rufnummer vom Verein der Tontaubenschützen. Man sagte mir dort, sie seien ein Bekannter von Herrn Hagen Fried. Richtig?“
„Ja, das stimmt. Ich kenne ihn aus dem Verein, bin aber nur flüchtig mit ihm bekannt. Worum geht es denn?“
„Wir müssen Herrn Fried dringend sprechen. Leider konnten wir ihn bisher nicht erreichen und versuchen es jetzt über seine Kontakte“, erklärte der Beamte von der Polizei.
„Da sind sie bei mir falsch, tut mir leid. Ich habe nur über den Verein Kontakt zu ihm und kann ihnen nicht weiterhelfen“, antwortete ich, ohne lange darüber nachzudenken.
„Alles klar. Dann sehen sie mir die Störung bitte nach und genießen sie ihren Feiertag“, verabschiedete sich der Herr am anderen Ende.
Mein Glück bestand in der Kürze des Telefonats. Ich gebe zu, dass mich diese Anfrage einigermaßen aus der Fassung brachte, was sich jedoch erst nach dem Auflegen bemerkbar machte. Mir schossen nun die Sätze von Hagen ungeordnet durch den Kopf, in denen er von den Umständen an seinem Haus berichtet hatte. Jene, die ihn so verschreckt hatten, dass er die Flucht auf das Sommerfest angetreten hatte. Erst jetzt nahm ich ernst, worüber er gesprochen hatte. Jedenfalls hatte ich mir selbst den Feiertag verdorben, indem mir am Telefon nicht schnell genug bewusst wurde, dass ich dem Polizisten alles hätte sagen müssen, was sich mit Hagen seit dem Abend zugetragen hatte. Also quälte mich nun ein schlechtes Gewissen, nein, im Grunde nur ein dummes Gefühl, denn ich hatte nichts Falsches gesagt.
Um mich abzulenken, fuhr ich am Nachmittag zum Weissenstein – das Schwärmen der Redakteurin aus dem Stadtboten hatte mich angesteckt. In der Höhe hatte der herrliche Sommertag einen besonderen Reiz, die Natur stand in vollem Saft, die Nadelgehölze dufteten unter den Strahlen der gleißenden Sonne. Keine Wolke zeigte sich am Himmel, die Fernsicht von hier reichte weit bis an die Grenzen zu den Nachbarländern. Nur der Streifen über dem Horizont war durch einen Dunst verschleiert, den die Sommerhitze ausgebrütet hatte.
Langsam verflogen die Bedenken zum Telefonat mit der Polizei. Ich gönnte mir ein gutes Dinner in einem Lokal auf dem Berg, zu früher Stunde, denn das Herumwandern und die vielen Stunden seit dem Frühstück hatten ein Hungergefühl ausgelöst. An meinem Tisch auf der Terrasse richtete sich der Blick nach Westen und Norden, und diese Aussicht zeigte, wie der Tag allmählich in großer Brillianz und Ruhe zur Neige ging.
Meine Rückkehr erlaubte, gerade den Beginn der Nachrichtensendung im Fernsehprogramm mitzubekommen. Die Berichte über das Weltgeschehen lenkten mich endgültig ab von dem Telefonat am Vormittag. Als der Wetterbericht ausgestrahlt wurde, klingelte es an meiner Wohnungstür.
Ich öffnete, und zwei Herren gaben sich als Polizisten in Zivil zu erkennen. Den Schrecken, der mich ergriff, versuchte ich zu überspielen.
„Herr Ginslow, wir müssen sie noch einmal zu ihrem Bekannten, Herrn Hagen Fried, befragen. Dürfen wir hereinkommen?“
Sofort bot ich den Herren an einzutreten.
„Ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Egkbarn. Wir haben heute bereits telefoniert“, sagte der eine Herr, ein sympathisch wirkender Dunkelhaariger mit Vollbart, etwa in meinem Alter.
Der andere war deutlich jünger, trug einen blonden Kurzhaarschnitt und eine Brille.
Sie traten mir folgend ins Wohnzimmer. Der Jüngere ließ seinen wachen Blick unablässig in jede Ecke schweifen, schien alles in meiner Wohnung aufmerksam zu registrieren. Egkbarn sah mich musternd an, während ich das TV-Gerät ausschaltete. „Herr Ginslow, wir suchen Herrn Fried und sind der Meinung, dass sie uns helfen können. Inzwischen haben wir herausgefunden, dass sie gestern Abend lange Zeit mit Herrn Fried zusammen gewesen sind.“
„Ja, das stimmt. Als sie anriefen, war ich so überrascht, dass ich meine Gedanken nicht richtig beieinander hatte.“
„Dafür haben wir Verständnis. Trotzdem hätten sie es nach dem ersten Schock noch erwähnen oder aber uns zurückrufen können. Sie sind kein Einheimischer, oder? Vielleicht lag es ja an der Sprache“, äußerte Egkbarn.
Der Kollege schwieg, sah aber immer wieder zur Tür Richtung Flur, als erwartete er, dass Hagen dort auftauchen würde.
„Richtig, ich bin als Kind mit meinen Eltern aus den USA hierher gekommen und dann hier aufgewachsen. Wegen der Sprache müssen sie sich nicht sorgen“, antwortete ich.
„Also sie wissen nicht, wo sich Fried jetzt aufhält, aber er war hier“, stellte Egkbarn in den Raum.
Daraufhin erklärte ich dann mit knappen Worten, wie der Ablauf vom Sommerfest am Abend bis zu meinem Aufwachen am Vormittag gewesen war.
„Dürfen wir uns einmal bei ihnen umschauen?“, meldete sich jetzt der Kollege zu Wort.
„Wenn es sein muss, ja. Aber sie werden Herrn Fried nicht finden. Ich habe keine Ahnung, wo er sich aufhält“, erwiderte ich ärgerlich.
„Schon gut“, sagte Egkbarn beschwichtigend, „Wir gehen. Und entschuldigen sie die Störung. – Kommen sie, Herr Kollege!“
Die beiden Polizisten strebten eiligen Schrittes der Eingangstür entgegen und waren so unvermittelt verschwunden, wie sie erschienen waren.
Damit ist es wohl erledigt, dachte ich bei mir und fühlte mich zufrieden und entspannt.
Der darauffolgende Tag war ein Freitag, ein Arbeitstag für mich. Früh schien die Sonne durch die Fenster herein, und es fiel mir leicht aufzustehen. Kaum stand ich gutgelaunt mit meiner Kaffeetasse in der Küche, tönte die Glocke an der Eingangstür. Das hatte es morgens um sieben Uhr noch nie gegeben. Die wirklich böse Überraschung trat beim Öffnen ein. Der Besuch bestand aus den beiden mir bekannten Polizeibeamten und einer größeren Gruppe aus der Abteilung für kriminaltechnische Untersuchungen. Egkbarn zeigte mir den Beschluss für die Hausdurchsuchung bei mir und erklärte, ich stünde möglicherweise in Verbindung zu einem Tötungsdelikt an einem älteren Mann im Hause Fried.
„Mit dem Tod des Mannes habe ich nicht das Geringste zu tun“, antwortete ich empört.
„Sie geben aber zu, davon gewusst zu haben, nicht wahr? Fried hat es ihnen zumindest erzählt. Oder liege ich da falsch?“, erwiderte Egkbarn.
„Ja, er hat es mir erzählt. Das war ja der Grund, warum er so vollkommen durcheinander war. Er hat wohl anfangs gedacht, seine Ehefrau sei tot“, gestand ich ein.
„Sie erkennen schon, dass es sie verdächtig gemacht hat, uns darüber nicht schon gestern Abend in Kenntnis zu setzen?“, sagte Egkbarns Kollege, woraufhin Egkbarn selbst das Wort ergriff und sprach:
„Halten sie sich zu unserer Verfügung und verlassen sie nicht den Kanton! Verstanden? Unsere Spezialisten haben hier noch zu tun, unterstützen sie die Leute!
Wir sind fertig.“
Der Blonde schaute missmutig drein, folgte aber Egkbarns Aufforderung, und beide verließen meine Wohnung.
Mir blieb keine Wahl, ich gab telefonisch meine Entschuldigung für verspätetes Erscheinen ins Sekretariat der Firma durch und wartete dann in der Küche auf das Abziehen des Kriminalteams. Dabei musste ich sehr die Zähne zusammenbeißen, hörte ich doch, wie diese Leute wirklich bis in jede hinterste Ecke meiner Wohnung schauten. Aus dem Flur klangen Geräusche herüber, die mir zeigten, dass sie selbst all meine Schlüssel aus der Schublade des Garderobenschranks ausprobierten, dazu passende Schlösser in den Türen suchten. Schließlich wurde ich nach weiteren Schlüsseln gefragt, die ich möglicherweise bei mir trüge. Und ich sollte Auskunft zu einem Schlüsselbund geben, für das hier nirgendwo Schlösser zu finden waren. Dieses Bund mit einem Anhänger, der die Initialen L und M zeigte, war mir nie vorher zu Gesicht gekommen.
'Hatte Hagen es liegenlassen, absichtlich?', schoss es mir durch den Kopf.
Ich äußerte gegenüber dem Ermittler, dass es mir nicht bekannt sei, und dass ich auch nicht sagen könne, wie es hierher gelangt sei.
Das waren klare Minuspunkte gegen mich. Der Ermittler steckte es in eine Asservaten-Tüte und nahm es mit.
Als ich endlich wieder alleine war, brodelte es in mir. Ein vollkommen aus der Luft gegriffener Verdacht wurde hier konstruiert, und ich wusste mich nicht dagegen zur Wehr zu setzen. Ja, ich begann, gegen mich selbst zu ermitteln. Konnte ich beweisen, dass ich unmöglich am Ort des vermeintlichen Verbrechens, also Hagens Zuhause, gewesen sein konnte?
Um welchen Zeitraum handelte es sich, für den ich Zeugen brauchen würde?
Ich hatte mich gestern schon mittags beim Kunden verabschiedet, war mit meinen Aufgaben schneller fertig geworden und wollte die Zeit für einen Besuch in einem großen Einkaufszentrum nutzen. Bis zu dem Treffen mit den Freunden am Abend hatte ich zu niemandem Kontakt gehabt, der sich an mich würde erinnern können.
Es beunruhigte mich so sehr, dass ich daran dachte, einen der Freunde anzurufen, der nach meinem Wissen Jura studiert hatte, und der mir vielleicht sagen konnte, wie ich mich verhalten sollte. Ich verwarf die Idee wieder – es konnte mich nur noch verdächtiger machen.
Nach dem Aufräumen zuhause fuhr ich ins Büro – eigentlich hätte ich wieder beim Kunden sein sollen. Wegen der Auflagen durch die Polizei gab es keine Wahl. Zum Glück konnte ich meine Aufgaben über das Netzwerk vom Büro aus erledigen. Durch den Zeitverlust am Morgen wurde es spät an diesem Freitag.
Um acht Uhr abends wollte ich spätestens den Heimweg antreten. Über die vielen Dinge, die bei der Arbeit zu erledigen waren, hatte ich mein unangenehmstes Problem fast vergessen. Es war Viertel vor acht, als mein privates Mobiltelefon klingelte – eine Rufnummer wurde angezeigt, also handelte es sich nicht um jemanden aus meinen Kontakten.
„Kantonspolizei, Egkbarn. – Herr Ginslow, wir müssen sie noch einmal zu Herrn Fried befragen. In ihrer Wohnung haben wir Schlüssel gefunden, die zu Frieds Haus gehören. Hat er sich bei ihnen gemeldet wegen seines Schlüsselbunds?“
„Nein, ich habe nichts von Hagen Fried gehört oder gesehen, seit er bei mir vorgestern Nacht auf dem Sofa geschlafen hat. Er muss seine Schlüssel bei mir vergessen haben“, erklärte ich.
„Herr Ginslow, wie erklären sie sich, dass wir keine Hinweise gefunden haben, dass sich Herr Fried überhaupt in ihrer Wohnung aufgehalten hat?“
„Das habe ich mir doch nicht eingebildet! Ich kann es nicht erklären“, antwortete ich kleinlaut.
„Wo sind sie jetzt? Ich würde das gerne persönlich mit ihnen durchgehen“, äußerte Egkbarn und ließ dabei seine Stimme in warmem, freundschaftlichen Ton erklingen.
„Sie finden mich noch im Büro meiner Firma.“ – Ich gab ihm die Adresse durch.
„Dann sehen wir uns gleich“, verabschiedete sich Egkbarn und legte auf.
Wieder hatte ich etwas verschwiegen: Das Firmengebäude musste bis zwanzig Uhr verlassen werden, weil die Alarmanlage zu dieser Stunde automatisch scharf geschaltet wurde. Wer dann fahrlässig den Alarm auslöste, hatte die Kosten für das Anrücken des Sicherheitsdienstes zu zahlen.
Ich beeilte mich, dies zu vermeiden und durch den Tiefgaragenausgang rechtzeitig aus dem Haus zu kommen. Egkbarn würde vergeblich am Haupteingang auf mich warten. Auf dem Weg zum Auto war ich noch unsicher, ob ich um den Komplex herumfahren sollte, um ihn dort zu treffen. Als ich dann im Wagen saß, siegte der Fluchtinstinkt. So konnte ich mich nicht zur Strecke bringen lassen. Das Risiko war zu groß, dass es kein Entkommen aus den Fängen des Staatsapparats gab. Also verließ ich den Firmensitz auf der rückwärtigen Seite und folgte der direkten Route zu meiner Wohnung. Den Wagen parkte ich auf der Straße in einiger Entfernung vom Haus und lief das letzte Stück zu Fuß.
Hier war alles ruhig, verdächtige Zivilfahrzeuge der Polizei waren nicht auszumachen. Eilig wurden in der Wohnung die wichtigsten Dinge für eine längere Abwesenheit, Ausweise, Kreditkarten, Laptop, Kleidung, Schuhe, notwendige Utensilien, in einer Sporttasche verpackt, Strom und Wasser abgestellt, und schon war ich wieder draußen am Auto.
Um zu verhindern, dass sie mich schnell aufspürten, fuhr ich hinauf zum Weissenstein und stellte das Auto auf einem Wanderparkplatz ab. Dann bestellte ich mir ein Taxi, mit dem ich mich zum Bahnhof bringen ließ.
Es gab noch einen Zug zur Stadt an der Grenze. Zum nahegelegenen deutschen Bahnhof führte eine Straßenbahnlinie. Die Grenzkontrolle im Bahnhofsgebäude war nicht besetzt, also verließ ich mein Land unerkannt.
An diesem lauen Sommerabend erschien mir die Bahnhofsumgebung gar nicht so abweisend. Ich kaufte ein Ticket für einen Nachtzug nach Hamburg. Der Zug kam aus Italien und hatte Verspätung. Für nahezu zwei Stunden musste ich Geduld aufbringen. Auf dem Bahnsteig blieb es still, fast menschenleer, niemand, der nach mir suchte.
Der Nachtzug war recht leer, ich nahm einen Schlafsessel in einem Großraumwagen und war auf halbe Waggon-Länge ganz für mich. An Schlaf war nicht zu denken, die Umstände beschäftigten mich allzu sehr, obwohl ich eigentlich todmüde war. Unterwegs wurde das Bedürfnis immer stärker, aus dem Zug wieder heraus zu kommen. Ich malte mir in meiner Schläfrigkeit aus, wie sie herausfanden, dass ich den Zug nach Hamburg genommen hatte, und folglich ihre Fahndung auf die Elbmetropole ausdehnten. Es wäre geschickt, den Zug vorher zu verlassen – nächster Halt war Heidelberg. Es erschien mir als Lösung, um sowohl meine Spur zu verwischen wie auch zu einer wirklichen Nachtruhe zu kommen. In der Nähe des Halts – in einem Nachbarort – kannte ich ein angenehmes, modernes Gästehaus. Dort würde ich zunächst einen Unterschlupf finden.
Noch aus dem Zug erreichte ich telefonisch den Spätdienst am Empfang des Gästehauses, eine bekannte Stimme, ein bekannter Name von mehreren früheren beruflich bedingten Aufenthalten. Selbst zu nächtlicher Stunde würde ein Einchecken mittels des Kreditkartenautomaten und der Ausgabe der Zugangskarte für Haus und Gästezimmer möglich sein, wurde mir zugesichert.
So fand ich es bestätigt, als ich mit einem Taxi gegen drei Uhr in der Nacht dort eintraf. Wie froh war ich, damit zunächst ein sicheres Refugium zu besitzen!
2
Am folgenden Tag begann ich damit, zu diesem „Kriminalfall“, den es ja offensichtlich gab, und in den ich auf diese absurde Weise verstrickt war, an Informationen zu gelangen. Es sollte doch wohl Pressemitteilungen der Polizei gegeben haben, dachte ich. Dieser Ansatz erwies sich als völlig unergiebig. Es blieb kein Ausweg, als es telefonisch zu versuchen. So nahm ich mir vor, es bei den Nachbarn an Hagens Wohnort zu probieren. Allerdings kannte ich die Adresse nicht – ein Telefonat mit dem Tontaubenschützenverein half weiter. Mühsam kämpfte ich mich durch viele vergebliche Anläufe. Zuviel Zeit durfte nicht verstreichen, denn irgendwann würden die Ermittlung zu meiner Entdeckung in diesem Städtchen am Neckar führen.
Erst am Morgen des zweiten Tages in meinem Versteck stellte sich das große Glück am Telefon ein in Person einer geschwätzigen Frau, die in einer Wohnung auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit direktem Blick auf das Haus des Ehepaars Fried lebte. Hätte ich sie am Ende nicht höflich darauf aufmerksam gemacht, dass meinem Telefon der Batteriestrom ausging, sie würde mir die Geschichten aus ihrem Wohnquartier und den Menschen darin bis zurück in die Zeit von Wilhelm Tell erzählen und hätte bis heute damit nicht abgeschlossen.
Während des fast einstündigen Gesprächs hatte ich mir einige Notizen gemacht, im Nachhinein eine wertvolle Idee. Mir brummte der Schädel. Diese Frau hatte unablässig geredet, ein wahrer Wasserfall von Beobachtungen, Mutmaßungen, Gerüchten, Verleumdungen war durch das Telefon auf mich niedergegangen. Außer zu Beginn, als ich mein erfundenes Anliegen erklärt hatte, war ich nicht mehr zu Wort gekommen. Aus dem Aufgeschriebenen und der Flut der angehörten Geschichten versuchte ich nun die bedeutsamen Zusammenhänge herauszufiltern.
Zum einen war dies der Hergang am Vortag des Feiertags. Demnach hatte Hagens Ehefrau wohl am Morgen mit Reisegepäck und mittels eines Taxis das Zuhause verlassen. Die Frau von gegenüber hatte allerdings berichtet, dass sie am Nachmittag in Begleitung eines älteren Herrn zurückgekehrt war. Die Nachbarin wunderte sich, dass Frau Fried anders gekleidet war als am Morgen. Während sie zuerst Sommermode trug, die zu einer Urlaubsreise passte, trat sie später dann eher in dezentem Chic auf. Die Beobachterin hielt dies für erwähnenswert – Frauen achten auf so etwas.
Im weiteren Verlauf hatte Frau Fried das Haus alleine wieder verlassen, musste sich im Weggehen aber noch einmal vergewissern, ob sie die Haustür verschlossen hatte.
Sodann vergingen wohl zwei Stunden, bis Frau Frieds Freundin – wegen häufiger Besuche nahm die Nachbarin an, dass es sich um eine Freundin handelte – am Haus gegenüber erschien und hineinging. Wenige Minuten später fuhren dann ein Polizeiauto und ein Rettungswagen vor, danach noch zwei, drei andere Autos mit einigen Personen, die eilig im Haus verschwanden. Später wurde dann ein Blechsarg zum Rettungswagen hinausgetragen, und kurz darauf rückten alle Fahrzeuge wieder ab. Die Nachbarin hatte natürlich so manche Kommentare parat, die sich aus ihren subjektiven Eindrücken speisten. So meinte sie, das Verhältnis der Eheleute Fried sei sehr abgekühlt in den drei Jahren seit ihrem Einzug. Diese blonde Freundin sei anfangs sehr oft drüben gewesen, fast täglich, betonte sie. Im letzten Jahr seien die Besuche der Freundin selten geworden, sie sei nur noch alle paar Wochen vorbeigekommen und nie lange geblieben. Herr Fried dagegen sei ein sehr disziplinierter Mensch, sehr fleißig vor allem. Nach seinem Kommen und Gehen könne man die Uhr stellen, er müsse wohl viel arbeiten und tue dies ausgiebig und zuverlässig. Warum sich ein so gutsituiertes, attraktives Paar wie die Frieds keine Kinder anschafften, könne sie nicht verstehen, das sei doch der Kitt, der die Ehe zusammenhalte. So, wie sich die Frieds seit Monaten verhielten, mache sie sich Sorgen um den Fortbestand der Ehe. Es sei so schade – so ein hübsches Paar. Die Frau mischte mit Vorliebe mit in der nachbarschaftlichen Gerüchteküche.
Indem alles, was nun vom Hörensagen unter Vorbehalten bekannt zu sein schien, noch ein weiteres Mal vor meinem geistigen Auge Revue passierte, wurden mir zwei wesentliche Dinge klar. Zum einen machte es keinen Sinn, selbst nach Hagen Fried zu suchen. Wenn die Ermittlungsbehörden schon nicht in der Lage waren, ihn aufzuspüren, würde es mir doch wohl kaum besser gelingen.
Seine Ehefrau hingegen erschien mir als der Schlüssel zur Aufklärung der ganzen Angelegenheit. Sie war beteiligt gewesen und konnte, ja musste Einzelheiten kennen. Am entscheidenden Tag warfen die Informationen über Frau Fried allerdings Fragen auf – es gab Widersprüche, und die hielt ich für ebenso verdächtig wie das angebliche Verbrechen für rätselhaft. War das Verreisen von Frau Fried nur ein Ablenkungsmanöver gewesen?
Fortan konzentrierte ich mich darauf zu erfahren, ob sie tatsächlich die Absicht verfolgt hatte, das Land zu verlassen. Wenn ich herausfinden könnte, ob sie etwas abbestellt hat, dachte ich mir, dann wäre dies ein Hinweis. So nahm ich mir die Bäckereien in der Nähe ihrer Wohnadresse vor … und landete bei der als Zweite Angerufenen einen Glückstreffer. Die redselige Verkäuferin am Apparat sagte:
„In den nächsten Wochen brauchen sie nicht zu versuchen, Frau Fried zu erreichen. Sie macht wieder Wellness auf Sri Lanka, wie schon im letzten Jahr.“
Daraus ließ sich doch bestimmt etwas kombinieren, zum Beispiel Wellness und Sri Lanka zu Ayurveda. Gut, das war wohl trivial. Jedoch der Gedanke an Frauen im zweiten Lebensdrittel, die sich alleine auf den Weg nach Sri Lanka machen, legt nahe, dass sie genau davon, dieser Exotik und dem Gefühl der eigenen Selbständigkeit und Unabhängigkeit, auch dem eigenen Körperbewusstsein, so begeistert und fasziniert sind, dass sie dies nicht mit sich selbst im stillen Kämmerlein abhandeln. Ein paar Suchanläufe in den sozialen Netzwerken brauchte es schon, doch dann hatte ich Lisa Fried aufgespürt. Sie war es, alles passte zusammen. Es gab viele Details, Bilder aus dem Ayurveda-Zentrum von ihr alleine und in Gesellschaft, Ortsnamen, Datumsangaben, Namen von Personen aus dem Zentrum und solchen aus Lisas „Netzwerk“ von Bekannten, et cetera, natürlich ebenso Daten ihrer Reisepläne aus diesem Jahr. Ihr Aufenthalt würde nun achtundzwanzig Tage dauern – eine lange Zeit, um auf ihre Rückkehr zu warten, zumal davon ja erst wenig verstrichen war.
In meine Unschlüssigkeit spielten weitere Aspekte hinein. Bisher gab es keinen Beleg, dass Lisa Fried in Sri Lanka eingetroffen war. Außerdem: Was hatte sie am späten Nachmittag des Tages des vermeintlichen Verbrechens an ihrem Haus getan, obwohl ihr Flug ab Zürich bereits am frühen Nachmittag desselben Tages stattfand?
Ich nahm mir vor, einen weiteren Tag abzuwarten. Sollte eine Meldung von ihr in den sozialen Netzwerken auftauchen, der ihre tatsächliche Anwesenheit in Sri Lanka bewies, würde ich versuchen, ihr nachzureisen.
Das erwartete Lebenszeichen von ihr tauchte sogar schon am Abend dieses Tages auf. Auch wenn es mir absurd vorkam, verspürte ich eine gewisse Freude, meine eigenen Reisevorbereitungen in die Hand zu nehmen. Ein Gedanke ging mir allerdings nicht aus dem Kopf: Wer war die angebliche Frau Fried vom späteren Nachmittag am Tag der Tat gewesen, die in Begleitung des älteren Herrn von der Nachbarin gesehen worden war?
„Jetzt nur keinen Fehler machen!“, lautete mein nächster Gedanke. Die Vorbereitungen auf den Trip nach Sri Lanka mussten gewissenhaft und in aller Stille erfolgen. Bestimmt war ich europaweit zur Fahndung ausgeschrieben, das machte das Buchen von Flügen riskant. Es kostete einen vollen Tag, um gedanklich auf eine vage Möglichkeit zu stoßen, wie ich unentdeckt ins ferne Ausland gelangen konnte.
Während meiner Studienzeit in den USA gehörte James Coleman zu meinem engen Freundeskreis. James war Militärpilot gewesen, hatte jedoch wegen Vaterschaft und Heirat ins Zivilleben zurück gewollt. An seinen Zielen im Engineering an der Universität drohte er allerdings zu verzweifeln – das Tüfteln und Forschen lag ihm einfach nicht, und außerdem vermisste er die Aussicht auf ein gehobenes Einkommen.