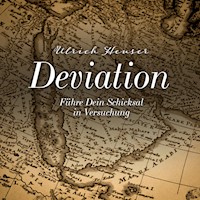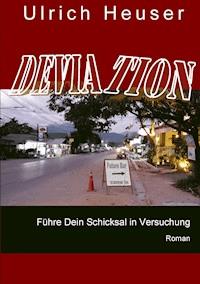
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Führen auch Sie ein Leben im labilen Gleichgewicht? Living on the edge? Auf Messers Schneide? Glückwunsch, wenn Sie das schon lange durchhalten. Aber hüten Sie sich vor der einen kleinen und doch entscheidenden Abweichung auf Ihrem Weg durch die Tage und Jahre. Von der Sie dann erwartenden Zukunft machen Sie sich in Ihren kühnsten Träumen kein Bild. Begleiten Sie Lennard – er könnte Ihr Nachbar sein. Ihm ist genau dies widerfahren. Ein erstes Mal anders reagiert, schon befindet er sich in einem fremden Universum. Er gelangt hinter die Bühne des großen Welttheaters. Lennard unternimmt für eine fixe Idee einen Trip um den halben Globus und bemerkt schließlich, dass es eine Reise in sein Innerstes und zu den Anfängen des Menschseins ist. Seine Lebensumstände veranlassen Lennard, mit hohen Erwartungen an das Preisrätsel einer Zeitung heranzugehen. Er hält die Situation, in der er davon erfährt, für schicksalhaft, steigert sich in das Erlebnis hinein und deutet viele Fakten als Zeichen der Vorsehung. Dem seiner Ansicht nach vorgezeichneten Weg folgt er mit großer Ergebenheit. Jeder kleine Hinweis wird von Lennard interpretiert. So gelangt er nach Thailand, von dort unter schweren Komplikationen nach Pakistan und schließlich in den Jemen. All seine Stationen und Begegnungen mit Menschen sieht er als Teil des Spiels an. Lennard verliert mehr und mehr die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen der Realität und der Welt seiner Träume und Wünsche. In einer antiken Fundstätte im jemenitischen Bergland begegnet er den Schlüsselfiguren seiner Odyssee wieder. Die unwirkliche Szene kann selbst er nicht für wahr halten. Die Hoffnung auf den Lohn für seinen extremen Einsatz zerplatzt, außer einem Zugewinn an Einsichten in die Menschheitsgeschichte bleibt Lennard nichts von den Versprechungen des Preisrätsels. Nach seiner Heimkehr jedoch erreicht ihn eine Nachricht, die wiederum die ernüchternden Erkenntnisse auf den Kopf stellt. Etwas Wahres muss doch den fantastischen Phänomenen anhaften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
1
2
3
4
5
6
7
8
EPILOG
PERSONEN UND ROLLEN
Dedicated to J.C.,
who is steady source of inspiration and teacher of fiercest observation to me, an authority of social awareness, and my favorite tutor in the exploration of human nature.
Gewidmet J.C.,
der beständige Quelle von Inspiration und Lehrer schärfster Beobachtung für mich ist, eine Autorität sozialen Bewusstseins und mein bevorzugter Lehrmeister bei der Erforschung der menschlichen Natur.
1
Es handelte sich um einen dieser Novembertage, den man am besten mit einer heißen Tasse Tee und einem guten Buch hinter dem Ofen verbringt.
Lennard blieb jedoch nichts anderes übrig, als diesen Gedanken abzuschütteln und sich auf den Weg zur Arbeit zu machen. Wie er es hasste, früh am Morgen im Dunkeln das Haus zu verlassen! Mit den Jahren hatte sich zwar ein selbstverständlicher, ja motorischer Ablauf eingestellt – nahezu alles wiederholte sich jeden Morgen zu beinahe gleicher Minute. Sein innerer Widerstand – ein Gefühl wie auch ein Gedanke, diesen Trott nicht länger zu erdulden –, diese Ablehnung war von der Macht der Gewohnheit nicht mehr zu verdrängen. Lennard nahm sich auf dem Weg in die Tiefgarage vor, einen Plan zu schmieden, einen Ausbruchsplan, wie ihn sich ein Häftling zurechtlegt. Das kalte Neonlicht des Parkdecks flutete sein Gehirn, und es war so auslöschend wie das Öffnen einer Filmpatrone bei Tageslicht. Die wenigen Minuten bis zum Einsteigen ins Auto reichten nicht einmal aus, den ersten Schritt in seinem Plan zu entwerfen. Er startete den Motor und begann seine alltägliche Fahrt. Hinter dem Rolltor der Tiefgarage tauchte er in die Dunkelheit ein, das Sichtbare in den Lichtkegeln der Scheinwerfer lenkte ihn weniger ab. In seinem Kopf machte sich wieder dieser Wunsch nach Weglaufen breit, und Lennard wollte sofort Ordnung und Reihenfolge in die Versatzstücke seiner vagen Vorstellungen vom Beenden dieses Lebens und dem Start in ein neues Leben bringen. Der Straßenrand schluckte das Licht, nasse Autos mit beschlagenen Scheiben parkten auf beiden Seiten, von den Bäumen in den Vorgärten fiel braunes Herbstlaub durch den erhellten Raum vor dem Wagen. Im Wohnviertel war es still, vereinzelte Schatten von Personen auf den Gehwegen nahm er aus den Augenwinkeln wahr. Sein Denken kreiste um dieses eine Thema. Es stellten sich schon Zweifel ein, kaum dass sein Planen begonnen hatte. Konnte es einen minutiösen Ablauf für das Ausbrechen geben? Der Versuch eines geordneten Rückzugs musste doch scheitern!
Lennard gingen diese Gerüchte durch den Kopf, dass – häufiger als man denkt – Menschen verschwinden, plötzlich wie vom Erdboden verschluckt sind. Und Gerüchte, dass solche Personen wieder auftauchen oder es sich um natürliche Todesfälle handelt, waren ihm nie zu Ohren gekommen. Nun war er also auch so ein Kandidat. Wie hatten es die anderen wohl angestellt, hatten sie etwas vorbereitet? Er konnte doch nicht so viel ungeregelt zurücklassen. Andererseits würde alles Nötige auch gelöst werden müssen, wenn er im nächsten Augenblick tot wäre. Jedoch konnte er die Menschen, die er liebte, seine Kinder und seine Frau, auch wenn er sie kaum noch sah, nicht auf diese Weise im Stich lassen. So weiterleben konnte er aber erst recht nicht. Diese miserable Stimmung in der Firma, die Unverschämtheiten des Chefs, die Streitereien mit den Handlangern dieses Chefs, die Einsamkeit zuhause, nachdem seine Ehefrau eine eigene, erfolgreiche und schillernde Karriere begonnen hatte, möglich wiederum durch den Auszug der erwachsenen Kinder, all die wirtschaftlichen Verpflichtungen, die das Mitschwimmen in der Konsumgesellschaft nach sich gezogen hatte: Diese unwürdigen Aspekte wollte Lennard aus seinem Leben verbannen. Noch blieb Zeit, es war an ihm zu handeln. Mit Mitte fünfzig sollte ein Neubeginn noch möglich sein.
Ein Radfahrer bog aus einer Seitenstraße auf seine Spur ein, ohne sich umzuschauen, und Lennard musste heftig abbremsen. Im nächsten Moment querte der in dicke Winterkleidung Vermummte mit seinem Rad beide Fahrbahnen und verschwand im schwarzen Loch einer Einfahrt. Die Schrecksekunde war vorüber, und die Gedanken von vorher kehrten zurück. Es ging jetzt auf der Durchgangsstraße dieses Vororts weiter, andere Autos fuhren voraus oder blendeten Lennard durch den Innenspiegel mit dem grellen Licht ihrer Scheinwerfer. Straßenlaternen erhellten im Takt das Fahrzeuginnere. Lennards Konzentration auf seine Pläne litt unter den äußeren Einflüssen. Er mochte diese Störung nicht.
Von der großen Straße, die den Verkehr aus den Vororten in die Metropole sammelte, bog er ab. Es gab einen Schleichweg, der manchmal half, den lästigen Stau zu umfahren. Jetzt brachte er keinen Gewinn, im Gegenteil: die Strecke war länger, im Dunkeln bestand das Risiko von Wildwechsel zwischen den Waldstücken und den landwirtschaftlichen Flächen, und die Bauern hatten die Fahrbahn witterungsbedingt sicher sehr verschmutzt. Lennard würde später als beabsichtigt in der Firma ankommen, aber er war auf diesem Weg alleine und unbelästigt und zurück bei seinen Plänen vom Neubeginn. Im Grunde war der Zeitpunkt ideal, er konnte ungestört Vorbereitungen treffen. Christina, seine Ehefrau, befand sich für weitere zwei Wochen auf einer Vortragsreise in den Vereinigten Staaten – sie meldete sich nur alle drei, vier Tage kurz per Telefon, und von Tochter Anne und Sohn Lasse hatte er seit einem Monat nichts gehört.
Sein Schleichweg führte ihn schließlich in die Außenbezirke der Großstadt auf einer Straße, die als nachrangiger Verkehrsweg auf eine große Kreuzung mündete. Die Hauptverkehrsadern, auch die heute von Lennard Gemiedene, bekamen an den Ampeln öfter und länger grünes Licht. Es würde ihn aus dieser Richtung fünf, sechs Ampelphasen kosten, bis er den Verkehrsknoten passiert hatte. Inzwischen war die Morgendämmerung so weit fortgeschritten, dass die Umgebung schemenhaft zu erkennen war. Die Kreuzung befand sich auf einem Platz, der von Grünanlagen gesäumt war. Die Hausfassaden lagen etwas zurück, hier und da leuchtete ein Reklameschild, oder Läden machten mit erhellten Schaufenstern auf sich aufmerksam. Ein Trupp Zeitungsverkäufer sprang zwischen den bei Rot wartenden Autos herum. Lennard hatte Zeit, diese Leute zu beobachten. Er kannte das Spiel natürlich. Die Zeitungsverkäufer konnten das Wechselgeld oft behalten, denn ihre Kunden mussten bei Grün losfahren, auch ohne ihr Rückgeld. Selten war ein Fahrer im Vorteil und hatte seine Tageszeitung umsonst, weil er das Geld noch nicht durch das Seitenfenster gereicht hatte, ihm die Zeitung aber schon ausgehändigt worden war. Lennard hatte noch nie solch einem fliegenden Verkäufer eine Zeitung abgekauft. Irgendwie kam es ihm doch fair vor, denn diese Straßenverkäufer lebten gefährlich, und den Autofahrern wurde die Zeitung bequem in den warmen Wagen serviert.
Es klopfte neben Lennards Kopf an der Scheibe. Er erschrak und blickte dorthin. Eine Person hielt ein Zeitungsexemplar hin: »Tor zum Leben« prangte in großen Lettern auf dem Titelblatt. Lennard kannte diese Tageszeitung nicht. Instinktiv kurbelte er trotzdem die Scheibe herunter – es war gerade erst wieder Rot geworden.
„Guten Morgen!“, hörte er eine junge, weibliche Stimme sagen. „Fünf Kronen für das »Tor zum Leben«!“
Lennard schaute in ein Paar sprechende Augen. Ein warmer, gütiger aber auch geheimnisvoller Blick traf ihn. Zu den Augen gab es kein Gesicht, durch eine Wollmütze und einen bis über die Nase hochgezogenen Schal blieb nur ein Schlitz mit den Augen und den Brauen frei. Diese Augen besaßen ein Funkeln, wie es Lennard noch nie zuvor gesehen hatte. Auf alles andere achtete er kaum. Es lag auch daran, dass diese Person in dunkle Winterkleidung eingepackt war, was der Erscheinung etwas Undefinierbares verlieh.
„Moment, ich nehme sie“, antwortete Lennard und beeilte sich, aus seinem Geldbeutel den geforderten Betrag herauszuholen. Er konnte nur einen Zehnkronenschein hinausreichen, anders hatte er es nicht parat. Eine kleine Hand mit recht dunkler Hautfarbe nahm den Geldschein entgegen, während gleichzeitig die Zeitung durch das Seitenfenster geschoben wurde. Lennard war so sehr damit beschäftigt, die Zeitung entgegenzunehmen und vor sich her auf den Beifahrersitz zu manövrieren, dass er auf nichts anderes achtete. Als er den Kopf wieder zum geöffneten Seitenfenster wandte, war die Verkäuferin verschwunden – Rückgeld bekam er nicht, obwohl er ab diesem Moment bei weniger als zehn Autolängen Fortschritt weitere zwei Rotphasen abwarten musste. Er empfand aber keinerlei Ärger und wunderte sich über sich selbst.
Sein Arbeitstag verlief unerfreulich. Trotzdem fühlte Lennard am Abend nicht die übliche Niedergeschlagenheit. Die Zeitung hatte er am Morgen unabsichtlich im Auto liegen lassen. Abends war er dann ganz gespannt darauf, dieses Blatt durchzuschauen. Daheim eingetroffen legte er sich die Zeitung wie eine Belohnung für sein Tageswerk zurück und erledigte zunächst die nötigen Hausarbeiten. Das »Tor zum Leben« sollte der Höhepunkt des Abends, ja des ganzen Tages werden.
Zwischendurch klingelte das Telefon. Christina rief unerwartet an. Dabei gab es von ihrer Seite keinen erkennbaren, besonderen Anlass. Das Telefongespräch verlief in herzlicher, ja intimer Atmosphäre und gar nicht zäh und langweilig wie oft zuvor.
„Was ist nur mit dir los?“, scherzte Christina, „So gut gelaunt kenne ich dich ja gar nicht. Da freue ich mich richtig, bald zu dir heimzukommen!“
Lennard kannte sich ja selbst nicht mehr, und alles nur, weil er etwas Ungeheuerliches getan hatte: durch das Autofenster eine Zeitung zu kaufen. Gut, da gab es noch diese Verkäuferin und ihr Augenpaar, das ihm nicht aus dem Sinn ging.
Schließlich begann er mit dem aufgesparten, angenehmen Teil seines Feierabends. Bewusst ließ Lennard den Fernsehapparat, diesen besten Freund der Einsamen, ausgeschaltet, sorgte für eine wohltuende, gedämpfte Musik und machte gemütliche Beleuchtung an. Dann nahm er sich das Zeitungsexemplar vor.
Zu seiner Verwunderung unterschied es sich gar nicht von den ihm bekannten hiesigen Blättern, es hätte genauso wie die ihm geläufigen Zeitungen »Stadtbote« oder »Abendpost« heißen können. Bis auf das Fehlen eines Lokalteils gab es keinen Unterschied, wirklich gar keinen.
Dreimal blätterte Lennard sämtliche Seiten durch, von vorne nach hinten und wieder zurück und noch einmal vor. Nichts! Lennard wusste zwar nicht, wonach er suchte, aber er war sich sicher, dass er es gefunden hätte, wenn es nur da gewesen wäre. Am Ende ließ er die Zeitung unordentlich zusammengelegt auf dem Tisch liegen, stellte die Musik ab und schaltete das Fernsehgerät ein. Als er wieder zur Couch zurückkehrte und sein Blick die auf dem Tisch liegende Zeitung streifte, erregte eine kleine Werbeanzeige seine Aufmerksamkeit. Zuvor hatte er sie nicht beachtet – sie befand sich als kleiner Einschub mitten in einer Spalte mit redaktionellem Inhalt.
Er las den kleingedruckten Text:
»Das Tor zum Leben« – wir stoßen es für Sie auf! Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und gewinnen Sie Ihren persönlichen Neuanfang. Starten Sie in eine spannende Zukunft! Ihre Teilnahmeunterlagen finden Sie in einer der nächsten Ausgaben. Weitere Infos unter Telefon …
Lennard überflog den kurzen Text mehrmals. Er schloss die Augen und dachte angestrengt darüber nach. Das Versprechen dieser Werbeanzeige bestand genau in der Sache, die er für sich suchte. In dieser Kampagne des Verlags konnte er gewinnen, was er sich gerade so sehr wünschte: einen Neubeginn. Er musste also gar nichts mehr selbst planen und vorbereiten, nur noch gewinnen. Das war alles.
Lennard schlief unruhig in dieser Nacht. Seine Gedanken kreisten um dieses Gewinnspiel – und um das Augenpaar. Er malte sich aus, wie die Frau wohl sein würde, zu der diese Augen und die zierliche, braune Hand gehörten. Dann wieder untersuchte er die Logik dieses Preisausschreibens. Der Gewinn bestand sicher im Wesentlichen aus einer Art Rente, die bei durchschnittlichem Lebensstandard eine wirtschaftliche Unabhängigkeit garantierte. Vermutlich nicht weniger als das, aber auch nicht mehr. Wie sollte er mit diesen Illusionen umgehen? Lennard entschied für sich, etwas würde passieren, das ihn freimachte, all dasjenige zu tun, von dem er träumte. Darüber schlief er letztendlich doch fest ein.
Der nächste Morgen verlief vollkommen im alten Trott, nur Lennards Stimmung war einfach besser. Eine Vorfreude hatte von ihm Besitz ergriffen, er sah einem Wiedersehen mit der Zeitungsfrau entgegen und war gespannt auf das Gewinnspiel des Verlags. Die äußeren Bedingungen hatten sich nahezu gar nicht verändert. Es war gleich dunkel, kalt und ungemütlich, ein feiner Sprühregen ging hernieder, und die Scheibenwischer seines Autos stotterten immer wieder über die Frontscheibe. Selbstverständlich folgte Lennard dem Schleichweg. Wieder musste er sich an der langen Schlange der Wagen hinten anstellen, als es auf die große Kreuzung zuging. Er sah eine Reihe von Zeitungsverkäufern zwischen den anhaltenden Autos herumspringen und ihre Blätter anbieten. An seinen Wagen trat keiner von ihnen heran. Lennards Herzschlag beschleunigte sich: Wo steckte sie nur? Warum kam sie nicht zu ihm? Es blieben höchstens noch zwei Rotphasen. Lennard kurbelte die Seitenscheibe herunter und versuchte, einen der Zeitungsverkäufer heranzuwinken. Endlich reagierte einer und sprang um die anderen Autos herum auf ihn zu.
„Für sie den »Stadtboten«?“, fragte der junge Mann und hielt Lennard die Zeitung hin.
„Nein! Haben sie nicht das »Tor zum Leben«?“, entgegnete Lennard in ärgerlichem Ton.
„Hab ich nicht“, lautete die lapidare Antwort, und schon war der Verkäufer wieder weg. Die Ampel schaltete auf Grün. Die Gelegenheit war vorüber, Lennard fühlte eine kalte Enttäuschung in sich aufsteigen. „Nur nicht die Hoffnung aufgeben!“, murmelte er vor sich hin.
„Kommst du mit zum Italiener?“, rief ihm halblaut ein Kollege zu, der schon im Mantel auf Lennards Ecke des Großraumbüros zu schritt.
„Nein, heute nicht. Ich hole mir zu Mittag etwas vom Kiosk – muss noch was erledigen“, antwortete ihm Lennard. Nach einigen Minuten war er alleine in seinem Bereich, irgendwo weit hinten verbrachten noch andere Mitarbeiter die Pause an ihren Plätzen. Lennard suchte die zentrale Telefonnummer der Redaktion von »Tor zum Leben« heraus. Dabei wurden ihm zwei Sachen klar: Er hatte sein Exemplar zuhause liegen lassen, und außerdem fand er heraus, dass diese Zeitung ein regionales Blatt war, welches in einer mittelgroßen Stadt an der Westküste, zweihundert Kilometer entfernt, hergestellt und verbreitet wurde. Er musste es lange klingeln lassen, bis jemand im Zeitungsverlag abhob.
„Ich möchte mich nach Einzelheiten zu ihrem Preisausschreiben erkundigen“, begann Lennard.
„Sie müssen entschuldigen, aber hier aus der Telefonzentrale kann ich ihnen solche Auskünfte nicht geben. Ich kann versuchen, sie mit der zuständigen Redaktion zu verbinden. Auf welcher Seite befand sich der Text zu diesem Preisausschreiben?“, entgegnete eine Telefonistin.
„Es war auf der Titelseite innerhalb eines Artikels als kleiner Kasten untergebracht“, erklärte Lennard. Die Stimme bat um etwas Geduld, und Lennard wurde auf die Wartemusik geschaltet. Es verstrichen mehrere Minuten.
Schließlich meldete sich eine andere weibliche Stimme: „Redaktionssekretariat, was kann ich für sie tun?“
Lennard nannte sein Anliegen noch einmal.
„Kann es sein, dass sie etwas verwechseln? Wir veranstalten momentan kein Gewinnspiel. Ich habe die Titelseite von gestern vor mir, und auf der gibt es den von ihnen beschriebenen Kasten mit dem Hinweis auf ein Preisausschreiben nicht“, erwiderte die Dame freundlich.
„Wirklich nicht? Leider habe ich die Zeitung gerade nicht zur Hand. Ich kann nicht ausschließen, dass ich mich getäuscht habe. Vielleicht war es nicht die gestrige Ausgabe“, sagte Lennard verunsichert.
„Melden sie sich doch noch einmal, wenn sie sicher sind, dass wir ihnen weiterhelfen können“, schlug die Dame vor.
Lennard bedankte sich, entschuldigte sich für die Störung und legte auf. Er dachte eine Weile nach. Konnte es sich um eine andere Zeitung gleichen Namens handeln? Es würde sich am Abend daheim aufklären lassen.
Es war spät, als er heimkam. Er hatte noch einkaufen müssen, und so befanden sich die meisten Leute in seinem Wohnviertel schon in ihren Häusern – er traf keine Person, die er kannte. Weder in der Tiefgarage noch im Lift oder im Flur begegnete ihm jemand. In ihrer Wohnung war alles ordentlich aufgeräumt und sauber gemacht – am Vormittag war die Haushälterin, die gute Seele, da gewesen. Lennard sortierte die Einkäufe in den Kühlschrank und zog sich bequeme Kleidung an, dann erst betrat er das Wohnzimmer. Als Erstes wollte er die Ausgabe von »Tor zum Leben« noch einmal genau anschauen, doch die Zeitung lag nicht mehr dort, wo er sie abgelegt hatte. Lennard schaute sich in allen Räumen um: Er fand sie nicht. Ein Blick in die Kiste mit dem Altpapier hinter der Küchentür bestätigte seine schlimme Ahnung. Die Kiste war leer. Die gute Seele hatte das Altpapier, offensichtlich einschließlich der Zeitung, mitgenommen und sicherlich in einen Recycling-Container geworfen. Eine tiefe Enttäuschung machte sich bei Lennard breit.
Der nächste Morgen wartete mit einer kleinen Überraschung auf. In der Nacht war etwas Schnee gefallen, gerade soviel, dass eine dünne Schicht den Boden bedeckte. Bei seinem ersten Blick aus dem Fenster empfand Lennard Freude darüber. Er mochte Schnee, Schnee spendete dieser dunklen Jahreszeit Helligkeit. Lennard schätzte zwar den Winter nicht sehr, aber weniger noch als ein Winter mit Schnee und Eis gefiel ihm ein trister, grau-brauner, dunkler und nasser Winter. Es war Donnerstag, und bis auf diesen Schnee erwartete Lennard nichts Außergewöhnliches von diesem normalen Arbeitstag. Die Helligkeit, die der weiße Puderzucker verursachte, ließ ihn forsch und gut gelaunt seine Fahrt beginnen. Auf den Fahrbahnen war der Zauber kaum liegen geblieben. Lennard sah nun in den Straßen seines Wohnorts mehr Leute als sonst – sie mussten die Schneeschicht von ihren draußen geparkten Autos fegen. Sonst schlüpften sie ja sofort in die Anonymität im Innern ihrer Wagen. Zu diesem Auto gehörte also der große, junge Mann mit dem Schnauzbart, und der rote Kleinwagen wurde also von einer schon ergrauten, korpulenten Frau gefahren. Lennards Gedanken weilten heute viel mehr in der Realität, und trotzdem entschied er sich, aus einer unerklärlichen Sentimentalität heraus, wieder die Nebenstrecke zu benutzen. Freiwillig und geduldig stellte er sich mit dem Auto wiederum an das Ende der Schlange vor der großen Kreuzung. Er beobachtete die fliegenden Zeitungsverkäufer, es waren weniger als sonst. Würde er seine Zeitungsverkäuferin hier wohl einmal wiedersehen? Er musste erneut um ein paar Autolängen vorrücken und unterbrach seine Gedanken. Als es dann plötzlich an seiner Seitenscheibe klopfte, erschrak er gehörig. Er kurbelte die Scheibe ein Stück herunter und blickte hinaus. Sie war es! Neben seiner Autotür stand wieder diese Frau. Heute konnte er sie besser erkennen durch das Mehr an Licht. Ihre Kopfvermummung zeigte sich unverändert – diese Augen, allein an den Augen, dem Blick hätte er sie wiedererkannt – diese Sterne von Augen schauten ihn auffordernd, anspornend an.
„Sie können mir gerne hier jeden Morgen eine Zeitung bringen“, sprach Lennard sie an. Er wollte etwas Ehrliches und Sinnvolles sagen. Auch sollte es liebenswürdig klingen.
Durch den über Mund und Nase gewickelten Wollschal hörte er sie antworten: „Es gibt keine Zeitung. Ich habe etwas anderes für sie.“
Sie hielt ihm ein großformatiges Kuvert hin.
„Ist von dem Gewinnspiel“, bemerkte sie leise und mit gesenkter Stimme.
Lennard griff nach dem Umschlag und nahm ihn durch das Fenster ins Auto. Einen Moment lang blickten sie sich stumm an. Dann drehte sie sich herum.
„Sehe ich sie wieder?“, rief Lennard durch das Autofenster.
Sie aber lief zu den nachfolgenden Autos und zwischen diesen hindurch. Kurz hatte Lennard sie noch im Außenspiegel wahrnehmen können, doch dann war sie verschwunden. Lennard musste einige Meter vorsetzen, bis die nächste Rotphase wieder alle zum Stehen brachte. Er betrachtete das Kuvert. Auf der Vorderseite war links unten in der Ecke die Adresse des Verlags »Tor zum Leben« aufgedruckt. Es gab keine Empfängeradresse. Die Klappe des Umschlags hatte der Versender zugeklebt. Lennard würde das Kuvert im Büro öffnen.
Der Tag verging, ohne dass Lennard Gelegenheit fand, sich den Inhalt des Kuverts anzuschauen – die Kollegen bestanden mittags darauf, dass er zum Lunch mitkam, und seine Arbeitszeit war zu ausgefüllt, als dass er lange genug mit dem Brief hätte allein sein können. Also blieb die Spannung bis zu Lennards Heimkehr am Abend erhalten. Er fand Lust daran, das Erforschen des Kuvertinhalts zu zelebrieren, so, als habe er eine Landkarte für eine Schatzsuche zu entrollen.
Zu seiner Überraschung enthielt der Briefumschlag nur ein einziges Blatt Papier, nein, um Schreibpapier handelte es sich gar nicht, es war vielmehr so etwas wie Pergament. Der Bogen besaß ein unübliches Format, Kanten, die nach Reißen statt Schneiden ausschauten, und eine leicht gelbliche Färbung. Nur auf einer Fläche war dieses Blatt beschriftet, dies in einer flüssigen, aber wenig eleganten Handschrift. Als Schreibwerkzeug hatte wohl ein Federhalter mit schwarzer Tinte gedient. Es handelte sich keinesfalls um einen Druck sondern um das Original einer Handschrift. Die Lettern wirkten sehr altmodisch, trotzdem konnte Lennard den Text ohne Mühe lesen. Der Inhalt war in englischer Sprache abgefasst und lautete:
Mein lieber junger Freund!
Ihre Nachricht hat mich mit einiger Verspätung erreicht. Die britische Marine sah wohl keinen Grund, Ihren Brief bevorzugt weiterzuleiten, sodass bis zum Eintreffen bei mir an der Siam-Küste vier Monate verstrichen sind. Wenn Sie aber immer noch in der Lage und willens sind, mir hier einen Besuch abzustatten, so heiße ich Sie im November oder Dezember willkommen. Mein Schiff liegt dann im Trockendock und bekommt seine dringende Überholung. Währenddessen kann ich mich endlich um mein gesammeltes völkerkundliches Material kümmern und lade Sie herzlich ein, mich bei der Sichtung, Einordnung, Katalogisierung und Dokumentation nach Kräften zu unterstützen. Wir werden sicher gemeinsam mit viel Freude daran arbeiten. Kommen Sie! Ich erwarte Sie schon bald nach meinem Eintreffen im Stützpunkt Anfang November.
Ihr E.B.
Lennard las den Brief ein zweites Mal. Er fragte sich, was dieses Schreiben mit einem Gewinnspiel zu tun hatte, welches einem den Start in ein neues Leben versprach. Schließlich trennte er das Kuvert auf, um zu schauen, ob sich auf der Innenseite weitere Hinweise zum Gewinnspiel befanden, jedoch ohne Ergebnis. Lennard war ratlos: Ein historischer Brief, der vielleicht aus einem Museum stammte, sollte ihm ein neues Leben ermöglichen? Worin lag der Sinn? Lennard löschte das Licht an seinem Sekretär, sodass der Wohnraum nur noch schwach von einer kleinen Lampe neben dem Sofa in der gegenüberliegenden Ecke beleuchtet wurde. Zum Nachdenken suchte er gerne die Dunkelheit. Gab es überhaupt Tatsachen in dieser Geschichte, oder hatte er sich am Ende alles nur eingebildet? Wenigstens zwei Dinge waren real: dieser Brief vor ihm auf der Schreibfläche und das Kuvert daneben. Die anderen damit in Zusammenhang stehenden Begebenheiten konnten sämtlich seiner Fantasie entsprungen sein. Nichts davon hätte sich beweisen lassen.
Jäh riss ihn das Klingeln des Telefons aus seinen Gedanken. Es war Christina, die ihm eine Nummer durchgab und zurückgerufen werden wollte.
„In einer Woche bin ich wieder zuhause“, sagte sie in freudigem Ton, „Treffe ich dich dann so aufgeräumt und gut gelaunt wie letztens an?“
„Natürlich. Ich sehne mich ja nach dir und freue mich auf deine Rückkehr“, antwortete Lennard durchaus aufrichtig.
Er konnte sich trotzdem eine Wiedervereinigung nicht recht vorstellen, wollte dies auch im Grunde nicht, denn er wusste ja, dass eine Harmonie von kurzer Dauer sein würde. Zu groß war der Gegensatz zwischen seiner auf der Erfolgswelle schwimmenden Ehefrau und dem eigenen, qualvollen, unwürdigen Kampf an seinem Arbeitsplatz.
„Ist zuhause alles in Ordnung? Hast du meine Post mal durchgesehen? Es sollte auch ein Brief von einem Zeitungsverlag dabei sein. Sie wollen mir originales Quellenmaterial zusenden. Ist das schon eingetroffen?“
Lennard musste schlucken – er hatte gar nicht selbst im Briefkasten nachgesehen, es seit Tagen völlig vergessen. In solchen Fällen konnten sie sich allerdings auf ihre gute Seele, die Haushälterin verlassen. Sie musste die im Briefkasten vorgefundene Post irgendwo in der Wohnung bereitgelegt haben.
„Warte, ich schaue einmal nach“, erwiderte Lennard und kontrollierte eilig die üblichen Stellen, an denen der Briefkasteninhalt zu sein pflegte. Obwohl er gar nichts vorfand, antwortete er: „Ist, glaube ich, dabei. Ich habe es noch nicht geöffnet.“
Lennard wurde es ganz heiß, sein Herz klopfte. War etwa das Kuvert des Verlags »Tor zum Leben« für Christina bestimmt gewesen? Als Archäologin forschte sie an Themen aus der vorderasiatischen Antike. Dazu passte der Brief aus dem Kuvert jedoch überhaupt nicht.
Lennard war froh, als das Telefongespräch endete. Dieser Brief musste einfach sein Strohhalm sein, nein, er war es, basta! Weitere Zweifel durfte er nicht aufkeimen lassen, kein Zögern oder Zaudern erlauben. Die Augen der Zeitungsverkäuferin blickten ihn an und sagten:
„Ergreife dein Schicksal, jetzt!“
Am Freitagmorgen begann für Lennard alles nahezu exakt wie an jedem anderen Arbeitstag. Der Schnee vom Vortag war bis auf kleine Reste wieder weggetaut, dafür hatten die Plusgrade gesorgt. Niederschlag hatte es nicht mehr gegeben, sodass die Straßen am Vorabend schon völlig abgetrocknet gewesen waren. Dafür war es über Nacht aber frostig geworden. Beim Blick aus dem Küchenfenster hinab auf die Straße vor dem Haus sah Lennard einige Nachbarn beim Freikratzen ihrer Autoscheiben. Er fühlte sich privilegiert, musste er sein Auto doch nicht von Reif und Eis befreien. Recht munter – er hatte gut geschlafen, und außerdem stand das Wochenende vor der Tür – trat er seinen Weg zur Arbeit an. Diesmal war es ihm nicht schwergefallen, bei Dunkelheit aufzustehen, in die dunklen Straßenzüge hinauszufahren, auf diesen Tunnelblick hinter den Autoscheinwerfern beschränkt zu sein. Wieder entschied er sich für den Schleichweg, ohne vernünftigen Grund, aber auch ohne Weisung der inneren Stimme, eines Gefühls, eines Instinkts, einer Vorahnung. Diesmal passierte es wie aus Zufall oder Unkonzentriertheit, nicht auf die andere Fahrspur gewechselt zu sein. So kam Lennard wieder an die große Kreuzung mit den fliegenden Zeitungsverkäufern und absolvierte eine Menge Ampelphasen in der Schlange der vielen Autos. Lennard kurbelte seine Seitenscheibe herab – schneidend kalte Luft drang in seinen Wagen. Angestrengt suchte er mit den Augen nach seiner Zeitungsverkäuferin. Heute waren es viele, die zwischen den wartenden Autos herumsprangen. Lennard blinkte nach links, scherte aus der Schlange aus und bog in eine Seitenstraße ein. Schnell fand er dort einen Parkplatz und ließ seinen Wagen stehen. Er hatte beschlossen, zu Fuß nach seiner Zeitungsverkäuferin zu schauen. So packte er sich mehrere der anderen Verkäufer und befragte sie zu der Gesuchten. Doch keiner hatte sie an diesem Tag schon gesehen, ja niemand war sich überhaupt sicher, sie zu kennen.
Lennard umrundete zweimal den Platz mit der großen Kreuzung und blieb bis zum Schluss erfolglos. Schließlich begann er, statt nach der Frau nach der Zeitung »Tor zum Leben« zu fragen. Keiner von den Zeitungsburschen kannte das Blatt, er erntete zigfach verständnisloses Schulterzucken. Die Dämmerung hatte längst eingesetzt, und der Platz gab immer mehr von der Hässlichkeit seiner Zweckbestimmung als Verkehrsknoten Preis. Lennard kehrte zu seinem Auto zurück. Die meisten der fliegenden Zeitungsverkäufer nahmen den abflauenden Verkehr zum Anlass, ihre Restbündel zu schnüren und den Ort zu verlassen. Lennard würde deutlich zu spät an seinen Arbeitsplatz kommen. Er wendete den Wagen und ordnete sich auf der Fahrbahn in Richtung stadtauswärts ein. Er hatte beschlossen, wieder heimzufahren. Mit einem Anruf würde er sich abmelden, würde behaupten, sich nicht wohlzufühlen, Migräne oder etwas Derartiges, und sich kurieren zu müssen. Alles Weitere fände sich dann von alleine, dafür bot das Wochenende ja genügend Spielraum.
Als Lennard seine Wohnungstür öffnete, strich ihm ein guter Kaffeeduft entgegen: Die Haushälterin war da.
„Nicht erschrecken, ich bin es!“, rief er in den Flur.
Aus der Küche trat die gute Seele Marie in den Gang. Sie hatte eine Schürze über ihr etwas altmodisches Wollkleid gebunden. Mit ihrem akkuraten, dunklen, nur von wenigen grauen Strähnen durchbrochenen Pagenkopf hatte sie etwas vom Bilde eines Ritterknappen.
„Gehen sie heute nicht ins Büro?“, erkundigte sie sich.
„Ich war schon dort, bin aber zurückgekehrt“, antwortete Lennard.
„Geht es ihnen nicht gut, fühlen sie sich nicht wohl?“, fiel ihm die liebe Frau beinahe ins Wort, und als er wohl einen leicht zerknirschten Gesichtsausdruck machte, schloss sie sofort an: „Ich werde ihnen einen schönen, heißen Tee kochen. Tee hilft immer!“
Sie drehte sich auf dem Absatz herum und klapperte im nächsten Moment schon mit dem Wasserkessel. Dabei hätte Lennard doch viel lieber von dem herrlich duftenden Kaffee getrunken. Und ihre Marotte, Wasser auf dem Herd im Kessel zu kochen, anstatt den elektrischen Wasserkocher zu benutzen, ging Lennard gerade heute etwas auf die Nerven, es kostete ihn Mühe, jegliche Bemerkung dazu zu unterlassen. Er ging ins Wohnzimmer an den Sekretär und nahm sich das Telefon herüber.
„Der Tee ist gleich fertig, sie müssen ihn heiß trinken, wenn er wirken soll. Kommen sie und dosieren sie den Rum selbst!“, schallte es aus der Küche zu ihm heran.
Lennard wusste, dass Widerspruch zwecklos war, und gehorchte. Er musste nur gleichzeitig an den Anruf bei seinem Chef in der Firma denken. Es fiel ihm schwer, diesen Chef überhaupt anzurufen – er hegte ja eine große Abneigung gegen diese Person – nein, schlimmer noch war es, unaufrichtig sein zu müssen und eine Krankheit vorzutäuschen. Damit begab sich Lennard auf die Ebene des Chefs, war in diesem Augenblick keinen Deut besser als jener, sodass dieses notwendige Telefonat eine schiere Unmöglichkeit für ihn darstellte.
Kaum war Lennard in der Küche angekommen, klingelte im Wohnzimmer das Telefon.
„Sie trinken ihren Tee!“, befahl die Haushälterin und trippelte los zum Telefon. Sie nahm ab, einen Moment lang war es still, dann hörte Lennard sie sagen:
„Es geht ihm gar nicht gut, er muss heute zuhause bleiben – ich sag ihm, dass er sie zurückrufen soll.“
Sie legte auf und kam zurück.
„Es war ihr Büro“, sagte sie betont beiläufig. Als sie Lennards fragendes Gesicht über der dampfenden Teetasse sah, gab sie doch noch Einzelheiten Preis.
„Der Mann aus ihrem Büro wollte natürlich mit ihnen sprechen. Obwohl: Eigentlich wollte er sie im Büro sehen. Aber ich habe ihm sofort gesagt, dass das in ihrem Zustand nicht geht. Zurückrufen sollen sie ihn stattdessen. An ihrer Stelle würde ich das heute aber gar nicht tun. Ihr Kranksein wirkt glaubwürdiger, wenn sie sich heute nicht mehr zu diesem Telefonat aufraffen können. Sie legen sich jetzt gleich hin, wir machen es dunkel und schließen die Tür, damit sie durch mich nicht gestört werden. Wenn ich heute Mittag fertig bin und gehe, fühlen sie sich bestimmt schon besser.“
Lennard ließ es genau so geschehen, er schlief sogar fest ein und erwachte erst, als er wieder alleine in seiner Wohnung war. Diese unvermittelt über ihn gekommene Freiheit beflügelte Lennard, er fühlte sich so gut wie schon lange nicht mehr. Als Erstes setzte er das Telefon außer Betrieb, versorgte sich danach mit ein paar leckeren Sachen und nahm sich diesen Brief noch einmal vor. Irgendetwas kam ihm daran bekannt vor, jedoch konnte er den fehlenden Zusammenhang partout in seinem Gedächtnis nicht wieder herstellen. Er zermarterte sich sein Hirn – eine undeutliche Ahnung sagte ihm, dass es etwas mit seinen Kindern zu tun hatte. Also schloss er den Telefonapparat wieder an und wählte die Nummer seines Sohnes. Lasse wohnte gerade am anderen Ende der großen Stadt. Seit er seine erste Arbeitsstelle angetreten hatte, sahen seine Eltern ihn selten. Es lag natürlich darin begründet, dass der junge Mann durch sein Arbeitspensum nur wenig Gelegenheit zu Familienbesuchen fand. Lennard kam auch erst darauf, dass Lasse sich noch in seiner Firma aufhielt, als er nach dem zwanzigsten Rufzeichen den Telefonhörer wieder auflegte. Also probierte Lennard das Gleiche bei seiner Tochter Anne, die ein Studium an einem vier Autostunden entfernt gelegenen Ort absolvierte. Bei ihr hatte er Glück.
„Vater, schön dich zu hören! Wann kommst du mich endlich einmal besuchen?“, begrüßte sie ihn.
Lennard versuchte, von Anne etwas zu dem Brief zu erfahren. Er wollte ihr die Hintergründe nicht verraten, und so klangen seine Erklärungen und Erkundigungen reichlich wirr. Zu einem Geistesblitz aus Annes Erinnerung führte es jedenfalls nicht. Stattdessen löste Lennards Fragerei bei seiner Tochter sorgenvolle Rückfragen aus:
„Vater, in welcher Sache recherchierst du denn überhaupt? Geht es dir vielleicht nicht so gut? Und wieso bist du überhaupt schon daheim? Wann wird Mutter denn zurückkehren? Soll ich über das Wochenende zu dir kommen?“
Es kostete Lennard Mühe, alle Bedenken seiner Tochter, es könne ihm nicht gut gehen, zu zerstreuen. Jedenfalls hatte dieser erfolglose Anruf die Folge, dass sein Sohn Lasse am frühen Abend bei ihm vorbeikam – seine Schwester hatte mit ihm am Nachmittag noch telefoniert und ihn darum gebeten. Zwischen Vater und Sohn bestand seit eh und je eine besondere Seelenverwandtschaft. In seinem ganzen Wesen war Lasse sehr nach seinem Vater geraten. Also verstanden sich die beiden Männer richtig gut und pflegten ihre ganz eigene Art, Gedanken auszutauschen. Die Frauen, Christina und Anne, hatten dieses Verhältnis schon immer argwöhnisch beobachtet, es oft ironisch kommentiert. Zwischen Mutter und erwachsener Tochter herrschte ein eher sachliches Klima, es gab häufiger Meinungsverschiedenheiten, die recht unnachgiebig ausgetragen wurden. Dabei war Anne ja im Begriff, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Sie studierte Archäologie und Geschichte. Ihre Mutter war zu ihrer Zeit für die Entscheidung, derart brotlose Künste als Studienfächer zu wählen, heftig kritisiert worden. Als sie später mit Doktortitel abschloss und kurz darauf Lennard heiratete – sie war mit Lasse schwanger – wurde sie mitleidig belächelt. »All die Mühe umsonst! «, hörte man viele aus ihrer Umgebung laut denken.
Christina hörte jedoch nie auf, sich mit Themen aus ihrem Fach Archäologie zu beschäftigen, während sie zwei Kinder groß zog und im Zentrum der Familie stand. Kaum waren die Kinder selbstständig und aus dem Haus, veröffentlichte Christina ein Buch über die vorderasiatische Antike, welches in der Fachwelt und in der Wissenschaftspresse viel Beachtung fand. Es brachte ihr Einladungen zu Forschungsreisen und Vortragsreihen ein. Und dieser Erfolg kam Anne in ihrer Entscheidung für ein Studium mit denselben Schwerpunkten sehr zugute. Die männliche Seite der Familie trat dadurch unwillkürlich in den Schatten. Lasse machte dies nichts aus. Er hatte als Ingenieur eine Anstellung ganz nach seinem Geschmack bei einer Sportbootwerft gefunden. Schiffe waren seine große Leidenschaft, und sein Traum bestand darin, einmal als Konstrukteur eine Yacht für den Admiral's Cup zu bauen.
Lennard freute sich über Lasses Besuch. Er holte die letzten zwei Flaschen Bier, die er im Hause hatte, und setzte sich mit seinem Sohn im Esszimmer an den großen Tisch, an welchem die Familie viele Jahre lang einmal täglich zusammengekommen war.
„Vater, was hast du auf dem Herzen? Anne meinte, du habest ihr so merkwürdige Fragen gestellt“, begann Lasse ohne Umschweife.
„Gut, lassen wir das Alltägliche weg und kommen zur Sache“, erwiderte Lennard mit einem Lächeln. Er nahm den bewussten Brief aus dem Kuvert und legte ihn vor Lasse auf den Tisch. „Schau dir dies hier einmal an.“
Lasse nahm einen Schluck aus seiner Bierflasche und las dann den Brief.
„Woher hast du das?“, fragte Lasse flüsternd, als wolle er vermeiden, dass fremde Ohren mithörten.
„Sagen wir: Es wurde mir zugespielt. Vielmehr kann ich zur Herkunft ehrlich nicht sagen. Aber fällt dir denn zu diesem Text irgendetwas ein? Kommt dir diese Sache nicht in irgendeiner Weise bekannt vor?“
Lasse überflog den Brief ein zweites Mal: „Nein, so ad hoc sehe ich keinen Zusammenhang mit etwas mir Bekanntem – obwohl: Ein wenig erinnert mich dieser Brieftext an ein Buch, das ich mal gehabt habe, als ich etwa dreizehn, vierzehn Jahre alt war.“
„Aha, weißt du noch, welchen Titel das Buch hatte?“, bohrte Lennard.
„Nein, Vater, beim besten Willen: Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber vielleicht existiert das Buch ja noch.“
„Würdest du mir helfen, danach zu suchen?“, äußerte Lennard zurückhaltend seinen Wunsch.
„Eigentlich gerne, aber ich bin mir sicher, dass so etwas nicht hier im Haus zu finden ist. Ich habe alles gründlich ausgeräumt, als ich umgezogen bin. Ganz viel, auch Bücher, hat das Entrümpelungsunternehmen damals abtransportiert. Unter den Dingen, die ich zu mir mitgenommen habe, befindet es sich auf keinen Fall. Wo es noch gut sein könnte: auf der Insel. Solche Sachen haben wir damals am liebsten dort aufbewahrt – in den Ferien hatten solche Bücher immer einen besonderen Reiz. Du kannst ja mal nachschauen, die Kartons auf dem Speicher im Ferienhaus erscheinen mir besonders vielversprechend für deine Suchaktion – es eilt ja sicher nicht.“
Lasses Hinweis war zwar wertvoll, jedoch bedeutete es viel Umstand, dafür auf die Insel hinauszufahren und ihr Ferienhaus zu durchstöbern. Dazu kam noch, dass ihr Häuschen dort nun fest vermietet war. Seit sie es als Familie nicht mehr nutzen konnten, ließen sie einen alten Seebären im Ruhestand und dessen Haushälterin für eine ganz geringe Miete darin leben. Dem Haus tat es gut, dass es bewohnt wurde.
Die Gedanken an das Ferienhaus veranlassten Vater und Sohn, alte Fotos hervorzuholen und ihre Erinnerungen aufzufrischen. Später bot Lennard Lasse an, im Gästezimmer zu übernachten, doch trotz mitternächtlicher Stunde entschied sich der Sohn, heimzufahren.
Nach einer kurzen und dennoch sehr erholsamen Nachtruhe erwachte Lennard recht früh. Dafür war nicht sein innerer Wecker verantwortlich – es war ja Samstagmorgen – sondern eine gewisse Ungeduld, eine Art von Tatendrang, die Zusammenhänge des mysteriösen Briefs aufklären zu wollen. Gegen Sieben verließ Lennard die Wohnung in der Absicht, auf die Insel herüberzufahren. Ein paar Utensilien und etwas Kleidung nahm er vorsorglich mit, er rechnete mit einer Rückkehr am Sonntag. Draußen war es dunkel und nass. Tauwetter hatte diesen Landstrich erreicht und die dünne Schneeschicht zu Flecken schrumpfen lassen. Auf den Straßen war Lennard zu dieser Morgenstunde beinahe alleine unterwegs. So hatte er die Strecke bis zur Küste in einer knappen Dreiviertelstunde schon hinter sich gebracht und freute sich darauf, in einem Bistro am Hafen des Städtchens zu frühstücken. Es sollte aber erst um Neun öffnen, und so blieb Lennard nichts anderes übrig, als sich die Zeit zu vertreiben. Er parkte vor dem Bistro und brach zu einem Gang Richtung Hafen auf. In der feuchtkalten Luft musste er seine Daunenjacke bis unter das Kinn schließen, um nicht zu frieren. Ein böiger, hässlicher Wind pfiff um die Häuserecken. Als er auf den Kai hinausging, blies ihm der Wind stetiger und noch kräftiger vom Meer her entgegen. Die vertäuten Schiffe, ein größerer Frachter, zwei, drei Küstenmotorschiffe und etwa ein Dutzend Fischereikutter hoben und senkten sich mit lauten Knarren des Tauwerks in der hereinlaufenden, hohen Dünung. Auf einem der Kutter spritzte ein Fischer mit einem Schlauch leere Fischfangkisten aus. Lennard blieb stehen und schaute für einen Moment zu. Der Mann in der Gummilatzhose und mit der Strickmütze auf dem Kopf bemerkte es und drehte das Schlauchventil zu.
„Wollen sie was von mir?“, rief er Lennard in unfreundlichem Ton zu.
Lennard schüttelte zwar den Kopf, antwortete dann aber doch mit einer Frage.
„Wissen sie, ob das Versorgungsschiff heute zur Insel hinübersetzt?“ Er deutete mit Kopfnicken auf eines der Küstenmotorschiffe.
„Nee!“, rief der Mann gegen die Windgeräusche zurück. Als er Lennards saures Gesicht bemerkte, fügte er hinzu: „Ich weiß es schon, aber es fährt heute nicht.“
Er drehte das Wasser wieder an und setzte seine Reinigungsarbeit fort. Lennard kehrte um, bog zwar noch ein Stück weit auf einen Pier ein, entschloss sich dann jedoch, zum Auto zurückzulaufen. Eine Viertelstunde verbrachte er noch im Auto. Dann sah er einen jungen Mann zu Fuß auf das Bistro zustreben. Dieser schloss die Eingangstüre auf und verschwand im Lokal. Nach ein paar Minuten sah Lennard, dass das hinter der Scheibe der Tür hängende Geschlossen-Schild herumgedreht wurde, und nun das Wort »Offen« in großen Lettern zu ihm herüberzeigte. Lennard stieg aus, schritt zum Eingang und betrat das Bistro. Der junge Mann stand hinter der Theke und brummte ein »Guten Morgen« in Lennards Richtung.
„Kann man schon etwas bekommen?“, fragte Lennard vorsichtig.
„Was darf es denn sein?“, kam als jetzt höflicher intonierte Rückfrage von der anderen Seite.
„Wenn es geht, hätte ich gerne ein Frühstück“, antwortete Lennard.
„Kann ihnen nur ein Getränk liefern“, sagte der junge Mann, „Aus der Küche gibt es erst etwas, wenn die Chefin da ist. Sie müsste aber so in zehn Minuten kommen.“
„Dann nehme ich schon einmal einen Kaffee.“
Tatsächlich erschien wenig später die Chefin. Schon beim Öffnen der Eingangstür entdeckte sie den frühen Gast und kam mit schnellen Schritten auf ihn zu.
„Lennard! Ach, ist das schön, dass du wieder einmal da bist!“
Lennard hatte sich vom Hocker an der Theke erhoben, und die Frau begrüßte ihn mit einer herzlichen Umarmung.
„Johanna, schön dich zu sehen!“, erwiderte Lennard die Begrüßung, „Du siehst gut aus.“
„Mir geht es auch gut. Aber was ist mit dir: Du kommst alleine? Und du schaust müde aus.“
Sie strich ihm mit der Hand über die Haare. Lennard half ihr aus dem Wintermantel. Die Frau nahm ihre Wollmütze ab, und ihr volles, blondes, leicht gewelltes Haar fiel ihr daraus bis auf die Schultern. Sie trug einen braun und gelb gemusterten Norweger-Pullover, der weit hinab reichte, und unter dem ein glatter, dunkelvioletter, kurzer Rock hervorkam. Schwarze, dichte, wollene Strümpfe bedeckten die Knie und verschwanden in den Schäften hoher, dunkler Lederstiefel. Ihre Figur und ihr Stil waren jene einer jungen Frau. Nur in ihren Gesichtszügen ließ sich erkennen, dass sie zu Lennards Generation gehörte.
„Du musst mir alles erzählen, mein Lieber. Es ist ja so lange her! Zwei Jahre?“, sagte sie und umarmte Lennard noch einmal.
Dann befreite sie ihn von ihrem Mantel und enteilte in einen Nebenraum.
„Hast du Hunger, kann ich dir ein ordentliches Frühstück bereiten?“, rief sie von dort.
„Er hat schon Frühstück bestellt“, meldete sich der junge Angestellte zu Wort.
Lennard hatte bemerkt, dass dieser mit argwöhnischen Blicken die Begrüßung verfolgt hatte.
Die Chefin wechselte von dem Nebenraum in die Küche, die man von der Theke aus einsehen konnte.
„Ich habe euch gegenseitig noch nicht vorgestellt“, sprach Johanna durch die offen gestellte Pendeltür zu beiden.
„Lennard, das ist Carlo, mein Mann für alle Fälle, aus Italien. Er ist mir eine große Hilfe. Ich kann mir diesen Laden hier nicht mehr ohne ihn vorstellen. Carlo, Lennard ist ein alter Bekannter. Er hat ein Haus drüben auf der Insel.“
Carlo trat hinter der Theke zu Lennard und reichte ihm die Hand. Lennard musterte ihn dabei schweigend. Carlo war ein hübscher, junger Mann von fünfundzwanzig, höchstens dreißig Jahren. Er besaß eine schöne Kopfform – Lennard ging das Wort »römisch« durch die Gedanken. Aus Carlos Augen sprach ein Funke von Ablehnung gegenüber Lennard.
Eifersucht? Was konnte es sonst sein, sie waren sich doch nie vorher begegnet.
Carlo entfernte sich wieder, legte Musik in die Stereoanlage ein und startete das Abspielen. Lennard griff nach einer Illustrierten, die in seiner Reichweite auf der Theke lag, und blätterte ziellos darin. Wenig später kam Johanna mit einem vollgefüllten Tablett in den Gastraum und deutete Lennard an, ihr zu folgen. Sie ging an einen Tisch mit Blick nach draußen, die Straße hinunter zum Hafen, der sich aber in einer Nische des Raums befand, die von der Theke aus nicht einsehbar war.
Im gleichen Moment traten zwei Männer durch die Eingangstür in das Bistro.
„Hanna, Püppchen, wir kommen zum Frühschoppen. Carlo, lass das Bier fließen!“, sagte der eine laut, während der andere nicht mehr als ein brummiges »Morgen zusammen« herausbrachte.
Johanna wandte sich zu Lennard um und flüsterte ihm zu: „Na, hab ich nicht einen fantastischen Job hier? Glaube mir, jeden Tag schwöre ich mir aufs Neue, dass ich damit Schluss mache.“
Sie sah Lennard ernst an, und es war ihm klar, dass sie es genau so meinte.
Johanna deckte für das Frühstück ein, es sah reichhaltig und appetitanregend aus. Carlo brachte eine Kanne mit duftendem, frisch gebrühtem Kaffee, kümmerte sich dann aber um die Kundschaft an der Theke.
„Setz dich doch, mein Lieber. Solange nicht mehr Betrieb ist, leiste ich dir Gesellschaft – wenn es dir recht ist“, sagte Johanna mit ihrer warmen, wohltuenden Stimme. Natürlich war es Lennard recht, und so saßen die beiden in der diskreten Ecke ganz zufrieden und in ein angeregtes Erzählen vertieft über ihren Kaffeetassen.
„Deine Frau ist ja eine richtige Berühmtheit geworden, eine Kulturbotschafterin. Von dir habe ich nichts gehört, aber über sie liest man ja beinahe jede Woche in der Zeitung“, meinte Johanna und verlieh ihrer Betonung eine mitleidige Note.
„Ach, weißt du, ich freue mich für sie und bin auch stolz auf ihren Erfolg. Es hat unser Verhältnis, also besonders die Gefühle füreinander, nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil, es kommt mir inniger vor, vielleicht durch die vielen Trennungen und die Freude beim Wiedersehen. Andererseits hat es mein Alltagsleben völlig umgekrempelt. Ich muss in einer Weise leben, wie ich es im Augenblick überhaupt nicht mag. Dazu ergeht es mir in meiner Arbeit wie dir: Ich habe die Nase voll davon. Mit meiner Ehe hätte ich kein Problem, dafür aber mit allem, wirklich absolut allem anderen“, gestand Lennard der alten Bekannten.
„Das hört sich ja an, als ob du weglaufen wolltest, hoffentlich nichts Schlimmeres – Schlussmachen?“, folgerte Johanna daraus, und ihr Ton schwankte dabei zwischen Ironie und Sorge.
„Nein, nicht Schlussmachen, anfangen will ich etwas“, beruhigte sie Lennard.
„Und womit willst du anfangen?“
„Das kann ich im Moment noch nicht erklären. Ich denke, ich stehe wirklich am Beginn eines neuen Lebens und kann trotzdem nichts darüber sagen“, antwortete Lennard, aber er wirkte dabei nicht überzeugend.
„Im Grunde könnten wir uns zusammenschließen", brachte die Gastgeberin mit einem Lachen heraus. Dann wurde sie wieder nüchtern und erzählte: „Eigentlich habe ich genau das schon hinter mir, und zwar als ich Carlo hier aufgenommen habe. Er brachte Geld mit, und ich habe ihm angeboten, zu dreißig Prozent hier einzusteigen – das Gebäude gehörte mir, aber ich konnte es aus den Einnahmen der Gastwirtschaft nicht mehr halten. Plötzlich kehrte sich alles um: es gab einen Mann, der mich trotz Altersunterschieds begehrte, wir hatten Kapital für Umbau und Modernisierung, wir reisten in seine Heimat, und seine Familie nahm mich herzlich auf. Doch dann, ganz langsam, holte uns der Alltag ein. Die Kundschaft war die gleiche geblieben, die Liebe beschränkte sich mehr und mehr auf das Bett, die jungen Frauen wurden wieder attraktiv, besonders die Köchin, die Carlo unbedingt einstellen wollte – du wirst sie nachher noch kennenlernen. Und Carlo zeigte mir von Tag zu Tag mehr, dass er mich nicht mehr brauchte.“ Johannas Stimme klang dabei bitter.
„Na, bist du dir sicher? Bildest du dir den Wandel bei deinem jungen Freund nicht nur ein? Vielleicht suchst du das Haar in der Suppe, das es jedoch gar nicht gibt, und nur deshalb, weil du so viel Glück auf einen Schlag nicht verkraftest.“, hinterfragte Lennard die Negativdarstellung der Chefin, natürlich in der Absicht, sie zu beruhigen und zu einer weniger irrationalen Einschätzung zurückzuführen.
„Du meinst, ich sei zu argwöhnisch und bildete mir alles nur ein? Möglich, dass du recht hast“, räumte Johanna ein.
Doch dann legte sie eine Hand auf ihr Herz und sagte: „Hier fühle ich etwas, das zu diesem ganzen Glück nicht passt, und diese Stiche dann und wann sind der Nährboden für die Zweifel am reinen Glück. Außerdem sind da noch die offensichtlichen Widerwärtigkeiten“, sie nickte mit ihrem Kopf in Richtung Theke, „Die haben nichts mit Carlo zu tun und sind doch geeignet, mich davonlaufen zu lassen.“
„Anfangs sagtest du, es ginge dir gut. Nun stellt sich das Gegenteil heraus. Was soll ich davon halten?“, fasste Lennard zusammen, während Johanna schwieg und starr auf die Tischplatte hinabblickte.
„Weißt du schon, was du unternehmen wirst? Hast du einen Plan gefasst?“, fuhr Lennard fort.
Mit gesenktem Blick antwortete Johanna: „Nimm mich mit! Können wir nicht gemeinsam von hier fortgehen? Ich hatte mir nichts vorgenommen, aber dein Erscheinen hier kommt mir vor wie ein Zeichen.“
Lennard erschrak. Er wollte es sich nicht anmerken lassen: Johannas Vorschlag, vielmehr flehende Bitte, sie von hier weg zu bringen, entsprach überhaupt nicht seiner Intuition, wie der Beginn seines neuen Lebens beschaffen sein sollte. Es wäre zwar ebenfalls ein Anfang, sich mit Johanna zusammenzutun, jedoch, wäre es nicht ein Weg ohne Ziel? Der Gedanke daran entbehrte nicht eines erotischen Reizes – Johanna war eine attraktive Frau – besaß aber diesen hässlichen Geschmack von Ehebruch. Christina, seine wunderbare Frau, liebte er doch und würde ihr auf solche Weise niemals wehtun wollen, auch wenn Christina ihn im Augenblick vernachlässigte, sehr vernachlässigte, beinahe im Stich ließ.
„Ich kann dir heute keine Zusage geben für einen solchen Schritt. Der Besuch auf der Insel ist für mich zwingend notwendig – ich habe etwas aufzuklären. Es ist trotzdem denkbar, dass wir gemeinsam unsere Leben neu gestalten. Vorher sehe ich in deinem Fall die Pflicht, eine Reihe Dinge in Ordnung zu bringen und zu regeln. Wenn ich von der Insel zurückkomme, besprechen wir das Thema erneut. – Apropos Übersetzen: Wer könnte mich denn heute mit seinem Boot hinbringen?“, endete Lennard mit einer ganz praktischen Frage.
„Ich könnte es – oder, wenn dir das lieber ist, auch Carlo“, antwortete Johanna in einem leicht bitteren Tonfall und ohne zu Lennard aufzublicken, „Wir haben ein kleines Boot mit Außenbordmotor. Du wirst heute auch kaum jemand anderen finden, der dich hinbringt.“
„Zu dieser Jahreszeit, bei dem Wetter und dem Seegang, den ich vorhin gesehen habe, kommt es nicht infrage, dass du mich hinfährst. Wenn es auch nur acht Seemeilen sind: Es ist zu gefährlich. Denk‘ an die Rückfahrt ganz alleine! Und ob Carlo überhaupt dazu bereit ist, wäre erst herauszufinden“, erwiderte Lennard.
Ohne ihren Blick zu heben – in ihrer Körperhaltung wie in ihrer Stimme lag der Ausdruck einer Zurückgewiesenen – sagte Johanna leise: „Ich werde ihn darum bitten, und Carlo wird diese Bitte nicht ausschlagen.“
Lennard legte seinen Arm beruhigend um ihre Schultern: „Danke! Und alles andere findet sich auch, hab etwas Geduld.“
Johanna wandte ihren Kopf langsam auf seine Seite, und ein vorsichtiges Lächeln glitt in ihre Züge. Sie stand auf und strich ihm über das Haar.
„Stärke dich ordentlich, du wirst es brauchen“, sagte sie fürsorglich und entfernte sich.
Lennard blickte ihr nach. Durch die Scheiben sah er dabei Passanten vom Hafen her kommen, die ihre Schirme mit beiden Händen festhalten mussten. Der Wind peitschte den Regen mal in diese, mal in die andere Richtung. Es war kein Tag, um in einer Nussschale zur Insel hinüber zu fahren. Johanna kam und stellte Lennard mit einem Lächeln wortlos mehr Toast und Brotaufstrich hin. Einige Minuten später brachte Carlo eine zweite Kanne Kaffee.
„Ich fahre sie hin“, sagte er zu Lennard und schenkte ihm dabei den frischen Kaffee ein, „Ist es in Ordnung, wenn wir uns in einer halben Stunde auf den Weg machen?“
Lennard nickte und reichte ihm die leere Kaffeekanne an.
Johanna hatte für die beiden Männer Ölzeug geholt, und sie bestand auch darauf, dass sie die im Keller ebenso vorgefundenen Schwimmwesten mitnahmen. Die Männer verließen das Bistro und erreichten bald den Liegeplatz des Bootes an der Sportboot-Pier. Unter der Persenning kam eine offene, weiße Polyesterwanne, bauchig wie ein Ruderkahn, von drei Meter Länge zum Vorschein. Der Außenbordmotor machte einen neuwertigen, überdimensionierten Eindruck.
Carlo wies Lennard an, über den Bug eine Spritzwasserplane zu zurren und sein Gepäck darunter zu verstauen. Der Motor sprang sofort an, und sie setzten sich in Bewegung, zogen eine ruhige Bahn auf die Hafenausfahrt zu und verschwanden in den dichten Regenfahnen schon nach den ersten hundert Metern im offenen Meer. Der Wind blies heftig von See, die Dünung kam lang herein. Nicht die Oberfläche war vom Wind angegriffen, nein, all das Wasser der Tiefe befand sich in Bewegung, vollführte einen rhythmischen Tanz, einen langsamen Walzer mit ausgeprägten Hebungen und Senkungen. Die beiden Männer konnten immer nur bis zum nächsten Wellenberg sehen, der Hafen geriet schon nach Minuten außer Sicht, das Ziel, die Insel, existierte in dieser Wasserwüste nicht.
Carlo blickte stur auf den Kompass, der am rechten Innenbord festmontiert war. Lennard hatte nie zuvor eine solche Überfahrt erlebt. Er machte sich Vorwürfe, überhaupt nach einem Transport an diesem Tag gefragt zu haben. Da Carlo aber seiner Sache sicher zu sein schien, verwarf Lennard den Vorschlag zur Umkehr wieder. Offenbar war Carlo überzeugt, dass sie das Halten des Kurses auf diese Achtseemeilenentfernung und bei der Größe der Insel in jedem Fall an die Gestade des Eilands führen würde.
Gegen das Tosen und Brausen schrie Carlo ein Wort, das bei Lennard nicht ankam. Lennard wusste trotzdem, dass es der Befehl zum Schöpfen gewesen war. Ihr Boot nahm bei jedem Richtungswechsel, auf oder ab, Wasser herein. Durch den schweren Außenborder und die im Heck sitzenden Männer hing der Kahn hinten recht tief. Das Wasser sammelte sich dort so, dass es sich herausschöpfen ließ. Lennard war damit nun beständig beschäftigt und vergaß darüber beinahe sein flaues Gefühl. Er rückte dabei einmal so nahe an Carlo heran, dass dieser ihm doch einen ganzen Satz zuzurufen versuchte. „Wenn man jemanden loswerden wollte, wäre dies hier die beste Gelegenheit.“, so etwa lautete das, was Carlo mit einem hämischen Grinsen von sich gegeben hatte. Diese Aussage besaß eine logisch kaum wiederlegbare Wahrheit, eine umso erschreckendere Erkenntnis, je mehr Lennard über mögliche Motive bei seinem Skipper nachdachte. War er vielleicht der eifersüchtige, heißblütige Italiener? War er der junge Liebhaber der reifen Geschäftsfrau und auf deren Vermögen aus? Oder hasste er Lennard einfach wegen dessen bürgerlichen Strebens nach Sicherheit und Verlässlichkeit?
Doch waren sie nicht aufeinander angewiesen? Das geschickte Steuern und Navigieren durch diese See war genauso überlebensnotwendig wie das Schöpfen, das das Volllaufen und Sinken verhinderte. Einer alleine hätte doch wohl keine Chance gehabt, sagte sich Lennard. Und trotzdem sah Carlos Gesicht von Mal zu Mal grimmiger aus. Lennard konnte den Stoß, der ihn über Bord befördern würde, förmlich vorausfühlen.
Aber der Stoß blieb aus. Lennard war so sehr mit dem Schöpfen beschäftigt, dass er die Bedrohung nach einigen Minuten vergaß. Es machte ihm zu schaffen, dass er keine Gummistiefel besaß, solche, wie sie Carlo trug, und dass das Wasser seine Lederhalbschuhe vollständig geflutet hatte. Bei jedem Herabbeugen in den Bauch des Bootshecks und dem Füllen des Schöpfgefäßes hatte er Carlos Gummistiefel vor Augen. Dieser italienische Schönling war den Bedingungen dieser Bootsfahrt sehr gut angepasst. Da waren keine Eitelkeit und kein Snobismus. Ganz gegen Lennards Bild von einem Gigolo war dieser Carlo einfach perfekt auf die Situation eingestellt, wie ein alter Seebär, der der See immer mit seinen seemännischen Mitteln trotzt und ihrer Gewalt seine selbstsichere Überlegenheit entgegenstemmt. So einer konnte doch niemals ein hübscher Neapolitaner sein! Verkehrte Welt. Und den Nordmann Lennard, der sich gerne als Nachfahr der Wikinger sah, störte das Wasser in seinen Schuhen! Es fuhr Lennard durch den Sinn, er könne den Spieß herumdrehen und Carlo über Bord werfen. Er müsste ihn nur bei seinen Gummistiefeln packen und ihm die Füße hochreißen – der Italiener würde unweigerlich nach achtern über das Heckbord kippen, am Außenborder würde er sich nicht festhalten können. Johanna wäre befreit, und er würde Carlos Überbordgehen als Unfall hinstellen. Vielleicht würde er sich doch entscheiden, einen Neuanfang gemeinsam mit Johanna zu wagen. Wikinger waren ja wilde Gesellen: Fremdlinge von fernen Küsten zählten nichts, sie kamen eben um, wenn sie den Wikingern im Weg waren.
Aber Lennard schöpfte und schöpfte. Er hasste das Wasser in seinen guten Lederschuhen, und er mochte nicht mit diesem Italiener in einem Boot sein. Am meisten aber verabscheute Lennard den zeitlichen Druck, sehr bald eine Entscheidung treffen und handeln zu müssen. Jedes Hinunterbücken und Schöpfen stellte ihn vor die Wahl: Jetzt sofort zupacken oder das Ganze aufgeben. Es war vielleicht schon nicht mehr weit bis zur Insel. Sich zu spät zu entschließen, konnte die Möglichkeit des nicht nachweisbaren Mordes zunichtemachen. Sein Neubeginn würde hinter Gittern enden.
Das Schaukeln in dieser Nussschale war entsetzlich. Die See um sie herum brodelte. Die meiste Zeit verbrachten sie in den Wellentälern zwei Meter unterhalb der weißen Gischtkämme, so kam es Lennard vor. Er erschrak gewaltig, als Carlo ihn plötzlich bei der Schulter packte und dann mit der freien Hand nach oben zeigte, dorthin, wo über den Wellenbergen die Regenfahnen rauschten. Lennard folgte dem Fingerzeig und entdeckte in all dem Spritzwasser ein grünes Leuchtfeuer auf einem hohen Mast. Er erkannte das Seezeichen, es handelte sich um die Steuerbord-Bake der Hafeneinfahrt. Carlo hatte mit schlafwandlerischer Sicherheit den Inselhafen angesteuert. Es dauerte kaum zwei Minuten, und die rote Markierung des Hafentors erschien rechts von ihnen. Mit dem Einfahren in das von den Brandungsmauern geschützte Hafenbecken ließ der Seegang schnell nach, übrig blieb nur der heftige, vom Wind hin und her gepeitschte Regen.
Carlo legte am Pier an. Er klopfte Lennard auf die Schulter und reichte ihm dann mit einem Lächeln wortlos die Hand zum Abschied. Lennard holte seine Reisetasche hervor und stieg damit auf die Pier. Er schaute Carlo ernst an und dachte bei sich: ‚Er wird doch wohl nicht alleine zurückfahren!‘ Dann winkte er Carlo mit einer Geste des Dankes zu – dieser wendete das Boot und steuerte sodann auf die Hafenausfahrt zu. Lennard blickte ihm nach, bis das Boot bei den Leuchtbaken im Grau der See, des Regens und des niedrigen Himmels verschwunden war.
Auf der Insel herrschte Stille. Nur das leise Rauschen des Regens blieb, als Lennard den kleinen Hafen verlassen hatte, auf der schmalen, gepflasterten Straße die ersten flachen Hügel überquert und sich damit vom Saum des Meeres abgewandt hatte. Vor ihm breitete sich diese so sehr geliebte grüne, offene Insellandschaft aus mit ihren flachen Anhöhen aus glattpoliertem Fels, den saftigen, grasbewachsenen Senken, den verstreuten Gruppen windzerzauster Föhren und den vereinzelt dazwischen hervorlugenden, geduckten Holzhäusern.
In der Ferne, eine knappe Stunde Fußmarsch entfernt, lag das Dorf mit seinem Kirchturm, der bei dieser regenverhangenen Sicht der deutlichste Orientierungspunkt war. Außerhalb der Saison gab es keine Touristen, die wenigen ständigen Inselbewohner gingen an einem Tag wie diesem kaum vor die Tür, oder sie befanden sich über das Wochenende auf dem Festland. So gab es keinen vernehmbaren oder sichtbaren Autoverkehr. Die einzigen von Menschen ausgelösten Geräusche waren die Schläge der Kirchturmuhr zu jeder verstrichenen Viertelstunde. Lennard fühlte sich auf seinem Weg zu Fuß um hundert oder mehr Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt. Wegen der milden Luft empfand er Wetter und Jahreszeit jetzt gar nicht als unangenehm, im Gegenteil: Alles kam ihm so natürlich und harmonisch vor. Selbst seine durchnässten Schuhe störten ihn nun nicht mehr. Er erinnerte sich, dass sie es in den vielen Jahren, in denen sie oft, ja regelmäßig hierhergekommen waren, immer so empfunden hatten.
Auf halber Strecke kam er an einer Ponyweide vorbei. Die zotteligen, kleinen Pferde ästen zufrieden ihr Gras. Lennard kannte die Ponys, so wie er auch den Besitzer kannte, einen mürrischen Kerl, der nur leidlich war, wenn er seine Pferdchen an Touristen vermieten konnte. Er blieb am Weidezaun stehen und sprach zu den Ponys wie zu alten Freunden. Die Tiere kamen bald zu ihm, erst etwas zögerlich – sie mochten die Menschen wohl nicht sehr leiden, mussten sie sich doch durch sie ihre Rücken krumm biegen lassen – nach dem ersten bezeugten Zutrauen durch eines der Ponys waren dann aber alle ganz dicht bei ihm. Und obwohl er nicht zum Füttern hatte, stellten sich die Tiere begierig an, um Streicheleinheiten abzuholen.
Schließlich ging Lennard auf eines der Häuser am Rande des Dorfes zu, welches auf einer leichten Anhöhe stand. Es war ihr Ferienhaus, und es wirkte auf ihn, als ob es ihn anlächelte, als er darauf zuschritt. Er klopfte an der niedrigen Holztüre. Erst nach einer Wiederholung waren im Haus Geräusche zu hören. Dann wurde geöffnet. Unter der Tür erschien der Kapitän im Ruhestand, ein breitschultriger, mittelgroßer Mann mit grauem Vollbart, kleinen, scharfen Augen und einer ledernen, dunklen Haut an den wenigen Bartlücken im Gesicht. Er trug eine braune, wollene Jacke, eine schwarze, gebügelte Stoffhose und dazu kurze Stulpenstiefel. Sein Haupthaar war kurz geschnitten und wuchs nicht mehr dicht – zum ersten Mal sah Lennard ihn ohne seine Kapitänsmütze.
„Lennard! Welch eine Überraschung“, rief der Kapitän aus, und seine Augen funkelten vor Freude.
„Entschuldigen sie, Kapitän, dass ich sie so unangemeldet aufsuche“, entgegnete Lennard und schüttelte ihm die Hand zur Begrüßung.
„Mein lieber Lennard, sie sind uns doch immer herzlich willkommen. Treten sie ein – der Regen hat sie völlig durchnässt", erwiderte der Kapitän und rief in das Häuschen nach seiner guten Seele: „Ma-Ank! Ma-Ank, komm und schau, wer uns besucht.
Lennard kam herein und schloss hinter sich die Tür. Er zog den Ölzeugmantel aus und hängte ihn an einen Garderobenhaken im Flur. Der Kapitän legte ihm freundschaftlich seine große Hand auf die Schulter und schob ihn durch die nahe Türöffnung in die Küche. Dort kam Ma-Ank schon auf sie zu. Sie blieb vor Lennard stehen und verbeugte sich tief. Lennard erwidert still diese Begrüßung. Im Gegensatz zu der kleinen, ja zierlichen asiatischen Frau schloss er dabei nicht seine Augen. Er betrachtete sie kurz aus nächster Nähe und stellte fest, dass sie nichts von ihrem fremdländischen Zauber eingebüßt hatte. Sie trug einen dunkelrot, blau und golden gemusterten, traditionellen Sarong und hatte ihr langes Haar kunstvoll zu einem Zopf geflochten, der ihr entlang des Rückgrats bis zur Taille reichte. Ihr rundliches Gesicht mit dem braunen Teint war immer noch frei von Falten, nur an den Seiten ihres Kopfes zeigten sich erste graue Strähnen in ihrem sonst schwarzen Haar.
„Meine Freunde, es tut mir leid, dass ich so überraschend herkomme, ich hätte vorher telefonieren sollen. Jedenfalls müsst ihr euch keine Sorgen machen – der Grund für meinen Besuch ist, dass ich etwas aus unseren hier aufbewahrten Dingen benötige, – und, dass ich große Lust verspürte, einmal wieder auf der Insel zu sein“, erklärte Lennard.
Der Kapitän bot Lennard am Esstisch Platz an. „Auf das Wiedersehen müssen wir anstoßen. Und dann, mein Lieber, müssen sie uns erzählen, wie es ihnen in der letzten Zeit ergangen ist – auch, was es in der großen Stadt an Neuem gibt.“