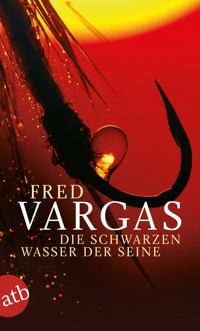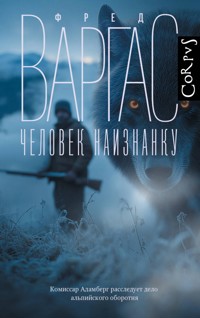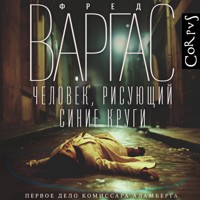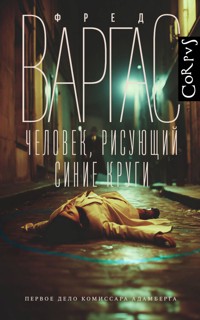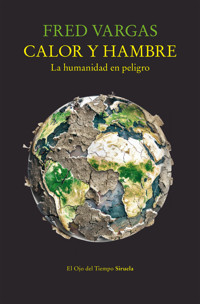9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ex-Inspektor Louis Kehlweiler sitzt auf Bank 102 an der Pariser Place de la Contrescarpe, als sein Blick auf einen winzigen weißen Gegenstand fällt, ein blankgewaschenes Knöchelchen, so scheint es. Man muß schon Kehlweilers blühende Phantasie haben, um daran etwas Ungewöhnliches zu finden. Doch nach wenigen Tagen hat er dank seiner alten, nicht immer ganz legalen Beziehungen heraus, daß es sich um den kleinen Zeh einer Frau handelt, der von einem Hund verdaut worden ist. Eine dazugehörige Leiche gibt es allerdings nicht im ganzen Arrondissement - dafür eine Menge Hundehalter, die zu beobachten und deren Gewohnheiten herauszufinden Kehlweiler sich vornimmt. Mit Hilfe der drei wissenschaftlich tätigen, wenn auch arbeitslosen junge Historiker Mathias, Marc und Lucien stößt er schließlich auf einen Pitbull-Besitzer und leidenschaftlichen Sammler alter Schreibmaschinen, der allwöchentlich zwischen Paris und der Bretagne pendelt. Und in Port-Nicolas, einem trostlosen bretonischen Hafenstädtchen, ist in der Tat vor wenigen Tagen eine Frau von der Steilküste gestürzt. »Knochentrocken selbst in den absurdesten Momenten und voller Wahnsinns-Typen.« Frankfurter Rundschau »Mörderisch menschlich, mörderisch gut.« Frankfurter Rundschau
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Über Fred Vargas
Fred Vargas, geb. 1957 und von Haus aus Archäologin. Sie ist heute die bedeutendste französische Kriminalautorin und eine Schriftstellerin von Weltrang. 2004 erhielt sie für „Fliehe weit und schnell“ den Deutschen Krimipreis. Ihre Werke sind in über 40 Sprachen übersetzt und liegen sämtlich bei Aufbau in Übersetzung vor:
Im Schatten des Palazzo Farnese
Die schöne Diva von Saint-Jacques
Der untröstliche Witwer von Montparnasse
Das Orakel von Port-Nicolas
Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord
Bei Einbruch der Nacht
Fliehe weit und schnell
Der vierzehnte Stein
Die dritte Jungfrau
Die schwarzen Wasser der Seine
Das Zeichen des Widders
Der verbotene Ort
Die Tote im Pelzmantel
Die Nacht des Zorns (Frühjahr 2012)
Informationen zum Buch
Ex-Inspektor Louis Kehlweiler sitzt auf Bank 102 an der Pariser Place de la Contrescarpe, als sein Blick auf einen winzigen weißen Gegenstand fällt, ein blankgewaschenes Knöchelchen, so scheint es. Man muß schon Kehlweilers blühende Phantasie haben, um daran etwas Ungewöhnliches zu finden. Doch nach wenigen Tagen hat er dank seiner alten, nicht immer ganz legalen Beziehungen heraus, daß es sich um den kleinen Zeh einer Frau handelt, der von einem Hund verdaut worden ist. Eine dazugehörige Leiche gibt es allerdings nicht im ganzen Arrondissement - dafür eine Menge Hundehalter, die zu beobachten und deren Gewohnheiten herauszufinden Kehlweiler sich vornimmt. Mit Hilfe der drei wissenschaftlich tätigen, wenn auch arbeitslosen junge Historiker Mathias, Marc und Lucien stößt er schließlich auf einen Pitbull-Besitzer und leidenschaftlichen Sammler alter Schreibmaschinen, der allwöchentlich zwischen Paris und der Bretagne pendelt. Und in Port-Nicolas, einem trostlosen bretonischen Hafenstädtchen, ist in der Tat vor wenigen Tagen eine Frau von der Steilküste gestürzt.
»Knochentrocken selbst in den absurdesten Momenten und voller Wahnsinns-Typen.« Frankfurter Rundschau
»Mörderisch menschlich, mörderisch gut.« Frankfurter Rundschau
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Fred Vargas
Das Orakelvon Port-Nicolas
Kriminalroman
Aus dem Französischenvon Tobias Scheffel
Inhaltsübersicht
Über Fred Vargas
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Impressum
1
»Was machst du denn hier im Viertel?«
Die alte Marthe schwatzte gern ein bißchen. An diesem Abend hatte sie wenig Gelegenheit dazu gehabt und sich daher am Tresen auf ein Kreuzworträtsel gestürzt, zusammen mit dem Wirt. Der Wirt war ein braver Mann, aber bei Kreuzworträtseln konnte er einen rasend machen. Seine Antworten lagen immer daneben, er hielt die Regeln nicht ein, er achtete nicht auf die Anzahl der Felder. Dabei hätte er von Nutzen sein können, er kannte sich in Geographie aus, was komisch war, weil er Paris nie verlassen hatte, genausowenig wie Marthe. Für Fluß in Rußland mit zwei Buchstaben, senkrecht, hatte er »Jenissej« vorgeschlagen.
Na ja, das war besser, als überhaupt nicht zu reden.
Gegen elf hatte Louis Kehlweiler das Café betreten. Zwei Monate hatte Marthe ihn jetzt schon nicht mehr gesehen, und im Grunde hatte er ihr gefehlt. Kehlweiler hatte eine Münze in den Flipper geworfen, und Marthe verfolgte den Lauf der dicken Kugel. Dieses Idiotenspiel, mit einem Spalt, der extra dazu da war, die Kugel zu verlieren, mit einer Schräge, die es mit unaufhörlichen Bemühungen zu überwinden galt und die man, kaum war sie erklommen, geradewegs wieder hinunterstürzte, um sich in dem Spalt zu verlieren, der extra dazu da war, – dieses Spiel hatte sie schon immer verdrossen. Es schien ihr, daß die Maschine im Grunde ständig Moralpredigten hielt, eine strenge, ungerechte und deprimierende Moral. Und wenn man ihr mal aus berechtigtem Zorn einen Fausthieb versetzte, tiltete sie, und man wurde bestraft. Und dafür mußte man auch noch zahlen. Man hatte durchaus versucht, ihr zu erklären, daß es sich dabei um ein Vergnügungsspiel handele, aber da war nichts zu machen, es erinnerte sie an ihren Religionsunterricht.
»Also? Was machst du hier im Viertel?«
»Ich bin gekommen, um nach was zu sehen«, sagte Louis. »Vincent ist was aufgefallen.«
»Etwas, das sich lohnt?«
Louis antwortete nicht, er mußte sich konzentrieren, die Flipperkugel rollte geradewegs auf das Nichts zu. Er erwischte sie mit einer Klappe, und sie bewegte sich träge klackernd wieder hinauf.
»Du spielst lahm«, bemerkte Marthe.
»Stimmt, aber du redest ja auch die ganze Zeit.«
»Muß man ja. Wenn du deinen Religionsunterricht da betreibst, verstehst du nicht, was man dir sagt. Du hast mir nicht geantwortet. Etwas, das sich lohnt?«
»Kann sein. Wird sich zeigen.«
»Was ist es? Politisch, zwielichtig, unbestimmt?«
»Gröl nicht so rum, Marthe. Eines Tages kriegst du noch Schwierigkeiten. Sagen wir, was Ultrareaktionäres an einem Ort, wo man es nicht vermuten würde. Das beschäftigt mich.«
»Was Richtiges?«
»Ja, Marthe. Was Richtiges, mit Siegel und allem Drum und Dran. Natürlich muß man’s noch überprüfen.«
»Wo ist das? Bei welcher Bank?«
»Bank 102.«
Louis lächelte und startete eine Kugel. Marthe dachte nach. Sie fand sich nicht mehr zurecht, sie war aus der Übung. Sie verwechselte Bank 102 mit den Bänken 107 und 98. Louis hatte es einfacher gefunden, den öffentlichen Bänken in Paris, die ihm als Beobachtungsstationen dienten, Nummern zuzuteilen. Den interessanten Bänken, versteht sich. Tatsächlich war das praktischer, als ihre genaue topographische Lage im einzelnen aufzulisten, um so mehr, als die Lage von Bänken im allgemeinen ungenau ist. Aber im Laufe von zwanzig Jahren hatte es Veränderungen gegeben, Bänke, die in Ruhestand geschickt wurden, und neue, um die man sich kümmern mußte. Man hatte auch Bäume numerieren müssen, wenn an Schlüsselstellen der Hauptstadt keine Bänke vorhanden waren. Es gab auch vorübergehende Bänke für kleinere Geschichten. So war man schließlich bei Nr. 137 angekommen, weil eine frühere Nummer nie wiederverwendet wurde, und das vermischte sich nun in ihrem Kopf. Aber Louis war dagegen, daß man sich Notizen machte.
»Ist 102 die mit dem Blumenhändler dahinter?« fragte Marthe stirnrunzelnd.
»Nein, das ist die 107.«
»Mist«, bemerkte Marthe. »Gib mir wenigstens einen aus.«
»Hol dir an der Bar, was du willst. Ich hab noch drei Kugeln zu spielen.«
Marthe war nicht mehr so leistungsfähig. Mit siebzig Jahren konnte sie nicht mehr so wie früher zwischen zwei Kunden in der Stadt umherstreifen. Und außerdem verwechselte sie die Bänke. Aber sie war eben Marthe. Sie brachte nicht mehr viele Informationen, aber sie hatte ein hervorragendes Gespür. Ihr letzter Tip war bestimmt zehn Jahre her. Er hatte einen ordentlich heilsamen Schock ausgelöst, und das war ja das Wichtigste.
»Du trinkst zuviel, meine Liebe«, bemerkte Louis, während er am Abzug des Flippers zog.
»Kümmer dich um deine Kugel, Ludwig.«
Marthe nannte ihn Ludwig, und andere nannten ihn Louis. Jeder, wie er wollte, das war er gewohnt. Fünfzig Jahre schwankten die Leute jetzt von einem Vornamen zum anderen. Es gab sogar welche, die nannten ihn Louis-Ludwig. Er fand das idiotisch, niemand heißt Ludwig-Ludwig.
»Hast du Bufo mitgebracht?« fragte Marthe, als sie mit einem Glas zurückkam.
»Du weißt genau, daß ihr Cafés Angst einjagen.«
»Geht’s ihr gut? Klappt’s immer noch mit euch beiden?«
»Es ist die große Liebe, Marthe.«
Für einen Moment herrschte Schweigen.
»Man sieht deine Freundin gar nicht mehr«, begann Marthe dann und stützte sich mit dem Ellbogen auf den Flipper.
»Sie ist abgehauen. Nimm deinen Ellbogen da weg, ich seh nichts mehr.«
»Wann?«
»Nimm deinen Ellbogen da weg, verdammt! Heute nachmittag, sie hat ihre Sachen gepackt, als ich weg war, und hat einen Brief auf dem Bett dagelassen. Na bitte, wegen dir ist jetzt die Kugel weg.«
»Das liegt an deinem lahmen Spiel. Hast du heute mittag wenigstens was gegessen? Wie war der Brief?«
»Erbärmlich. Ja, ich hab gegessen.«
»Es ist nicht leicht, großartige Briefe zu schreiben, wenn man abhaut.«
»Warum? Man braucht bloß zu reden, anstatt zu schreiben.«
Louis lächelte Marthe zu und schlug mit der flachen Hand gegen die Seite des Flippers. Wirklich ein erbärmlicher Brief. O. k., Sonia war gegangen, das war ihr gutes Recht, da brauchte man jetzt nicht ständig drauf zurückzukommen. Sie war gegangen, er war traurig, und das war alles. Die Welt war wüst genug, da mußte er sich nicht wegen einer Frau aufregen, die gegangen war. Obwohl … Traurig war das natürlich schon.
»Mach dir deswegen keinen Kopf«, sagte Marthe.
»Es tut weh. Und dann gab es dieses Experiment, erinnerst du dich? Es ist schiefgegangen.«
»Was hast du dir erhofft? Daß sie nur wegen deiner Visage bleiben würde? Ich sag nicht, daß du häßlich bist, leg mir nicht in den Mund, was ich nicht gesagt habe.«
»Ich mach ja gar nichts.«
»Aber grüne Augen und all so was reichen nicht aus, Ludwig. Ich hatte auch welche. Und dein steifes Knie ist offengestanden ein Handicap. Es gibt Mädchen, die mögen keine hinkenden Männer. Das nervt sie, merk dir das.«
»Schon geschehen.«
»Mach dir keinen Kopf.«
Louis lachte und strich zärtlich über Marthes alte Hand.
»Ich mach mir keinen Kopf.«
»Wenn du es sagst … Willst du, daß ich zur Bank 102 gehe?«
»Mach, wie du willst, Marthe. Ich bin nicht der Eigentümer der Pariser Bänke.«
»Du könntest nicht zufällig von Zeit zu Zeit mal Anweisungen erteilen?«
»Nein.«
»Na, da schadest du dir selbst. Das Erteilen von Anweisungen verleiht einem Mann ein gewisses Flair. Aber, natürlich, da du schon nicht gehorchen kannst, wüßte ich nicht, wie du befehlen können solltest.«
»Natürlich.«
»Hab ich dir das nicht schon mal gesagt? Diese Methode?«
»Hundertmal, Marthe.«
»Gute Methoden sind unverwüstlich.«
Natürlich hätte er Sonias Weggang verhindern können. Aber er hatte sich auf das idiotische Experiment »Der Mann, wie er ist« eingelassen, und das Ergebnis lag nun vor ihm, sie war nach fünf Monaten abgehauen. O. k., es reichte jetzt, er hatte genug daran gedacht, er war traurig genug, die Welt war wüst genug, er hatte zu tun, in den kleinen Angelegenheiten dieser Welt genau wie in den großen, da konnte man nicht stundenlang an Sonia und ihren erbärmlichen Brief denken, da mußte anderes getan werden. Aber da oben, in diesem verdammten Ministerium, wo er sich so lange als begehrtes, gehaßtes, unentbehrliches und teuer bezahltes freies Elektron herumgetrieben hatte, warf man ihn raus. Neue Köpfe saßen dort, neue Köpfe von alten Idioten – übrigens nicht alles Idioten, das war das Ärgerliche daran –, die auf die Hilfe von jemandem, der ein bißchen zu gut Bescheid wußte, nicht mehr scharf waren. Sie entließen ihn, sie hegten Mißtrauen, zu Recht. Aber ihre Reaktion war absurd.
Nehmen wir zum Beispiel eine Fliege.
»Nimm zum Beispiel eine Fliege«, sagte Louis.
Louis war mit seinem Spiel fertig. Ein durchschnittliches Ergebnis. Diese neuen Geräte, bei denen man zugleich den Schirm und die Kugel beobachten mußte, waren nervtötend. Aber manchmal begannen die Kugeln in Dreier- oder Vierergruppen gleichzeitig zu rollen, und das war interessant, was immer Marthe auch dazu sagte. Er stützte sich auf die Theke, während er darauf wartete, daß Marthe ihr Bier ausgetrunken hatte.
Als bei Sonia die ersten Zeichen des Aufbruchs erkennbar wurden, war er versucht gewesen, ihr zu erzählen, was er in den Ministerien, auf den Straßen, bei den Gerichten, in den Cafés, in der Provinz und in den Büros der Bullen so gemacht hatte. Fünfundzwanzig Jahre Minenräumung nannte er das, Treibjagd auf steinerne Männer und widerliche Gedanken. Zwanzig Jahre Wachsamkeit und zu viele Begegnungen mit Männern mit steinigen Hirnen, die als Einzelgänger umherstreiften, in Gruppen operierten, als Horde gröhlten, dieselben Steine in den Köpfen, dieselben Gemetzel an den Händen, Scheiße. Als Minenräumer hätte Sonia ihn geliebt. Sie wäre vielleicht geblieben, sogar trotz seines steifen Knies, das er sich beim Brand eines vom organisierten Verbrechen betriebenen Hotels in der Nähe von Antibes versengt hatte. Das verleiht einem Mann ein gewisses Flair. Aber er hatte widerstanden und hatte nicht das geringste erzählt. Als einzigen Reiz hatte er nur seine Knochen und sein Wort geboten, als Test. Was das Knie anging, so glaubte Sonia, er sei eine Metrotreppe hinuntergefallen. Solche Sachen machen einen Mann kaputt. Marthe hatte ihn gewarnt, er werde noch enttäuscht werden, Frauen seien nicht besser als alle anderen, da solle man keine Wunder erwarten. Vermutlich hatte auch Bufo die Sache nicht gerade leichter gemacht.
»Genehmigen wir uns einen, Ludwig?«
»Du hast genug getrunken, ich begleite dich nach Hause.«
Nicht, daß Marthe irgendwas riskieren würde, da sie keinen Sou besaß und in ihrem Leben schon viel erlebt hatte, aber wenn es nachts regnete und sie ein bißchen betrunken war, neigte sie dazu, auf die Schnauze zu fallen.
»Was ist nun mit deiner Fliege?« fragte Marthe, als sie die Bar verließen und sie sich mit einer Hand eine Plastiktüte über den Kopf hielt.
»Du hast von einer Fliege gesprochen.«
»Hast du neuerdings Angst vor dem Regen?«
»Das ist wegen meiner Tönung. Wie seh ich aus, wenn das alles rausläuft?«
»Wie eine alte Nutte.«
»Die ich bin.«
»Die du bist.«
Marthe lachte. Ihr Lachen war seit einem halben Jahrhundert im ganzen Viertel bekannt. Ein Mann drehte sich um und deutete vage einen Gruß an.
»Du kannst dir nicht vorstellen«, bemerkte Marthe, »wie der vor dreißig Jahren ausgesehen hat. Ich sag dir nicht, wer das ist, das mache ich nie.«
»Ich weiß, wer er ist«, erwiderte Louis lächelnd.
»Sag mal, Ludwig, ich hoffe, du schnüffelst nicht in meinem Adreßbuch rum? Du weißt, daß ich die Regeln meines Berufs respektiere.«
»Und ich hoffe, daß du das nur sagst, um zu schwatzen.«
»Ja, um zu schwatzen.«
»Trotzdem könnte das Adreßbuch Typen interessieren, die weniger gewissenhaft sind als ich, Marthe. Du solltest es vernichten, das hab ich dir schon hundertmal gesagt.«
»Das sind zu viele Erinnerungen. Diese ganze Hautevolee, die an meine Tür geklopft hat, das mußt du dir mal vorstellen …«
»Vernichte es, sag ich dir. Das ist riskant.«
»Was denkst du denn! Die sind alle alt geworden … Wen sollten die Alten denn noch interessieren?«
»Eine Menge Leute. Wenn du wenigstens nur die Namen hättest, aber du hast doch auch deine kleinen Notizen dazu gemacht, nicht wahr, Marthe?«
»Sag mal, Ludwig, machst du nicht auch hier und da kleine Notizen?«
»Red doch leiser, Marthe, wir sind nicht auf dem flachen Land.«
Marthe hatte schon immer zu laut geredet.
»Na? Kleine Notizbücher? Untersuchungen? Erinnerungen an Minenräumungen? Hast du das vielleicht alles weggeworfen, nachdem sie dich da oben rausgeschmissen haben? Übrigens, bist du wirklich rausgeschmissen worden?«
»Sieht so aus. Aber ich habe noch Beziehungen. Sie werden Schwierigkeiten haben, mich loszuwerden. Nimm zum Beispiel eine Fliege.«
»Meinetwegen, aber ich bin völlig k. o. Kann ich dich was fragen? Dieser verdammte Fluß in Rußland, der immer wieder kommt, mit zwei Buchstaben, sagt dir das was?«
»Der Ob, Marthe, das hab ich dir schon hundertmal gesagt.«
Kehlweiler setzte Marthe vor ihrem Haus ab, hörte, wie sie die Treppe hinaufging, und betrat das Café an der Avenue. Es war fast ein Uhr nachts, es waren nicht mehr viele Leute da. Nachzügler wie er. Er kannte sie alle, sein Gedächtnis dürstete immer nach Gesichtern und Namen, dauernd verlangte und bettelte es nach mehr. Was im Ministerium übrigens mit Sorge betrachtet wurde.
Ein Bier noch, und dann würde er sich wegen Sonia keinen Kopf mehr machen. Er hätte ihr auch von seiner großen Armee erzählen können, ungefähr hundert Männer und Frauen, auf die Verlaß war, ein Blick in jedes Departement, und dazu noch etwa zwanzig in Paris, Minenräumung kann man nicht allein betreiben. Sonia wäre vielleicht geblieben. Mist.
Nehmen wir also eine Fliege. Die Fliege ist ins Haus geflogen und macht alle wahnsinnig. Tausende von Flügelschlägen in der Sekunde. So eine Fliege ist tüchtig, aber sie macht einen wahnsinnig. Fliegt in alle Richtungen, läuft so mir nichts, dir nichts an der Decke herum, kommt überall hin, wo sie nicht hin soll, und findet vor allem auch noch den winzigsten Honigklecks. Sie fällt allen auf den Wecker. Genau wie er. Er fand den Honig dort, wo alle dachten, gut saubergemacht und keinerlei Spur hinterlassen zu haben. Honig oder Scheiße, natürlich, einer Fliege ist alles gleich. Die idiotische Reaktion besteht darin, die Fliege rauszuschmeißen. Das ist der Fehler. Denn was macht die Fliege, kaum ist sie draußen?
Louis Kehlweiler bezahlte sein Bier, nickte allen zu und verließ die Bar. Er hatte nicht die geringste Lust, nach Hause zu gehen. Er würde sich auf Bank 102 setzen. Ganz zu Anfang hatte er vier Bänke gehabt, jetzt waren es 137 plus 64 Bäume. Seitdem er über diese Bänke und Kastanien verfügte, hatte er haufenweise Sachen aufgeschnappt. Auch das hätte er erzählen können, aber er hatte widerstanden. Es goß jetzt in Strömen.
Denn was macht die Fliege, kaum ist sie draußen? Sie macht ein paar Minuten blöd rum, das versteht sich von selbst, und dann paart sie sich. Und dann legt sie Eier. Danach hat man Tausende von kleinen Fliegen, die größer werden, blöd rummachen und sich dann paaren. Also gibt es nichts Inkonsequenteres, als eine Fliege loswerden zu wollen, indem man sie rauswirft. Man muß sie drinnen lassen, sie ihre Fliegensachen machen lassen und sich in Geduld fassen, bis sie alt und müde wird. Während eine Fliege draußen Bedrohung und große Gefahr bedeutet. Und diese Trottel hatten ihn rausgeworfen. Als ob er aufhören würde, kaum daß er draußen wäre! Im Gegenteil, es würde noch schlimmer kommen. Und natürlich konnten sie sich nicht erlauben, mit einem Lappen nach ihm zu schlagen, wie man es bisweilen mit einer Fliege tut.
Unter prasselndem Regen kam Kehlweiler in Sichtweite von Bank 102. Gutes Gelände, direkt gegenüber dem Wohnsitz des Neffen eines sehr verschwiegenen Abgeordneten. Kehlweiler konnte aussehen wie jemand ziemlich Heruntergekommenes, das wirkte bei ihm recht natürlich, und so ein großer, verwahrloster Körper auf einer Bank machte niemanden mißtrauisch. Nicht einmal, wenn dieser große Körper mit langsamen Schritten eine kleine Bespitzelungstour unternahm.
Er blieb stehen und verzog das Gesicht. Ein Hund hatte sein Gelände versaut. Dort, auf dem Baumgitter, am Fuß der Bank. Louis Kehlweiler mochte es nicht, wenn man ihm seine Standorte verpestete. Er wäre beinahe umgekehrt. Aber die Welt war wüst genug, und er würde nicht vor einer lächerlichen Hundescheiße zurückweichen.
Mittags hatte er auf dieser Bank gegessen, und das Gelände war unberührt. Jetzt, am Abend, war eine Frau abgehauen, hatte ein erbärmlicher Brief auf dem Bett gelegen, hatte es ein durchschnittliches Ergebnis beim Flippern und ein verdrecktes Gelände gegeben, und es herrschte vage Hoffnungslosigkeit.
Zuviel Bier heute abend, durchaus möglich, er behauptete nicht das Gegenteil. Und kein Mensch auf der Straße bei diesem strömendem Regen, der zumindest die Bürgersteige, die Baumgitter und den Posten 102 reinigen würde; vielleicht auch seinen Kopf. Wenn Vincent ihn richtig informiert hatte, bekam der Neffe des Abgeordneten seit ein paar Wochen Besuch von einer obskuren Person, die ihn interessierte. Er wollte mal sehen. Aber heute abend kein Licht in den Fenstern, keinerlei Bewegung.
Er schützte sich unter seiner Jacke vor dem Regen und schrieb ein paar Zeilen in ein Notizheft. Marthe sollte ihres beseitigen. Um es richtig zu machen, müßte man es ihr mit Gewalt entreißen. Marthe war – kein Mensch würde es glauben – die schönste Animierdame des gesamten 5. Arrondissements gewesen, nach allem, was man ihm erzählt hatte. Kehlweiler warf einen Blick auf das Baumgitter. Er wollte aufbrechen. Nicht, daß er zurückwich, aber es reichte für diesen Abend, er wollte schlafen. Natürlich könnte er morgen in aller Frühe wieder da sein. Man hatte ihm gegenüber oft die Schönheit des Morgengrauens gepriesen, aber Kehlweiler schlief gern. Und wenn er schlafen wollte, gab es kaum ein Argument, das dem standhielt. Manchmal sogar war die Welt verwüstet, und er wollte trotzdem schlafen. So war das, er leitete daraus weder Ruhm noch Schmach ab, obwohl, manchmal schon, aber er konnte nichts dafür, und das hatte ihm nicht wenig Ärger und sogar Mißerfolge eingebracht. Er zahlte für seinen Anteil am Schlaf. Die Zukunft gehört den Frühaufstehern, hieß es. Was idiotisch ist, denn die Zukunft wird auch von jenen überwacht, die spät zu Bett gehen. Morgen könnte er gegen elf da sein.
2
So zu töten, das hätten nur die wenigsten verstanden. Aber Vorsicht. Jetzt geht es darum, genau, geschickt, ja brillant vorzugehen. Die Brillanz in der Diskretion zu üben ist das Geheimnis der Dinge. Wie bescheuert die Leute sein können, unglaublich. Georges, ein gutes Beispiel, ich sage Georges, aber es gibt auch andere. Was für ein erbärmlicher Wicht, dieser Typ.
Das war nur ein Beispiel.
Vorsicht, nicht öfter lächeln als gewöhnlich, viel üben, Präzision. Die Methode hat bereits zu mustergültigen Ergebnissen geführt, sie muß peinlich genau angewandt werden. Den Kiefer locker hängen lassen, Wangen und Augen träge hängen lassen. Die Brillanz unter der Gleichgültigkeit des Alltäglichen üben, unter einer leicht ermüdeten Normalität. Nicht ganz leicht, wenn man zufrieden ist. An diesem Abend ist es mehr als Zufriedenheit, es ist beinahe – völlig berechtigtes – Frohlocken. Sehr schade, daß man es nicht so richtig genießen kann, die Gelegenheit bietet sich nicht oft. Aber das kommt nicht in Frage, bloß nicht so blöd sein. Wenn ein erbärmlicher Wicht verliebt ist, merkt man es ihm an, und wenn ein Mörder zufrieden ist, dann ist das an seinem ganzen Körper ablesbar. Am nächsten Tag steht die Polizei da, und dann ist Schluß. Um zu töten, muß man was anderes sein als ein erbärmlicher Wicht, darin liegt das Geheimnis der Dinge. Viel üben, Präzision, Strenge, und niemand wird auch nur das geringste bemerken. Das Recht, zu genießen und zu frohlocken, kommt später dran, in einem Jahr, ganz unauffällig.
Die Gleichgültigkeit pflegen und das Vergnügen verbergen. Auf diese Weise zu töten, unsichtbar und rasch zuzuschlagen, da oben auf den Felsen – wie viele hätten das gekonnt? Die Alte hat nichts kommen sehen. Brillant, was die Schlichtheit angeht. Man sagt, Mörder verspüren den Drang, die anderen wissen zu lassen, daß sie es waren. Sie können nicht umhin, sich zu zeigen, sonst sei ihr Vergnügen verdorben. Noch schlimmer sei es, wenn man einen anderen an ihrer Stelle festnimmt, eine alte Falle, um sie aus dem Bau zu locken. Sie könnten es nicht ertragen, daß man ihnen sozusagen ihren Mord stiehlt. Ach was. So was ist gut für erbärmliche Wichte. Nein, so dumm bin ich nicht. Sollen sie zwanzig andere festnehmen, ich werde nicht mal mit der Wimper zucken. Darin liegt das Geheimnis. Aber man wird niemanden festnehmen, man wird nicht mal an einen Mord denken.
Dieses Bedürfnis zu lächeln, zu genießen, ganz legitim. Aber genau das nicht, geschickt sein. Ordentlich den Kiefer hängen lassen, friedlich sein. Darin liegt alles.
Zum Beispiel ans Meer denken. Eine erste Welle, eine zweite Welle, es steigt, es fällt, und so weiter. Sehr entspannend das Meer, sehr regelmäßig. Erheblich besser als Schäfchenzählen, um sich zu entspannen, was primär ein System für die erbärmlichen Wichte ist, die nicht nachdenken. Das erste Schaf geht ja noch. Es springt über sein Hindernis und rennt auf die linke Seite des Kopfes. Und wohin verschwindet dieses erbärmliche Wesen? Es versteckt sich auf der linken Seite des Gehirns, über dem Ohr. Die Sache verschlechtert sich ab dem zweiten Schaf, das natürlich weniger Platz hat als das vorherige, um zu verschwinden. Sehr schnell hat man einen Haufen Schafe links vom Hindernis, den neu hinzugekommenen gelingt es nicht mehr zu springen, am Ende stürzt der ganze Haufen unter lautem Blöken zusammen, es ist ein Greuel, da schneidet man ihnen lieber gleich die Kehle durch. Das Meer ist sehr viel besser. Es steigt, es fällt, unaufhörlich und einfach so. Wie dumm, dieses Meer. Und im Grunde auch irritierend, in seiner immensen Nutzlosigkeit. Vom Mond hingezogen und wieder zurückgezogen, unfähig, seinen Willen geltend zu machen. Das beste wäre natürlich, an den Mord zu denken. Wenn ich ihn in Gedanken noch einmal durchgehe, muß ich lachen – und lachen ist für alles hervorragend. Nein, nicht so dumm sein, oberstes Gebot: vergessen, nicht an den Mord denken.
Rechnen wir. Morgen werden sie anfangen, die Alte zu suchen. Bis die Leiche zwischen den Felsen gefunden wird, wo im November niemand vorbeikommt, ist ein weiterer Tag, sicher zwei, gewonnen. Dann wird es nicht mehr möglich sein, den genauen Zeitpunkt des Todes festzustellen. Fügen wir noch Wind, Regen und Flut hinzu, nicht zu vergessen die Möwen, das wäre perfekt. Schon wieder dieses Lächeln. Genau das vermeiden, wie auch vermeiden, daß die Hände sich zu Fäusten ballen und sich wieder öffnen, was immer nach einem Mord passiert. Fünf, sechs Wochen lang dringt einem der Mord aus den Fingern. Außer dem Kiefer auch die Hände hängen lassen, keine Einzelheit unkontrolliert lassen, Strenge. All diese erbärmlichen Wichte, die sich wegen übermäßiger Nervosität erwischen lassen, wegen Ticks, wegen Selbstzufriedenheit, wegen Exhibitionismus oder aus übermäßiger Gleichgültigkeit, einfache Schwächlinge, die nicht mal in der Lage sind, sich zu benehmen. Aber so dumm bin ich nicht. Wenn sie mir die Nachricht überbringen werden, mich dafür interessieren, sogar bewegt sein. Beim Gehen darauf achten, ordentlich die Arme hängen zu lassen, in aller Ruhe weiter meinen Geschäften nachgehen. Rechnen wir. Morgen werden sie die Suche beginnen – Gendarmen und sicherlich Freiwillige. Mich den Freiwilligen anschließen? Nein, so dumm nun wieder nicht. Mörder mischen sich zu häufig unter die Freiwilligen. Jeder weiß, daß selbst die bescheuertsten Gendarmen mißtrauisch sind und eine Liste mit den Namen der Freiwilligen aufstellen.
Die Brillanz üben. Die Arbeit ganz wie üblich machen, normal lächeln, die Arme hängen lassen und sich erkundigen, mehr nicht. Diese Spannung der Finger korrigieren, es ist jetzt bestimmt nicht der Moment, Krämpfe zu kriegen, natürlich nicht, und es ist nicht meine Art, gewiß nicht. Sehr auf die Lippen und die Hände achten, das ist das Geheimnis der Dinge. Die Hände in die Taschen stecken oder gewandt die Arme verschränken. Nicht öfter als sonst auch.
Darauf achten, was in der Umgebung geschieht, die anderen beobachten, aber ganz normal, nicht wie jene Mörder, die sich vorstellen, daß die kleinste Einzelheit sie betrifft. Aber auch den Einzelheiten Aufmerksamkeit schenken. Alle Vorsichtsmaßnahmen sind getroffen, aber man muß immer mit den Idioten dieser Erde rechnen. Immer. In Betracht ziehen, daß ein Idiot irgend etwas hätte bemerken können. Voraussehen, darin liegt das Geheimnis. Und wenn jemand auf den Gedanken kommen sollte, die Nase in diese Angelegenheit zu stecken, wird er dran glauben müssen. Je weniger erbärmliche Wichte es auf der Erde gibt, desto besser. Er wird dran glauben müssen, wie die anderen. Schon jetzt daran denken.
3
Um elf Uhr setzte sich Louis Kehlweiler auf Bank 102. Vincent war da und blätterte in einer Zeitung.
»Hast du im Augenblick nichts anderes zu tun?« fragte ihn Louis.
»Ein paar Artikel in der Mache … Wenn da drin was geschieht«, sagte er, ohne das Gesicht in Richtung des Gebäudes gegenüber zu heben, »läßt du mich dann die Reportage schreiben?«
»Natürlich. Aber du hältst mich auf dem laufenden.«
»Natürlich.«
Kehlweiler zog ein Buch und Blätter aus einer Plastiktüte. Der Herbst war nicht warm, und es gelang ihm nicht, auf der vom nächtlichen Regen noch feuchten Bank eine gute Arbeitsposition zu finden.
»Was übersetzt du?« fragte Vincent.
»Ein Buch über das Dritte Reich.«
»In welche Richtung?«
»Vom Deutschen ins Französische.«
»Bringt das was ein?«
»Nicht wenig. Es stört dich doch nicht, wenn ich Bufo auf die Bank setze?«
»Überhaupt nicht«, erwiderte Vincent.
»Aber stör sie nicht, sie schläft.«
»Ich bin nicht so bescheuert, mich mit einer Kröte zu unterhalten.«
»Das sagt man so, und manchmal kommt man soweit.«
»Redest du viel mit ihr?«
»Ständig. Bufo weiß alles, sie ist ein Tresor, ein lebender Skandal. Sag mal, hast du heute morgen irgend jemanden in der Nähe der Bank gesehen?«
»Redest du mit mir oder mit deiner Kröte?«
»Meine Kröte war heute morgen noch nicht auf. Also mit dir.«
»Gut. Ich hab niemanden hier an der Bank gesehen. Na ja, jedenfalls nicht nach halb acht. Außer der alten Marthe, wir haben ein paar Worte gewechselt, und sie ist verschwunden.«
Vincent hatte inzwischen eine kleine Schere herausgeholt und schnitt Artikel aus einem Stapel Tageszeitungen aus.
»Machst du jetzt dasselbe wie ich? Schneidest du alles aus?«
»Der Schüler muß seinen Lehrer nachahmen, bis er ihm auf die Nerven geht und der Lehrer ihn rausschmeißt, das Zeichen dafür, daß der Schüler bereit ist, seinerseits Lehrer zu werden, nicht wahr? Geh ich dir jetzt zum Beispiel auf die Nerven?«
»Nicht im geringsten. Aber du kümmerst dich nicht ausreichend um die Provinz«, sagte Kehlweiler, während er den Stapel Zeitungen durchblätterte, die Vincent neben sich gelegt hatte. »Zuviel Paris.«
»Ich habe keine Zeit. Ich hab nicht wie du Typen, die mir schon vorbereitete Sachen aus allen Ecken Frankreichs schicken, ich bin kein alter Bonze. Später mal werd ich auch meine verborgene Truppe haben. Wer sind die Leute deiner Großen Armee?«
»Männer wie du, Frauen wie du, Journalisten, politisch Aktive, Neugierige, Untätige, Im-Dreck-Wühler, Richter, Cafébesitzer, Philosophen, Bullen, Zeitungsverkäufer, Maroni-Verkäufer …«
»Das reicht«, sagte Vincent.
Kehlweiler warf rasche Blicke auf das Baumgitter, auf Vincent, auf die Umgebung.
»Hast du was verloren?« fragte Vincent.
»In gewisser Weise ja. Und was ich mit der einen Hand verloren habe, glaube ich mit der anderen wieder zurückzuholen. Bist du sicher, daß sich heute morgen niemand hier hingesetzt hat? Bist du bei deiner Lektüre auch nicht eingeschlafen?«
»Nach sieben Uhr morgens schlafe ich nicht wieder ein.«
»Großartig.«
»Die regionale Presse«, fuhr Vincent eigensinnig fort, »das ist bürgerliches Recht, das führt zu nichts, es sind doch immer wieder dieselben privaten kleinen Delikte, die interessieren mich nicht.«
»Und damit liegst du falsch. Ein vorsätzliches Verbrechen, eine private Verleumdung, eine kleine willkürliche Anschuldigung führen durchaus irgendwohin, auf einen großen Misthaufen, auf dem Sauereien in großem Maßstab und gemeinschaftlicher Konsens gären. Besser, man kümmert sich um alles, ohne auszusortieren. Ich bin Generalist.«
Vincent brummte etwas, während Kehlweiler aufstand, um sich das Baumgitter anzusehen. Vincent kannte Kehlweilers Theorien genau, unter anderem die Geschichte mit der linken und der rechten Hand. Die linke Hand, verkündete Louis, hob die Arme und spreizte die Finger, ist unvollkommen, ungeschickt, zögernd und folglich die nützliche Hervorbringerin von Verwirrung und Zweifel. Die rechte Hand ist die sichere, entschlossene, die Bewahrerin des Könnens, Führerin des menschlichen Genies. Bei ihr liegen Beherrschung, Methode und Logik. Vorsicht, Vincent, jetzt mußt du mir genau folgen: Kaum neigst du ein bißchen zu stark zu deiner rechten Hand, nur zwei Schritt mehr, und schon sprießen Strenge und Gewißheit, siehst du sie? Geh noch ein bißchen weiter, drei Schritt mehr, und es kommt das tragische Umkippen in die Perfektion, ins Tadellose und dann ins Unfehlbare und Erbarmungslose. Dann bist du nur noch ein halber Mann, der extrem auf seine rechte Seite geneigt läuft, des hohen Wertes der Verwirrung nicht bewußt, ein ärgerlicher Schwachkopf, der den Tugenden des Zweifels nicht zugänglich ist. Das kann auf hinterhältigere Weise kommen, als du dir vorstellst, glaub nicht, daß du geschützt bist, man muß auf sich aufpassen, du hast zwei Hände, die sind nicht nur zum Anschauen da. Vincent lächelte und bewegte seine Hände. Er hatte gelernt, die geneigt laufenden Menschen zu suchen, aber er wollte sich nur um Politisches kümmern, während Louis sich immer um alles gekümmert hatte. Einstweilen lehnte Louis noch immer am Baum, den Blick auf das Gitter gerichtet.
»Was machst du da?« fragte Vincent.
»Siehst du dieses weißliche Ding da auf dem Baumgitter?«
»Halbwegs.«
»Ich hätte gern, daß du mir das bringst. Mit meinem Knie kann ich nicht in die Hocke gehen.«
Vincent stand seufzend auf. Er hatte die Vorschläge Kehlweilers, des geistigen Vorbilds in Sachen Verwirrung, nie in Frage gestellt, da würde er nicht jetzt damit anfangen.
»Nimm ein Taschentuch, ich glaube, es stinkt.«
Vincent schüttelte den Kopf und reichte Kehlweiler die zerbrechliche Kleinigkeit in einem Stück Zeitung, weil er kein Taschentuch hatte. Er setzte sich wieder auf die Bank, nahm seine Schere und ignorierte Kehlweiler; alles Entgegenkommen hat Grenzen. Aber aus den Augenwinkeln beobachtete er, wie Kehlweiler die Kleinigkeit in dem Zeitungspapier in alle Richtungen drehte.
»Vincent?«
»Ja?«
»Es hat doch heute morgen nicht geregnet?«
»Nicht seit zwei Uhr morgens.«
Vincent hatte mit dem täglichen Wetterbericht für eine Stadtteilzeitung angefangen, und noch immer lauerte er jeden Tag auf die Vorhersage. Er wußte eine Menge über die Ursachen dafür, warum das Wasser vom Himmel fällt oder oben hängenbleibt.
»Und heute morgen war niemand hier, da bist du dir sicher? Nicht einmal jemand, der seinen Hund zum Pinkeln an den Baum geführt hätte?«
»Du zwingst mich, zehnmal dieselben Sachen zu sagen. Das einzige Wesen, das sich genähert hat, war Marthe. Hast du nichts an Marthe bemerkt?« fügte Vincent hinzu, während er den Kopf in der Zeitung versenkte und sich dann die Nägel mit der Schere reinigte. »Anscheinend hast du sie gestern gesehen.«
»Ja, ich war im Café, eine Partie Religionsunterricht spielen.«
»Hast du sie nach Hause begleitet?«
»Ja«, antwortete Kehlweiler, der sich wieder hingesetzt hatte und noch immer die Kleinigkeit im Zeitungspapier anstarrte.
»Und hast du nichts bemerkt?« fragte Vincent leicht aggressiv.
»Sagen wir mal, sie war nicht gerade in Hochform.«
»Ist das alles?«
»Ja.«
»Ist das alles?« rief Vincent heftig. »Du hältst Vorträge über die globale Bedeutung kleiner häuslicher Morde, du sorgst dich um deine Kröte, du verbringst eine Viertelstunde damit, ein Stück Abfall anzustarren, das auf einem Baumgitter klebt, aber bei Marthe, bei Marthe, die du seit zwanzig Jahren kennst, hast du nichts bemerkt? Bravo, Louis, bravo, hervorragend!«
Kehlweiler warf ihm einen lebhaften Blick zu. Zu spät, sagte sich Vincent, egal, Scheiße. Kehlweilers grüne Augen unter dunklen Brauen, die wie übertrieben geschminkt wirkten, konnten sich von verträumter Verschwommenheit zu furchtbarer, schneidender Intensität wandeln. Gleichzeitig verzogen sich die Lippen zu einem Strich, und all die gewöhnliche Sanftheit machte sich davon wie eine Wolke auffliegender Spatzen. Kehlweilers Gesicht erinnerte dann an jene majestätischen Profile, die in kalte Medaillen gestochen werden und überhaupt nicht spaßig sind. Vincent schüttelte den Kopf, wie wenn man eine Wespe vertreibt.
»Erzähl«, sagte Kehlweiler nur.
»Marthe lebt seit einer Woche auf der Straße. Sie haben alle Dienstmädchenzimmer übernommen, um sie in Luxusapartments umzubauen. Der neue Besitzer hat sie alle rausgeschmissen, alle.«
»Warum hat sie mir nichts gesagt? Sie werden doch wohl vorher benachrichtigt worden sein, oder? Hör auf, du tust dir noch weh mit der Schere.«
»Sie haben gekämpft, um ihre Buden zu behalten, und sind rausgeschmissen worden.«
»Aber warum hat sie mir nichts gesagt?« wiederholte Louis lauter.
»Weil sie stolz ist, weil sie sich schämt, weil sie Angst vor dir hat!«
»Armes Dummchen! Und du? Hättest du mir nichts erzählen können? Verdammt noch mal, hör mit deiner Schere auf! Deine Nägel sind sauber, oder?«