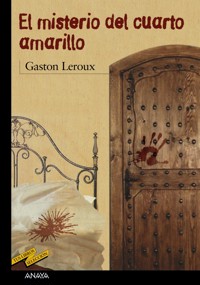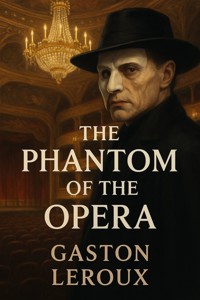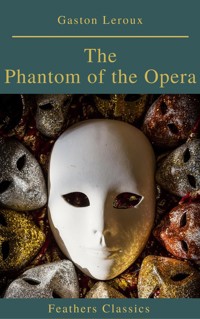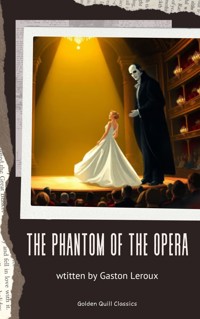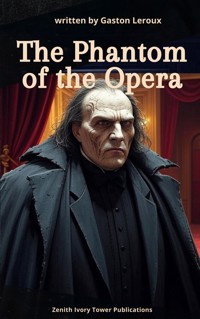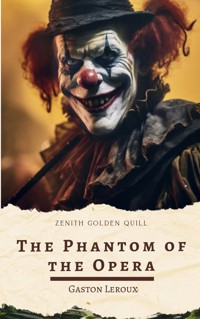Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Krimis bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Ein weiterer Kriminalfall mit dem zwielichtigen Frédéric Larsan und dem Reporter Joseph Rouletabille. Mathilde Stangerson und Robert Darzac, nach den abenteuerlichen Erlebnissen aus "Das Geheimnis des gelben Zimmers" nun frisch verheiratet, fahren zu ihren Freunden Edith und Arthur Rance nach Château d'Hercule. Aber der geheimnisvolle Larsan taucht wieder auf ihrem Weg auf und terrorisiert weiterhin die schöne Mathilde. Rouletabille, unterstützt vom treuen Sainclair, untersucht, wie Larsan es gelungen ist, in das Château einzudringen. Wieder ein Schloss, wieder ein geheimnisvolles Verbrechen, und wieder eine Gruppe von Menschen, von denen jeder der Täter sein könnte. Die Verfilmung von 2005 war in Frankreich ein großer Erfolg. Gaston Louis Alfred Leroux war ein französischer Journalist und Schriftsteller. Weltbekannt ist er vor allem durch seinen Roman "Das Phantom der Oper". Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Gaston Leroux
Das Parfüm der Dame in Schwarz
Gaston Leroux
Das Parfüm der Dame in Schwarz
(Le Parfum de la dame en noir)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]ßnoten und Übersetzung: Jürgen SchulzeÜbersetzung: Anne-Marie Nauheimer 2. Auflage, ISBN 978-3-962814-96-0
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel – Ein Anfang wie ein Ende
Zweites Kapitel – Das Parfüm der Dame in Schwarz
Drittes Kapitel – Im Hafen von Marseille
Viertes Kapitel – Panik im Schlafwagen
Fünftes Kapitel – Der Henker des Meeres
Sechstes Kapitel – Geheimnisvolle Vorbereitungen im Château d’Hercule
Siebentes Kapitel – Die unerwartete Ankunft des »alten Bob«
Achtes Kapitel – Der Tag des elften April
Neuntes Kapitel – Der Angriff auf den viereckigen Turm
Zehntes Kapitel – Der geheimnisvolle Tote
Elftes Kapitel – Der Mann im Wandschrank
Zwölftes Kapitel – Der Kartoffelsack und ein Seufzer in der Nacht
Dreizehntes Kapitel – Die Entdeckung Australiens und das Abenteuer des alten Bob
Vierzehntes Kapitel – Der König der Schrecken
Fünfzehntes Kapitel – Der Überzählige
Nachwort
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Krimis bei Null Papier
Der Frauenmörder
Eine Detektivin
Hemmungslos
Der Mann, der zu viel wusste
Noch mehr Detektivgeschichten
Sherlock Holmes – Sammlung
Eine Kriminalgeschichte & Das graue Haus in der Rue Richelieu
Der Doppelmord in der Rue Morgue
Indische Kriminalerzählungen
Kriminalgeschichten
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erstes Kapitel – Ein Anfang wie ein Ende
Am 6. April fand in Paris in der Kirche Saint Nicolas du Cardonnet die Trauung von Robert Darzac und Mathilde Stangerson in aller Stille statt. Es waren kaum zwei Jahre verflossen seit den Ereignissen, die ich in dem Buche: »Das geheimnisvolle Zimmer« erzählt habe. Um die Trauungsfeierlichkeiten geheim zu halten, hatte man eine abgelegene Kirche gewählt und nur ein paar Freunde von Robert Darzac und Professor Stangerson, auf deren Verschwiegenheit man sich verlassen konnte, eingeladen.
Als ich die Kirche betrat und die Anwesenden musterte, wunderte ich mich, dass Joseph Rouletabille noch nicht da war. Aber er musste jeden Augenblick kommen.
Inzwischen näherte ich mich den beiden Rechtsanwälten – Robert und Hesse –, die leise ihre Erinnerungen über die merkwürdigen Begebenheiten bei dem Versailler Prozess damals austauschten, die die bevorstehende Feierlichkeit in ihnen wieder wachrief. Rechtsanwalt Robert meinte, dass selbst der günstige Ausgang des Versailler Prozesses ihn noch nicht über das Schicksal von Robert Darzac und Mathilde Stangerson beruhigt habe. In Sicherheit hielt er sie erst seit der offiziell bestätigten Nachricht von dem Tode ihres furchtbaren Feindes Frédéric Larsan.
Einige Monate nach der Freisprechung Darzacs nämlich hatten die Zeitungen den Untergang der »Dordogne«, des Postdampfers der Linie Havre–New York gemeldet. Ein Dreimaster war nachts bei der Neufundlandbank im Nebel auf die »Dordogne« gestoßen und mit seinem Vorderteil in den Maschinenraum des Postdampfers gedrungen. Während der kenternde Dreimaster abgetrieben wurde, war der Postdampfer binnen zehn Minuten gesunken. Mit knapper Not hatten etwa dreißig Passagiere, deren Kabinen sich auf dem Deck befanden, in die Rettungsboote springen können. Sie wurden von einem Fischerboot aufgenommen, das in St. Jacot einlief. In den nächsten Tagen warf der Ozean Hunderte von Leichen ans Land. Unter ihnen befand sich Larsan. Die Dokumente, die man in den Kleidern des Toten fand, bewiesen einwandfrei, dass Larsan tot war.
Mathilde Stangerson war also endlich befreit von diesem abenteuerlichen Gatten, den sie als ganz junges, unerfahrenes, leichtgläubiges Mädchen unter dem Schutze der weitherzigen amerikanischen Gesetze heimlich geheiratet hatte. Dieser gefährliche Verbrecher, dessen wahrer Name Ballmeyer in den Gerichtsstatistiken eine berüchtigte Rolle spielte, und der sie unter dem Namen Jean Roussel geheiratet hatte, konnte nun nicht mehr zwischen Mathilde und den Mann treten, den sie seit vielen Jahren liebte.
In meinem bereits genannten Buch habe ich alle Einzelheiten dieses Prozesses erzählt. Er war wohl einer der eigenartigsten in der Geschichte des Schwurgerichtes, und er hätte den tragischsten Ausgang für die Familie nehmen können ohne das Eingreifen von Joseph Rouletabille. Dieser kleine achtzehnjährige Journalist war der einzige, der hinter dem berühmten Beamten der Sicherheitspolizei, Frédéric Larsan, die Züge von Ballmeyer entdeckte.
Der plötzliche Tod dieses Elenden schien nun aber all den traurigen Ereignissen ein Ende gemacht zu haben, und er hatte auch die schnelle Gesundung von Mathilde Stangerson zur Folge, deren Geisteszustand durch die Schrecken schwer erschüttert gewesen war.
»Sehen Sie, lieber Freund«, sagte Rechtsanwalt Robert zu seinem Kollegen Hesse, dessen Blicke unruhig in der Kirche umherschweiften, »sehen Sie, man muss immer optimistisch sein. Alles wird wieder gut – selbst das Unglück von Fräulein Stangerson. Aber warum sehen Sie sich denn die ganze Zeit so um? Wen suchen Sie? Erwarten Sie jemanden?«
»Ja«, erwiderte Hesse, »ja. Ich erwarte Frédéric Larsan!«
Robert musste trotz der Würde des Ortes lachen. Aber mir war durchaus nicht zum Lachen zumute, denn ich konnte Hesses Gefühl nur allzu gut nachempfinden. Allerdings war ich weit davon entfernt, all das Schreckliche vorauszusehen, das uns bedrohte, aber wenn ich mich in die damalige Situation zurückversetze, da ich noch nichts von all dem wusste, was ich seither erlebt habe, so ist mir noch dieses eigenartige Gefühl gegenwärtig, das mich damals bei der Erwähnung Larsans ergriff.
»Nun, nun, Sainclair«, flüsterte Robert mir zu, der jedenfalls eine unwillkürliche Bewegung von mir aufgefangen hatte. »Sie sehen doch, dass Hesse Spaß macht.«
»Wer weiß«, sagte ich.
Und wie vorher Hesse, spähte auch ich jetzt aufmerksam umher. Larsan wurde, als er sich noch Ballmeyer nannte, so oft totgesagt – wer weiß, ob er nicht als Larsan noch einmal aufersteht?
»Ah, da ist Rouletabille«, sagte Robert, »ich wette, dass er sich nicht solche Gedanken macht wie Sie.«
»Aber er sieht sehr bleich aus«, bemerkte Hesse.
Der junge Journalist näherte sich uns. Zerstreut drückte er uns die Hand.
»Guten Tag, Sainclair! Guten Tag, meine Herren! Ich komme doch nicht zu spät?«
Mir schien, als ob seine Stimme zitterte. Er verließ uns sofort, und ich sah, wie er in einem Betstuhl niederkniete. Er hielt sein Gesicht, das in der Tat außerordentlich bleich war, in den Händen verborgen und schien zu beten. Dann sah ich, wie er sich wieder erhob und sich in den Schatten eines Pfeilers zurückzog. Ich folgte ihm nicht, denn ich bemerkte, dass er allein sein wollte.
In diesem Augenblick betrat Mathilde Stangerson am Arm ihres Vaters die Kirche. Robert Darzac schritt hinter ihr. Wie verändert sie waren! Das Drama von Glandier hatte sie mit allzu schmerzhaftem Griff gepackt. Wessen ich mich genau entsinne, das ist der seltsame Ausdruck, den ihre Augen annahmen, als sie den nicht zwischen uns sah, den sie suchte. Sie schien erst ihre Ruhe und Selbstbeherrschung wiederzufinden, als sie endlich Rouletabille hinter einem Pfeiler entdeckte. Sie lächelte ihm zu, dann auch uns.
»Sie hat immer noch diesen irrsinnigen Blick!«
Ich wandte mich rasch um. Wer hatte diese abscheulichen Worte gesagt? Es war Brignolles, ein weitläufiger Verwandter Darzacs, ein unsympathischer Bursche, der durch die Fürsprache Robert Darzacs die Stelle seines Assistenten in dem Laboratorium der Sorbonne erhalten hatte.
Außer ihm kannten wir keine Verwandten von Robert Darzac, dessen Familie aus dem Süden stammte. Er hatte schon früh seine Eltern verloren, besaß keine Geschwister und hatte keinerlei Verbindung mehr mit seiner Heimat.
Vor einem Jahr etwa hatte er seinen Schülern Brignolles vorgestellt. Er war geradewegs aus Aix gekommen, wo er eine Stelle als Laboratoriumsassistent innegehabt hatte, aber wegen irgendeines Disziplinarvergehens plötzlich auf die Straße gesetzt worden war. Damals hatte er sich rechtzeitig seiner Verwandtschaft mit Darzac erinnert. Er war direkt nach Paris gefahren und hatte es so gut verstanden, das Herz des jungen Professors zu rühren und sein Mitleid zu erregen, dass dieser seine Anstellung durchsetzte.
Zu jener Zeit stand es mit der Gesundheit Darzacs nicht gerade günstig. Die Rückwirkungen der furchtbaren Aufregungen des Prozesses machten sich geltend, aber man hoffte, dass die von den Ärzten in Aussicht gestellte Heilung Mathildes und die baldige Heirat einen guten Einfluss auf seinen Zustand haben würden. Wir mussten jedoch leider im Gegenteil feststellen, dass seit der Ankunft Brignolles, von dessen Hilfe Darzac doch eine Entlastung erhofft hatte, seine Schwäche sich noch vermehrte.
Überhaupt schien ihm Brignolles kein Glück zu bringen. Zweimal hintereinander gab es beim Experimentieren Unfälle. Das erste Mal platzte eine Geißlersche Röhre, deren Splitter Darzac ernstlich hätten verletzen können, statt dessen aber Brignolles an den Händen Verwundungen beibrachten; das nächste Mal explodierte eine kleine Spirituslampe, über die sich Darzac gerade gebeugt hatte. Die Flammen hätten ihm das Gesicht verbrennen können, glücklicherweise versengten sie ihm nur die Wimpern. Es stellten sich dadurch aber Sehstörungen ein, sodass seine Augen das Tageslicht nur mehr schlecht ertrugen.
Seit den rätselhaften Ereignissen von Glandier befand ich mich in einem Geisteszustand, der mich hinter den einfachsten Begebenheiten etwas Übernatürliches vermuten ließ. Der letzte Unfall geschah in meiner Gegenwart, als ich gerade Darzac zur Universität abholen wollte. Ich brachte unsern Freund zu einem Arzt, nachdem ich Brignolles’ Begleitung, die er uns anbot, kurz zurückgewiesen hatte.
Unterwegs fragte mich Darzac, warum ich den armen Brignolles so schlecht behandelt hätte. Ich sagte ihm, dass ich den Burschen erstens nicht leiden könne, weil seine Manieren mir nicht gefielen, und zweitens, weil er meiner Ansicht nach an dem Unfall schuld sei. Darzac wollte meine Beweisgründe dafür wissen, und als ich ihm keine geben konnte, lachte er mich aus. Aber er lachte nicht mehr, als der Doktor ihm sagte, er hätte leicht sein Augenlicht einbüßen können, und es sei ein Wunder, dass er so gut davongekommen sei.
Die Unruhe, die Brignolles in mir erweckte, war sicher lächerlich, denn die Unfälle wiederholten sich nicht. Aber dennoch – ich habe nun einmal eine Voreingenommenheit gegen ihn, und ich schrieb es ihm allein zu, dass die Gesundheit Darzacs sich nicht bessern wollte. Zu Beginn des Winters hustete Darzac so stark, dass wir alle ihn baten, Urlaub zu nehmen, um sich im Süden gründlich zu erholen. Die Ärzte rieten ihm zu einem Aufenthalt in San Remo. Er fügte sich schließlich, und acht Tage nach seiner Abreise schrieb er uns, dass er sich schon viel wohler fühle.
Er blieb vier Monate dort und kam fast völlig geheilt zurück. Nur seine Augen waren noch schwach und bedurften größter Schonung. Rouletabille und ich waren übereingekommen, Brignolles scharf zu beobachten, und waren daher sehr froh, als wir hörten, dass die Hochzeit sofort stattfinden sollte, und Darzac mit seiner Frau eine große Reise machen würde, die ihn lange Zeit fernhalten würde von Paris und – von Brignolles.
Und nun war Darzac endlich am Ziel! Aber erst hier in der Kirche hatten wir zum ersten Male einen richtigen Eindruck von seinem Glück, denn in der kurzen Zeit, die zwischen seiner Rückkehr und seiner Hochzeit lag, hatten wir ihn kaum gesehen. Er schien wie umgewandelt. Mit berechtigtem Stolz trug er seine leicht gebeugte Gestalt höher aufgerichtet, es war, als ob das Glück ihn größer und schöner erscheinen ließ.
»Gott sei Dank, dass wir soweit sind«, seufzte Rechtsanwalt Hesse, als wir die Sakristei durchschritten, »ich atme auf.«
»Warum denn?« fragte Rechtsanwalt Robert.
Und Hesse gestand ihm, dass er bis zur letzten Minute gefürchtet hätte, dass der Verstorbene doch noch auftauchen würde.
»Was wollen Sie?« sagte er zu seinem Kollegen. »Ich kann mir nun einmal nicht vorstellen, dass Frédéric Larsan wirklich tot ist.«
Wir waren alle – etwa zehn Personen – jetzt in der Sakristei versammelt. Während die Zeugen den Trauakt unterschrieben, gratulierten die anderen den Neuvermählten. Die Sakristei war noch dunkler als die Kirche selbst, und ich glaubte zuerst, diese Dunkelheit sei schuld, dass ich Rouletabille nirgends sah. Aber der Raum war zu klein, als dass ich ihn hätte übersehen können. Da Mathilde schon zweimal nach ihm gefragt hatte, bat mich Robert Darzac, ihn zu suchen. Ich ging, aber ich kehrte, ohne ihn gefunden zu haben, zur Sakristei zurück.
»Das ist sonderbar«, meinte Darzac, »und unerklärlich. Sind Sie sicher, sich überall umgesehen zu haben? Er sitzt vielleicht in irgendeinem Winkel und träumt.«
»Ich habe ihn überall gesucht und sogar gerufen«, erwiderte ich.
Aber Darzac gab sich nicht mit meiner Auskunft zufrieden. Er begab sich selbst auf die Suche und hatte mehr Glück als ich. Von einem an der Kirchentür stehenden Bettler erfuhr er, dass ein junger Mann, der niemand anders als Rouletabille sein konnte, vor einigen Minuten die Kirche verlassen hätte und in einer Droschke fortgefahren sei. Seine junge Frau war über diese Nachricht unbeschreiblich niedergeschlagen.
Sie rief mich zu sich: »Sie wissen doch, mein lieber Herr Sainclair«, sagte sie, »dass wir in zwei Stunden vom Lyoner Bahnhof abreisen. Suchen Sie doch unseren jungen Freund und bringen Sie ihn mir. Sagen Sie ihm, wie sehr mich sein sonderbares Wesen beunruhigt.«
»Verlassen Sie sich auf mich«, sagte ich. Und unverzüglich machte ich mich auf, Rouletabille zu suchen. Aber ich kam wieder unverrichteter Sache auf den Bahnhof. Weder in seiner Wohnung noch in der Zeitung, noch im Café, das er aus Berufsgründen um diese Tageszeit zu besuchen pflegte, hatte ich ihn entdecken können. Niemand wusste mir Auskunft zu geben, wo er zu finden sein könnte.
Auf dem Bahnsteig traf ich zuerst Darzac, der mit der Besorgung des Gepäcks und der Plätze beschäftigt war, Professor Stangerson, der einige Zeit in Nieuton bei seinem Assistenten Arthur Rance verbringen wollte, sollte bis Dijon mit dem jungen Ehepaar fahren. Dieses beabsichtigte dann, von dort aus allein seine Reise über Culoz und den Mont Cenis fortzusetzen.
Darzac war sehr betrübt über meine Nachricht und bat mich, sie selbst seiner Frau zu überbringen. Sie begann zu weinen, und als ich ihr tröstend sagte, Rouletabille würde sicher noch vor Abgang des Zuges eintreffen, schüttelte sie den Kopf:
»Nein, nein! Er kommt nicht mehr!«
Und sie stieg in ihr Abteil. –
Es waren noch drei Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. Obwohl wir fast die Hoffnung aufgegeben hatten, dass Rouletabille noch käme, spähten wir dennoch prüfend den Bahnsteig entlang, ob nicht doch noch unter den herbeieilenden Nachzüglern das Gesicht unseres jungen Freundes auftauchen würde. Schon hörte man das Knallen zuschlagender Türen, die kurzen Aufforderungen der Bahnhofsbeamten: »Alles einsteigen«, das scharf pfeifende Abfahrtssignal, das Fauchen der Lokomotive … und der Zug setzte sich in Bewegung.
Kein Rouletabille hatte sich sehen lassen. Wir waren so betrübt und zugleich so bekümmert, dass wir dastanden und Frau Darzac anstarrten, ohne daran zu denken, uns von ihr zu verabschieden. Sie warf noch einmal einen langen Blick auf den Bahnsteig, und als der Zug schneller zu fahren begann und ihr jede Hoffnung schwand, ihren jungen Freund vor der Abreise noch einmal zu sehen, reichte sie mir einen Brief durch das Fenster.
»Für ihn«, sagte sie. »Leben Sie wohl, lieber Freund! Hoffentlich auf Wiedersehen!« –
Als ich den Bahnhof verließ, fühlte ich mich von einer eigenartigen Traurigkeit befallen, deren Ursache ich mir nicht recht erklären konnte.
All die Launen, Grillen und Wunderlichkeiten Rouletabilles im Laufe dieser zwei Jahre kamen mir in den Sinn, aber sie gaben mir keinerlei Aufklärung über sein eigenartiges Benehmen von heute. Wo steckte Rouletabille? Ich nahm den Weg nach seiner Wohnung auf dem Boulevard St. Michel, indem ich mir sagte, dass, wenn ich ihn nicht antreffen würde, ich wenigstens den Brief von Frau Darzac dort lassen könnte. Wie groß war aber meine Verblüffung, als ich im Hausflur meinen Diener sah, der meinen eigenen Koffer in der Hand trug.
Ich fragte ihn, was dies zu bedeuten habe. Das wisse er nicht, antwortete er, ich müsse Herrn Rouletabille fragen. Nun stellte sich heraus, dass, während ich Rouletabille überall gesucht hatte – außer natürlich bei mir –, er in meine Wohnung gegangen war, sich dort von meinem Diener einen Koffer hatte geben lassen, in den er alles hineingepackt hatte, was ein anständiger Mensch auf einer vier- bis fünftägigen Reise braucht. Darauf hatte er meinem Esel von Diener befohlen, dies Gepäck in einer Stunde in seine Wohnung zu tragen – und da war er nun!
In einem Sprung war ich in Rouletabilles Zimmer und fand ihn damit beschäftigt, seinen Koffer zu packen. Vor der Beendigung dieser Arbeit war aus Rouletabille nichts herauszukriegen, denn in den kleinen Dingen des täglichen Lebens war er ungemein pedantisch, und trotz seiner bescheidenen Einkünfte hielt er sehr auf Korrektheit und hasste alles, was an Boheme streifte.
Endlich geruhte er, mir zu verkünden, dass wir zusammen »in Ferien gehen würden«, und zwar würden wir, da ich frei sei und seine Zeitung L’Epoque ihm drei Tage Urlaub gegeben hätte, die Osterfeiertage »am Meer« verbringen. Ich gab ihm gar keine Antwort, so entrüstet war ich über sein Benehmen. Welch blödsinnige Idee, um diese Jahreszeit ans Meer zu gehen, wo die Frühlingsmonate oft kälter und unfreundlicher sind als der Winter! Aber Rouletabille schien sich über mein Schweigen nicht gerade aufzuregen. Er nahm meinen Koffer in die eine Hand, den seinen in die andere, lief mir voran die Treppe hinunter und ließ mich unten in eine Droschke einsteigen, die vor dem Hause wartete. Eine halbe Stunde später befanden wir uns in einem Abteil erster Klasse in dem Zuge, der über Amiens nach Tréport fährt.
Als wir in den Bahnhof von Creil einfuhren, sagte Rouletabille endlich:
»Warum gibst du mir nicht den Brief, den du für mich hast?«
Ich sah ihn an. Er wusste also, wie sehr es Frau Darzac schmerzte, ihn bei ihrer Abfahrt nicht mehr gesehen zu haben, und dass sie ihm schreiben würde.
»Weil du ihn nicht verdienst«, gab ich ihm zur Antwort.
Und ich machte ihm bittere Vorwürfe, auf die er jedoch nicht achtgab. Er versuchte nicht einmal, sich zu verteidigen, und das machte mich noch zorniger. Schließlich gab ich ihm den Brief. Er nahm ihn, führte ihn an sein Gesicht und atmete sein zartes Parfüm ein. Als er sich von mir beobachtet sah, runzelte er die Brauen, um hinter dieser Miene seine große Erregung zu verbergen, und lehnte seine Stirn an die Fensterscheibe, als sei er in ein gründliches Studium der Landschaft versunken.
»Warum liest du ihn denn nicht?« fragte ich.
»Nein«, sagte er, »hier nicht, erst wenn wir dort sind.«
Nach einer sechsstündigen endlosen Fahrt kamen wir in Tréport an. Es war stockfinstere Nacht und ein Hundewetter. Wir froren und der Seewind fegte über den verödeten Bahnsteig. Vor dem Bahnhof war natürlich kein Wagen zu sehen. Ein paar Lampen warfen ihren zitternden Schein über die großen Regenlachen, in die wir um die Wette hineinpatschten. Wenn wir nicht in das schwarze Loch des Hafens fielen, kam es nur daher, weil das Geräusch der Flut, das aus der Tiefe aufstieg, uns vor der Gefahr warnte.
Ich ging schimpfend hinter Rouletabille her, der Mühe hatte, uns durch die feuchte Dunkelheit den Weg zu bahnen. Dennoch schien er den Ort gut zu kennen, denn wir erreichten rasch und ohne Umwege das einzige zu dieser Jahreszeit geöffnete Hotel am Strand. Rouletabille bestellte sofort ein warmes Abendessen, denn wir waren durchfroren und mordshungrig.
»Nun also«, begann ich, »wirst du endlich geruhen, mir mitzuteilen, was wir an diesem Ort zu suchen haben außer Rheumatismus und Lungenentzündung?«
Denn Rouletabille hustete schon.
»Ich will es dir sagen. Wir wollen das Parfüm der Dame in Schwarz suchen.« –
Am nächsten Morgen stand Rouletabille an meinem Bett und weckte mich. Ich sah in ein entsetztes Gesicht. Er reichte mir ein Telegramm, das von Bourg kam und ihm von Paris hierher nachgeschickt worden war. Ich las:
»Kommet unverzüglich. Geben unsere Orientreise auf. Wollen Stangerson in Mentone1 wiedertreffen. Haltet diese Depesche geheim. Niemand beunruhigen! Kommet unter irgendeinem Vorwand – aber schnell!
Darzac.«
französische Küstenstadt, direkt an der Grenze zu Italien <<<
Zweites Kapitel – Das Parfüm der Dame in Schwarz
»Da haben wir’s« rief ich, »das wundert mich übrigens nicht.«
»Du hast also nicht an seinen Tod geglaubt?« fragte Rouletabille aufgeregt.
»Nein«, antwortete ich. »Er hatte so viel Interesse daran, für tot zu gelten, dass es ihm auf das Opfer von ein paar Papieren bei dem Untergang der Dordogne nicht ankommen durfte. Aber was hast du, mein Lieber, bist du krank?«
Rouletabille war in einen Stuhl gesunken. Mit fast zitternder Stimme vertraute er mir an, dass auch er erst wirklich an Larsans Tod geglaubt habe, als die Trauung endgültig vollzogen war. Er glaubte nämlich fest, dass, wenn Larsan am Leben wäre, er niemals diese Heirat zwischen Mathilde und Darzac zugelassen hätte. Er hätte sich ja nur zu zeigen brauchen, um sie zu hintertreiben. Und dies hätte er auch bestimmt getan, trotz aller Gefahr, die ihm dabei gedroht hätte – so sicher wäre er seines Erfolges gewesen. Denn er kannte Mathildes religiöse Gefühle und wusste, dass sie nie eingewilligt hätte, ihr Schicksal an das eines anderen Mannes zu binden, solange der erste noch am Leben war – selbst wenn sie durch menschlichen Richterspruch von diesem geschieden war. Es wäre vergeblich gewesen, ihr zu beweisen, dass nach dem französischen Gesetz diese erste Ehe ungültig war; in ihren Augen war es nun einmal ein heiliges Gelübde, das sie für immer zur Frau eines Verbrechers gemacht hatte.
Rouletabille wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Und jetzt sollte er bis nach der Trauung gewartet haben, bis ein paar Stunden nach der Trauung, um wieder aufzutauchen?« rief er. »Denn nicht wahr, Sainclair, du glaubst doch auch, dass die Depesche von Darzac nichts anderes bedeuten kann, als dass der andere wieder da ist?«
»Es hat den Anschein. Aber Darzac hat sich vielleicht geirrt.«
»Darzac ist doch kein Kind, das sich fürchtet. Immerhin, wir wollen hoffen, dass er sich geirrt hat. Es wäre ja zu schrecklich! Nicht wahr, Sainclair, es ist immerhin möglich, dass er sich geirrt hat? Es wäre grauenhaft, zu grauenhaft!«
Niemals, selbst in den schlimmsten Augenblicken in Glandier, hatte ich Rouletabille so aufgeregt gesehen. Ich suchte ihn zu beruhigen, indem ich ihm vorstellte, wie unvernünftig es sei, sich so aufzuregen, nur auf ein Telegramm hin, das doch gar nichts beweise und vielleicht nur auf einer Einbildung beruhe. Noch dazu jetzt, wo wir alle unsere Kaltblütigkeit nötig hätten, dürfe man sich doch nicht auf so unverzeihliche Weise gehen lassen.
»Unverzeihlich, Sainclair? Wenn du wüsstest! – Aber du sollst alles erfahren! – Warum ist er nicht tot?«
»Wer sagt dir denn, dass er es nicht ist?«
»Höre Sainclair, du sollst alles erfahren – du sollst alles wissen, was ich weiß, und es wird dich ebenso erschüttern wie mich selbst.«
Aber anstatt zu erzählen, beschränkte er sich darauf, im Fahrplan zu blättern.
»Wir fahren um ein Uhr«, sagte er, »es gibt jetzt im Winter keinen direkten Zug zwischen Eu und Paris, wir werden also erst um sieben Uhr in Paris sein. Dort haben wir reichlich Zeit, unsere Koffer zu packen, und nehmen dann auf dem Lyoner Bahnhof den Neun-Uhr-Zug nach Marseille und Mentone.«
Er fragte mich nicht einmal, ob ich damit einverstanden sei. Er schleppte mich einfach nach Mentone, wie er mich nach Tréport geschleppt hatte. Er wusste nur zu gut, dass ich ihm unter den gegebenen Verhältnissen nichts abschlagen konnte. Übrigens war er in einem solchen Zustande, dass ich ihn auf keinen Fall allein gelassen hätte. Außerdem waren Gerichtsferien, sodass ich beruflich nicht behindert war.
»Wir fahren also nach Eu?« fragte ich.
»Ja, wir nehmen dann von dort aus den Zug nach Paris. Es ist höchstens eine halbe Stunde Wagenfahrt von Tréport nach Eu.«
»Das war kein allzu langer Aufenthalt in dieser Gegend«, sagte ich.
»Lange genug, hoffentlich, für das, was ich hier suchte.«
Ich dachte an das Parfüm der Dame in Schwarz und schwieg. Hatte er mir nicht gesagt, dass ich alles erfahren sollte?
Er führte mich auf die Mole. Der Wind blies so stark, dass wir hinter dem Leuchtturm Schutz suchen mussten.
»Hier habe ich sie zum letzten Mal gesehen«, sagte er endlich und deutete auf die Bank von Stein. »Hier saßen wir, und sie hat mich umarmt und geküsst. Ich war noch ganz klein, neun Jahre alt. Sie sagte mir, ich solle auf der Bank sitzen bleiben, und dann ist sie fortgegangen. Es war Abend, ein Sommerabend, am Tage war die Preisverteilung gewesen. Sie war nicht dabei, aber ich wusste, dass sie am Abend kommen würde. Ein Abend voller Sterne war’s, so hell, dass ich hoffte, einen Augenblick ihre Gesichtszüge unterscheiden zu können. Aber sie zog ihren Schleier wieder dicht zusammen und seufzte. Dann ist sie fortgegangen. Ich habe sie nie wiedergesehen.«
»Und du, mein Freund?«
»Ich?«
»Ja, was hast du gemacht? Bist du noch lange auf der Bank geblieben?«
»Ich hätte es gerne getan. Aber der Kutscher kam, um mich abzuholen, und ich musste heim.«
»Heim? Wohin denn?«
»Nun, in die Schule natürlich.«
»Ist denn eine Schule in Tréport?«
»Nein, aber in Eu. Ich bin in Eu in die Schule gegangen.« Er machte mir ein Zeichen, ihm zu folgen.
»Wir wollen hingehen«, sagte er. –
Eine halbe Stunde später waren wir in Eu. Der Wagen rollte über das holprige Pflaster des öden Marktplatzes. Wir stiegen aus. Über den Dächern des ausgestorbenen Städtchens hörte man eine Uhr schlagen. »Die Schuluhr«, sagte Rouletabille. Er zog mich durch eine enge Gasse, und ich fühlte seine fieberheiße Hand. Bald standen wir vor der steinernen, halbkreisförmigen Eingangspforte einer kleinen Kirche im jesuitischen Stil. »Die Kapelle der Schule«, sagte leise der junge Mann.
Sie war leer. Wir gingen schnell hindurch. Rouletabille stieß eine kleine Seitentür auf, die unter eine Art von Wetterdach führte.
»Das ist gut gegangen«, sagte er leise, »auf diese Weise kommen wir ins Gebäude hinein, ohne dass uns der Pförtner sieht. Vater Simon würde mich sicher wiedererkennen.«
»Wäre das denn so schlimm?«
In diesem Augenblick ging ein Mann vorn an dem Wetterdach vorbei, barhaupt, einen Bund Schlüssel in der Hand. Rouletabille drückte sich tiefer in den Schatten.
»Da ist Vater Simon. Wie alt er geworden ist! Er hat fast keine Haare mehr. Gib acht! Um diese Zeit fegt er den Arbeitsraum der Kleinen. Alle sind jetzt in ihren Klassen. Da werden wir ungestört sein. Aber halt, da kommt Vater Simon zurück!«
Als er wieder vorbei war, gelang es uns, einen kleinen, gartenartigen Hof zu erreichen, wo wir, hinter einigen Büschen versteckt, bequem Umschau halten konnten auf die weiten Höfe und die Gebäude der Anstalt.
Rouletabille packte mich am Arm.
»Siehst du, Sainclair, dort, das ist die Tür der unteren Klasse. Wie oft bin ich als Kind dort hindurchgegangen! Aber niemals in so seligem Gefühl, als wenn Vater Simon mich in den Empfangssaal holte, wo mich die Dame in Schwarz erwartete. – Wenn man nur den Empfangssaal nicht verändert hat.«
Und er streckte den Kopf vor.
»Nein, nein, sieh, das ist das Empfangszimmer, neben der Wölbung, die erste Tür rechts, dahin kam sie. Wir gehen hinein, sobald Vater Simon vorüber ist.
Ich glaube, ich werde verrückt, toll, nicht wahr? Aber ich kann nichts dafür. Der Gedanke, dass ich den Empfangssaal wiedersehen soll, wo sie mich erwartete. Ich lebte ja nur in der Hoffnung, sie zu sehen, und wenn sie fort war, verfiel ich jedes Mal in eine so tiefe Verzweiflung, dass man für meine Gesundheit fürchtete. Man konnte mich nur aus meiner Stumpfheit aufrütteln, indem man mir vorstellte, dass sie mich nicht wiedersehen könne, wenn ich krank würde. Bis zu ihrem nächsten Besuch blieb mir nur die Erinnerung an sie und ihr Parfüm. Da ich ihr liebes Gesicht nie gesehen habe, nur ihr Parfüm, wenn sie mich in die Arme nahm, gierig einsog, lebte ich weniger von ihrem Bild als von ihrem Duft. An den Tagen nach ihrem Besuch stahl ich mich während der Pausen heimlich in den leeren Empfangssaal und atmete andachtsvoll die Luft ein, und ich ging hinaus, das Herz voll von Wohlgeruch. Es war das zarteste, das feinste und dabei das natürlichste Parfüm der Welt. Ich dachte nicht, dass es mir je im Leben wieder begegnen würde – ja, bis damals – erinnerst du dich noch, Sainclair, bis zu dem Ball im Elysée.«
»Damals, als du Mathilde Stangerson kennenlerntest?«
»Ja«, antwortete er mit zitternder Stimme.
Wenn ich damals gewusst hätte, dass die Tochter Stangersons ein Kind aus erster Ehe gehabt hatte, einen Knaben, der im Alter Rouletabilles gewesen wäre, wenn er noch lebte, so hätte mir diese Reise Aufklärung gegeben, und ich hätte seine Erregung, seinen Schmerz, seine seltsame Verwirrung verstanden, und hätte begriffen, warum er den Namen Mathilde Stangerson so seltsam betonte, gerade in der Schule, in der ihn einst die Dame in Schwarz besuchte.
Wir schwiegen beide. Schließlich wagte ich die Stille zu unterbrechen.
»Und du hast niemals erfahren, warum die Dame in Schwarz nicht wiedergekommen ist?«
»Oh«, sagte Rouletabille, »ich bin überzeugt, dass sie wiedergekommen ist. Aber da war ich nicht mehr dort.«
»Wer hat dich denn abgeholt?«
»Niemand! Ich bin fortgelaufen.«
»Warum? Um sie zu suchen?«
»Nein, um vor ihr zu fliehen.«
»Wie unglücklich muss sie gewesen sein, als sie dich nicht mehr fand.«
Rouletabille schüttelte traurig den Kopf.
»Wie kann ich das wissen? Aber still! Da ist Vater Simon. So, jetzt ist er vorbei. Schnell in den Empfangssaal.«
In drei Schritten waren wir dort.
Es war ein ziemlich großer, nüchterner Raum mit ärmlichen weißen Vorhängen vor den kahlen Fenstern. Sechs Rohrstühle, die an den Wänden standen, ein Spiegel über dem Kamin und eine Wanduhr bildeten das ganze Mobiliar.
Als wir eintraten, nahm Rouletabille den Hut ab mit einer Bewegung frommer Andacht, wie in einer Kirche. Sein Gesicht war rot. Er wendete sich zu mir, und mit erregter Stimme, aber leise, noch leiser als vorhin in der Kapelle, sagte er:
»O Sainclair! Das ist er, der Empfangssaal. – Fasse meine Hände an, wie sie brennen! Ich bin ganz rot, nicht wahr? Ich war immer so rot, wenn ich hier hereinkam und wusste, dass ich sie sehen würde. Natürlich war ich gelaufen und ganz außer Atem, ich hatte es doch nicht erwarten können. Mein Herz schlägt wie damals, als ich klein war. Siehst du, hier an der Tür blieb ich stehen, ganz schüchtern, und ich sah ihren schwarzen Schatten dort in der Ecke. Dann streckte sie mir stumm die Arme entgegen, ich stürzte zu ihr, wir umarmten uns und weinten. – Sie war meine Mutter, Sainclair! Sie hat es mir aber nicht gesagt, im Gegenteil, sie sagte, meine Mutter sei gestorben, und sie sei ihre Freundin gewesen. Aber als sie mich bat, sie Mama zu nennen, da wusste ich, dass sie meine Mutter sei! Siehst du, hier saß sie immer, in diesem dunklen Winkel, und sie kam nur in der Dämmerung, wenn das Licht im Empfangssaal noch nicht angezündet war. Und wenn sie kam, legte sie immer hier auf das Fensterbrett ein weißes Paket, verschnürt mit einem rosa Bändchen. Da waren Windbeutel drin. Ich schwärmte für Windbeutel, Sainclair!«
Er verließ den Empfangssaal, ohne sich noch einmal umzusehen.
Ich folgte ihm. Wir kamen auf die verödete Straße; niemand hatte uns bemerkt. Dort hielt ich ihn an und fragte gespannt:
»Sage, Rouletabille, hast du das Parfüm der Dame in Schwarz wiedergefunden?«
Er musste merken, dass mein ganzes Herz in dieser Frage lag und der innige Wunsch, dieser Besuch an dem Ort seiner Kindheitserinnerungen möge ihm den Frieden seiner Seele wiedergegeben haben, denn er sagte sehr ernst:
»Ja, Sainclair, ich habe es wiedergefunden.«
Und er deutete auf den Brief von Mathilde Stangerson.
Da ich nicht wusste, was er damit sagen wollte und ihn fragend ansah, ergriff er meine beiden Hände, sah mir tief in die Augen und sagte:
»Ich will dir ein großes Geheimnis anvertrauen, Sainclair, das Geheimnis meines Lebens und vielleicht eines Tages das Geheimnis meines Todes. Was auch geschehen mag, es muss mit mir und mit dir sterben. Höre also: Mathilde Stangerson hatte ein Kind, einen Sohn. Dieser Sohn ist gestorben, er ist tot für alle – außer für dich und für mich!«
Bestürzt wich ich zurück, wie betäubt von einer solchen Enthüllung. Rouletabille – Mathilde Stangersons Sohn? Und plötzlich durchzuckte es mich noch heftiger, aber dann, ja, dann war ja Rouletabille der Sohn von Larsan!
Jetzt verstand ich Rouletabilles Seelenzustand, jetzt wusste ich, warum er in der Vorahnung der Wahrheit heute Morgen ausgerufen hatte: »Wenn er lebt, dann wünsche ich, ich wäre tot!«
Rouletabille las jedenfalls diese Gedanken in meinen Augen, denn er machte mir ein Zeichen, als wollte er sagen: Ja, ja, Sainclair, so ist es! Nun weißt du es! Und laut sagte er:
»Schweigen, nicht wahr?«
In Paris angekommen, trennten wir uns. Als wir uns ein paar Stunden später auf dem Bahnhof wieder trafen, reichte mir Rouletabille ein Telegramm, das aus Valence kam und von Professor Stangerson unterzeichnet war. Es lautete:
»Darzac sagt, dass Sie einige Tage Urlaub haben. Wir wären alle sehr glücklich, wenn Sie sie mit uns verleben würden. Wir erwarten Sie auf den roten Bergen bei Arthur Rance, der Ihnen gern seine Frau vorstellen möchte. Auch meine Tochter wäre glücklich, Sie wiederzusehen. Sie vereinigt ihre Bitte mit der meinen.« Kaum waren wir in den Zug gestiegen, als wir den Portier des Hauses, in dem Rouletabille wohnte, den Bahnsteig entlang eilen sahen. Er brachte eine dritte Depesche. Sie kam aus Mentone und war von Mathilde unterzeichnet. Sie enthielt nur die beiden Worte: »Zu Hilfe.«
Drittes Kapitel – Im Hafen von Marseille
Jetzt wusste ich alles. Rouletabille hatte mir die Geschichte seiner Kindheit erzählt, und ich verstand nun, warum er augenblicklich nichts so sehr fürchtete, als dass Mathilde sein Geheimnis erfahren könne. Aber ich konnte ihm keinen Rat geben, dem armen Burschen!