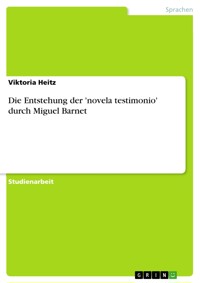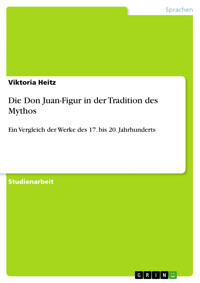13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,0, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Zu Beginn stellt sich die Frage, was Jugendsprache ist und was sie dazu macht. Diese Frage bzw. dieses Thema wurde bereits von zahlreichen Autoren aufgegriffen und ist für die Linguisten sogar derart wichtig, dass schon zahlreiche Wörterbücher mit jugendsprachlichen Ausdrücken erschienen sind, wie das 1984 erschienene „angesagt: scene – deutsch. Ein Wör-terbuch.“ von Michael Rittendorf, aus dem Jahre 2005 „Endgeil – das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache“ von Herrmann Ehrmann oder das im letzten Jahr neu erschienene „PONS Wörterbuch der Jugendsprache 2011“. Jedoch sei angemerkt, dass sich die genannten Wörter-bücher in ihrem Vokabular keinesfalls gleichen, da sich die Jugendsprache immer weiter entwickelt, weshalb viele Ausdrücke, die noch 1984 von Jugendlichen verwendet wurden, heutzutage in deren Sprachgebrauch nicht mehr vorkommen. Die Forschung in dem Bereich der Jugendsprache hat erst in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts konkrete Formen angenommen. Natürlich gab es schon immer Interesse an der Sprache Jugendlicher, doch eine linguistische Forschung entstand erst in der letzten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Ein Einblick in die Forschungsgeschichte sowie deren Ziel wird in Kapitel 2 behandelt. Ein Fehlschluss, der zu Beginn der Jugendsprachforschung auftrat und der ebenfalls durch die Wörterbücher vermittelt wird, ist, die Sprache der Jugend als eine einheitliche zu sehen. In den erwähnten Lexika werden oft nur allgemeingebräuchliche Ausdrücke aufgeführt, ohne auf das Alter, die Bildung, den Migrationshintergrund oder das Geschlecht einzugehen. Kapitel 3 der vorliegenden Arbeit behandelt konkret den Ausdruck Jugendsprache, was unter diesem Phänomen zu verstehen ist, sowie dessen Zusammensetzung. Darauf folgen die äußeren Einflussfaktoren (Kapitel 4) sowie die Motive für das Sprechen der Jugendsprache (Kapitel 5). Kapitel 6 beinhaltet den praktischen Teil der Arbeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
I. Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Geschichte der Forschung von Jugendsprache
4. Äußere Einflussfaktoren
4.1 Medien, Werbung und Musik
4.2 Fremdsprachen
5. Motive für das Sprechen
6. Merkmale und Beispiele der Jugendsprache
6.1 Wortbildung
6.2 Phraseologie
6.3 Syntax
6.4 Wortschatz
7. Zusammenfassung
8. Literaturverzeichnis
I. Abbildungsverzeichnis
Abbildung A.1: Variationsspektrum Jugendsprache (Quelle: Neuland 2000, 116)
Abbildung A.2: Jugendsprache und Sprachwandel (Quelle: Neuland 2000, 80)
Abbildung A.3: Medien als Promoter des sprachlichen Wandels (Quelle: Neuland 2008a, 84)
1. Einleitung
Zu Beginn stellt sich die Frage, was Jugendsprache ist und was sie dazu macht. Diese Frage bzw. dieses Thema wurde bereits von zahlreichen Autoren aufgegriffen und ist für die Linguisten sogar derart wichtig, dass schon zahlreiche Wörterbücher mit jugendsprachlichen Ausdrücken erschienen sind, wie das 1984 erschienene „angesagt: scene – deutsch. Ein Wörterbuch.“ von Michael Rittendorf, aus dem Jahre 2005 „Endgeil – das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache“ von Herrmann Ehrmann oder das im letzten Jahr neu erschienene „PONS Wörterbuch der Jugendsprache 2011“. Jedoch sei angemerkt, dass sich die genannten Wörterbücher in ihrem Vokabular keinesfalls gleichen, da sich die Jugendsprache immer weiter entwickelt, weshalb viele Ausdrücke, die noch 1984 von Jugendlichen verwendet wurden, heutzutage in deren Sprachgebrauch nicht mehr vorkommen.
Die Forschung in dem Bereich der Jugendsprache hat erst in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts konkrete Formen angenommen. Natürlich gab es schon immer Interesse an der Sprache Jugendlicher, doch eine linguistische Forschung entstand erst in der letzten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Ein Einblick in die Forschungsgeschichte sowie deren Ziel wird in Kapitel 2 behandelt.
Ein Fehlschluss, der zu Beginn der Jugendsprachforschung auftrat und der ebenfalls durch die Wörterbücher vermittelt wird, ist, die Sprache der Jugend als eine einheitliche zu sehen. In den erwähnten Lexika werden oft nur allgemeingebräuchliche Ausdrücke aufgeführt, ohne auf das Alter, die Bildung, den Migrationshintergrund oder das Geschlecht einzugehen.
Kapitel 3 der vorliegenden Arbeit behandelt konkret den Ausdruck Jugendsprache, was unter diesem Phänomen zu verstehen ist, sowie dessen Zusammensetzung. Darauf folgen die äußeren Einflussfaktoren (Kapitel 4) sowie die Motive für das Sprechen der Jugendsprache (Kapitel 5). Kapitel 6 beinhaltet den praktischen Teil der Arbeit, wobei neben verschiedenen Merkmalen auch Beispiele zu dem behandelten Phänomen herangezogen werden.
Ziel der Arbeit ist es, festzustellen, aus welchen Gründen es falsch ist, von einer einheitlichen Jugendsprache zu sprechen. Der Ausdruck Jugendsprache „[…] suggeriert, eine solche Sprechweise sei vergleichbar der Standardsprache (oder Schriftsprache), mit eigener Grammatik, differenziertem Wortschatz und normativer […] Geltung […]“[1]. Henne stellt fest, dass die Jugendsprache ein „[…] fortwährendes Ausweich- und Überholmanöver[…]“[2] bzw. eine
Abwandlung der Standardsprache ist.
2. Geschichte der Forschung von Jugendsprache
Obwohl die Forschung erst nach 1945 Form annahm, ist es falsch zu sagen, Jugendsprache gebe es erst seit dieser Zeit. Sicherlich sprachen die Jugendlichen aller Epochen, sei es die Urzeit, die Antike oder das Mittelalter, eine etwas andere Sprache als die ältere Generation, selbst wenn sie damals noch nicht erforscht wurde. Anfang der 80er Jahre schrieb Henne, es gebe keine linguistische Jugendsprachforschung.[3] Nun stellte sich die Frage, ob die Jugend tatsächlich eine andere Spreche spreche und die Forschung kam dadurch immer mehr in Schwung. Neuland stellt den Sachverhalt der langen Tradition von Jugendsprache folgendermaßen dar:
„In der öffentlichen Meinung wird Jugendsprache oft als neuzeitliches Phänomen der Gegenwartssprache angesehen. Kaum bis gar nicht ist bekannt, das Jugendliche auch zu früheren Zeiten einen ihnen eigenen Sprachstil ausgebildet haben, der sich von dem in der Gesellschaft vorherrschenden und von der älteren Generation verwendeten in bedeutsamer Weise unterschied.“[4]
Neuland stellt fest, dass schon im 16. Jahrhundert die Studentensprache als Vorläufer der Jugendsprache datiert wurde. Durch sie entwickelte sich die Burschensprache, welche ein Gemeinschaftsgefühl zwischen den Studierenden herstellte.[5] Ausdrücke, die aus der Zeit bis heute präsent sind, sind beispielsweise einschreiben, pumpen (Geld) und schwänzen. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war die Forschung „auf dürftige Quellenlage gelegentlicher literarischer Belege verwiesen, unter anderem in Zachariäs Renommist (1744), in Kortums Jobsiade (1784) und vor allem in den Lebensbeschreibungen des Magisters Laukhard (1792)“[6]. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde ausschließlich die Sprache der Männer untersucht. Erst zu Beginn des 19. Jahrhundert, als sich auch die ersten Universitäten für Mädchen öffneten, wurde langsam begonnen, deren Sprache ebenfalls genauer zu analysieren.