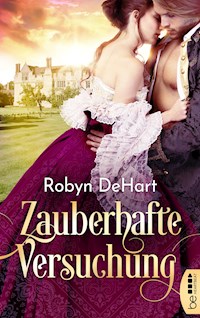4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Legend Hunters Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein großes Abenteuer um den wertvollsten aller Schätze: die Liebe!
Im sagenumwobenen Atlantis gab es einen großen Traum: den Jungbrunnen. Spencer Cole ist der festen Überzeugung, dass der Brunnen immer noch existiert. Er setzt alles daran, ihn zu finden, denn er verspricht große Macht. Sabine Thomas ist eine Nachfahrin der Atlanter. Ihre Aufgabe ist es, das größte Geheimnis ihrer Ahnen zu schützen. Die Jagd auf Spencer Cole beginnt. Dabei läuft ihr der attraktive Max über den Weg, der von Atlantis besessen ist. Mit ihm gemeinsam versucht Sabine, die einzige Waffe zu finden, die Cole besiegen kann. Während der sich überstürzenden Ereignisse erkennen Sabine und Max, dass sie ihr Herz nicht nur an Atlantis verloren haben ...
Weitere prickelnde Romane zum Dahinschmelzen von Robyn DeHart:
Zauberhafte Versuchung
Das Geheimnis unserer Herzen
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Danksagungen
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Zauberhafte Versuchung
Das Geheimnis unserer Herzen
Über dieses Buch
Ein großes Abenteuer um den wertvollsten aller Schätze: die Liebe!
Im sagenumwobenen Atlantis gab es einen großen Traum: den Jungbrunnen. Spencer Cole ist der festen Überzeugung, dass der Brunnen immer noch existiert. Er setzt alles daran, ihn zu finden, denn er verspricht große Macht. Sabine Thomas ist eine Nachfahrin der Atlanter. Ihre Aufgabe ist es, das größte Geheimnis ihrer Ahnen zu schützen. Die Jagd auf Spencer Cole beginnt. Dabei läuft ihr der attraktive Max über den Weg, der von Atlantis besessen ist. Mit ihm gemeinsam versucht Sabine, die einzige Waffe zu finden, die Cole besiegen kann. Während der sich überstürzenden Ereignisse erkennen Sabine und Max, dass sie ihr Herz nicht nur an Atlantis verloren haben …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Robyn DeHart wusste schon immer, dass sie Schriftstellerin werden wollte. Sie wuchs als jüngstes von drei Kindern wohlbehütet in Texas auf. Nach ihrer Schulzeit studierte sie Soziologie an der Texas State University. Anschließend hatte sie diverse Jobs, bis sie sich ganz dem Schreiben widmete. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei sehr verwöhnten Katzen am Fuße der Smoky Mountains in den USA.
Robyn DeHart
DAS RÄTSELDEINERLEIDENSCHAFT
Aus dem amerikanischen Englisch vonUlrike Moreno
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2010 by Robyn DeHart
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Desire Me«
Originalverlag: Forever, an imprint of Grand Central Publishing
This edition published by arrangement with Grand Central Publishing, New York, NY, USA. All rights reserved.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2012/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Susanne Kregeloh, Drestedt
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © Palana997/iStock/Getty Images Plus; sanyal/iStock/Getty Images Plus; khd86/iStock/Getty Images Plus; The Killion Group; luchschen/iStock/Getty Images Plus;
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2378-7
be-heartbeat.de
lesejury.de
Dieses Buch ist Kathleen Woodiwiss, Amanda Quick, Teresa Medeiros und Johanna Lindsey gewidmet, denn ihr seid der Grund dafür, dass ich historische Liebesromane zu schreiben begann – und was für eine erstaunliche Reise das doch ist!
Danksagungen
Die meisten guten Bücher entstehen in einer Art Zusammenarbeit, und so wäre es sehr unaufmerksam von mir, spräche ich den Menschen, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen, nicht meinen herzlichsten Dank aus:
Meinen Kritikerinnen und Brainstorming-Partnerinnen Emily und Hattie. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne euch tun würde. Ihr seid immer da, wenn ich mich mit neuen Ideen befassen muss. Ich höre den Strand rufen.
Meinem Ehemann Paul, der immer ein großer Anhänger meiner Arbeit gewesen ist. Du hattest einige großartige Ideen für diese Geschichte, Paul. Danke, dass du deinen Einfallsreichtum mit mir teilst.
Meinen wunderbaren Redakteurinnen Amy und Alex, die geduldig meine Hand halten, während sie mir das Feedback geben, das ich so dringend brauche. Ihr treibt mich dazu an, die Autorin zu sein, die ich sein muss.
Ein großes Dankeschön auch an Claire Brown und den Rest des GCP Art Departments – ihr alle seid fantastisch und so talentiert, dass es kaum zu glauben ist. Danke, dass ihr solch wundervolle Cover für mich und die Charaktere meiner Erzählungen gestaltet.
Und an letzter, aber keineswegs geringster Stelle möchte ich meiner wunderbaren Agentin Christina Hogrebe danken, die mir in mehr kritischen Situationen beigestanden hat, als ich zählen kann. Du bist ein Juwel, und ich arbeite sehr gern mit dir zusammen. Tausend Dank für alles!
Prolog
An der Küste Cornwalls,1873
Maxwell Barrett zündete seine Laterne an und betrat die feuchte Höhle. Hinter sich hörte er die Wellen gegen den Fels des Höhleneingangs schlagen. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit. Das war auch der Grund, der ihn zur Eile antrieb. Andernfalls hätte er sich länger hier drinnen aufgehalten und alle Ecken und Winkel untersucht, die er erreichen konnte. Doch ihm blieben nur noch zwei Stunden, bevor die Flut wieder ansteigen und den Eingang zur Höhle überschwemmen würde.
Zwei Stunden, bevor er ertrinken würde.
Vorausgesetzt, er hatte sich nicht verschätzt, denn dann blieb ihm vielleicht sogar noch weniger Zeit. Aber wie auch immer, er musste die Karte finden und dann schnellstens wieder trockenes Land erreichen.
Die Höhle erschien und verschwand mit den Gezeiten, deshalb hatte er fast vier Monate gebraucht, die verflixte Stelle ausfindig zu machen, und trotzdem blieb noch abzuwarten, ob er finden würde, wonach er in die letzten beiden Jahre gesucht hatte.
Die unebenen, von Moos und Wasser glitschigen Steine unter seinen Stiefeln machten das Vorankommen noch viel strapaziöser. Er war schon mehrmals ausgerutscht, hatte die Laterne aber immer fest in der Hand gehalten und sich weiter vorgekämpft. Er wusste, diese Höhle war die richtige, er spürte es.
Heute würde er die Karte von Atlantis finden.
Auf einem nassen Stein kam er ins Rutschen, verlor das Gleichgewicht und schlug hart auf einem seiner Knie auf. Der spitze Stein zerriss seine wollene Hose und schnitt ihm in die Haut. Zum Glück gelang es ihm, die Laterne vor dem Zerbrechen zu bewahren.
Max rappelte sich auf und atmete tief durch. Er konnte das hier schaffen. Das wäre ja gelacht. Mit gerade mal fünfzehn Jahren hatte er den längst vergessenen Schatz einer Piratenkönigin entdeckt und ausgegraben. Und heute war er siebzehn. Mit entschlossenen, aber vorsichtigen Schritten drang er weiter in die Höhle ein. Es war immer noch Atlantis, was ihn antrieb … die einzige Karte des verlorenen Kontinents zu finden, würde zweifellos beweisen, dass Platos Schriften den Tatsachen entsprachen und keine Ausgeburt der Fantasie waren. Sollte ihm der Fund gelingen, würden seine Eltern das zur Kenntnis nehmen und anerkennen müssen. Alle würden Kenntnis davon nehmen müssen.
Lange Stalaktiten streckten sich wie uralte Finger von der Höhlendecke zu ihm herab. Max musste sich zwischen ihnen hindurchschlängeln und sich ducken, um nicht aufgespießt zu werden. Ohne zu zögern, ging er weiter. Unaufhaltsam weiter. Noch immer konnte er hinter sich die Wellen hören, die ihn wie ein Stundenglas daran erinnerten, dass er nur über begrenzte Zeit verfügte.
Je tiefer er in die Höhle eindrang, desto drückender wurde die Luft. Als er tief einatmete, füllte sich seine Nase mit dem kalkartigen Geruch, der nur in kleinen Erdnischen zu finden war. Sein Herz begann wie wild zu schlagen.
Der Gang vor ihm teilte sich. Die Wände der Höhle verengten sich und bildeten zwei Pfade. Einer war breit genug für Max, um weiterzugehen, und wenn auch nur gebückt; der andere war nicht einmal groß genug, um ein kleines Kind hindurchschlüpfen zu lassen. Damit war die Wahl für ihn getroffen. Denn die Atlantider, die vor ihm hier gewesen waren, um die Karte zu verstecken, hatten mit Sicherheit den größeren Tunnel benutzt.
Dennoch zögerte Max jetzt.
Die Stalaktiten waren eine Ermahnung, dass fließendes Wasser Felsen nicht nur entstehen lassen, sondern sie auch zerstören konnte. Max hoffte, dass der Lauf des Wassers sich nicht mit der Zeit verändert und den richtigen Weg verschmälert hatte, sodass er nun vielleicht doch den falschen einschlagen würde.
Aber es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Vorsichtig tastete sich Max mit einer Hand an der Wand entlang, während er mit der anderen die Laterne vor sich hielt, auch wenn der jämmerlich schwache Lichtschein die Mühe fast nicht wert war. Der Stein unter Max' Fingern war kühl und nass. Irgendetwas schlängelte sich unter seiner Hand hindurch, und er riss sie schnell zurück.
Wieder verengte sich der Tunnel, dieses Mal so stark, dass Max seitlich gehen musste, um voranzukommen. Ertrinken wäre so oder so eine fürchterliche Art zu sterben, in diesem engen Gang aber bestimmt noch viel grauenvoller. Max beschleunigte seine Schritte, und obwohl Laufen ausgeschlossen war, kam er doch ziemlich schnell voran. Beim Gehen verfing sich sein Haar immer wieder in den Felsvorsprüngen des Ganges, und die Steine vor ihm würden ihm die Haut vom Gesicht reißen, wenn er nicht sehr achtsam war.
Die Dunkelheit vor ihm wurde immer dichter und schwärzer, je tiefer er in die Höhle eindrang. Dann erweiterte sich die Spalte wieder, durch die er halb gekrochen, halb gegangen war. Er machte einen Schritt, aber unter seinem Stiefel war nur Luft. Er verlor das Gleichgewicht und wäre fast gestürzt, konnte sich aber im letzten Moment an der Höhlenwand rechts von ihm festhalten.
Er stand auf einem Felsvorsprung über einem unterirdischen See, stellte er fest, als er die Hand mit der Laterne ausstreckte und sich vorbeugte, um einen Blick in die Tiefe zu tun. Die Entfernung zu dem Wasser war schwer einzuschätzen, aber es musste sich einige Meter unter ihm befinden, und obwohl ein solcher Sturz vermutlich nicht tödlich wäre, wollte Max nicht das Schicksal herausfordern.
Der Felsvorsprung umgab das Wasser, und Max konnte nun auch erkennen, dass der Sims zu seiner Rechten wesentlich schmaler war als der zu seiner Linken. Deshalb wandte er sich vorsichtig nach links und folgte dem Felsvorsprung. Die Öffnung, durch die er gestiegen war, schien – soweit er es sehen konnte – die einzige zu sein.
Seinen Nachforschungen zufolge müsste diese Höhle ihn zu der Stelle führen, an der die Atlantider ihre Landkarte verborgen hatten. Alles, was er gelesen hatte, deutete darauf hin, dass sie gut versiegelt inmitten von Wasser ruhte. Max legte den Kopf zurück und ließ seinen Blick über die Decke der Höhle gleiten. So glatt, wie die Mauern von der Feuchtigkeit waren, erschien es äußerst unwahrscheinlich, dass jemand dort hinaufgestiegen sein könnte. Und geeignete Stellen, um irgendetwas zu verstecken, schien es dort oben auch keine zu geben. Das trübe Laternenlicht, das sich auf den nassen Wänden spiegelte, reichte gerade aus, dass Max seine eigene Hand sehen konnte. So vorsichtig er konnte, ging er langsam weiter.
Der Vorsprung wurde so schmal, dass Max kaum noch darauf stehen konnte. Den Rücken an die Höhlenwand gepresst, schob er sich weiter den schmalen Sims entlang.
Urplötzlich enthüllte der Schein der Laterne einen großen Brocken Quarz, der ein unheimliche bläuliches Licht erzeugte.
Und in diesem seltsamen Glühen spiegelte sich der Lichtschein seiner Laterne in irgendetwas wider, das sich in der Mitte des Sees befand. Ein hölzerner Sockel ragte aus dem Wasser, auf dessen Mitte eine Art Behälter stand.
Max' Herz begann zu rasen. Das musste es sein! Die Karte war darin versteckt. Er war schon drauf und dran, von dem Vorsprung in den See zu springen, als er eine Bewegung in dem Wasser wahrnahm. So rasch er konnte wandte er sich nach rechts, zu einem robusteren Teil des Felsvorsprungs, und beugte sich wieder mit der Laterne in der Hand ein wenig vor.
Dort unten im Wasser trieb ein verwesender menschlicher Körper! Die schon fast bis auf die Knochen verfaulte Leiche trug zum Teil noch Kleider, die in Fetzen an ihr klebten. Wie in einem makabren Todestanz schwankte sie im Wasser auf und ab. Es schien die Leiche eines Mannes zu sein, und in ihr steckte ein hölzerner Pfahl. Und dann bemerkte Max die anderen Pfähle unterschiedlicher Größe und Länge, die um den Sockel herum angebracht waren.
Wäre er in das Wasser gesprungen oder gefallen, könnte jetzt er es sein, der dort unten an einem dieser Pfähle verblutete.
»Interessant«, murmelte er und richtete sich auf.
Wie sollte er ohne eine Brücke, die von seinem Felsvorsprung zur anderen Seite hinüberreichte, an die Karte herankommen, ohne sich auf einem dieser Pfähle aufzuspießen? Er blickte sich um, suchte die Umgebung nach irgendetwas ab, was ihm nützlich sein könnte. Aber da war nichts.
Das Geräusch herabfallenden Wassers lenkte seine Aufmerksamkeit auf die Felsspalte, aus der er vorhin herausgekrochen war. Wasser lief jetzt aus dem schmalen Tunnel und strömte in den See darunter. Max beobachtete, wie die Leiche weiter hin und her wogte und mit dem Wasser langsam höher stieg.
Darin lag die Antwort. Der einzige Weg, zu diesem Sockel zu gelangen, ohne sich zu pfählen, war, den See volllaufen zu lassen, bis er die Plattform erreichte. So lange abzuwarten, würde seine Chancen, lebend aus der Höhle herauszukommen, jedoch wesentlich verringern.
Aber einen anderen Weg schien es nicht zu geben. Es lief auf zwei Möglichkeiten hinaus: entweder gab er die Karte auf und mit ihr jeglichen Beweis für den verlorenen Kontinent oder er riskierte sein Leben in der Hoffnung, aus einer Fiktion eine Tatsache zu machen. Max holte tief Luft und straffte seine Schultern. Wenn man eins von Maxwell Barrett sagen konnte, dann, dass er unerbittlich war in seiner Suche.
Er würde diese Karte heute bekommen oder bei dem Versuch sein Leben lassen.
Max hatte seine Taschenuhr am Strand liegen lassen, als er zum Eingang der Höhle geschwommen war, sodass er nun auf sein Zeitgefühl angewiesen war. Das Wasser stand jetzt etwa einen halben Meter unterhalb des Sockels, und er schätzte, dass es noch an die dreißig Minuten dauern würde, bis der See sich ganz gefüllt hatte. Und Max war ein guter Schwimmer. Er würde genügend Zeit haben, und er würde diese Höhle lebend verlassen.
Als kaum noch ein Pfahl die Wasseroberfläche durchbrach, ließ Max sich langsam vom Felsvorsprung in den See hinunter. Die Kälte des Wassers schien ihm bis in die Knochen zu dringen und er versuchte vergeblich, sich durch Wassertreten an die eisige Temperatur zu gewöhnen. Der Wasserstand musste nur noch geringfügig ansteigen, dann konnte Max seinen Plan verwirklichen.
Von diesem Gedanken getrieben, ignorierte er die Kälte und schwamm auf den Sockel zu. Das Wasser lief schon schneller über den Vorsprung in den See. Für einen Moment zog die Strömung den Toten in die schlammigen Tiefen, doch gleich darauf tauchte er schon wieder auf. Eine Hand voll Pfähle ragte noch immer aus dem Wasser. Max tat sein Bestes, sie zu umschwimmen. Gegen einen stieß er mit der Stiefelspitze, dann schwamm er direkt gegen einen anderen, dessen scharfe Spitze ihn am Schienbein traf, seine Hose zerriss und ihm das Bein verletzte. Die Jahre hatten nichts dazu beigetragen, die Gefahr der hölzernen Pfähle zu verringern.
Mit höchster Konzentration gelang es ihm, den mittleren Pfosten zu erreichen, der die hölzerne Plattform aufrecht hielt. Mittlerweile stand das Wasser so hoch, dass Max sich an dem Sockel hinaufziehen konnte. Als er zitternd vor Kälte endlich den Schatz erblickte, stockte ihm der Atem, und er traute seinen Augen nicht. Bei genauerem Hinsehen konnte er erkennen, dass der Behälter in der Mitte ein Glasgefäß war. Er versuchte, es zu lösen, zu verdrehen, daran zu ziehen – was auch immer, um es von seinem Standort zu entfernen –, aber es ließ sich nicht vom Fleck bewegen.
Doch Max war viel zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Mit einer schnellen Bewegung hieb er seitlich mit der Faust gegen das Glas, und es zersprang. Schnell nahm er das lederne Päckchen an sich, steckte es in sein Hemd und sprang wieder ins Wasser, ohne auf die Schnitte an seiner Hand zu achten. Nur um Zentimeter verfehlte er dabei einen weiteren Pfahl. Doch Zeit, erleichtert zu sein, blieb ihm nicht; das Wasser schäumte um ihn herum, und bald würde der Pfad, auf dem er hergekommen war, völlig unter Wasser stehen.
Schnell kletterte er auf den Felsvorsprung hinauf und kehrte zu dem engen Tunnel zurück, dem er bis zum Teich gefolgt war. Das Wasser reichte ihm schon bis zur Taille, als er den Rückweg antrat – ohne eine Laterne, die ihm den Weg wies. Er hatte sie zurückgelassen, als er in den See gesprungen war, und keine Zeit mehr gehabt, sie zu holen.
Das Wasser schlug gegen seinen Gürtel, und Panik griff mit eisigen Fingern nach ihm. Er verdrängte die Angst und ging weiter, doch seine Schritte wurden unsicherer, als er gegen die Strömung ankämpfte. Irgendwann jedoch, als ihm das Wasser schon bis zu den Schultern stand, schaffte er es aus der engen Felsspalte heraus und zurück in die Haupthöhle.
Eine Welle krachte gegen deren Eingang, und das Wasser, das eine Sekunde später an Max vorbeischoss, ließ ihn fast den Halt verlieren. Er holte tief Luft, als das eisige Meerwasser ihn von allen Seiten umschloss und zu verschlingen drohte.
Max schwamm. Mit jeder Unze Kraft, die er besaß, kämpfte er gegen die Strömung und die ihm entgegenschlagenden Wellen an. Seine Lungen brannten und schrien nach Luft; Salz brannte in seinen Augen, als er nach Licht und nach der Oberfläche suchte.
Doch dann durchbrach er sie endlich und rang nach Atem.
Ja, er hätte aufgeben und sich dem Tod in dieser Höhle überlassen können, aber dann wäre er ebenso namenlos wie die Leiche in diesem See dort drinnen. Diese Landkarte zu finden würde seinen Namen in England in aller Munde sein lassen.
Auf dem Rücken liegend und ganz aufs Atmen konzentriert, ließ er sich von den Wellen tragen. Eine Minute später schwamm er zu den Felsen, über die man zur Küstenlinie gelangte.
Der scharfkantige Fels schnitt in seine Hand, als er sich an Land hinaufhievte, seine nassen Kleider zogen ihn herunter, und seine Beine waren geschwächt von der Anstrengung des Schwimmens, aber er kämpfte sich unermüdlich weiter hoch. Etwa zehn Minuten später stand er schwer atmend und mit wild pochendem Herzen oben auf den Klippen. Er war erschöpft, aber auch wie berauscht, da es sehr gut möglich war, dass er soeben die Geschichtsschreibung geändert hatte.
Das Päckchen unter seinem Hemd war mit einem wachsartigen Material überzogen, das es wahrscheinlich wasserdicht machte. Max zog das gefaltete Dokument heraus, um es dann langsam, ja, fast ehrfürchtig zu öffnen.
Sie war schön, die Karte, und anders als alle, die er je gesehen hatte, mit den sich abwechselnden Wasser- und Landringen des Inselreiches von Atlantis. Auf der handkolorierten Zeichnung sahen die Wasserkanäle aus, als würden sie sich feucht anfühlen, und die Bergkämme, als wären sie scharf unter den Fingern, wenn man sie berührte, und Poseidons Palast erstrahlte förmlich von seinem Platz im innersten Landring.
Max faltete die Karte wieder und steckte sie in den Lederbeutel an seinem Gürtel. Er hatte es geschafft. Er hatte den Beweis für die Existenz des verlorenen Inselreichs gefunden.
Kapitel eins
London,Januar 1888
Spencer Cole spielte mit der Pistole in seiner Hand, deren kaltes Metall im Mondlicht schimmerte. Die heutige Nacht könnte so oder so verlaufen, und er war auf beides vorbereitet. Als eine Kutsche die Straße hinunterrumpelte, steckte er die Waffe in seinen Hosenbund und drückte sich an die Außenwand des Stadthauses.
Der aufdringlich süße Duft von Jasmin hing in der Luft. Der verdammte Garten war voll von diesem Zeug. Er hasste Jasmin. Mit zwei Fingern riss er eine der zarten weißen Blüten ab, warf sie in den Schmutz und zertrat sie mit seinem Stiefel.
Spencers eng anliegender schwarzer Mantel ließ ihn fast vollständig mit der Dunkelheit verschmelzen. Um nicht aufzufallen, hatte er sich vorhin sogar umgezogen und sein weißes Hemd gegen ein dunkelbraunes ausgetauscht.
Nun dachte er an die Aufgabe, die vor ihm lag. Diesen Offizier zu finden war eine echte Herausforderung gewesen. Da ihm gesagt worden war, der Mann hielte sich in Afrika auf, hatte Spencer beschlossen abzuwarten, bis der Offizier nach London zurückkehrte. Dann hatte er vor zwei Wochen eine Nachricht abgefangen, die etwas anderes besagte. Wenn man der Botschaft glauben durfte, befand sich der Gesuchte jetzt oben in diesem Haus.
Die erste Zielperson hatte allein gelebt und war bekannt dafür gewesen, allzu sehr dem Alkohol zuzusprechen, egal ob im Dienst oder nicht. Er war laut und ungehobelt und bei vielen unbeliebt gewesen. Spencer hatte sich nicht die Mühe gemacht, dem Kerl eine Chance zu geben. Ihn zu töten war leicht gewesen. Zu leicht. Er war fast besinnungslos vom Alkohol gewesen, und Spencer hatte nur ein brennendes Streichholz an die Vorhänge halten müssen, um sein Haus in Flammen aufgehen zu lassen. Samt diesem nichtswürdigen Strolch.
Spencer hatte bei der Leiche keine Nachricht hinterlassen können. Weil seine Wut mit ihm durchgegangen war und er sich von seiner persönlichen Abneigung von seiner Aufgabe hatte ablenken lassen. Aber es war von größter Wichtigkeit, dass die Leute von seiner Absicht, von seiner Bestimmung erfuhren.
Deshalb hatte er sich bei dem zweiten Opfer mehr Zeit genommen und war präziser vorgegangen. Zuerst hatte er dem Mann einen Handel angeboten; die Chance, ein Teil von etwas Wichtigem zu sein. Aber der Dummkopf hatte abgelehnt. Also hatte Spencer ein Messer gezückt und dem Mann die Kehle durchgeschnitten, von einem Ohr zum anderen und so tief, dass er den Kopf fast ganz abgetrennt hatte. Das Blut war nur so aus dem Mann herausgeschossen, und es hatte eine außerordentliche Schweinerei gegeben.
Anders als beim vorhergehenden Mord hatte er seine erste Botschaft hinterlassen können – mit der ausdrücklichen Anweisung, die Botschaft in der Times abzudrucken. Spencer hatte keine Ahnung, ob die Wächter, die er suchte, Londoner Zeitungen lasen, aber die Bewohner Londons taten es. Und die Veröffentlichung solcher Botschaften würde Furcht erzeugen. Spencer liebte das. Scotland Yard war jedenfalls bestimmt schon alarmiert, und binnen Kurzem würde es auch die Stadtbevölkerung sein.
Was ihn zu Opfer Nummer drei führte. Spencer blickte zu dem erleuchteten Fenster über ihm hoch. Dieser Offizier hatte eine Familie, eine Geliebte, unzählige Freunde und sehr gute Beziehungen zu Ihrer Majestät. Er hatte also viel zu verlieren. Vielleicht würde ihn das dazu bewegen, das großzügige Angebot anzunehmen, das Spencer ihm machen würde. Wenn nicht …
Spencer spuckte aus.
Nach seiner Entdeckung, dass dieser Mann sich tatsächlich in London aufhielt, hatte er begonnen, ihn zu verfolgen und zu beobachten wie ein Jäger, der seiner Beute nachspürt. Das Gleiche hatte er bei allen Offizieren getan, die auf seiner Liste standen.
Zwei Wochen hatte er beobachtet und gewartet, war seine Geduld auf eine harte Probe gestellt worden. Doch heute Abend war nun endlich der richtige Moment gekommen, denn seine Zielperson war allein im Haus. Seine Frau und seine beiden Töchter waren ausgegangen, ins Theater und danach zu einem Ball, sodass sie noch Stunden wegbleiben würden. Und der Mann dort drinnen im Haus hatte noch keine Ahnung, welche Rolle er in einem Plan spielen sollte, der größer und bedeutender war, als ihm wohl je bewusst sein würde.
Da weitaus mehr Offiziere verfügbar waren, als Spencer brauchte, hatte er seine Zielpersonen mit größter Sorgfalt ausgesucht. Sieben Leben als Sinnbild der sieben Ringe von Atlantis. Diese sieben Männer würden ihr Leben durch seine Hand verlieren oder sich ihm anschließen und dadurch die Gunst der Königin verlieren. Im letzteren Fall würden sie beginnen, die Prophezeiung zu verwirklichen und seine Armee anführen. Spencer schaute auf den Ring an seiner rechten Hand, der ihn geradewegs zu dem Elixier führen würde. Das war sein Schicksal, und es war belanglos, wer dabei auf der Strecke blieb. Eine Prophezeiung, die älter war als irgendetwas hier in London, war größer noch sogar als er.
Irgendwo in der Ferne schlug eine Uhr die elfte Stunde. Es wurde Zeit.
Spencer bewegte sich lautlos zu den Terrassentüren, die vom Garten in einen Salon führten. Mit beträchtlicher Kraft gelang es ihm, das solide Schloss aufzubrechen und die Tür zu öffnen. Das Zimmer war dunkel, doch von der Halle fiel genügend Licht herein, um nicht versehentlich irgendwelche Möbel anzustoßen. Der starke Geruch von Politur kitzelte ihn in der Nase.
Da er wusste, dass General Lancers Arbeitszimmer im Erdgeschoss lag, schlich Spencer aus dem Salon und durch die Eingangshalle. Eine Küchenmagd, die ins Foyer kam, riss entsetzt die Augen auf, als sie ihn sah. Sie öffnete schon den Mund zum Schreien, als Spencer sie an der Kehle packte und sie an sich zog. Ihre großen braunen Augen füllten sich mit Tränen, als sie zu ihm aufblickte.
»Schrei nicht«, sagte er. »Wenn du schreist, bin ich gezwungen, dich zu töten. Ist das klar?«
Sie nickte heftig.
Natürlich würde er sie trotzdem töten. Aber er zog es vor, dies still und leise zu tun, um nicht sein wahres Opfer auf sich aufmerksam zu machen. Schnell zog er das Messer, das in seinem Stiefel steckte, und stieß der Frau die Klinge in die Kehle. Das Messer erstickte ihren Schrei, nur das zischende Geräusch von Luft kam aus der Wunde. Sie brach leblos zusammen, ihre braunen Augen in Entsetzen erstarrt.
Sie hatte ihm keine andere Wahl gelassen, denn er musste unbemerkt bleiben.
Schritt für Schritt schlich er über den Korridor und spähte in die Zimmer, die den Gang flankierten. Fast begegnete er zwei Dienstboten, die es in einem dunklen Speisezimmer miteinander trieben, aber er hatte Glück, denn die gedämpften Laute, die sie von sich gaben, übertönten das leichte Knarren der Tür.
Schließlich fand er das richtige Zimmer. Ein sanftes Licht drang unter der Tür hindurch, und als Spencer sie aufstieß, stand er dem Mann gegenüber, den er suchte.
Mit offenem weißem Hemd und ohne Krawatte saß der ältere Mann an seinem Schreibtisch, der mit Stapeln von Büchern und Journalen bedeckt war.
»Wer zum Henker sind Sie?«, fragte er, während er sich schnell erhob.
»Wer ich bin, spielt keine Rolle«, erwiderte Spencer ruhig. »Setzen Sie sich.«
»Ich werde nichts dergleichen tun.« Der Mann hatte weißes Haar, das aber noch immer dicht und wellig war, und seine Augen sprühten vor Intelligenz. »Moment mal«, sagte er und verengte diese Augen, »ich kenne Sie doch. Was wollen Sie?«
Spencer konnte die freudige Erregung, die ihn durchzuckte, nicht verleugnen. Er liebte es, erkannt zu werden. Aber das war nicht sein Bestreben heute Abend. Bewusst verlangsamte er seine Atmung.
»Ich möchte Ihnen einen Vorschlag unterbreiten«, sagte er.
Die Nasenflügel des Mannes bebten. »Hat sie Sie geschickt?«
»Ein großer Krieg steht uns bevor«, sagte Spencer, ohne auf die Frage des Mannes einzugehen. »Und England ist nicht vorbereitet.«
»Wir haben das beste Militär der Welt«, gab der Mann empört zurück. Tiefe Furchen bildeten sich auf seiner ohnehin schon faltigen Stirn. »Sie haben vielleicht Nerven!«
Dieser Mann würde keiner der Auserwählten sein, das erkannte Spencer schon jetzt, aber er hatte eine Aufgabe zu erfüllen. Langsam zog er die kleine Phiole aus der Tasche. »Ich habe hier die Lösung. Ein winziger Tropfen nur, und Sie würden klüger, stärker und wachsamer. Sie könnten der beste aller Generäle sein.« Spencer verdrehte fast die Augen. Wenn es nach ihm ginge, würde er sie einfach alle beseitigen und mit Männern seiner eigenen Wahl noch einmal ganz von vorn beginnen. Aber seine ausdrücklichen Anweisungen lauteten, zuerst diesen Männern anzubieten, sich seiner Sache anzuschließen, und sie nur dann zu töten, wenn sie ablehnten.
»Ich weiß nicht, worauf Sie hinauswollen, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich mehr als befremdet bin. Ich bin bereits der beste General von allen.« Er stützte beide Arme auf den Tisch. »Ich denke, Sie sollten jetzt gehen. Morgen werde ich einen Bericht über diesen Vorfall einreichen. In mein Haus einzudringen, mich zu beleidigen und mir dann irgendein magisches Gebräu anzubieten, das vermutlich nichts anderes als Opium ist! Das ist eine Unverschämtheit ohnegleichen«, knurrte er.
Spencer ließ den Mann zetern; im Grunde fand er die Szene sogar recht unterhaltsam. Besonders angesichts dessen, was gleich geschehen würde.
»Wenn das so ist, befürchte ich, dass Ihre Dienste nicht länger benötigt werden«, sagte er und zog mit einer blitzschnellen Bewegung die Pistole aus seinem Hosenbund. »Ich glaube, ich hatte Ihnen befohlen, sich wieder hinzusetzen.«
Das Gesicht des Generals war von Resignation geprägt, als er langsam wieder seinen Platz einnahm. All die Jahre, die er im militärischen Oberkommando gewesen war, hatten seinen Kampfinstinkt geschärft, und er war vernünftig genug zu wissen, wann er einem überlegenen Gegner gegenüberstand.
»Ich habe sehr viel Geld«, sagte Lancer. »Und ich kann Ihnen den Schmuck meiner Frau geben. Was immer Sie auch wollen, ich kann es Ihnen geben.« Er streckte seine Hand aus. »Und Ihr Angebot nehme ich an. Ich nehme die Phiole.«
Spencer überdachte kurz das Angebot des Generals. Seine militärischen Fähigkeiten hätten sich als nützlich erweisen können, aber jetzt war es zu spät. Die Loyalität des Mannes würde immer fraglich sein. Schade eigentlich.
»Wenn es nur so einfach wäre«, sagte Spencer zu dem Mann. »Ich bin sicher, dass ich einen Mann von Ihrem Format und Ihren Fähigkeiten brauchen könnte. Aber Sie hätten mein Angebot annehmen sollen, als Sie noch die Chance dazu hatten.« Er nahm ein Kissen von dem Sessel hinter ihm, ging damit zum Schreibtisch und richtete seine Waffe auf den General. »Aber es hat nicht sein sollen.«
»Ich brauche nur zu rufen, und schon habe ich einen Raum voller Männer, die mir zu Hilfe eilen«, warnte Lancer, aber sein heftiges Schlucken verriet seine Angst und strafte seine Drohung Lügen.
Denn wäre es wahr, was er sagte, hätte er längst um Hilfe gerufen. Spencer ging um den Schreibtisch herum, trat hinter den General und strich mit dem Lauf der Pistole über dessen dichtes weißes Haar. »Nur zu«, sagte er achselzuckend. »Rufen Sie um Hilfe, wenn Sie wollen, aber dann werde ich gezwungen sein, auch die anderen zu töten. Und ich würde es vorziehen, das nicht zu tun.«
»Hat sie Sie geschickt?« Lancers Stimme schwankte. Dann schüttelte er den Kopf, wie um sich die Frage selbst zu beantworten. »Sicher nicht.«
Genug des Spiels. Sosehr Spencer die Quälerei auch genoss, hatte er doch eine Aufgabe zu erfüllen. »Schluss mit dem Gerede«, flüsterte er. Dann hielt er das Kissen zwischen die Pistole und die Schläfe des Mannes und drückte ab.
Jetzt standen nur noch vier Offiziere auf seiner Liste.
Sabine Tobias drehte sich im Bett herum und starrte an die dunkle Zimmerdecke. Sie hatte keine Nacht mehr gut geschlafen, seit sie vor sieben Monaten nach London gezogen waren. Nachdem sie die ersten vierundzwanzig Jahre ihres Lebens in einem Dorf verbracht hatte, war sie einfach noch nicht an die Geräusche der Stadt gewöhnt. Heute Nacht hätte sie schwören können, unter ihrem Fenster etwas rascheln zu hören. Sie holte tief Luft, hielt den Atem an und spitzte die Ohren. Da – da war es schon wieder! Vielleicht war es nur der Wind oder eine streunende Katze, aber sie konnte auf jeden Fall ein Geräusch hören.
Ihre Ohren schienen jedes noch so kleine Geräusch wahrzunehmen. Vermutlich war da nichts, aber was, wenn doch etwas – oder jemand – da draußen herumschlich? Ein Dieb vielleicht. Oder ein Mörder? Schweiß rann ihren Rücken hinunter, und ihr drehte sich vor Unruhe der Magen um.
Schließlich schwang sie die Beine aus dem Bett und lief auf bloßen Füßen aus ihrem winzigen Zimmer auf den Korridor hinaus, wo sie fast mit ihrer Tante zusammenstieß.
»Hast du es auch gehört?«, fragte Lydia.
»Ja«, flüsterte Sabine.
»Ich glaube, draußen ist jemand.« Lydia hielt ihre Kerze vor sich, als sie in ihrem langen gelben Nachtgewand zur Treppe ging.
Sie waren noch nicht einmal die Hälfte der Stufen hinuntergegangen, als auch Sabines andere beiden Tanten aus ihren Zimmern kamen. Zu viert schlichen sie ins Erdgeschoss hinunter, um nachzusehen.
Lydia blieb am Fuß der Treppe stehen. »Das Geräusch«, flüsterte sie. »Es ist jetzt drinnen.«
Sabines Herz verkrampfte sich vor Panik. Langsam schlichen die vier Frauen auf Zehenspitzen in den Lagerraum hinter ihrem Laden. Dort saß an einem kleinen Tisch ein Mann. Ein Eindringling!
»Tut mir leid, dass ich euch geweckt habe«, sagte der Mann mit dünner Stimme.
»Madigan?«, rief Lydia und eilte zu dem Mann.
Die Erleichterung, die Sabine erfasste, war so groß, dass sie für einen Moment ins Taumeln kam. Ihre Tanten kannten diesen Eindringling.
»Ja, ich bin's«, sagte er.
»Du hast uns zu Tode erschreckt«, wies Agnes den Mann ärgerlich zurecht. Sie trug ihr blassrotes Haar zu einem losen Zopf geflochten, der ihr über die Schulter fiel.
Der Mann schüttelte den Kopf und hustete. »Ich habe nicht viel Zeit. Ich bin gekommen, um das Kind zu warnen.«
Lydia stellte ihre Kerze auf den Tisch und setzte sich auf den Stuhl neben dem Mann. »Calliope«, wandte sie sich an ihre jüngste Schwester. »Lass uns etwas mehr Licht hier drinnen machen.«
Warmes Licht verbreitete sich im Zimmer, als Sabine mit ihrer Tante Calliope die Wandleuchten anzündete. Sie hatten sich die neumodischen elektrischen Lampen noch nicht leisten können, aber die alten brannten noch hell genug.
Madigan, wie Lydia ihn genannt hatte, kauerte auf dem Stuhl und sah blass und leidend aus. Bei ihrem ersten genaueren Blick auf ihn zogen Sabines Tanten erschrocken den Atem ein.
»Was ist mit dir passiert?«, fragte Agnes und rückte näher an ihn heran.
Calliope zog eine Flasche ihres selbstgebrannten Whiskys hinter einem Schrank hervor und schenkte ihm ein Glas ein. »Du siehst nicht gut aus, alter Freund.«
Sabines drei Tanten kannten diesen Mann, und doch hatte sie selbst ihn weder je gesehen noch von ihm gehört. Und sie hatte ihr ganzes Leben mit diesen Frauen verbracht. Selbst als ihre Eltern noch gelebt hatten, waren ihre Tanten immer da gewesen. Sabine war sich ganz sicher, dass er nicht aus ihrem Dorf stammte. Aber auch hier in London hatte sie ihn noch nie gesehen, und immerhin waren sie mit ihrem kleinen Laden schon fast ein Jahr hier in der Stadt.
Madigan trank den Whisky und nickte dann Sabine zu. »Kommt alle mal her.«
Sabine lag schon eine scharfe Antwort auf der Zunge, weil sie diesen Mann nicht kannte, aber Tante Lydia schüttelte den Kopf. »Nicht jetzt, Kind«, sagte sie.
Sabine nickte und setzte sich auf den Stuhl, auf den Lydia gewiesen hatte. Agnes nahm ebenfalls am Tisch Platz, während Calliope, die Flasche Whisky in Händen, stehen blieb.
Madigan war ein großer, breitschultriger Mann mit welligem dunklem Haar und einem Bart, der viel von seinem Gesicht verdeckte. Seine braunen Augen blickten freundlich.
»Ich habe euch viel zu erzählen, aber nur wenig Zeit«, sagte er mit heiserer Stimme. Dann hustete er wieder und krümmte sich dabei vor Schmerz.
»Kann ich irgendetwas für Sie tun?«, fragte Sabine. »Wir sind so etwas wie Heilerinnen. Calliope«, wandte sie sich an ihre Tante, »könntest du meinen Kasten holen? Er steht gleich hinter dir in dem Regal.«
Der Mann streckte eine Hand aus, um Calliope zurückzuhalten. »Es gibt nichts, was ihr tun könntet, um mir zu helfen«, sagte er, nach Atem ringend. »Ich bin gekommen, um die Wächter zu warnen.«
Sabines Magen krampfte sich zusammen. Noch nie, nicht ein einziges Mal, hatten sie außerhalb ihres Dorfes die Identität der Wächter enthüllt. Sie warf ihren Tanten einen fragenden Blick zu, um ihre Reaktion zu sehen, aber deren Mienen verrieten nichts, und so wandte sie sich wieder zu dem Fremden.
»Es gibt drei von uns«, sagte er mit einer nervösen Bewegung, und wieder verzerrte eine Welle des Schmerzes sein Gesicht, als ihn ein weiterer Hustenanfall schüttelte.
Von uns, hatte er gesagt. Also war er einer der anderen Wächter. Sabine wusste natürlich von der Existenz der beiden anderen, des Sehers und des Weisen. Da jedoch jeder der drei Wächter in einem anderen Dorf lebte, war sie bisher noch keinem der beiden begegnet. Sie lebten offenbar sehr zurückgezogen, und Sabine wusste nur, dass beide Männer waren.
Ursprünglich waren die Wächter alle Männer gewesen, bis Sabines Mutter und nach ihr Agnes auserwählt worden war. Und ihre Tanten glaubten, dass Sabine die nächste Wächterin sein würde. Aber Sabine wusste, dass das nur eine Illusion war. Wäre es ihr bestimmt gewesen, Wächterin zu werden, dann wäre sie schon auserwählt worden, als ihre Mutter starb. Früher hatte sie oft mit ihren Tanten über diesen Punkt gestritten, da ihre Proteste aber immer auf taube Ohren gestoßen waren, versuchte sie es jetzt nicht einmal mehr.
Es war ein Schock für ihre Leute gewesen, als ihre Mutter geboren worden war. Bis dahin hatte jede atlantische Familie mindestens ein männliches Kind gehabt. Noch nie zuvor hatte ein Atlantider als erstes Kind ein weibliches und anschließend noch drei weitere Mädchen gezeugt. Als Sabines Großvater gestorben war, hatten die Leute daher keine andere Wahl gehabt, als ihre Mutter als erste weibliche Wächterin zu akzeptieren. Und durch die uralte Zeremonie war diese Wahl bestätigt worden. Alle hatten jedoch geglaubt, dass sie versagen würde, und als das geschah, hatte man ihren Namen verspottet und verhöhnt.
»Doch sehr bald«, fuhr Madigan fort, als sein Husten nachließ, »werden nur noch zwei verbleiben.« Er legte eine warme Hand auf Sabines Schulter. »Die Prophezeiung hat ihren Anfang genommen.«
»Phinneas hat uns schon vor Monaten gewarnt«, sagte Agnes leise.
Madigan nickte. »Ja, Phinneas hat die Vorzeichen irgendwann im letzten Jahr gesehen. Warnzeichen, aber das hier …« Er sah mit kummervollen Augen zu den Frauen auf. »Es hat begonnen. Der Auserwählte ist erschienen.«
»Bist du sicher?«, fragte Calliope.
Sabine wusste, dass Agnes eine Warnung erhalten hatte, aber sie hatte nie erfahren, von wem. Das konnte nur bedeuten, dass Phinneas der Seher war, was wiederum darauf schließen ließ, dass Madigan der Weise war. Die Warnung war der Grund dafür, dass sie nach London gezogen waren und diesen kleinen Laden in Piccadilly eröffnet hatten.
»Die Prophezeiung«, wiederholte Sabine nachdenklich. Sie war ihr Leben lang davor gewarnt worden. Welcher Atlantider hatte nicht davon gehört? Auch wenn keiner die Prophezeiung je gesehen hatte – zumindest niemand, den sie kannte. Vielleicht war dieser Phinneas über die Einzelheiten im Bilde, auch wenn jeder wusste, dass die Prophetie aus dem Buch des Sehers herausgerissen worden war.
Sabine wusste nur, dass es zu einem Kampf kommen würde und die Wächter das Elixier vor dem Auserwählten beschützen mussten.
Was bedeutete, dass Agnes in Gefahr war.
Sabines Magen krampfte sich vor Furcht zusammen, und sie tat einen tiefen, beruhigenden Atemzug, um sich nicht von ihrer Unruhe ablenken zu lassen. Sie würde nicht die gleichen Fehler machen wie ihre Mutter. Sabine war fest entschlossen, den guten Namen ihrer Familie wiederherzustellen, indem sie verhinderte, dass die Prophezeiung sich erfüllte.
Sie und ihre Tanten hatten einen Plan gefasst, nachdem sie die Warnung erhalten hatten.
»Wir haben uns vorbereitet, so gut wir konnten«, sagte Sabine. »Deshalb sind wir nach London gezogen. Wir sind auf der Hut, aber wir werden doch wohl nicht in Angst leben müssen?«
Madigan lächelte. »Sie ist ein tapferes Mädchen.«
»Das ist sie«, stimmte Agnes zu.
»Erzähl mir von eurem Plan, Kind«, forderte Madigan sie auf.
»Da wir nur sehr wenig über die Prophezeiung wissen«, begann Sabine, »war es schwierig, Vorbereitungen zu treffen. Aber wir wissen, dass der Auserwählte sich erheben und versuchen wird, das Elixier zu stehlen, um so die Wächter zu vernichten.« Sabine beugte sich vor. »Und natürlich sind wir uns auch der Gefahren des Missbrauchs des Elixiers bewusst.«
Sie hielt inne, als Madigan bei einem neuerlichen Hustenanfall fast zusammenbrach. Er trank einen großen Schluck Whisky und nickte ihr zu, fortzufahren.
»Sind Sie sicher, dass wir nichts für Sie tun können?«, fragte sie. »Sie wissen doch bestimmt, dass Agnes die Heilerin ist.« Vielleicht vertraute er ihren Fähigkeiten nicht. Bestimmt hatte sich schon überall herumgesprochen, was Sabines Vater zugestoßen war. Es hatte Jahre gedauert, bevor irgendjemand in ihrem eigenen Dorf der Heilerin wieder vertraut hatte.
»Es ist schon gut, Kind. Bitte sprich weiter«, sagte er.
»Wir wissen, dass der Auserwählte einen Weg gefunden hat, unsere Präsenz wahrzunehmen und diejenigen aufzuspüren, die das Elixier benutzt haben. Deshalb habe ich mir als Vorsichtsmaßnahme etwas einfallen lassen, wie wir gewissermaßen vor aller Augen unsichtbar bleiben können«, sagte Sabine. »Natürlich können wir nichts tun, um uns selbst oder die Tatsache zu verbergen, dass wir dem Elixier ausgesetzt sind. Aber wir können diejenigen um uns herum verändern, indem wir das Elixier verkaufen«, erklärte sie.
Madigan straffte sich, so gut er konnte, und eine steile Falte bildete sich zwischen seinen Brauen. »Hast du den Verstand verloren, Kind? Damit bringst du euch in noch größere Gefahr«, sagte er und wandte sich dann an ihre Tanten. »Wie konntet ihr das zulassen? Damit werdet ihr ihn direkt zu eurer Tür führen.«
»Wir sind doch keine Dummköpfe«, sagte Sabine kopfschüttelnd und streckte die Hand nach Calliope aus, die ihr eins der Glasgefäße reichte. »Das hier ist nichts anderes als ein Heiltrunk, und wir sind sehr vorsichtig mit den Dosierungen.« Sie stellte den Behälter auf den Tisch vor ihm.
»›Tobias' Miracle Creme für das Gesicht‹«, las Madigan. »Ist das euer Ernst?«
Sabine schwieg, während Madigan über das Gesagte nachdachte. Bislang hatten ihre Tanten nichts dazu gesagt. Es war Sabines Idee gewesen, eine Strategie, um Agnes zu beschützen, und sie hatten lange und gründlich nachgedacht, bevor sie sich entschieden und mit der Verwirklichung des Plans begonnen hatten. Heute, Monate später, waren ihre Produkte erfolgreich, und das Elixier wurde langsam in ganz London verbreitet.
Madigan entfernte den Deckel des Tiegels und schnupperte an der Creme. Dann nahm er mit der Fingerspitze ein wenig davon heraus und verrieb die Creme auf seinem Arm. »Sie dringt in die Haut ihrer Benutzer ein … Jetzt verstehe ich, was du meinst«, murmelte er und sah Sabine mit seinen braunen Augen an. »Durch die Benutzung dieser Creme müssen alle für den Auserwählten gleich aussehen.«
Sabine nickte. »Genau. Und wir haben auch noch andere Produkte. Tatsächlich sind wir in den letzten Wochen sogar zu einer Sensation geworden. Die Gesellschaft hat anscheinend Notiz von uns genommen.«
»Wie viel Elixier gebt ihr in jedes Tiegelchen?«, fragte Madigan.
»Einen einzigen Tropfen nur«, erwiderte Agnes.
»Die Frauen in der Stadt sind bestimmt entzückt, wie gut die Creme ihre Falten glättet«, bemerkte Madigan.
»Genau«, sagte Agnes. »Und je mehr sie sie benutzen, desto mehr bringt es ihn von unserer Fährte ab.«
Madigan schwieg eine Weile, dann nickte er. »Das ist brillant. Ich hatte mich schon gefragt, warum ihr nach London gezogen seid. Es ist ziemlich unüblich für Wächter, ihre Dörfer zu verlassen.«
»Zu Agnes' Schutz«, sagte Sabine. Sie hatte gewusst, dass es riskant war, sie von ihren Leuten fortzubringen, doch zu bleiben wäre ein noch größeres Risiko gewesen. Sie hatten mit ihren Leuten vereinbart, dass sie jemanden in die Stadt schicken würden, um die Heiltränke und Salben abzuholen, die das Dorf benötigte.
»Madigan, ich verstehe nicht, wie du wissen kannst, dass die Prophezeiung sich zu erfüllen beginnt. Hast du erst kürzlich mit Phinneas gesprochen?«, fragte Agnes. »In seinen Briefen hat er nichts davon erwähnt.«
»Nein, schon seit ein, zwei Monaten nicht mehr«, sagte er.
Lydia trat vor. »Hast du die Karte gefunden?«
Generationen ihrer Leute hatten nach der Karte von Atlantis gesucht, da sie das einzige verbliebene Dokument war, auf dem die Prophetie in ihrer Ganzheit noch zu finden war. Aber all ihre Bemühungen waren umsonst gewesen.
»Nicht eigentlich gefunden, aber ich weiß jetzt, wo sie ist«, sagte Madigan und wurde wieder von einem rasselnden Husten erfasst, der damit endete, dass er sich Blut vom Mund abwischte.
»Warum haben Sie nicht etwas von Ihrem eigenen Elixier genommen, Madigan, um Ihre Lungen zu reinigen?«, fragte Sabine. »Oder sich von Agnes helfen lassen? Sie ist eine großartige Heilerin.«
»Ich sagte euch ja schon, dass es für mich zu spät ist.« Er schüttelte den Kopf und schwieg einen Moment, bevor er weitersprach. »Ich konnte ihn nicht aufhalten. Er schlug mich nieder, so hart, dass ich die Besinnung verlor, und dann hat er es mitgenommen.«
»Das Elixier?«, fragte Lydia.
Madigan nickte nur.
»Wie lange hast du schon keines mehr genommen?«, wollte Agnes wissen.
»Schon über vierundzwanzig Stunden«, sagte er. Dann schüttelte er den Kopf. »Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war, daher kann ich mir nicht wirklich sicher sein, wie lange. Und ich war so vorsichtig.« Er griff nach Agnes' Hand. »Es tut mir schrecklich leid.«
»Dann hat es also wirklich schon begonnen«, sagte Calliope leise.
Deshalb sah Madigan so krank aus. Wenn ein Wächter sein Elixier verlor und es nicht innerhalb von zwei Tagen zurückgewann, musste er sterben. Sabine hatte es bei ihrer eigenen Mutter geschehen sehen. Es war eine mystische Verbindung, die selbst Sabine nicht verstand, aber es gab Dinge, die man einfach nicht infrage stellte.
»Dann gib ihm doch etwas von deinem Elixier«, schlug Sabine Agnes vor.
Aber Madigan schüttelte den Kopf. »Das würde mir nichts mehr nützen – oder zumindest doch kein anderes als mein eigenes. Nur du bist wichtig«, sagte er und sah Sabine an. Seine Atemzüge waren schwer und pfeifend. »Ich habe die Zeit, die mir verblieb, genutzt, um herzukommen und euch zu warnen. Phinneas kann auf sich selbst aufpassen. Aber ich habe ihm trotzdem eine Nachricht geschickt.«
»Was müssen wir tun?«, fragte Sabine. Sie würde tun, was auch immer nötig war, um dafür zu sorgen, dass Agnes und ihre anderen Tanten sicher waren. Sie wollte nicht noch jemanden verlieren. Madigan hatte kostbare Zeit damit verbracht, sie aufzusuchen und zu warnen, statt sich auf die Suche nach seinem Elixier zu machen. Sie war ihm zu großem Dank verpflichtet.
»Ihr braucht die gesamte Prophezeiung«, sagte er. »Ihr müsst sie haben, um auch nur hoffen zu können, den Auserwählten zu vernichten.«
»Die Karte«, erinnerte ihn Sabine. »Sie sagten, Sie wüssten, wo sie ist.«
Wieder hustete er, trank einen weiteren Schluck Whisky und stieß dann einen müden Seufzer aus. »Ein Mann, ein Engländer, hat sie vor vielen Jahren gefunden. Und sie befindet sich auch heute noch in seinem Besitz.«
»Phinneas' Vision war also richtig«, sagte Agnes. »Er sagte, ein großer Mann würde die Karte finden und uns zu Hilfe kommen.«
Madigan griff in seinen Mantel und zog ein gefaltetes Stück Papier heraus. »Ich habe euch seinen Namen und seine Adresse aufgeschrieben. Leider ist das alles, was ich über ihn in Erfahrung bringen konnte.« Er legte seine Hand über Sabines. »Es ist unerlässlich, dass du dir diese Prophezeiung beschaffst. Ohne die Karte besteht für euch keine Hoffnung, den Auserwählten zu überleben.«
Sabine machte keine Anstalten, das Papier zu entfalten, nachdem er es ihr in die Hand gedrückt hatte. Er hatte ihr diese Aufgabe übertragen. Er traute ihr zu, etwas zurückzuholen, was ihre Leute seit Jahren gesucht hatten. Sie konnte ihren Blick nicht von dem Mann abwenden, der kurz davor war, seinen letzten Atemzug zu tun.
»Wie lange haben Sie gewusst, dass dieser Mann unsere Karte hat?«, fragte sie.
»Nicht lange. Ursprünglich wusste ich nur, dass ein Engländer sie hatte. Es hat eine ganze Weile gedauert, herauszufinden, wer er war.«
»Wird er sie uns verkaufen?«, fragte sie.
»Nein. Das habe ich schon vor ein paar Monaten versucht«, sagte Madigan und griff nach ihrer Hand. »Aber du kannst es schaffen, Kind. Wir müssen die Prophezeiung haben.«
Sabine schluckte.
Er sah ihre Tanten an. »Wir haben keine andere Wahl.«
Madigan war noch in derselben Nacht im Lagerraum gestorben, einen sehr qualvollen und schlimmen Tod. Als Mädchen hatte Sabine ihre Mutter sterben sehen, und jetzt war ein weiterer Wächter von ihnen gegangen. Sie würde tun, was auch immer nötig war, um Agnes zu beschützen.
Und so tat sie, was jede Dame in ihrer misslichen Lage tun würde. Sie ließ sich in einer verhängten Kutsche bis vor das Haus des Gentlemans fahren und wartete darauf, dass er für den Abend ausging. Dass er das vorhatte, wusste sie, weil er seine Kutsche hatte vorfahren lassen.
Madigans Zettel hatte ihr nicht viel Aufschluss über den besagten Engländer, einen gewissen Maxwell Barrett, Marquess of Lindberg, gegeben. Sie wusste nur, wo er wohnte und dass er im Besitz der legendären Karte von Atlantis war. Madigan hatte Mr Barrett einige Monate beobachtet, doch wie sich herausstellen sollte, war der Mann recht geheimnisvoll.
Madigan hatte gesagt, Barrett wäre nicht an einem Verkauf der Karte interessiert, was Sabine nur zwei Möglichkeiten offen ließ – sie konnte in das Haus des Mannes einbrechen und die Karte stehlen. Im Prinzip könnte sie argumentieren, dass die Karte ihr und ihrem Volk gehörte, aber sie bezweifelte, dass sie damit bei den Behörden durchkommen würde, sollte sie erwischt werden.
Oder sie könnte versuchen, diesen Mr Barrett zu überreden, ihr einen Blick auf die Karte zu gestatten. Letzteres war einer Gefängniszelle natürlich vorzuziehen. Außerdem konnte man die Welt nicht vor einer vorausgesagten Katastrophe retten, wenn man im Gefängnis saß. Doch wenn sich ihre heutigen Bemühungen als kompletter Fehlschlag erweisen sollten, würde sie auf jeden Fall den Diebstahl in Betracht ziehen. Eine Frau musste tun, was sie tun musste.
Mr Barrett gehörte zur vornehmen Gesellschaft Londons, was eigentlich nur bedeuten konnte, dass er ein Gentleman war. Und da sie die Bekanntschaft dieses Mannes machen musste, schien ihr der heutige Abend dazu ebenso geeignet wie jeder andere, zumal sie nicht über den Luxus von viel Zeit verfügte. Denn wenn die uralte Prophezeiung bereits ihren Anfang genommen hatte, war das Stundenglas umgedreht worden, und die Sandkörnchen rieselten unaufhaltsam hindurch. Doch ohne den vollständigen Wortlaut der Prophezeiung zu kennen, kämpften sie mit verbundenen Augen, wie Madigan ganz richtig gesagt hatte.
Wenn Sabine einen Mann dazu bringen wollte, ihr einen Wunsch zu erfüllen, so verfügte sie über gewisse Vorteile, die sie nutzen konnte. Einer war Schönheit. Obwohl Sabine nur sehr ungern die Rolle der Verführerin spielte, hatte sie sich heute Abend dennoch bemüht, sich dementsprechend zu kleiden. Sie trug ein Kleid aus feinster elfenbeinfarbener Seide, das dem Engländer bestimmt gefallen würde. Es passte ihr wie angegossen, was an sich schon bemerkenswert war, wenn man bedachte, dass sie es direkt aus dem Schaufenster eines Geschäfts erstanden hatte. Kurze, hauchdünne Spitzenärmel bedeckten ihre Oberarme nur knapp, dazu trug sie bis zum Ellbogen reichende Satinhandschuhe. Das großzügige Dekolleté des Kleids hob ihre Brüste an und presste sie zusammen, sodass sie den Stoff buchstäblich zu sprengen drohten.
Von Calliope hatte sie sich das Haar zu duftigen kleinen Locken aufstecken lassen, die gerade eben ihre Schultern streiften und deren Zartheit noch betonten. Sie sah ganz und gar wie eine englische Lady aus. Unwillkürlich griff Sabine nach der Kette an ihrem Hals. Sie mochte einem Betrachter wie eine schlichte Goldkette erscheinen, doch unter dem Ausschnitt ihrer Abendrobe verborgen hing eine Glasphiole daran, die eine kleine Menge des Elixiers enthielt. Agnes hatte es ihr vor Monaten gegeben und sie angewiesen, es immer bei sich zu haben.
Von ihrem Beobachtungspunkt aus sah Sabine jetzt einen Mann aus dem Haus kommen. Er trug einen langen schwarzen Mantel, der sich um seine breiten Schultern spannte, und setzte sich einen Zylinder auf, ehe er in die wartende Kutsche stieg. Kaum dass seine Kutsche sich in Bewegung gesetzt hatte, wies Sabine ihren Fahrer an, ihr nachzufahren.
Sie hatte noch keine Vorstellung davon, wie sie Zutritt zu einem Ball, einer Soiree, oder wo auch immer er hingehen mochte, erlangen sollte, da sie keine Einladung vorweisen konnte. Aber vielleicht würden ihr hübsches Kleid und ein charmantes Lächeln genügen, um ihr Einlass zu verschaffen. Sie hielt den Blick auf die voranfahrende Kutsche gerichtet, um den englischen Gentleman nicht zu verlieren. Aber ihr Kutscher war geschickt und blieb dicht hinter ihm. Sie wünschte nur, sie hätte Mr Barretts Gesicht gesehen, denn da alle wohlhabenden Männer solche Mäntel und Zylinder trugen, war es eher unwahrscheinlich, dass sie ihn in einer Menge erkennen würde. Es dauerte weniger als zwanzig Minuten, bis sie vor einem dreistöckigen roten Ziegelbau anhielten. Mr Barrett stieg aus der Kutsche und verschwand hinter einer der schwarzen Haustüren. Sabine bemerkte, dass es keine Schilder gab, die auf irgendeine Art von Etablissement hinwiesen, auch wenn das Viertel erkennen ließ, dass es sich hier um ein Geschäfts-, und nicht um ein Wohnhaus handelte.
Die Straße war leer, als Sabine aus der Mietkutsche stieg. Ihr Magen flatterte vor Aufregung, und sie presste eine Hand dagegen, um ihn zu beruhigen. Dies war nicht der richtige Moment für Ängste.
Sie hatte eine Aufgabe zu erfüllen; so einfach war das. Nachdem sie sich in die Wangen gekniffen und fest die Lippen zusammengepresst hatte, um sie zu röten, machte sie sich auf den Weg zur Tür. Sie würde sich unter die Leute mischen, sich eine Weile umsehen und dann den gesuchten Herrn finden. Die schwere Tür ging auf, und Sabine fand sich in einem verrauchten Spielcasino wieder.
Fast hätte sie gelacht. Das kostbarste Artefakt von Atlantis in den Händen eines Spielers! Sie war versucht, sich furchtbar aufzuregen, aber vielleicht konnte sich dieser Umstand ja auch als günstig für sie erweisen. Von diesem Gedanken beflügelt, machte sie sich auf die Suche nach dem Marquess.
Kapitel zwei
Max nahm seine Karten auf und sah sogleich, dass mit dieser lausigen Kombination nichts zu gewinnen war. Aber gerade deswegen liebte er dieses amerikanische Spiel so sehr – weil er bluffen und sogar mit einem nur mittelmäßigen Blatt gewinnen konnte.
Die anderen Männer der Pokerrunde waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen, denen problemlos anzusehen war, ob sie ein gutes Blatt hatten oder ob sie wussten, dass sie verlieren würden. Zwei der älteren Herren hatten sich schon entschuldigt und den Tisch verlassen, als die Einsätze erhöht worden waren. Jetzt blieben außer ihm nur noch vier andere Spieler. Ein alter Mann mit dichtem weißem Haar und einer tiefen, rauen Stimme; ein junger Bursche, den man noch für einen Knaben halten könnte, da nicht einmal ein leichter Flaum sein Kinn bedeckte, und der Earl of Chilton, der ein guter Gegner war, wenn er nicht trank. Heute Nacht hatte sich der Mann jedoch schon einiges zu viel gegönnt.
Der vierte Spieler war der bei Weitem interessanteste. Es war eine Frau in einem cremefarbenen Kleid mit tiefem Ausschnitt, der Max' reger Fantasie nur wenig Spielraum ließ. Sie war die Art von Frau, die man in einem Ballsaal erwarten würde, umgeben von Bewunderern, aber nicht in einer verrauchten Spielhölle inmitten betrunkener Narren. Mit ihrem glänzenden, rötlich braunen Haar und ihren karamellfarbenen Augen war sie geradezu umwerfend. Und obwohl ihre dunklere Hautfarbe ihn vermuten ließ, dass sie ursprünglich nicht aus England stammte, hatte sie doch keinen Akzent, der ihm einen Hinweis auf ihr Heimatland gegeben hätte.
Obwohl Max sie noch nie gesehen hatte und sie wie eine kultivierte Dame aussah, hegte er doch gewisse Zweifel. Wenngleich sie keine spezifischen Eigenarten erkennen ließ und auch das richtige Aussehen hatte, war doch irgendetwas an ihr anders. Und er wusste, dass er sie noch nie zuvor gesehen hatte, da sie nicht die Art von Frau war, die ein Mann vergaß.
Anfänglich hatte er sie als Ablenkung empfunden, doch nachdem auch die zweite Partie in Folge an sie gegangen war, hatte er sich zusammengerissen und seine Blicke von ihrem verführerischen N'Dekolleté ferngehalten.
Obwohl sie mehr Partien gewonnen hatte als die meisten Männer am Tisch, war sie keine geübte Spielerin. Bisweilen erwies sie sich jedoch als schwer durchschaubar, fast so, als wäre sie eine Schauspielerin, die in eine Rolle schlüpfte und charmant, kokett und wagemutig wurde, während sie sie spielte. Aber hin und wieder fiel ein Schleier über ihre Augen, und dann konnte Max einen Anflug von Unsicherheit darin wahrnehmen. Ob das an dem Blatt lag, das sie in der Hand hielt, oder an etwas anderem, würde er allerdings erst noch herausfinden müssen.
»Ich erhöhe«, sagte sie mit einer Stimme, die wie warmer Honig war, und zog eine ihrer perfekten Augenbrauen hoch, als sie in seine Richtung blickte. »Mylord«, sagte sie.
Max sah sich am Tisch um. An Chiltons süffisantem Lächeln erkannte er, dass der Earl ein gutes Blatt hatte. Der weißhaarige alte Mann hatte schon gepasst, ebenso der junge. Aber was für Karten hielt die hübsche junge Frau in ihren Händen?
»Was für eine Verführerin«, sagte Max, ohne die Augen von ihr abzuwenden, als er seine Geldstücke auf die Tischmitte warf. »Ich gehe mit.«
Chilton runzelte die Stirn, brummelte etwas Unverständliches vor sich hin und passte. Offensichtlich gab sein Blatt, so gut es vielleicht auch sein mochte, dem angetrunkenen Mann nicht genügend Zuversicht.
Sie erhöhten schnell noch einmal, bevor der Geber die Partie für beendet erklärte. Max deckte seine Karten auf. Zwei Paare gegen ihr Trio.
»Die Lady gewinnt«, sagte der Dealer.
Mit ihren behandschuhten Händen schob sie die Münzen zu sich heran und stapelte sie ordentlich.
Chilton stand auf. »Mir reicht’s von diesem dummen Spiel.« Er beäugte die Dame am Tisch, dann richtete er seinen Blick auf Max. »Du hast ja hübsche Gesellschaft heute Nacht, Lindberg. Ich glaube, ich ziehe mich zurück«, sagte er, als er sich entfernte, doch dann sah Max, dass er sich ein paar Tische entfernt einen anderen Platz suchte.
Max nahm sein neues Blatt und betrachtete es. Die Götter selbst schienen die Karten gegeben zu haben, denn er schaute auf vier Könige.
Wieder passten die anderen beiden Herren und überließen die Partie Max und der Dame, der geheimnisvollen, schönen Frau mit den karamellfarbenen Augen. Diesmal konnte er jedoch nicht verlieren. Nicht mit einem solch fabelhaften Blatt.
Sie hob einige Münzen auf, hielt dann aber über der Einsatzschale inne und sah sich noch einmal ihre Karten an, bevor sie langsam ihren Blick auf Max richtete. »Wie wäre es mit einem anderen Einsatz?«
Max nickte interessiert. »Und woran hatten Sie gedacht?« Seine Fantasie beschwor augenblicklich Bilder all der sündhaften Dinge herauf, die er mit ihr auf ebendiesem Tisch tun könnte. Er würde Stunden brauchen, um jede ihrer hinreißenden Rundungen zu erkunden. Beginnen würde er an dieser wunderbar zarten Haut unter ihrem Ohr und an ihrem Nacken. Dann würde er sich langsam tiefer vorarbeiten …
»Ihre Landkarte, Mr Barrett. Ich will nur die Karte«, sagte sie langsam und bedächtig.
Oho. Sie wusste also, wer er war, und sie wusste auch von seiner Karte.
Es war kein großes Geheimnis, das er zu verbergen suchte. Trotzdem würde er in Gesellschaft nie damit hausieren gehen. Wozu auch? Es war ein beliebter Zeitvertreib, sich auf die Jagd nach Schätzen oder Artefakten zu begeben, und für die Existenz von Atlantis gab es keinen wissenschaftlichen Beweis.
Er hatte einmal geglaubt, mit der Landkarte den endgültigen Beweis gefunden zu haben, doch außer den Männern von Solomon's hatte niemand seiner Entdeckung viel Beachtung geschenkt. Und daher hing diese Karte jetzt einfach nur an seiner Wand. Wieso also das plötzliche Interesse daran? Und wie hatte diese Frau davon erfahren?
Frauen redeten viel, das wusste er. Und er hatte mehr als seinen Teil an Frauen gehabt. Manchmal hatte er auch die eine oder andere auf seinem Schreibtisch genommen, aber er wäre nie auf die Idee gekommen, dass sie einer alten Landkarte Beachtung schenken würden. Es wäre ein ziemlicher Schlag für seinen Stolz, hätte eine dieser Frauen auf die Ausstattung seines Arbeitszimmers geachtet, während er glaubte, sie wären mit interessanteren Dingen beschäftigt. Der Gedanke brachte ihn fast zum Lachen.
Ihm lag schon die Frage auf der Zunge, wie diese Frau von der Karte erfahren hatte, aber wichtiger war, warum sie sie haben wollte. »Was will eine schöne Frau wie Sie mit einer staubigen alten Landkarte?«
Sie schenkte ihm ein Lächeln, und ihr ohnehin schon hübsches Gesicht verwandelte sich zu einem von vollkommener Schönheit. Ihr Anblick traf ihn wie ein Fausthieb in den Magen.
Sie zupfte an einem ihrer Satinhandschuhe. »Vielleicht bin ich ja eine Gelehrte. So wie Sie«, sagte sie und zog eine Augenbraue hoch.
»Ich bin ein Abenteurer, kein Gelehrter.« Wenn sie wirklich etwas über ihn wusste, sollte ihr das bekannt sein. »Und Sie sehen genauso wenig wie eine Gelehrte aus wie ich.«