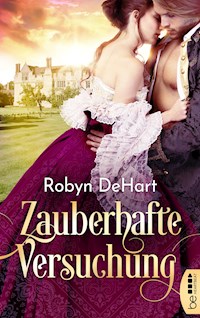
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Legend Hunters Reihe
- Sprache: Deutsch
Nichts ist verführerischer als das Abenteuer der Liebe!
Die Legende um die Büchse der Pandora übte seit jeher eine große Anziehungskraft auf die schöne, aber schüchterne Esme aus. Als sie die Büchse plötzlich in ihren zarten Händen hält, kann sie ihr Glück kaum fassen. Ein kurzer, verstohlener Blick hinein verändert ihr Leben von einer Sekunde auf die andere - aus dem stillen Bücherwurm wird eine Dame, die die Kunst der Verführung genau einzusetzen weiß. Für ihre neue Gabe findet sie schon bald Verwendung: Als der attraktive Gentleman Fielding sie aus einer äußerst gefährlichen Situation befreit, weiß sie ganz genau, wie sie ihm danken kann ...
"Eine Abenteuerromanze, die Ihr Blut zum Kochen bringt!" Romantic Times
Weitere prickelnde Romane zum Dahinschmelzen von Robyn DeHart:
Das Rätsel deiner Leidenschaft
Das Geheimnis unserer Herzen
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Vorwort
Danksagung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Das Rätsel deiner Leidenschaft
Das Geheimnis unserer Herzen
Über dieses Buch
Nichts ist verführerischer als das Abenteuer der Liebe!
Die Legende um die Büchse der Pandora übte seit jeher eine große Anziehungskraft auf die schöne, aber schüchterne Esme aus. Als sie die Büchse plötzlich in ihren zarten Händen hält, kann sie ihr Glück kaum fassen. Ein kurzer, verstohlener Blick hinein verändert ihr Leben von einer Sekunde auf die andere – aus dem stillen Bücherwurm wird eine Dame, die die Kunst der Verführung genau einzusetzen weiß. Für ihre neue Gabe findet sie schon bald Verwendung: Als der attraktive Gentleman Fielding sie aus einer äußerst gefährlichen Situation befreit, weiß sie ganz genau, wie sie ihm danken kann …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Robyn DeHart wusste schon immer, dass sie Schriftstellerin werden wollte. Sie wuchs als jüngstes von drei Kindern wohlbehütet in Texas auf. Nach ihrer Schulzeit studierte sie Soziologie an der Texas State University. Anschließend hatte sie diverse Jobs, bis sie sich ganz dem Schreiben widmete. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei sehr verwöhnten Katzen am Fuße der Smoky Mountains in den USA.
Robyn DeHart
ZAUBERHAFTEVERSUCHUNG
Aus dem amerikanischen Englisch vonUlrike Moreno
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2009 by Robyn DeHart
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Seduce Me«
Originalverlag: Grand Central Publishing, New York
This edition published by arrangement with Grand Central Publishing, New York, NY, USA. All rights reserved.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2011/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Susanne Kregeloh, Drestedt
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © zhaojiankang/iStock/Getty Images Plus; sanyal/iStock/Getty Images Plus; gosia76/iStock/Getty Images Plus; The Killion Group
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2377-0
be-heartbeat.de
lesejury.de
Mein großer Dank gilt meiner ältesten und liebsten Freundin Amy White. Wir sind sehr erwachsen geworden seit jenen langen Nächten auf dem Sofa, in denen wir uns alberne Filme angesehen und gelacht haben, bis wir keine Luft mehr kriegten, doch unsere Freundschaft ist unverbrüchlich. Und wer hätte gedacht, dass Cracker so vielseitig verwendbar sind. Danke, dass du immer für mich da bist. Nein, in dieser Geschichte geht es nicht um Olivia und Simon, aber ich verspreche dir, dass du Esme und Fielding ebenso lieben wirst.
Und wie immer danke ich von ganzem Herzen meinem Ehemann Paul. Danke, dass du all meine Verrücktheiten erträgst und die zahllosen Pizzen (nicht, dass dich das je gestört hätte!). Und danke dafür, dass du dich immer bereit erklärst, die Rühreier zu machen. Du bist mein Held, im wahrsten Sinne dieses Wortes.
Danksagung
Kein Buch wird ohne die Unterstützung anderer geschrieben, und auch das vorliegende bildet keine Ausnahme. Deshalb geht mein aufrichtiger Dank an meine Kritikerinnen Emily und Hattie, die mehr von meinem Gejammere ertragen haben, als zwei Menschen es verdienen. Ich danke meiner fantastischen Agentin Christina Hogrebe, die sich immer im richtigen Moment begeistert. Ganz besonders herzlich bedanke ich mich bei allen Mitarbeitern von Grand Central für die herzliche Aufnahme, vor allem meiner brillanten Redakteurin Amy Pierpont, die mir eine neue Sichtweise für Veränderungen vermittelt hat. Für ihr unübertreffliches Urteilsvermögen ist dieses Buch das beste Beispiel. Danke, dass du an mich und dieses Projekt geglaubt hast. Und natürlich möchte ich keinesfalls versäumen, Kelly Harms zu erwähnen; auch wenn du dich jetzt größeren Aufgaben widmest, weiß ich, dass meine Karriere ohne deine Unterstützung und Anleitung nicht zu dem Erfolg geführt hätte, den ich heute habe. Dafür werde ich dir immer dankbar sein.
Prolog
In der Nähe von AlexandriaMärz 1887
Schweiß vermischte sich mit Sand, lief ihm in die Augen und trübte seinen Blick. K-J Fielding Grey, Viscount of Eldon, fuhr sich mit einem schmutzstarrenden Lappen über das staubbedeckte Gesicht. Es war immer mit Mühen verbunden, in eine Höhle zu kriechen oder eine Grabstätte freizulegen. Oder, wie eben jetzt, einen Tempel auszugraben.
Sand und Schmutz waren dabei nebensächlich. Für Fielding Grey waren sie ebenso unwichtig wie der Gegenstand, nach dem er auf der Suche war. Das Einzige, was für ihn zählte, als er sich in einen kleinen, nur von der Laterne in seiner Hand erhellten Vorraum zwängte, war die enorme Summe, die sein Kunde ihm zahlen würde, sobald er die Überreste der Großen Bibliothek von Alexandria fand.
Diese Bibliothek war einst die größte der Welt gewesen und hatte Schätze wie Aristoteles' private Sammlung enthalten. König Ptolemäus II. hatte sogar Schiffe kapern lassen, um Bücher oder Schriften, die sich an Bord befanden, für die berühmte Bibliothek zu konfiszieren. Der Legende nach war sie auf Befehl Julius Caesars vernichtet worden, die Mehrheit der Archäologen behauptete jedoch, die Stadt sei rechtzeitig gewarnt und die umfangreiche Sammlung in Sicherheit gebracht worden.
Mehr als sechzehn Monate der Nachforschungen hatten Fielding letztendlich hierhergeführt: zum Tempel der Isis auf einer kleinen Insel vor der Küste Ägyptens und in der Nähe Alexandrias.
Fielding sprang in die Vorkammer hinunter, und der dumpfe Laut des Aufpralls auf dem steinernen Boden hallte durch den Raum. Die beiden Ägypter, die er als Helfer angeheuert hatte, folgten ihm und brachten weitere Laternen mit. Das zusätzliche Licht erhellte die Kammer und beleuchtete die Hieroglyphen an den steinernen Wänden. Die farbigen Zeichnungen stellten sowohl die Göttin Isis, die Horus stillte, als auch den erwachsenen Horus dar.
Fielding schritt eine der Wände ab und strich mit der Hand über den kalten Stein. Es musste irgendwo einen Hebel, einen lockeren Stein oder irgendetwas anderes geben, das ihnen einen Zugang zu der nächsten verborgenen Kammer öffnete. Doch er fühlte nichts als glatten Stein. Fielding wusste, dass er so weit wie möglich in die Tiefe vordringen musste. Denn dort würden die Überreste der Bibliothek zu finden sein; vor allem aber - wenn die Gerüchte stimmten - die geheimen Schriften des Sokrates, die ein wertvoller Bestandteil der Sammlung des Aristoteles gewesen waren. An ebendiesen Schriften war Fieldings Auftraggeber ganz besonders interessiert.
Ein sechs Zoll langer schwarzer Skorpion kroch über Fieldings Stiefel und versuchte, einen Weg in sein Hosenbein zu finden. Fielding schüttelte das lästige Tier ab und schleuderte es quer durch den Raum. Seine Helfer sprangen erschrocken zur Seite und drückten sich ängstlich gegen die Wand.
»Wir müssen tiefer hinunter«, erklärte er ihnen in ihrer Muttersprache. Er sprach sie nicht fließend, kannte aber immerhin von früheren Ausgrabungen her genügend Worte, um zurechtzukommen.
Die beiden dunkelhäutigen Männer nickten, machten aber keine Anstalten, sich von der Stelle zu bewegen.
Als Fielding den Boden unter seinen Füßen genauer betrachtete, fiel ihm dort, wo er den Skorpion weggeschleudert hatte, eine leichte Rille im Sand auf. »Ich brauche Wasser.« Er streckte die Hand aus, und einer der Männer, vielleicht der tapferere der beiden, trat vor und reichte ihm die Feldflasche.
Mit der Stiefelspitze schob Fielding noch mehr Sand beiseite und legte ein größeres Stück der Rille frei. Dann kniete er sich hin und goss ein wenig Wasser in die Spalte. Die Flüssigkeit schlug Blasen im Sand und nahm eine hellbraune Färbung an, bevor sie nach unten versickerte. Fielding scharrte noch mehr Sand beiseite und legte sein Ohr an den Boden, ehe er eine größere Menge Wasser nachgoss.
Auch dieses Wasser verschwand in der Spalte, und irgendwo tief unter ihnen konnte Fielding die Tropfen aufschlagen hören.
»Da ist noch eine weitere Kammer unter dieser«, sagte er zu seinen Assistenten. »Sucht nach einer Möglichkeit, sie zu öffnen.« Mit einer ungeduldigen Handbewegung zeigte er auf die beiden Männer, die noch immer ängstlich an der Wand standen. »Scharrt mit den Füßen den Sand beiseite«, befahl er ihnen.
Als sie sich immer noch nicht rührten, sagte er: »Und hört auf, diese lächerliche Angst vor einem Fluch zu haben! Das hier ist ein Tempel, in den Menschen zum Beten gegangen sind.« Er erwähnte nicht, dass die Wahrscheinlichkeit einer Bedrohung umso größer wurde, je näher sie der legendären Bibliothek kamen. Die Menschen der Antike hatten alles nur Erdenkliche getan, um wertvolle Dinge vor Schatzjägern wie ihm zu schützen.
Ein weiterer Skorpion kroch über den sandbedeckten Steinboden auf einen von Fieldings Helfern zu. Der Mann wich dem Tier mit einem Sprung aus und kam hart auf einem Stein zu seiner Rechten auf. Urplötzlich geriet der gesamte Boden in Bewegung, und zwischen den Steinen taten sich breite Spalten auf. Das gefährliche Insekt verschwand in einer der Öffnungen, und Fielding fasste nach der Wand zu seiner Rechten, um sich festzuhalten.
»Rührt euch nicht von der Stelle!«, warnte er seine beiden Begleiter.
Nachdem alle sekundenlang regungslos verharrt waren, trat Fielding vorsichtig einen Schritt vor und dann noch einen zweiten. Beim dritten geriet er wieder so heftig ins Schwanken, dass er Halt suchend nach der Wand griff. Kaum hatte er sie berührt, hörte er hinter sich ein Klicken. Dann gab der Boden unter ihm nach.
Fielding fluchte, als er in die Tiefe stürzte und mit einem schmerzhaften Aufprall auf dem harten Boden der darunterliegenden Kammer landete. Die Laterne, die er in der Hand gehalten hatte, zerbrach und erlosch. Er konnte kaum noch den Schein der Laternen seiner beiden Helfer über ihm sehen.
»Werft mir eine Fackel zu!«, rief er zu ihnen hinauf.
Sie befolgten seine Anweisung, doch die unangezündete Fackel landete irgendwo zu seiner Linken. Es war so dunkel, dass er sie nicht sehen konnte. Er begann, den Boden abzutasten, doch der Gedanke an den Skorpion, der irgendwo hier unten war, ließ ihn wieder innehalten.
»Lasst eine der Laternen an einem Seil herab, damit ich hier etwas sehen kann.«
Die herabgelassene Laterne verbreitete genügend Licht in dem Raum, um die Fackel finden zu können. Fielding zündete sie rasch an, und sogleich streifte die Wärme des Feuers sein Gesicht. Ein rascher Blick durch die Kammer offenbarte ihm zwei weitere Fackeln an der Wand. Er entzündete beide, und kurz darauf erfüllte ein weiches Licht den Raum.
Zu seiner Rechten befand sich die Öffnung zu einem dunklen Gang, der seiner Erforschung harrte. Ob er dabei, wie es seinem Auftrag entsprach, die Bibliothek entdeckte oder nicht, spielte keine Rolle, denn was immer er auch sonst hier unten finden mochte, würde ihm zweifellos ebenfalls ein hübsches Sümmchen einbringen.
»Lasst das Seil noch ein Stück herunter, damit ich hochklettern kann, wenn ich hier fertig bin.« Keiner der Männer antwortete, aber das Seil wurde heruntergelassen, bis es fast den Boden der Kammer erreichte, in die Fielding gefallen war.
Hier unten gab es weitere Hieroglyphen, doch sie waren nicht auf die Wände gemalt, sondern eingemeißelt worden. Fielding atmete tief ein und füllte seine Lungen mit der kalten, nach Kalk riechenden Luft. Der Gang erwies sich als enger als erwartet, und Fielding wurde klar, dass er ihn auf allen vieren würde durchqueren müssen. Keine leichte Aufgabe, wenn man gleichzeitig eine Fackel bei sich tragen musste.
Auf die Knie und den linken Ellbogen gestützt, kroch er langsam in den Gang hinein, während er in der rechten Hand die Fackel hielt. Er befand sich schon halb in dem engen Gang, als ihm der Gedanke kam, der Tunnel könnte eventuell beschädigt sein. Mit der linken Hand tastete Fielding den Boden vor sich ab, um die Festigkeit des Gesteins zu prüfen. Soweit er es beurteilen konnte, war es ausreichend fest.
Zentimeter um Zentimeter bewegte er sich vorwärts und merkte, dass das Dunkel vor ihm zunehmend schwärzer wurde. Erst mehrere aufgeregte Herzschläge später erkannte er, dass der Gang jenseits einer breiten Spalte im Boden weiterführte.
Vorsichtig näherte er sich der Öffnung im Tunnelboden. Jemand hatte hier zu extremen Maßnahmen gegriffen, um zu schützen, was immer auch am Ende dieses Ganges lag. Fielding kroch bis an den Rand der breiten Bodenspalte und spähte in eine von Felswänden umgebene Kammer hinunter, die in tiefster Dunkelheit verschwand.
Normalerweise stellte seine Körpergröße eine Behinderung für seine Arbeit dar, wenn er sich durch enge Spalten zwängen musste. Bei dieser großen Öffnung im Boden vor sich war Fielding jedoch ziemlich sicher, sie überwinden zu können. Wieder beugte er sich über den Rand und hielt die Fackel über den Abgrund, um zu sehen, was für ein Schicksal ihn dort unten erwartete, sollte der Sprung misslingen. Der Sand am Boden der Kammer war mit Knochen und angespitzten, aus dem Boden aufragenden Holzpfählen übersät.
Nach einem tiefen, beruhigenden Atemzug sprang Fielding, mit der Fackel zwischen seinen Zähnen, auf die andere Seite des Spaltes. Doch die Entfernung war größer, als er angenommen hatte, und der Sprung misslang. Er landete bäuchlings auf der gegenüberliegenden Seite, während er mit den Beinen über dem Abgrund hing. Die Tasche, die er um die Taille trug, geriet ins Rutschen und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Mit Händen und Füßen tastete er an den glatten Wänden der Kammer nach einem Halt und schaffte es im letzten Moment, seinen Absturz zu verhindern.
Die heiße Asche der Fackel stob ihm ins Gesicht und brannte ihm in den Augen, aber er sagte sich grimmig, dass er schon oft in schwierigen Situationen gewesen war und sie immer überlebt hatte.
Beherrscht von diesem Gedanken zog er sich zum Rand der Spalte hinauf und kroch weiter den Gang entlang. Nach kurzer Zeit erreichte er einen riesigen Raum mit vielen, in die Steinwände gehauenen Fächern, in denen Schriftrollen und -tafeln lagerten.
Zu guter Letzt hatte er sie also doch gefunden, die verlorene Bibliothek Alexandrias!
Fielding begann mit seiner Suche in dem Fach zu seiner Rechten, wobei er darauf achtete, die empfindlichen Rollen mit größter Sorgfalt zu behandeln. Ein Vermögen lagerte in diesem Raum. Sein Kunde hatte ihn beauftragt, ihm einige ganz bestimmte Texte zu bringen, doch alles andere würde er selbst an den Meistbietenden verkaufen können.
Fielding brauchte fast eine Stunde, um den Inhalt mehrerer Fächer durchzusehen, bevor er Schriftrollen mit Sokrates' Namen darauf entdeckte. Er verstaute sie sorgfältig in seiner Tasche und wandte sich zum Gehen. Morgen würde er mit einigen Helfern zurückkommen, um den Rest des Fundes zu holen.
Da Fielding die Größe der Fallgrube jetzt besser einzuschätzen wusste, bewältigte er den Rückweg durch den Tunnel ohne Zwischenfall, und schon bald stand er wieder unter dem Seil, mit dem seine Helfer die Laterne herabgelassen hatten.
»Zieht das Seil straff«, rief er zu ihnen hinauf. »Ich komme hoch.«
Nachdem er die Tasche an seiner Taille befestigt hatte, begann er den Aufstieg in die Vorkammer. Er schaffte es mühelos bis oben und streckte seine Hand aus. Kräftige Finger schlossen sich um seinen Unterarm und gaben ihm genügend Unterstützung, um sich hinaufziehen zu können.
Als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte, klopfte Fielding sich als Erstes den Staub von der Hose. Erst dann richtete er sich auf. »Wer zum Teufel sind Sie?«, fragte er verblüfft den Mann, der vor ihm stand. Fielding schaute sich schnell in der Kammer um, doch von seinen beiden Helfern, die mit ihm in den Tempel gestiegen waren, war nichts zu sehen. »Und was haben Sie mit meinen Männern gemacht?«
»Sie wurden ausgezahlt und heimgeschickt.« Der Mann hielt ihm eine Visitenkarte hin. »Ich bin ein Freund.«
Was für ein großspuriger Idiot nahm Visitenkarten zu einer Ausgrabungsstätte mit? Fielding griff nach der Karte und las die Aufschrift: Jonathon Kessler, Solomons. Klar, ein großspuriges Mitglied von Solomons natürlich. Und er hatte diesen Skorpion vorhin für lästig gehalten! Fielding drückte dem Mann die Karte in die Hand. »Ich bin kein Freund von Solomons«, erklärte er mit unüberhörbarer Kälte in der Stimme.
Kessler lächelte und steckte die Visitenkarte wieder ein. »Die Herren unseres Clubs würden Ihnen gern ein Geschäft vorschlagen«, sagte er. Der Mann, der um einige Jahre älter als Fielding zu sein schien, hatte es irgendwie geschafft, in die Grabstätte hinabzusteigen, ohne auch nur ein Staubkörnchen auf seinen tadellos gebügelten Anzug zu bekommen. Fielding kämpfte gegen das kindische Bedürfnis an, mit einem Fußtritt Sand auf Kesslers glänzende schwarze Stiefel zu befördern.
Aber er beherrschte sich und rollte das Seil auf, um es in seinem Rucksack unterzubringen. »Man will mir also ein Geschäft vorschlagen. Und deshalb schicken die Sie bis nach Ägypten, um mit mir zu sprechen.«
Kesslers Mundwinkel verzogen sich zu einem schwachen Lächeln. »Natürlich nicht«, erwiderte er herablassend. »Ich war bereits in Alexandria. Und nun, da Sie gefunden haben, wonach Sie gesucht haben -«, der Mann deutete mit dem Kinn auf die Tasche an Fieldings Taille-, »werden Sie nach London zurückkehren. Die Herren möchten Sie gleich nach Ihrer Ankunft sprechen.«
Fielding hatte eine lange Liste von Dingen, die er nach seiner Rückkehr nach London zu tun gedachte: Ein langes, heißes Bad nehmen, sich ein Glas guten Brandy oder vielleicht sogar mehrere genehmigen und mindestens eine Woche im Bett einer willigen Frau verbringen. Ein Besuch bei Solomons stand nicht auf dieser Liste.
»Ich habe kein Interesse an Solomons«, sagte er.
»Und ich kann Ihnen versichern, dass das normalerweise auf Gegenseitigkeit beruhen würde, Mr. Grey. Unter den gegebenen Umständen glaube ich jedoch, dass ein befristetes Bündnis für beide Seiten von sehr großem Nutzen sein würde. Vielleicht denken Sie ja noch einmal darüber nach.« Der Mann zog ein Kuvert aus seiner Rocktasche und reichte es Fielding. »Es ist ein Angebot, das Sie gar nicht ablehnen können.«
1. Kapitel
London,Mitte Juni 1887
Es war an einem Freitagabend in einem verschlafenen Viertel Londons, als Esme Worthington höchst undamenhaft gähnte und sich die Augen rieb. Es war weit über ihre normale Schlafenszeit hinaus, aber sie hatte sich nicht von ihrer Lektüre losreißen können. Irgendwann nach Mitternacht hatte sie den Stuhl in ihrem Arbeitszimmer gegen das weitaus bequemere Sofa im Wohnzimmer getauscht. Dessen weiche geblümte Polster machten sie jedoch noch schläfriger, anstatt sie zu ermuntern, ihre Recherchen fortzusetzen. Esme veränderte erneut ihre Haltung, blinzelte ein paarmal und gab sich alle Mühe, sich wieder auf ihr Buch zu konzentrieren.
Sie las den letzten Satz noch einmal und versuchte, das Gelesene zu erfassen. Einige dieser sogenannten Gelehrten stellten aber auch wirklich die absurdesten Behauptungen auf. Wie hätte ein Artefakt aus dem alten Griechenland in den Dschungel Südamerikas gelangen sollen? Es war völlig ausgeschlossen, dass die Büchse der Pandora auf dem Schiff eines spanischen Entdeckers gelandet war.
Wieder gähnte Esme.
Ihr großer schwarzer Kater hob verschlafen den Kopf von ihrem Schoß, auf dem er sich zusammengerollt hatte. Seine goldenen Augen waren kaum mehr als Schlitze, als er gähnte. »Du hast recht, Horace, ich glaube, ich sollte besser schlafen gehen. So müde, wie ich bin, bekomme ich ohnehin nichts mehr geschafft.«
Esme kraulte den Kater hinter den Ohren, was er ihr mit einem zufriedenen Schnurren dankte. Sie legte das schwere Buch auf den Tisch neben sich und erhob sich seufzend. »Du bewachst die Bücher, und morgen früh bekommst du dafür etwas warme Milch von mir.«
Esme löschte die Lampe und verließ das Zimmer. Als Horace ihr folgte, nahm sie ihn auf den Arm. »Du willst mir heute Nacht die Füße wärmen, was?«
Dann hielt sie plötzlich inne, weil sie im Nebenzimmer ein Scharren auf dem Holzboden gehört hatte. Zu dieser späten Stunde konnte Tante Thea unmöglich noch wach sein. Vielleicht war es ja einer der Dienstboten, obwohl auch die normalerweise früh zu Bett gingen. Auf leisen Sohlen schlich Esme zu dem Zimmer und öffnete vorsichtig die Tür.
Zwei von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidete Männer unterbrachen, was immer sie auch taten, und fuhren zu ihr herum, als sie die Tür aufgehen hörten.
Ein erstickter Schrei entrang sich Esme, als Horace ihr aus den Armen sprang und in das Arbeitszimmer stolzierte, in dem die Diebe sich befanden. Offenbar fehlte es ihm völlig an dem üblichen katzenhaften Gespür für Gefahr.
Esmes Herz raste, doch nachdem sie die Eindringlinge überrascht hatte, konnte sie die beiden keinesfalls mit ihren Missetaten weitermachen lassen,. »Ich muss doch sehr bitten!«, sagte sie und straffte die Schultern, um größer zu erscheinen. »Was erlauben Sie sich eigentlich?« In ihrem Arbeitszimmer herrschte ein schier unglaubliches Durcheinander. Der Fußboden war übersät mit Büchern und Papieren. Was für Barbaren … Esme hob das Buch auf, das direkt vor ihren Füßen lag und drückte es an ihre Brust.
Die beiden Männer hatten in etwa die gleiche Größe, wobei der eine deutlich muskulöser und kräftiger als sein Komplize war. Er ging jetzt auf Esme zu, die viel zu spät bemerkte, dass sie nichts hatte, was sie als Waffe gegen den Kerl benutzen konnte. Selbst ihre Hausschuhe waren für eine Gegenwehr absolut untauglich. Vielleicht hätte sie ihm das Buch, das sie in der Hand hielt, über den Kopf schlagen können, aber es war ihre wertvolle Ausgabe von Gullivers Reisen, und sie wollte nicht riskieren, sie zu beschädigen. Und sie wollte auch weder ihre Tante noch deren altgedienten Dienstboten wecken, um sie nicht auch noch in Gefahr zu bringen. Deshalb nahm Esme ihren ganzen Mut zusammen und beschloss, nicht zu verzagen.
»Ich kann Ihnen versichern, dass es hier nichts zu stehlen gibt. Sollte das Ihre Absicht sein, dann sind Sie hier im falschen Viertel«, sagte sie. »Auch wenn Sie schon sehr gute Arbeit beim Zerstören meiner Bibliothek geleistet haben.« Dann kam ihr der Gedanke, dass es ihre kostbaren Bücher sein könnten, auf die die Einbrecher es abgesehen hatten. »Ich habe keine Originalausgaben«, log sie. »Diese Bücher sind nur billige Romane und überhaupt nichts wert.« Auch das war eine Lüge.
Der Kräftigere der beiden Männer machte noch einen Schritt auf sie zu. Sein Blick war von beängstigender Wildheit, und als er ihn langsam über ihren Körper gleiten ließ, wurde Esme nur allzu gut bewusst, wie dürftig sie bekleidet war. Andererseits war es bereits weit nach Mitternacht, weswegen einer Frau durchaus das Recht zustand, nur mit einem dünnen Nachthemd und einem Morgenmantel angetan in ihrem eigenen Haus zu sitzen. Der aufdringliche Blick dieses Mannes ging ihr jedoch derart durch und durch, dass sich die Härchen in ihrem Nacken aufrichteten und sie ein Erschaudern unterdrücken musste.
Diese Kerle waren doch wohl nicht hier, um sich an ihr zu vergreifen? Während Esme ihren Morgenrock noch fester um sich zog, musterte sie ihre Gegner. Sollten die beiden tatsächlich so etwas vorhaben, würde sie das ganze Haus zusammenschreien. Auch wenn die anderen drei Personen im Haus schon ziemlich alt und grau waren, konnten sie doch immer noch einen Schürhaken oder Schirm ergreifen und ihr gegen die Angreifer zur Seite stehen. Und Tante Thea hatte doch diese lächerlich schweren Kandelaber im Esszimmer … Vielleicht wäre es klüger gewesen, einen davon zu holen, anstatt unbewaffnet in das Zimmer zu stürmen.
»Wo ist der Schlüssel?«, fragte der Mann.
»Wozu brauchen Sie Schlüssel?« Esme zeigte auf die ausgeleerten Schubladen und Regale. »Sie brechen doch sowieso all das auf, in das Sie hineinschauen wollen.«
Er kam ihr so nah, dass sie die Gier in seinen Augen sehen konnte, als er ihr das Buch aus der Hand riss und es durchs Zimmer schleuderte. Es landete auf dem Rücken, und die Seiten fächerten sich auf, bis es geöffnet liegen blieb. Esmes Herz verkrampfte sich, und Panik ergriff sie, als ihr das Ausmaß des Schadens bewusst wurde, den diese Männer in ihrem Arbeitszimmer angerichtet hatten. Sie wagte sich gar nicht auszumalen, was solche Unmenschen ihr selbst zuleide tun könnten.
Sie sah den Mann vor sich aus schmalen Augen an. »Sie sollten bedenken, dass ich das ganze Haus zusammenschreien werde, falls Sie die Absicht haben, mir Gewalt anzutun«, sagte sie mit erzwungener Ruhe. »Und Sie können mir glauben, dass die Leute, die mir dann zu Hilfe eilen werden, Ihnen großen körperlichen Schaden zufügen werden.« Was natürlich vollkommen absurd war, wie sie wusste.
Der Mann streckte die Hand aus und befingerte die Rüschen an Esmes Ärmel. »Ein verlockender Gedanke«, erwiderte er und kräuselte die Lippen. »Aber wir wollen nur den Schlüssel.« Seine Stimme war unangenehm schnarrend, als er hinzufügte: »Und Ihr Personal haben wir bereits gesehen.« Dabei grinste er und verzog seinen hässlichen Mund zu einem bösen Lachen.
Esme verschränkte die Arme vor der Brust, um das Zittern ihrer Hände zu verbergen, aber auch, weil sie hoffte, so ein wenig imponierender zu wirken. Kein leichtes Unterfangen für jemanden von ihrer zierlichen Statur, aber sie gab sich Mühe. »Ich habe keine Ahnung, von was für einem Schlüssel Sie da reden.«
Der Mann auf der anderen Seite des Zimmers begann, nervös zu werden. »Wir haben keine Zeit, Thatcher«, sagte er in dem breiten Cockney, das die ungebildete Londoner Bevölkerung sprach.
»Dann nehmen wir sie eben mit«, erklärte Thatcher.
»Sie werden nichts dergleichen tun«, sagte Esme und wich erschrocken einen Schritt zurück.
Der Mann ging um sie herum, schloss leise die Tür und stopfte Esme dann einen Lappen in den Mund. Wütend versuchte sie, danach zu greifen oder ihn auszuspucken, doch der Mann packte ihre Handgelenke und hielt sie fest, bevor sie noch das eine oder das andere tun konnte.
Esme versuchte, ihn zu kratzen, während er mit ihr rang, aber leider waren ihre Nägel so kurz, dass er sie vermutlich kaum spürte. Sie musste wirklich aufhören, sie abzukauen. Wütend trat sie um sich, versuchte, ihre Hände frei zu bekommen und alles zu tun, um die Männer davon abzuhalten, sie zu entführen.
Angst und Panik krampften ihr den Magen zusammen und verursachten ihr Übelkeit. Sie war ernsthaft in Gefahr. Wieder trat sie um sich, zielte verzweifelt nach den Schienbeinen des Mannes, doch all ihre Versuche waren vergeblich.
Das durfte einfach nicht geschehen!
Mit ihren Bemühungen, sich aus der eisernen Umklammerung ihres Bezwingers zu befreien, erreichte sie nur, dass sie ermüdete. Sie kämpfte darum, ihren Atem unter Kontrolle zu halten, um nicht zu hyperventilieren oder an dem Knebel zu ersticken. Denk nach, Esme. Sie konnte, musste einen Ausweg aus dieser Lage finden.
Bestimmt hatten die Männer sie mit jemand anderem verwechselt. Sie besaß nichts Wertvolles. Schon gar nicht irgendwelche Schlüssel. Sie hatten ja nicht einmal einen verschließbaren Schrank für das Familiensilber. Für das nicht vorhandene Familiensilber, denn auch davon hatten sie schon längst nichts mehr. Diese dummen Einbrecher waren im falschen Haus und entführten die falsche Frau.
Thatcher riss den Gürtel ihres Morgenmantels ab, der sich öffnete, sodass Esme auch noch der Kälte ausgesetzt war. »Los, Waters, fessle ihr die Hände.«
Waters tat, wie ihm geheißen, während Thatcher die Bibliothek durch das Fenster verließ. Der dünne Satingürtel des Morgenmantels wurde zu einer harten Kordel, die in Esmes Handgelenke schnitt, als Waters sie damit fesselte. Da der Kräftigere der beiden Männer abgelenkt war, verdoppelte sie ihre Bemühungen, sich aus Waters Griff zu befreien. Doch trotz seiner schmächtigeren Gestalt waren seine Arme wie aus Stahl und hielten sie unerbittlich fest.
»Schieb sie zu mir raus, mit den Füßen voran«, befahl Thatcher seinem Komplizen mit gedämpfter Stimme.
Waters gehorchte, und Sekunden später wurde Esme durch das Fenster geschoben, als wäre sie ein Sack Kartoffeln.
»Irgendwie steckt sie mit ihrem Hintern fest«, sagte Waters.
»Dann heb sie doch hoch.« Thatchers Ungeduld war unüberhörbar.
Waters packte Esme an. »Dafür, dass sie so klein ist, hat sie 'n ziemliches Hinterteil.«
Esme funkelte ihn an, aber er bemerkte es nicht einmal. Was gäbe sie nicht dafür, den verflixten Knebel loszuwerden und den beiden für diese despektierlichen Bemerkungen über ihren Po gehörig die Meinung zu sagen! Er mochte für eine Frau von ihrer zierlichen Statur zwar ein bisschen groß sein, aber sie hatte ihn eigentlich immer als genau richtig empfunden.
Nachdem alle das Haus durch das Fenster verlassen hatten, bemerkte Esme die wartende Kutsche vor dem Haus. Vier Rappen scharrten ungeduldig mit den Hufen. Die ebenfalls schwarze Kutsche, die offenbar einem wohlhabenden Mann gehörte, war mit goldenen Filigranarbeiten verziert, und trotz der Dunkelheit konnte Esme sehen, wie sie glänzte. Die Tür schmückte ein Wappen, das auf rotem Grund einen prächtigen schwarzen Vogel zeigte, der seine Schwingen spreizte, als wäre er im Begriff davonzufliegen.
Bis auf die Kutsche lag die Straße verlassen da, aber sie waren nur wenige Schritte von der nächsten Ecke entfernt, die zu einer belebteren Straße führte. Jetzt war Esmes Chance gekommen, einen Fluchtversuch zu wagen. Sie rannte auf die Straßenecke zu, doch die Wolken, die den schon fast vollen Mond verdeckten, erschwerten ihr das Sehen sehr. Trotzdem schaffte sie es, ein ziemliches Stück weit zu entkommen, bevor einer der Männer sich von hinten auf sie stürzte, sie mit seinem Gewicht fast erdrückte und ihr den Atem raubte.
Das feuchte Gras, in dem Esme lag, wirkte auf sie wie eine kalte Dusche und brachte ihr augenblicklich wieder zu Bewusstsein, dass sie nur ihr dünnes Nachtzeug trug.
»Du gehst nirgendwohin, du kleines Biest.« Thatcher riss Esme auf die Beine und schwang sie sich über die Schulter. Dann warf er sie mit einer einzigen schnellen Bewegung in die Kutsche, wo sie auf dem schmutzigen Boden liegen blieb. Dann sprang er hinter ihr hinein, und die Kutsche setzte sich in Bewegung.
»Setz dich auf die Bank!«, fuhr Thatcher Esme an. Als sie sich nicht rührte, hob er sie auf und stieß sie auf den Sitz. »Du kannst nicht auf dem Boden liegen bleiben. Wir haben eine lange Fahrt vor uns.«
Esme zog die Beine an die Brust, um sich zu wärmen. Das Frösteln ließ aber nicht nach, und schließlich kniff sie die Augen zusammen und wünschte mit aller Macht, dass alles nur ein böser Traum sein möge. Denn es konnte einfach nicht geschehen. Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie sich wieder der Realität gegenüber, denn die beiden Schurken saßen mit ihr in der engen Kutsche. So gut es mit ihren gefesselten Händen möglich war, schob Esme den Fenstervorhang beiseite. Wenn sie schon nicht fliehen konnte, wollte sie wenigstens sehen, wohin die Männer sie verschleppten.
Die schwach erleuchteten Straßen Londons zogen vorbei, und Esme versuchte, sich die zu merken, durch die sie fuhren. Aber schon nach kurzer Zeit bogen sie in eine Straße ein, die sie nicht kannte, und dann in eine weitere, bis sie nicht mehr wusste, wo sie waren, und den Vorhang enttäuscht wieder zurückfallen ließ.
Esme war sicher, dass die Männer ihr Herz klopfen hören konnten, so heftig, wie es gegen ihre Rippen pochte. Sie zwang sich zur Ruhe, indem sie bewusst langsam und tief atmete. Dann schloss sie die Augen. Wenn diese Schurken glaubten, sie schliefe, würden sie vielleicht in ihrer Wachsamkeit nachlassen, und sie würde fliehen können.
»Was tun wir mit ihr?«, fragte Waters.
Thatcher ließ seine Knöchel knacken. Das widerliche Geräusch hallte von den Wänden der kleinen Kutsche wider. »Wir nehmen sie mit zum Verlies. Danach bringen wir sie zum Raben; der wird sie schon zum Reden bringen.«
2. Kapitel
Fielding Grey starrte nachdenklich auf das Schreiben, das er in Händen hielt. Er hatte es mindestens zehnmal gelesen, doch die Worte blieben immer dieselben.
Mr. Grey,
wir haben etwas Geschäftliches mit Ihnen zu besprechen. Es liegt in Ihrem eigenen Interesse, sich die Zeit für ein Gespräch zu nehmen. Setzen Sie sich so bald wie möglich mit uns in Verbindung, um ein Treffen zu vereinbaren.
Hochachtungsvoll
Die Mitglieder von Solomons
28 King Street
Fielding steckte die Nachricht ein, während er wieder auf die Uhr auf dem Kaminsims schaute und sich zum x-ten Mal fragte, warum er sich überhaupt die Mühe gemacht hatte, hierher zu Solomon's zu kommen. Bis zu der unerwarteten Begegnung in Ägypten hatte er lange Zeit weder an Solomon's gedacht noch an die Männer, die diesem Club angehörten.
An diese Männer mit ihrer frömmlerischen Gesinnung und ihren Träumen von antiken Schätzen, die sich selber weismachten, sie suchten aus ehrenhaften Gründen nach verborgenen Kostbarkeiten. Seinen Vater hatten sie mit diesem Unsinn hinters Licht geführt und ihn dazu getrieben, einem solchen Schatz hinterherzujagen. Letztendlich jedoch hatte diese Jagd das gesamte Familienvermögen aufgezehrt und den viel zu frühen Tod seines Vaters herbeigeführt.
Das Zimmer, in dem Fielding wartete, ähnelte denen in anderen Herrenclubs - schwere Ledersessel, auf den Tischen Aschenbecher und Pfeifenständer, an der einen Wand eine Kredenz mit Brandy, Portwein und Scotch. Es herrschte eine ruhige, entspannte Atmosphäre. Die Clubs waren Zufluchtsorte für jene Männer, die den Nörgeleien und der Geschäftigkeit ihrer Ehefrau und dem Geschrei ihrer Kinder aus dem Weg gehen wollten.
Und dieser Club hier war der, in dem Fieldings Vater Zuflucht vor seiner Familie gesucht hatte.
Fielding stand auf und ging durch das Zimmer, um die gerahmten Fotografien zu betrachten, die an einer der mahagonigetäfelten Wände hingen. Er ließ den Blick über die Bilder gleiten. Einige waren im Laufe der Zeit verblasst, andere dagegen waren jüngeren Datums und gestochen scharf. Auf allen waren ausschließlich die Mitglieder von Solomon's zu sehen. Fielding erkannte einige von ihnen, zum Beispiel den Marquis von Lindberg, der den Gerüchten zufolge ein ziemlicher Schürzenjäger war, oder Nick Callum, zweitältester Sohn eines Adligen, den Fielding aus der Schule kannte.
Jeder dieser Männer stand für eine Legende oder, genauer gesagt, eine Obsession. Solomons war der geheimnisumwobenste und exklusivste Club Londons. Es hieß, er sei von König Henry VIII. gegründet worden, einem Mann, der selbst von dem Gedanken besessen gewesen war, verborgene Schätze aufzuspüren. Wer Mitglied bei Solomons werden wollte, musste sich zunächst als Experte im Wissen um eine Sage oder einen Mythos beweisen, bevor er in die Gemeinschaft aufgenommen wurde. Alle Bewerber wurden auf Herz und Nieren geprüft, ihr Engagement und ihre Absichten genauestens hinterfragt.
Nur die altruistischsten Männer durften die Schwelle dieses angesehenen Clubs überschreiten. Und noch nie war jemand in diesen Club aufgenommen worden, den unlautere Motive antrieben, wie zum Beispiel einen finanziellen Gewinn zu machen, um Schulden abzuzahlen. Was die Tatsache, dass Fielding sich jetzt in ebendiesem Club aufhielt, umso pikanter machte.
Fielding war über Solomons bestens informiert. Jeder der Männer dieses Clubs würde alles dafür tun, die Schätze in die Hände zu bekommen, nach denen er trachtete. Und dabei spielte es für ihn keine Rolle, ob er eine Frau und einen Sohn daheim zurückließ, denen nichts anderes blieb, als zu warten und sich zu fragen, ob der Ehemann und Vater je wieder zurückkehren würde.
Fieldings Blick blieb an einer der Fotografien hängen. Wenn man vom Teufel spricht … Er trat näher, um es genauer zu betrachten. Das vierte Foto in der zweiten Reihe von oben zeigte seinen Vater. Mit dem lächerlichen Hut und den verstaubten Kleidern sah er wie ein Dienstbote aus, nicht wie ein Adeliger. Und eigentlich nicht viel anders, als Fielding selbst die meiste Zeit aussah.
Verdammt!
Hier endeten aber auch schon die Ähnlichkeiten zwischen ihm und seinem Vater, tröstete Fielding sich. Denn er war kein Träumer.
Warum war er hierhergekommen? Aus purer Neugier, hatte er sich gesagt, als er heute Morgen aus dem Haus gegangen war. Doch nun, da er vor dem Foto seines Vaters stand und sich mit den Geistern seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert sah, erkannte Fielding, dass ihn weitaus mehr als nur Neugier hierhergeführt hatte. Innerhalb dieser Wände gab es Antworten, die wichtig für ihn waren, um die Männer von Solomons für das bezahlen zu lassen, was sie seiner Familie angetan hatten.
Die Uhr auf dem Kaminsims schlug die volle Stunde, und auf dem Gang draußen erklangen Schritte. Pünktlich auf die Minute. Aber von diesen Männern hätte er auch nichts anderes erwartet.
Eine Tür zu seiner Rechten öffnete sich geräuschlos, und ein Butler kam herein. »Mr. Grey, die Herren werden Sie jetzt empfangen.«
Fielding warf einen letzten Blick auf das Bild seines Vaters und ließ sich dann von dem Butler in das Sitzungszimmer führen.
Als Junge war er ungeheuer neugierig auf diesen Raum gewesen. Sein Vater hatte ihm viele Geschichten über die wichtigen Entscheidungen erzählt, die hier getroffen wurden, wie etwa die, wer eine Einladung erhalten würde, Clubmitglied zu werden, oder wem die Aufnahme verweigert wurde. »Nur die, die dessen würdig sind«, hatte sein Vater immer gesagt. Und nun, ob er dessen würdig war oder nicht, stand Fielding selbst in diesem Zimmer.
Aber er verdrängte die Erinnerungen an früher; er hatte heute keine Zeit für Geister.
Dunkle Holzvertäfelungen bedeckten die Wände des Raums, dessen Mittelpunkt von einem großen Tisch beherrscht wurde. Die darum gruppierten Stühle mit den hohen Rückenlehnen wirkten unbequem und wenig einladend. An einer der Wände hingen, unmittelbar neben einem Bildteppich, einige Schwerter. Die Szene auf dem Teppich stellte vermutlich eine Dame dar, die von einem edlen Ritter aus einer misslichen Lage gerettet wurde. Auf der Brust des Reiters prangte ein roter Löwe. Als hielten sich die Männer von Solomon's selbst für die verdammten Ritter der Tafelrunde.
Als Fielding nur drei Männer an dem großen Tisch stehen sah, fragte er: »Sie haben die anderen nicht eingeladen?« Er gab sich keine Mühe, den Spott aus seiner Stimme fernzuhalten.
»Die anderen, wie Sie sie nennen«, erwiderte der Älteste, »sind über unsere Zusammenkunft im Bilde.«
»Wünschen Sie Tee?«, fragte der Butler.
Wieder antwortete derselbe Mann und hob dabei seine vom Alter welke Hand. »Das wird nicht nötig sein. Der Brandy«, sagte er und zeigte auf die Kristallkaraffe auf dem Tisch, »wird genügen.« Der Mann war fast so groß wie Fielding, was durchaus bemerkenswert war, da Fielding für einen Engländer sehr hochgewachsen war. Dieser Mann war jedoch mindestens dreißig Jahre älter, und obwohl er mit seinen scharf geschnittenen Zügen sicherlich sehr aristokratisch wirkte, bezweifelte Fielding, dass man ihn je gut aussehend hätte nennen können.
Ohne dazu aufgefordert worden zu sein, nahm Fielding auf einem der Stühle Platz und streckte seine langen Beine aus.
Auch die Männer setzten sich. Wieder ergriff der Älteste von ihnen das Wort und deutete mit einer Handbewegung auf den Mann zu seiner Linken. »Mr. Grey, das ist Maxwell Barrett, der Marquis von Lindberg.«
Lindberg nickte. »Wir sind uns schon einmal begegnet, glaube ich.«
Fielding schwieg. Er wusste nicht viel über Lindberg, nur, dass ihm der Ruf als Schürzenjäger vorauseilte. Bei diesem Aussehen - blondes Haar und blaue Augen - dürften ihm Eroberungen auch nicht schwerfallen, dachte Fielding.
»Und das ist Mr. Nichols«, sagte der Sprecher der drei und wies auf den Mann zu seiner Rechten. »Und ich bin Jensen.«
»Nur Jensen?«, hakte Fielding nach.
»Das genügt«, erwiderte Jensen. Sein faltiges Gesicht ließ keinerlei Regung erkennen, doch seine schwarzen Augen - sie waren so schwarz, dass Iris und Pupille nicht voneinander zu unterscheiden waren-, verrieten, dass er kein Mann war, der mit sich spaßen ließ. Er war es gewohnt, seinen Willen durchzusetzen, und er würde tun, was immer nötig war, damit das so blieb.
Aber so leicht war Fielding nicht zu beeindrucken. Er hatte es schon mit weitaus mächtigeren Männern als diesen zu tun gehabt.
Max Barrett schenkte sich einen Drink ein und erhob sich dann. »Wir möchten Ihnen ein Geschäft vorschlagen.«
»Das sagte mir Ihr Partner schon.« Fielding verschränkte die Arme vor der Brust. »Beeindruckend, dass Sie mich bis nach Ägypten verfolgt haben.«
»Wir sind über Ihre derzeitige Beschäftigung ebenso informiert wie über Ihre frühere … Tätigkeit für den Raben«, sagte der kleine, rundliche Mr. Nichols mit vor Nervosität stockender Stimme und wischte sich mit einem Taschentuch über die Stirn. »Es ist Ihre Erfahrung in solchen Angelegenheiten, die Sie auf einmalige Weise für unser Angebot qualifiziert.«
Fielding beugte sich vor und stützte die Arme auf den Tisch. »Bieten Sie mir etwa eine Stellung an?«, fragte er spöttisch. »Ich wusste gar nicht, dass Solomons Personal beschäftigt.«
»Abgesehen von den Angestellten, die in unserem Club arbeiten, beschäftigen wir auch für gewöhnlich keine Mitarbeiter«, stellte Jensen mit ruhiger, gelassener Stimme fest. »Wir möchten so weit wie möglich Stillschweigen bewahren, was unseren Namen und unsere Existenz betrifft.«
»Doch da ich bereits von Ihnen weiß …«, folgerte Fielding.
»Richtig«, sagte Max.
Fielding wusste, was sie meinten, aber nicht aussprachen. Sie wollten ihn ebenso wenig hier haben, wie er hier sein wollte. Sie hatten ihn aus purer Verzweiflung eingeladen. Ein Gefühl der Genugtuung erfasste ihn. Er würde ihr Angebot auf jeden Fall abweisen, egal, um was es ging.
Allerdings würde er lügen, würde er behaupten, nicht ein wenig neugierig zu sein. Das war eine Eigenschaft, die er mit seinem Vater teilte und die er niemals hatte loswerden können, egal, wie sehr er sich bemühte.
Um seine Neugier zu verbergen, beugte er sich vor und schenkte sich einen Brandy ein. »Was ist es denn nun, was ich für Sie tun soll?«, fragte er.
»Uns ist zu Ohren gekommen, dass der Rabe möglicherweise eine ganz bestimmte, sehr wertvolle Antiquität ausfindig gemacht hat. Wir können nicht zulassen, dass er sie behält oder verkauft«, erklärte Jensen. »Ihr Onkel ist schließlich nicht unbedingt dafür bekannt, die reputierlichsten Verbindungen zu pflegen.«
Das war noch milde ausgedrückt. »Sie wollen, dass ich ihm dieses Objekt stehle?« Fielding lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und ließ sich den Gedanken durch den Kopf gehen.
»Sie können nicht bestreiten, Erfahrung in derartigen Dingen zu haben«, sagte Jensen.
»Ich soll meinen Onkel bestehlen?« Fielding lachte. »Nein. Das kann ich nicht.« Es hatte früher schon Interessenkonflikte zwischen dem Raben und Solomons gegeben, doch zu einem Diebstahl hatten diese Männer sich noch nie verleiten lassen. Welches Artefakt auch immer es sein mochte, hinter dem sowohl sein Onkel als auch die Männer von Solomons her waren - es musste ein Vermögen wert sein. Fielding ließ nur einen winzigen Moment verstreichen, bevor er fragte: »Um was für einen Gegenstand handelt es sich?«
Die drei Männer wechselten Blicke, ehe sie zu einem stillschweigenden Einverständnis kamen. Schließlich beugte Max sich vor und sah Fielding eindringlich an. »Es ist die Büchse der Pandora.«
Fielding lachte. Die Büchse der Pandora aus dem Kindermärchen? Das sollte doch wohl ein Scherz sein. Aber dann bemerkte er, dass keiner der Männer lachte. »Sie meinen es ernst.«
Jensen nickte.
»Die echte Büchse der Pandora«, sagte Fielding. Im Grunde hätte er nicht überrascht sein dürfen. Alle Mitglieder von Solomon's waren Legendenjäger. Warum sollten sie da nicht an einen alten griechischen Mythos glauben?
»Genau die«, bestätigte Mr. Nichols, dessen Stimme jetzt kaum mehr als ein Flüstern war.
»In der Geschichte ließ sich Pandora von ihrer Neugier hinreißen und öffnete eine Büchse, wodurch sie Seuchen und andere Plagen freisetzte. Ist es diese verfluchte Büchse, die Sie wollen?«, fragte Fielding. Es gelang ihm nicht, die Verachtung aus seiner Stimme fernzuhalten.
Jensen setzte abrupt sein Glas ab. »Spott können wir keinen gebrauchen, Mr. Grey. Wir waren der Auffassung, dass Sie schon oft mit dieser Art von Antiquitäten zu tun hatten.«
Fielding hatte sich nie besonders für die Artefakte interessiert, die er gefunden hatte; das konnte er sich gar nicht leisten. Für ihn bedeuteten sie nicht mehr als den Preis, den er dafür erlangte. Von seinen Kunden wusste er jedoch, dass viele an die Magie gewisser Stücke glaubten. Und so sah er sich trotz seiner Abneigung gegen Solomon's genötigt, die Stimme der Vernunft zu sein. »Könnte es nicht einfach nur ein Artefakt, ein Schmuckstück oder ein Schmuckkasten aus der griechischen Antike sein, was mein Onkel aufgestöbert hat?«
Mr. Nichols schüttelte den Kopf. »Wenn es nur so einfach wäre«, sagte er mit besorgter Miene. »Diese Büchse ist mit furchtbaren Verwünschungen belegt, Sir.«
Fielding schüttelte den Kopf. Verwünschungen waren Unsinn. »Aber warum gerade ich? Warum machen sich die Männer von Solomon's nicht selbst auf die Jagd danach? Ihre Mitglieder sind doch ebenso erfahrene Schatzjäger wie die Männer, die für den Raben arbeiten.«
»Wir haben jeder unser Fachgebiet«, wandte Lindberg ein. »Ich selbst bin mit einer anderen Suche als nach der Büchse der Pandora beschäftigt. Und einige von uns geben sich damit zufrieden, die Experten ihres jeweiligen Fachgebiets zu sein. Mr. Nichols beispielsweise hat sich jahrelang mit der Geschichte der Pandora befasst, aber er richtet sein Augenmerk auf die Recherche und nicht auf die Bergung solcher Artefakte.«
Mr. Nichols lächelte verhalten und nickte.
Bei genauerer Betrachtung des sanftmütig wirkenden Mannes konnte Fielding sich sehr gut vorstellen, warum Solomon's nicht ihn zum Raben schickte. Eine durchsetzungsfähige Frau wäre da eine weitaus ebenbürtigere Gegnerspielerin für seinen Onkel.
»Sie kennen die Handlanger des Raben besser als wir«, warf Jensen ein. »Sie wissen, wie sie sich verhalten und wohin sie die Büchse bringen werden. Sie sind am besten dazu geeignet, mit diesen Männern umzugehen. Wir dagegen sind …« Jensen unterbrach sich und machte eine kurze Handbewegung.
»Gentlemen?«, ergänzte Fielding mit einem Anflug von Verbitterung in der Stimme. »Selbstverständlich.« Er spürte die Hitze, die ihm in den Nacken stieg. Er sollte diese Narren jetzt gleich zum Teufel schicken. Denn schließlich war auch er ein Gentleman. Zumindest war er wie einer erzogen worden. Er trug einen Titel und verfügte über das nötige Vermögen, das zu untermauern. Doch für die Männer von Solomon's war Fielding kein Viscount, sondern nur das Mittel zum Zweck.
»Nennen Sie uns Ihren Preis«, forderte ihn Mr. Nichols auf, dessen kurze Finger sein Taschentuch umklammerten und den feuchten Stoff zu einem festen Knäuel kneteten. »Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir uns dieses Artefakt verschaffen.«
»Warum ist gerade dieses Stück so wichtig? Von Mr. Nichols' offensichtlichem Interesse dafür einmal abgesehen.«
Lindbergs freundliches Lächeln verblasste. »Weil es gefährlich sein könnte«, sagte
er.
»Könnte?«, fragte Fielding.
»Höchstwahrscheinlich ist es das«, berichtigte sich Lindberg.
»Wir wissen es einfach nicht«, warf Mr. Nichols mit vor Aufregung schriller Stimme ein. »Über die Büchse der Pandora und deren Inhalt ist viel geschrieben worden, und wir wissen nicht, was davon den Tatsachen entspricht. Doch die Möglichkeiten …« Er unterbrach sich für einen Moment. »Die Möglichkeiten sind katastrophal«, schloss er.
»Sag es ihm«, forderte Lindberg ihn auf.
Mr. Nichols sah die anderen Clubmitglieder an, ehe er nickte und sich wieder Fielding zuwandte.
»Es heißt, dass die Büchse der Pandora alles Böse und Schlechte in sich birgt. Dass die Götter so furchtbare Plagen wie Gier und Hass, Eitelkeit, Neid, Wollust und Krankheit in die Büchse legten, um Pandora für ihre Neugier zu bestrafen. Und diese Übel werden, so heißt es, von Gegenständen verkörpert, die sich in der Büchse befinden.«
»Von Gegenständen, die man anfassen und berühren kann«, erklärte Lindberg.
»Ja, ja«, rief Mr. Nichols aufgeregt. »Sobald die Büchse geöffnet wird und diese Übel freigesetzt werden, befällt unvorstellbar Böses unser Land.«
»Diese Übel gibt es schon auf unserer Welt«, sagte Fielding.
»Sie sind aber nicht mit denen in der Büchse der Pandora zu vergleichen. Und wenn sie in die falschen Hände gerät …« Mr. Nichols rang wieder die Hände.
»Und Sie glauben also, dass mein Onkel sie gefunden hat?«, fragte Fielding. »Ich will gar nicht bestreiten, dass er sein Handwerk versteht, aber wieso sollte ausgerechnet er nach diesen vielen Jahrhunderten und von den Hunderten Menschen, die nach der Büchse gesucht haben, er ihren Aufbewahrungsort ausfindig gemacht haben?«
»Er ist nicht der Erste; sie ist zuvor bereits von anderen gefunden worden«, erwiderte Jensen. »Vielleicht haben Sie schon einmal vom Schwarzen Tod gehört?« Das Lächeln des Mannes wirkte angespannt, seine Stimme klang fast schroff.
»Wenn ich mich recht entsinne, waren es Ratten, die die Pest auslösten«, sagte Fielding.
»Sie waren nur die Überträger«, wandte Jensen ein.
»Ihr Onkel ist sehr gut in seinem Metier. Das lässt sich nicht bestreiten«, sagte Lindberg. »Und egal, ob Sie die Warnungen ernst nehmen oder nicht - sollten sie sich als wahr erweisen, wäre der Schaden, den der Rabe zweifelsohne mit der Büchse anrichten würde, katastrophal. Deshalb müssen wir ihn daran hindern.«
»Genau«, pflichtete ihm Jensen bei und legte seine langen Finger unter seinem Kinn aneinander. »Wir können nicht riskieren, dass er die Flüche der Pandora freisetzt. Das ist viel zu gefährlich.«
Fielding glaubte kein Wort von alledem. Er hatte von diesem Mythos gehört, aber das war auch schon alles, was es war. Doch diese Männer meinten es ernst mit ihrer Besorgnis. Andererseits galten die Legendenjäger von Solomon's ganz allgemein als eher ernst veranlagte Menschen.
Sollte jedoch nur die kleinste Möglichkeit bestehen, dass von der Büchse der Pandora eine Gefahr ausging, dann hatten diese Männer recht: Zuzulassen, dass sie dem Raben in die Hände fiel, würde böse Folgen nach sich ziehen.
»Wo befindet sie sich?«, fragte Fielding.
»Wir glauben, dass sie in Portsmouth ist, in den Ruinen einer Burg«, antwortete Lindberg.
»Die bis vor kurzer Zeit ein Kloster war«, fügte Mr. Nichols hinzu.
»Am wichtigsten ist, dass der Rabe sie dort vermutet«, sagte Jensen und schob Fielding einen Stapel Papiere zu. »Hier sind die Unterlagen über unsere gesamten Nachforschungen zu dem Thema.«
Fielding blätterte in den Papieren. Sie hatten den Raben beschatten lassen, und die Recherchen seines Onkels waren ebenso akribisch in den Unterlagen festgehalten wie die von Mr. Nichols. Als Fielding eine Liste mit fünf ihm unbekannten Namen entdeckte, fragte er: »Wer sind diese Leute?«
»Andere Gelehrte, die an diesem Thema arbeiten«, antwortete Mr. Nichols.
»Warum wurde ›Mr. Spencer‹ durchgestrichen und durch den Namen Worthington ersetzt?«, fragte Fielding.
»Spencer war ein fiktiver Name, der zum Schutz dieser Person benutzt wurde«, sagte Mr. Nichols.
»Worthington ist die Einzige auf dieser Liste, die hier in London lebt«, sagte Jensen. »Wir wissen nur nicht genau, wo.«
»Sie versteht ihre Privatsphäre zu schützen«, bemerkte Mr. Nichols.
»Worthington ist eine sie?«, fragte Fielding.
»Oh ja, und eine brillante Wissenschaftlerin. So viel weiß ich immerhin.«
»Sie bekämen selbstverständlich Zugang zu all unseren Ressourcen«, sagte Lindberg und deutete auf die Papiere. »Die Ortsbeschreibung des Klosters befindet sich in diesen Aufzeichnungen.«
Fielding brauchte ganz gewiss weder das Geld noch die Ressourcen dieser Männer. Aber dass sich ihm diese Gelegenheit bot, dass sie sich so verzweifelt um seine Hilfe bemühten, bedeutete für ihn nur eines: Sie würden in seiner Reichweite sein. Er würde ihnen nahe sein und Zugang zu ihrem elitären Club bekommen. Und er könnte endlich jemanden für den Tod seines Vaters zur Rechenschaft ziehen.
»Ich glaube nicht, dass Sie sich meine Dienste leisten können«, erklärte Fielding. »Mein Honorar beträgt dreißigtausend Pfund.« Er erwartete Protest und Ablehnung, vielleicht sogar Spott, aber niemals hätte er damit gerechnet, dass sie seine Forderung akzeptieren würden.
»Sie werden ein Bankakzept über die Hälfte dieser Summe erhalten, bevor Sie heute gehen«, erwiderte Jensen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. »Die andere Hälfte bekommen Sie, wenn Sie uns die Büchse der Pandora bringen.«
»Werden Sie unser Anliegen unterstützen?«, fragte Mr. Nichols. Fielding grinste. »Das werde ich.«
3. Kapitel
Irgendwann am nächsten Abend hielt die Kutsche an. Im Laufe der langen, beschwerlichen Fahrt hatten die Männer Esme die Fesseln und den Knebel abgenommen, was ihr das Atmen sehr erleichterte. Sie sehnte sich danach, der bedrückenden Enge der Kutsche zu entkommen, um sich die Beine zu vertreten und sich erleichtern zu können. Keiner der beiden Männer war ihr beim Aussteigen behilflich, doch sie schaffte es auch allein hinaus.
Esmes Hoffnung, dass sie an einem Gasthof angehalten hatten und sie dort um Hilfe bitten konnte, zerschlug sich. Als sie sich umschaute, waren keine einladenden Lichter zu sehen. Sie befanden sich inmitten einer öden Landschaft, in der weit und breit weder ein Haus oder auch nur eine Scheune zu sehen waren. Esme war nach der langen Fahrt ein wenig unsicher auf den Beinen, aber sie schaffte es bis hinter den nächsten Busch und kauerte sich hin.
»Bleib bei dem Mädchen und pass auf, dass sie nicht wegläuft«, rief Thatcher Waters zu.
Damit die Entführer sie nicht in halb bekleidetem Zustand sahen, brachte Esme ihre Kleidung schnell wieder in Ordnung und kehrte auf den Weg zurück. Waters packte sie am Arm und führte sie über eine Lichtung. Esme versuchte, ihre Umgebung zu erkennen. Der aufgehende Mond stand noch tief am Horizont, doch sein schwaches Licht reichte aus, die Mauern zu erkennen, die sich unweit von ihr erhoben. In der Ferne hörte sie die Brandung gegen Felsen schlagen und das Geschrei von Möwen. Esme atmete tief ein und füllte ihre Lungen mit frischer, salzhaltiger Luft. Sie waren an der Küste.
Es hatte eine Weile gedauert, London zu durchqueren, doch sobald sie die offene Straße erreicht hatten, waren sie den ganzen Tag bis in den frühen Abend hinein gefahren. Eine Zeitspanne, die jedoch nicht lang genug war, um die West- oder Nordküste zu erreichen.
Waters packte Esme wieder am Arm. »Dir wird nichts geschehen, wenn du tust, was wir dir sagen«, beschied er sie und führte sie zu der eingestürzten Mauer, die sich als Teil einer Ruine erwies.





























