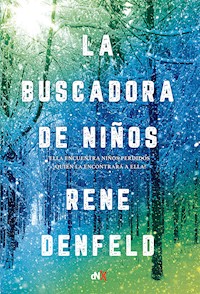5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Naomi Cottle
- Sprache: Deutsch
Vor 20 Jahren verschwand ihre Schwester. Naomi selbst hat kaum Erinnerungen an dieses Ereignis – und doch will die »Kinderfinderin« die Spur aufnehmen. Die Suche führt sie direkt in die Dunkelheit von Portland in Oregon, wo mehr Kinder auf der Straße leben als im Rest des Landes. Und immer wieder findet man die Leichen junger Mädchen im Fluss ... Dort trifft Naomi auf Celia, ein zwölfjähriges Mädchen, das vor ihren Eltern geflohen ist. Der Vater missbrauchte sie, die Mutter ist suchtkrank. Ceilas einzige Hoffnung sind die Schmetterlinge. Sie sieht sie überall um sich herum – ihre schillernden Beschützer und Führer auf den trostlosen Straßen. Poetisch, fesselnd und bittersüß. Rene Denfeld schickt Naomi, die Ermittlerin mit der unheimlichen Fähigkeit vermisste Kinder zu finden, ein weiteres Mal auf eine emotionale Suche. Washington Post: »Erinnert uns daran, dass Geschichten nach wie vor eines der wirkungsvollsten Mittel sind, mit dem wir unseren dunkelsten menschlichen Impulsen begegnen können.« Kirkus Reviews: »Naomi zeigt uns die Botschaft von Denfelds gesamter Arbeit auf: Kein Mensch verdient es, vergessen zu werden.« Margaret Atwood: »Ein herzzerreißender, an den Nerven zerrender und doch hoffnungsvoller Roman.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Claudia Rapp
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe The Butterfly Girl
erschien 2019 im Verlag HarperCollins.
Copyright © 2019 by Rene Denfeld
Copyright © dieser Ausgabe 2022 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Titelbild: Arndt Drechsler-Zakrzewski
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-015-1
www.Festa-Verlag.de
Für Luppi, Tony, Markel und Tamira.
Euch zu lieben verleiht mir Flügel.
1 Raupe
Celia erkannte einen schlimmen Ort, wenn sie ihn sah.
Das verlassen wirkende Haus befand sich im Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft des Straßenstrichs, wo die Laderampen feucht glänzten und Gleise die bröckelnden Straßen querten. Die Fenster waren mit Brettern vernagelt, und unter den Latten lugte hier und da etwas hervor, das wie Decken aussah. An der schweren Vordertür prangten gleich mehrere Schlösser.
Celia war auf der Jagd nach Pfandflaschen gewesen, als ihr das Haus auffiel. Die wenigen Gebäude, die in dieser Gegend noch standen, waren üblicherweise leer. Dieses nicht.
In den Taschen ihrer Jeansjacke ballte sie die Hände zu Fäusten und musterte das Haus aufmerksam. Ihr Haar war schmutzig und muffig, hatte aber immer noch seinen Kupferschimmer. Sie trug die unbändigen Locken kurz geschnitten. Sie mochte erst zwölf Jahre alt sein, aber sie wusste mehr als die meisten. Das sagte sie sich zumindest, auch wenn sie tief in sich die Angst verbarg, dass sie nicht genug wusste.
Ein Schatten schien sich hinter dem vernagelten Kellerfenster zu bewegen. Celia erstarrte, zwang sich dann zum Atmen. Jemand sah sie an, durch eine winzige Glasscheibe. Sie spürte die Hitze, die in diesem Blick lag. Eine Sekunde lang schien es ihr, als würden sie einander direkt in die Augen sehen.
Celia verschwand, zog sich in sich selbst zurück. Daran war sie gewöhnt. Sie konnte sich praktisch aus dem Stand in Luft auflösen, und dann war sie nur ein weiteres Straßenkind ohne Zukunft.
Celia vertraute niemandem, glaubte nur an sich selbst und die Schmetterlinge, und sie wusste, dass die schlimmsten Ängste auf der Straße immer begründet waren. Das ließ sich am eigenen Leib erfahren, oder man blieb stets wachsam. Sie machte ein paar Schritte rückwärts und rannte dann zurück zum Straßenstrich. Aber diese Augen vom Fenster spürte sie immer noch auf sich. In ihnen hatte etwas gebrannt, das Zorn oder Wut gewesen sein mochte – oder vielleicht auch Hoffnung.
Naomi erwachte und glaubte für einen kurzen Moment, dass sie immer noch dort wäre. An jenem Ort. Sie hörte die Stimme ihrer Schwester, die sie nach all den Jahren rief: Komm zurück und finde mich! Ich bin jetzt 25. Die Wasserrinnsale, die wir damalsertasteten, sind fort, und der Triumphwagen ist davongeflogen.
Naomi öffnete die Augen und fand sich im sonnigen Gästezimmer ihrer Freundin Diane wieder, an ihren Ehemann Jerome gekuschelt, in dem Bett, das einst für sie allein reserviert gewesen war – für ihre seltenen Besuche. Sie atmete erleichtert aus, weil der Traum vorbei war, spürte aber das drängende Echo der Rufe in sich nachhallen.
Ich nähere mich der Lösung, dachte sie. Deswegen waren sie und Jerome hier in der Stadt. Nach fast einem Jahr der Suche nach ihrer lange verschollenen Schwester hatten ihre Ermittlungen sie hierhergeführt.
Ihre Nase reagierte auf den Geruch von gebratenem Schinken und Kaffee. Das Zimmer war sonnendurchflutet und Jerome lag neben ihr; sein Schulterblatt zeichnete sich unter dem Laken ab. Gleich würde sie aufstehen und die schmale Treppe hinuntersteigen, um mit ihrer Freundin zu frühstücken.
Diane hatte den Schinken angebraten und mit einem Schuss Kaffee abgelöscht; die daraus entstandene Soße nannten sie im Süden Redeye Gravy. Dazu servierte sie Rührei mit gehacktem Schnittlauch. Naomi goss Sahne in ihren Kaffee. Sie wusste, dass Jerome oben sicher schon wach war, ihr aber diese paar Minuten allein mit Diane ließ, und dafür war sie dankbar.
Diane trank ihren Kaffee schwarz, verzog aber das Gesicht beim ersten Schluck. Sie musterte Naomis Kaffeesahne, als wollte diese sie kränken. »Jung müsste man sein«, beklagte sie sich.
»Bisher hast du dir nie solche Sorgen gemacht«, stellte Naomi fröhlich fest und löffelte zusätzlich Zucker in ihre Tasse.
Diane war älter geworden im vergangenen Jahr. Silber durchzog ihr üppiges rotes Haar, und in ihrem Gesicht zeigten sich Fältchen. Ihre übliche Herzlichkeit war verhaltener, und Naomi sah die Einsamkeit in der schlaffen Haut unter dem Kinn und in ihren Augen.
»Bleibst du lange?«, fragte Diane hoffnungsvoll.
»Wahrscheinlich nicht«, erwiderte Naomi, während sie ihre Schinkenscheibe anschnitt und sich ein Stück in den Mund steckte. »Danke, dass Jerome mitkommen durfte.«
»Selbstverständlich. Er ist dein Ehemann.« Diane sagte das in mildem Tonfall, aber Naomi hörte eine Spur Missfallen heraus. War sie enttäuscht von Naomi? Das letzte Mal hatten sie sich vor einem Jahr gesehen, bei ihrer Hochzeit, die hier in Dianes Wohnzimmer stattgefunden hatte. Naomi und Jerome waren beide 30 Jahre alt. Es war ihre erste ernsthafte Beziehung, für Naomi die erste überhaupt.
Sie bohrte nicht weiter nach zwischen den Frühstückstellern aus dem Service mit Blümchenmuster am Rand, den leinenfarbenen Tassen, dem Sahnekännchen. Draußen riefen die Vögel einander zu, und Naomi hörte, wie eine Krähe sie alle zum Schweigen brachte. Sie war auf dem Land groß geworden und konnte ein Dutzend Vögel anhand ihrer Rufe bestimmen. Und dennoch konnte sie ihre Schwester nicht finden.
Diane streckte die Hand nach ihrer aus. »Du glaubst, sie könnte hier sein«, stellte sie leise fest.
»Wir haben von einigen vermissten Mädchen erfahren«, gab Naomi vorsichtig zurück.
»Und eins davon könnte deine Schwester sein?« Diane wusste, dass Naomi als Kind selbst der Gefangenschaft entkommen war.
Die längste Zeit ihres Lebens hatte Naomi nur eine einzige Kindheitserinnerung besessen: Sie rannte nachts durch ein Erdbeerfeld, nachdem sie durch eine morsche Falltür im Wald entkommen war, mitten im tief liegenden Obstanbaugebiet Oregons. Eine Gruppe Migranten hatte sie gefunden und nach Opal gefahren, eine Kleinstadt, die eine Tagesreise weit entfernt lag. Dort war Naomi groß geworden, bei einer liebevollen Pflegemutter namens Mrs. Cottle. Sie war neun gewesen, als man sie fand, aber sosehr sie sich auch anstrengte, sie konnte sich an nichts anderes aus ihrer Vergangenheit erinnern. Angst und Schrecken hatten ihr Gedächtnis leer gefegt. Als Erwachsene wurde Naomi Ermittlerin, die sich dem Finden verschollener Kinder verschrieb. Sie dachte, dass sie Kinder wie sich selbst aufspüren wollte, aber die ganze Wahrheit war, dass sie die kleine Schwester finden wollte, die sie zurückgelassen hatte.
Naomi schüttelte den Kopf. »Das glaube ich nicht. Sie sind zu jung. Aber ich wollte mir das genauer ansehen. Sie wurden hier in den Fluss geworfen. Zumindest die, die man gefunden hat.«
Diane zog die Brauen zusammen und ließ ihre Hand los. »Davon hatte ich gar nichts gehört.«
Naomi blickte auf ihren Teller, blinzelte. »Der Green River Killer ermordete mindestens 75 Frauen. Dutzende, bevor irgendjemand irgendwas merkte.«
Diane bedachte Naomi mit einem mitfühlenden Blick. Sie wusste, wie schwer es sein musste, immer im Auge des Sturms zu bleiben. »Waren es hier auch Prostituierte?«, fragte sie.
»Straßenkinder. Spielt das eine Rolle?«
»Du kennst mich«, sagte ihre Freundin scharf. »Natürlich macht es keinen Unterschied.«
Hinter ihnen hörte Naomi Jeromes leise Schritte, als er die Treppe vom Gästezimmer im ersten Stock herunterkam. Der Mann, der einst ihr Pflegebruder gewesen war, heute ihr Liebhaber, Freund und mehr.
Diane griff nach ihrer Kaffeetasse und lehnte sich zurück. Sie kannte Jerome nicht gut.
Naomi sah auf, lächelte kurz. »Jerome. Erklär du es!«
Die schmale Gestalt ihres Mannes nahm auf einem der Stühle Platz. Er lächelte Diane an und hielt die dunklen Augen auf sie gerichtet, während ihm eine breite Strähne des dunklen Haars ins Gesicht fiel. Die Schulter zuckte. Der Arm darunter fehlte; den hatte ihm der Krieg genommen. »Wir besuchten gerade die Sondereinheit in Salem, als wir hörten, dass hier Straßenkinder – Mädchen – verschwinden. Alle unter ›Jane Doe‹ gelistet, weil selbst ihre Freundinnen auf der Straße ihre echten Namen nicht kennen. Einige wurden ermordet; deren Leichen wurden aus dem Fluss gefischt. Naomi will mit ihrem Freund, dem Detective, sprechen, dem Gerichtsmediziner einen Besuch abstatten, Flyer aufhängen wegen ihrer Schwester. Um auszuschließen, dass sie eins dieser Mädchen gewesen sein könnte.« Er hielt inne. »Und vielleicht mit ihrer Expertise etwas für diese Mädchen tun.«
»Ich hoffe, das klappt alles«, gab Diane leise zurück und pustete in ihren heißen, bitteren Kaffee.
Jerome streckte den verbliebenen Arm aus, nahm mit seinen langen, schlanken Fingern das Sahnekännchen und goss, ohne zu fragen, einen großzügigen Schuss in Dianes Tasse. Sein Blick sagte ihr, dass er verstand, wie es war, wenn man Naomi liebte. Diane fand Trost in diesem Blick.
»Hoffnung ist genug«, sagte er.
Ein stämmiger Mann mit zerdrückt wirkendem Gesicht beobachtete Celia. Er trug eine blaue Jacke, deren Reißverschluss bis zu seinem geröteten Hals hinauf geschlossen war. Es war die Art Jacke, wie sie Kerle trugen, die in Autozubehörgeschäften oder Reparaturläden arbeiteten, aber bei dieser hier war nicht der Name auf der vorderen Brusttasche eingestickt.
Er konnte irgendwer sein. Das war die Wahrheit der Straße: Bestand Gefahr, konnte sie von jedem ausgehen. Man konnte niemandem vertrauen … nicht wirklich. Das glaubte Celia fest.
Der bullige Mann, dessen Augen wie winzige Periskope auf sie gerichtet waren, hätte er sein können. Der Mann, der auf den Straßen von Downtown umherstreifte und ihre Freundinnen verschwinden ließ. Manche tauchten als Leichen wieder auf und trieben im Fluss. Andere verschwanden schlicht. Nicht dass solche Dinge nicht sowieso immer wieder geschahen, aber in den letzten Wochen – in diesem unbesonnenen Frühling voller Regengüsse und Straßen, auf denen sich das Blut in der dunklen Hochwasserströmung verlor – geschah es immer häufiger. Geradezu ständig.
Ihr Blick huschte noch einmal verstohlen zu ihm hinüber. Sein zerdrücktes Gesicht, das durch Nase und Augen noch verkniffener wirkte, beobachtete sie noch immer. Unter seinem feuchten silbrigen Haar schauten zwei komisch verformte Ohren heraus wie kleine Kohlköpfchen. Sein Mund war von Narben zerfetzt.
Die Dämmerung senkte sich herab, Celia befand sich auf dem Straßenstrich, und die letzten Bürohengste rauschten an ihr vorbei, Aktentaschen gegen die Hüften gedrückt, als müssten sie sich selbst die Sporen geben, um endlich nach Hause zu traben. Ölpfützen, in denen das Wasser schimmerte, ließen unter den Straßenlaternen Regenbogen entstehen, und der Nachthimmel glitt über ihr dahin, erinnerte sie an die unendliche Weite des Universums. Die Leuchtreklamen der Schwulenbars blinkten, und die ersten Transvestiten tauchten auf, nach Einbruch der Dunkelheit, weil die Lichter der Nacht ihre rauen Gesichter gnädiger in Szene setzten; auch die Bartschatten, die die Rasierer nie komplett eliminieren konnten. Einige von ihnen trugen falsche Wimpern, die so lang waren, dass sie dich pikten, wenn sie sich dir näherten und dich umarmten, was sie furchtbar gern und häufig taten.
Sie sagte sich, dass sie nichts zu befürchten habe. Sie hatte Freunde, die sie beschützten: Stoner und Rich, die beiden Jungs, mit denen sie abhing; Straßenkinder wie sie selbst. Zur Sicherheit ist man mehrere, hatte Rich einmal den alten Spruch im Scherz verdreht. Die Jungs standen jetzt an der Ecke und bettelten. Die Handflächen ihrer kalten Hände waren klamm und leer. »Haste bisschen Bargeld übrig?«, baten sie die Anzugträger, die an ihnen vorbeieilten. »Ich hab Hunger, Mister.«
Celia sah zu, wie die Herde der Pendler die Straße hinabströmte. Schon bald wären nur noch die Obdachlosen übrig, denn für sie war die Nacht gemacht. Erneut sah sie zu dem Mann mit dem Narbengesicht hinüber, aber der machte sich gerade auf den Weg. Sie sah seinen Rücken und die nassen Schultern, als auch er die Straße hinunterging. Die Ziegelmauer, an der er gestanden hatte, war leer. Ein trockener Schatten war daran zurückgeblieben, wie der Umriss einer Gestalt nach einem Atomschlag.
Rich winkte ihr zu und hielt triumphierend einen Geldschein in der Faust. »So ein Depp hat mir ’nen Zwanziger gegeben!«, prahlte er, als er auf sie zukam. »Holen wir uns was zu essen.«
Manchmal sah sich Celia als Vogel, der über diesen Straßen flog. Manchmal fühlte sie sich eher wie ein Luftzug, der sich jederzeit auflösen konnte, wie die Ranken aus Dunst, die aus der Gosse aufstiegen. Aber am allermeisten, insgeheim in ihrem Herzen, war sie ein Schmetterling mit Zauberflügeln, die heftig schlugen, um von hier zu entkommen.
In jener Nacht rief Celia ihre Mom an.
Die anderen Straßenkinder wussten nicht, dass sie eine Mom hatte. Überhaupt sprach niemand von ihnen über diese Dinge – das wäre sehr nahegegangen. Einige der Kinder sagten, sie seien Waisen, aber Celia glaubte, dass sie das eher nicht waren. Waisen im Herzen vielleicht.
Celia lieh sich ein Handy von einem anderen Mädchen und tippte die jüngste Ziffernfolge von ihrem feuchten Zettel ab, den sie in ihrer Jackentasche aufbewahrt hatte. Sie rechnete damit, dass auch diese Nummer stillgelegt worden war.
Aber die Nummer funktionierte noch. Vielleicht lebte auch die Stimme am anderen Ende noch.
»Wer ist da?«, wollte ihre Mom leise wissen.
»Ich bin’s. Celia«, antwortete sie und wandte sich von ihren Freunden ab. Sie erinnerte sich noch an das erste Mal, als sie den Begriff ›Opioidabhängigkeit‹ gehört und begriffen hatte, dass sie über ihre Mom sprachen.
»Mein Baby.« Im Hintergrund hörte Celia den Fernseher dröhnen. Sie lauschte angestrengt auf die Stimme ihrer Schwester Alyssa. Die war jetzt sechs – genauso alt wie Celia, als ihre Schwester zur Welt kam. Die Stimme wurde noch leiser. »Ich vermisse dich.«
»Wie geht es Alyssa?«, fragte Celia.
Ihre Mutter ließ ihre Stimme bei der Antwort leicht klingen. »Ihr geht’s gut.«
Wann immer Celia mit ihrer Mutter sprach, drang der die Traurigkeit aus allen Poren, und binnen weniger Augenblicke wurde Celia ganz flau vor Verzweiflung. Ihr wurde so schwindlig, dass sie die Hand ausstreckte, um sich irgendwo festzuhalten, in diesem Fall an der Ziegelmauer, an der sie so oft stand.
»Kommst du nach Hause?«
»Du weißt, dass ich das nicht kann, Mom.«
Die Antwort war Stille. Sie hörte die langsamen Atemzüge ihrer Mutter. Celia wünschte, sie würde die Welt verstehen, würde begreifen, was sie ihr antat. Was sie mit ihr machte.
Das andere Mädchen wollte sein Telefon zurückhaben, pikte Celia mit einem abgebrochenen Fingernagel in den Rücken. »Ich muss aufhören, Mom. Wollte nur Hallo sagen.«
Ihre Mutter gähnte. »Celia? Bist du das?«
Celia legte auf. Heute konnte man ein Leben auslöschen, indem man mit dem Finger über den Bildschirm wischte. Dann setzte sie sich auf die Bordsteinkante, wo die Autoscheinwerfer die Dunkelheit ausleuchteten. Die Männer in diesen Autos waren wie ein Teil von ihr, genau wie ihr Stiefvater. Jede ihrer Zellen hatte Celia geschmeckt. Sie flossen durch ihre Blutbahn. Aber das war jetzt ihr Leben, und sie musste etwas daraus machen.
Oh, die Schmetterlinge … Sie mildern die scharfen Kanten dieser harten Welt. So hoch in der Luft gefangen fallen sie zur Erde wie Meteoriten, und ihre schillernden Flügel ziehen Spuren roten Donners und flüssigen Goldes hinter sich her, und ein Purpur, das nur die Natur im Tuschkasten bereithält.
Celia spürte, wie ihr Rücken gegen ihre Jeansjacke rieb, dann entspannte sie sich. Manchmal glaubte sie, sie hätte Flügel, bloße Stümpfe unter der Haut, und wenn die anderen sagten, das seien ihre Schulterblätter, dann tat sie das ab und sagte: Nee, dort verstecken sich meine Flügel. Sie konnte sich vorstellen, dass auch die anderen Kinder auf der Straße Flügel besaßen, die sie eng an den Rücken gefaltet trugen, feucht und pulsierend, bis sie sich zu gefiederter Pracht ausbreiteten. Helles, blitzendes Grün, die Art Silber, die sich in Licht verwandelte, ein Weiß, das zu Gold wurde.
Es könnte Legionen von uns geben, dachte sie, und wir erheben uns in den Nachthimmel. Wenn alle Straßenkinder plötzlich losfliegen würden, na, dann würde der Nachthimmel von goldenen Strömen erleuchtet werden. Oder vielleicht wäre sie auch die Einzige, dachte sie dann.
Sie atmete tief aus und flog.
Naomi wusste, dass der Grund und Boden eine Rolle bei ihren Ermittlungen spielte.
Sie hatte Dutzende Fälle verschollener Kinder bearbeitet, und jede Suche begann im Wortsinn mit dem Untergrund. Dieser mochte weich und halbschattig sein, gesprenkelt mit Kiefernnadeln, wie im Fall des Pfadfinders, der vom Weg abgekommen war. Oder bereift und schneebedeckt wie im Fall des Kindes, das in den Wäldern des pazifischen Nordwestens verschwunden war. Oder er mochte eine zerfurchte Betondecke aufweisen, geflickt mit schwarzem Asphalt, der dampfend eine Straße in der Stadt bedeckte.
Der Untergrund spielte eine Rolle, denn er führte sie irgendwohin. Immer. Sie würde ihre Schwester auf dieser Erde finden, aufgrund all der Schritte, die Naomi tat oder getan hatte. Der Gedanke erfüllte sie mit Ungeduld. Sie wollte endlich anfangen.
Naomi wusste, dass sie zuerst die dunkelsten Straßen aufsuchen musste. Also ging sie los und suchte nach den Obdachlosen.
Der Ort hieß ›Schwestern der Barmherzigkeit‹ und befand sich in einer Straße, die für ihre Trinker und Junkies bekannt war. Als die Nacht hereinbrach, begegnete Naomi Massen von Straßennomaden, in staubiges schwarzes Leder gehüllt, und Alkoholikern mit Gesichtern wie verbeulte Kirschen. Sie sah eine magere alte Frau mit spärlichen Haarbüscheln auf dem kahl werdenden Schädel, die laut kichernd im Lehm eines Rinnsteins buddelte. Es gab eine beunruhigende Menge an Familien: Mutter, Vater, ein oder zwei Kinder, die alle das müde, angespannte Gesicht der Armut zeigten, aber sonst wies kaum etwas darauf hin, dass sie obdachlos waren – außer der langen Schlange. Die wand sich mit der friedlichen Disziplin der Hungrigen um die Ecke.
Naomi hatte viele Vermisstenfälle bearbeitet, bei denen es um arme Menschen ging, denn die waren üblicherweise diejenigen, die ihre Hilfe am meisten brauchten, und hatte feststellen dürfen, dass sie sich am gesittetsten verhielten. Verzweiflung beeinflusste das Verhalten tiefgreifend.
Als Naomi an der Schlange vorbeiging und durch die Tür trat, erhob sich kaum ein Murmeln hinter ihr. Auch das war Teil der Armut. Die Leute hatten Angst, abgewiesen zu werden, Hunger zu leiden. Das leere Café stand genauso voller Tische und klappriger Stühle wie jedes andere Restaurant. Nur dass hier eine Nonne hinter der Theke stand, deren müder, herzlicher Blick nun auf Naomi traf.
»Es ist noch zu früh. Stell dich hinten an.«
In der offenen Küche waren Ehrenamtliche mit Kochen beschäftigt: riesige Bottiche, aus denen es nach Bohnen roch, und breite, vorgefertigte Platten Maisbrot, die aus dem Ofen kamen. Auf einem Tisch standen große Wasserkrüge und daneben Pappbecher. An der Wand gab es eine Tafel, auf der das Tagesmenü prangte: Reis, Bohnen und Maisbrot, Preis nach Ermessen. Du kannst deine Mahlzeit auch abarbeiten.
»Ich wette, Sie haben eine Menge Freiwillige, die für ihr Essen abspülen«, stellte Naomi fest, während sie nahe an den Tresen trat. Sie zog ihre Detektivlizenz aus der Jacke, weil sie mit Misstrauen rechnete. »Ich bin nicht bei der Polizei«, erklärte sie. »Ich suche nach jemandem. Nach meiner Schwester.«
Der Blick der müden Augen begegnete ihrem. Die Nonnenhaube hatte die Stirn der Frau dauerhaft zerknittert. »Wir reden nicht über unsere Kundschaft.«
»Es ist schön, dass Sie ›Kundschaft‹ sagen.« Naomi lächelte. »Normalerweise höre ich eher ›Bezieher‹, als wären sie bestenfalls geduldet oder eine bloße Last für uns.«
Diese Nonne wollte sich offenbar nicht bezaubern lassen. Naomi konnte die Gestalt unter all dem Stoff jenseits des Tresens fühlen: die Erschöpfung und den schwerfälligen, hartnäckigen Kampf gegen Ungerechtigkeit. »Passen Sie auf, ich möchte keinen Ärger machen«, besänftigte Naomi sie. »Haben Sie eine Art Gemeindepinnwand, wo ich eine Nachricht hinterlassen könnte?«
Die Antwort war ein knappes Nicken. Dann blickte die Nonne über Naomis Schulter hinweg und lächelte nunmehr aufrichtig, denn jetzt war es Zeit für die Schlange. Einer nach dem anderen betraten die Familien, Trinker und Obdachlosen den Raum, und die Stimme der Nonne begrüßte jeden von ihnen persönlich, mit Namen oder mit einer Frage, aus der Liebe herauszuhören war.
Das Schwarze Brett befand sich im Nebengebäude der Suppenküche, wo Naomi auch eine Reihe von Briefkästen vorfand, über die die Obdachlosen Post empfangen konnten, sowie eine Nachrichtenpinnwand voller Zettel. Tony, mein Bruder, bitte ruf mich an, stand auf einem. Suche meine leibliche Mutter, mit detaillierten Angaben. Aushänge für Sitzungen der Anonymen Alkoholiker. Hilfe für Armee-Veteranen. Selbsthilfegruppen für Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung.
Und die Suchplakate für die verschwundenen Straßenmädchen. Diese las Naomi mit dem Gefühl einer kalten Hand, die sich um ihr Herz legte. Die meisten der verschollenen Mädchen hatten nicht einmal richtige Namen, sondern trugen Pseudonyme wie Mercedes und Diamond. Teure Objekte aus Traumwelten, von denen sie alles trennte. Mit Erleichterung las Naomi auf den älteren Postern einen Namen, der ihr vertraut war: Bitte melden Sie sich telefonisch bei Det. Winfield, Polizei des Staates Oregon. Aber darunter hingen die Flyer der gemeinnützigen Organisation Crimestoppers, die sich den Ermordeten widmeten, und auf denen verwies man auf die Nummer der lokalen FBI-Dienststelle. Naomi zog die Brauen zusammen.
Sie holte einen ihrer Flyer aus der Umhängetasche. Der Text war mit einem gelben Kreis versehen, um aufzufallen. Sie pinnte ihn in die Mitte des Schwarzen Bretts.
Ich suche meine Schwester. Sie ist etwa 25, stand da. Naomi hatte die wenigen Einzelheiten aufgelistet, an die sie sich erinnern konnte: das landwirtschaftlich genutzte Tal in Oregon, wo sie damals gefangen gehalten worden waren, den unterirdischen Bunker, in dem ein Mann sie festhielt, das Jahr ihrer Flucht. Sie kannte nicht einmal den Namen ihrer Schwester, deswegen konnte sie den nicht hinzufügen. Und dann stand da noch: Wenn ihr sie kennt, sagt ihr, dass es mir leidtut und dass ich sie vermisse.
Naomi trat einen Schritt zurück.
Ein alter Mann, der verdrossen und zittrig vom Alkohol oder anderen Problemen wirkte, war hinter ihr aufgetaucht, so still wie ein Wispern. Naomi konnte seinen klebrigen Atem riechen. Er blinzelte, als er den Text auf ihrem Flyer las. »Es gibt ’ne Menge Mädchen auf der Welt«, stellte er fest und grinste sie mit seinen Pferdezähnen an.
»Ich weiß«, gab Naomi heiser zurück.
»Wie sieht sie denn aus?«, fragte der Alte freundlich.
»Das weiß ich nicht«, musste Naomi zugeben.
»Hast du kein Foto?«
»Nein.«
»Was für eine Schwester bist du denn, wenn du noch nicht mal ein Bild von ihr hast?«
Draußen gab es keine Schlange mehr, der Gehweg war wie leer gefegt. Hinter ihr konnte sie durch das staubige Fenster sehen, dass alle Tische besetzt waren, dass die Kundschaft ihre köstlich aussehende Mahlzeit aß. Bohnen und Maisbrot, am Tisch in Stücke geschnitten und mit Honig beträufelt. Ein kleines Mädchen mit strähnigen blonden Haaren blickte zu ihr hoch. Die Mutter strich ihm über den Kopf, und der Blick des Kindes glitt wieder zum Teller zurück.
Naomi fühlte sich hohl und blechern; Verzweiflung holte sie ein. Die Dunkelheit war hereingebrochen, und sie wäre am liebsten auch zusammengebrochen. Sie ging methodisch die Straße hinab, trat an jeden provisorischen Unterschlupf, zu jedem Menschen, der in einem Hauseingang schlief. »Ich suche nach meiner Schwester«, begann sie jedes Mal aufs Neue, aber an der nächsten Straßenecke blieb sie stehen, weil die Hoffnungslosigkeit sie übermannte.
Das hier war nicht wie ihre sonstigen Fälle. Die Tatsache, dass all diese anderen verschwundenen Kinder nicht mit ihr verwandt waren, hatte es ihr überhaupt erst ermöglicht, die Alternative in Betracht zu ziehen, dass sie vielleicht niemals gefunden werden würden. Erst jetzt verstand Naomi die Panik der Eltern wirklich, wenn sie ihr sagten, dass sie nicht atmen konnten, solange ihr Kind verschollen war. Selbst im Schlaf suchte Naomi nach ihr. Wenn ihre Schwester in irgendeiner Form etwas mit den verschwundenen Straßenkindern zu tun hatte, würde sie es herausfinden. Sie wusste aus Erfahrung, dass Menschen auf der Straße aufeinander aufpassten. Vielleicht würden die ihr helfen.
Sie kam an Wohnmobilen unter Planen vorbei, an einem Betrunkenen, der am Bordstein würgte. Zeltstädte, die nachts auf Parkplätzen errichtet wurden, die satten Geräusche von Sex, der in einer Gasse stattfand. Vor ihr blinkten die Lichter von Bars, der Geruch nach Autoabgasen, die Geräusche von Autotüren, die geöffnet und zugeschlagen wurden. Der Rotlichtbezirk. Naomi erkannte Gestalten, die wie Kinder aussahen und im Halbdunkel bettelten. Bettelten und vielleicht Schlimmeres.
Sie hielt auf die Kinder zu.
Celia stand an der Ecke, die Scheinwerfer der Autos weiße Augen in der Dunkelheit. Sie hasste die Männer in den Autos, hasste sie und ihre grapschenden Hände, ihre schwammig-saugenden Bedürfnisse, auch wenn sie selbst manchmal bei einem einstieg.
Das war besser als Sterben.
Und dann sah sie die Frau die Straße herunterkommen. Die Frau war mittelgroß, nicht dürr und nicht dick. Sie wirkte stark. Sie hatte langes seidenbraunes Haar, das ihr über die Schultern fiel. Sie schob es mit ungeduldiger Geste zurück. Celia erhaschte das Aufblitzen eines Ringes an ihrer Hand. Ihre Haut schimmerte im Dunkeln.
Die Frau gehörte ganz offensichtlich nicht hierher. Was nachts geschah, sollte geheim bleiben – so wie das, was mit ihrem Stiefvater Teddy geschehen war. Celia hatte den Fehler begangen, darüber zu sprechen. Sie hatte herausgefunden, dass die Tagmenschen nicht wissen wollen, was nachts geschieht.
Diese Frau war ein Tagmensch. Celia konnte das mit einen Blick erfassen und verzog abfällig die Lippen.
»Sieh dir die an!«, sagte sie zu Rich.
Der größere Junge blickte auf seine kleine Freundin hinab, wollte sehen, was diesen höhnischen Tonfall hervorgerufen hatte. Normalerweise war Celia der sanfte Typ, jetzt aber nicht.
»Wahrscheinlich eine dieser Kirchentanten«, beschied Rich.
Celias grüne Augen blickten hart. »Dann sollte sie besser nach Hause gehen«, sagte sie.
Beide beobachteten, wie die Frau den Gehweg entlangkam und mit den anderen Straßenkindern sprach. Die Transvestiten waren fort, zu den Bars hinübergeweht wie Federn aus ihren Boas, die davonschwebten. Je später es wurde, desto kleiner und härter wurden die Menschen, die übrig blieben, bis die Nacht ihnen alles nahm und sie zu nichts reduzierte. Dann war es Zeit wegzurennen.
Die Frau trat auf die Straße, um mit einem Kind zu sprechen. Der Junge war mit etwas beschäftigt, das man wohl als Transaktion bezeichnen konnte, und hing in einem offenen Autofenster. Er drehte sich zu der Frau um, von ihrer Einmischung schockiert, und hinter dem Steuer konnte Celia den Freier und das überraschte O sehen, zu dem sich sein Mund geöffnet hatte.
»Was zur Hölle tut sie da?«, fragte Celia.
»Vielleicht versucht sie, ihren lieben Freund Jesus zu finden. Der braucht frische Nägel«, witzelte Rich und sah dann enttäuscht ein, dass sein kranker Witz bei Celia nicht gelandet war.
Diese verspürte eine Aufwallung von Eifersucht und hasste die Frau auf Anhieb. Wie konnte die so wunderbar dreist durch die Nacht gleiten – hier umherlaufen und Fragen stellen, die Schultern gestrafft, als hätte sie jedes Recht dazu? Ihr gesamtes Verhalten drückte aus, dass sie zählte.
Hinter ihnen schlängelte sich ihr gemeinsamer Freund Stoner aus einem Wagen wie ein Wesen, das nur aus Armen und Beinen bestand, bis er sich zu seiner vollen spindeldürren Größe aufgerichtet hatte. Seine langen Glieder erinnerten Celia an Schmetterlinge, die sechs geschmeidige Beine besaßen, um so den Raubtieren zu entkommen. Das war Stoner wohl nicht gelungen. Er wischte sich über den Mund, und niemand sagte etwas darüber, wo er gewesen war oder was er getan hatte. Er würde sich schon so beschmutzt genug fühlen.
»Gehen wir«, drängte Rich und verlagerte das Gewicht seines Rucksacks. Sie entfernten sich von der Straßenecke, als sich die Frau umdrehte. Der Mond beleuchtete ihr Gesicht und verwandelte es in etwas Wunderschönes.
Die Straßenkinder überquerten den Fluss mittels der knarzenden Fußgängerbrücke, rochen das schlammige Wasser, das träge unter ihnen vorbeifloss. Die Autos dröhnten auf der breiteren Brücke über ihnen vorbei. Celia dachte darüber nach, wie das Leben über ihren Köpfen verlief: die hohen Gebäude, die großen Limousinen, die ordentlich gescheitelten Fahrer. Auf der anderen Seite des Flusses schraubten sich die Autobahnen in die Höhe, und unter denen befand sich ein Netzwerk von Nestern. Das größte davon nannten alle ›die Höhlen‹. Die Obdachlosen hatten unter der Überführung aus Beton Tunnel gegraben und ein Labyrinth aus Höhlen geschaffen. In diesen herrschten Gewalt und Vergewaltigung, und die Straßenkinder hielten sich so weit wie möglich von diesem Bereich fern. Auch andere Überführungen waren heftig umkämpft; manchmal führten diese Kämpfe sogar zum Tod: Dann rollte ein zerknautschter Körper den Hang der Autobahn hinunter und wurde am nächsten Tag von den Reinigungsfahrzeugen der Stadt eingesammelt.
Celia und ihre Freunde besaßen keinerlei Macht und bekamen ebenso wenig Schonung von den anderen. Sie nahmen sich, was übrig blieb: die Tischabfälle nach der Mahlzeit. Aber manchmal fanden auch sie Schätze, wie zum Beispiel die vergessene Autobahnauffahrt hinter einer stillgelegten Farbenfabrik, deren Zugang im Gestrüpp verborgen lag. Sie nannten diesen Ort ›Nirgendwo‹. Das war Geheimsprache, denn auf diese Weise hielten sie ihren Schlafplatz verborgen: Wo pennt ihr denn heute Nacht? Nirgendwo.
Die Kinder huschten behände über die leerer werdenden Autobahnspuren, zwischen den vorbeipfeifenden Autos hindurch, bis sie die Farbenfabrik erreichten und unter dem zerrissenen Maschendrahtzaun hindurchglitten, der rings um den Parkplatz führte. Von dort aus kletterten sie einen steilen Hügel zur Überführung hoch, wobei die Brombeersträucher ihre Hände zerkratzten. Wo die Auffahrt auf den Erdhügel traf, gab es einen Hohlraum, der etwa die Größe eines kleinen Zimmers hatte. Die Decke war gerade hoch genug, dass man aufrecht darin stehen konnte.
Als sie sich durch die Sträucher zwängten, rochen Celia und ihre Freunde alten Schweiß, Staub und Urin. Sie hockten sich im Dunklen auf den Boden, zogen ihr Essen aus den Rucksäcken, schlangen und rissen in ihrer Gier Packungen auf, wollten endlich gesättigt sein. Sie würgten das Essen in weichen Klumpen hinunter, weil selbst die Geräusche, die sie beim Schlucken machten, ihnen Angst einjagten.
Als sie fertig waren, sackten sie zusammen, kippten einfach zur Seite. Aber der Schlaf wollte sich nicht einstellen; lange Zeit nicht. Die Jungen lagen mit weit aufgerissenen Augen da, lauschten dem Verkehr, der über sie hinwegrollte, und als die Nacht zur Morgendämmerung verblasste, wurden diese Geräusche zum Taktgeber ihrer Schlaflosigkeit, ihrer Ängste. Jedes Rascheln, das der Wind in die Sträucher vor ihrer Senke trug, klang wie ein nächtlicher Herumtreiber auf Beutezug.
Stoner legte seine langgliedrige Hand über die Augen und weinte im Dunkeln.
Auch Celia lag wach. Um sie herum war alles schwärzer als jede Dunkelheit. Sie dachte wieder an die Frau, die sie gesehen hatte, und fühlte, wie die Eifersucht zurückkehrte. Die Frau würde sich an einem Ort schlafen legen, der keine Erdkuhle unter einer Schnellstraße war, in der dich nachts die Spinnen bissen. Es war ein Ort mit einem Bett und mit Sicherheit. Nicht wie bei ihr – oder ihrer Schwester Alyssa.
Celia dachte an Alyssa. Sie sah ihren Stiefvater vor sich, und ihre Augen glänzten vor ungeweinten Tränen. Sie brachte sich dazu, tiefe Atemzüge zu nehmen. Schmetterlinge schlafen niemals, erinnerte sie sich. Sie ruhen sich mit offenen Augen aus. Das half ihr, ruhiger zu werden. Sie konzentrierte sich, bis sie die Schmetterlinge in Gedanken sehen konnte. Sie flogen auf sie zu, umringten sie mit sachte flatternden Flügeln, die ihre Ohren umschlossen, weichen Samt auf ihre Wangen legten, mit ihren Fühlern, die sich schließende Lider nachzeichneten, beschwichtigend murmelten. Immer mehr von ihnen flogen unter der Überführung herein, Schwärme wie große, weiche Wolken, bis sie komplett von ihnen bedeckt war. Sie landeten auf ihrer Jeans, ihren müden Füßen, ihrer leeren Mitte. Sie tranken ihre Tränen. Sie verwandelten sie in eine Decke aus leuchtenden Farben, und erst als sie von oben bis unten darunter verborgen lag, fühlte sich Celia endlich sicher.
»Du willst nicht, dass ich dich begleite?«, vergewisserte sich Jerome.
Es war Morgen, sie standen auf Dianes Veranda. Das bezaubernde Haus im viktorianischen Stil war in leuchtenden Farben gestrichen. Ihr Gästezimmer ging zur Straße hinaus, Dianes großes Schlafzimmer nach hinten, mit Blick über den stillen Garten. Naomi hatte Diane kennengelernt, als sie beide in einem Fall als Zeuginnen aussagten. Sie freundeten sich augenblicklich an, vielleicht auch, weil Diane akzeptierte, dass Naomi ständig wegen ihrer Fälle durchs Land zog und daher immer wieder in ihrem Leben auftauchte und daraus verschwand. Sie hatte ihr sogar den leeren Dachboden überlassen, damit Naomi ihre Akten dort verwahren konnte.
Aber nun waren Naomi und Jerome pleite. Das letzte Jahr hatte die knappen Ersparnisse verschlungen, die sie beiseitegelegt hatten. Naomi hatte sich geweigert, andere Fälle anzunehmen, bis sie ihre Schwester finden würde, und das ständige Reisen bedeutete, dass auch Jerome keine Anstellung fand.
»Wir brauchen Geld, mein Schatz«, erwiderte Naomi lächelnd.
»Ich versuche es ja«, scherzte er und spannte den einen Arm an, der ihm geblieben war. Der fehlende sprach Bände: Versuch du doch mal Arbeit zu finden, wenn du nur einen Arm hast.
Jerome, der Soldat und Sheriff gewesen war, wusste, dass er einen exzellenten Polizeibeamten und Ermittler abgab. Aber das bedeutete noch lange nicht, dass ihn die hiesigen Vollzugsbehörden eingestellt hätten, und darüber hinaus wusste er ja auch nicht, ob sie in der Stadt bleiben würden. Er hätte viel lieber draußen auf dem Land gelebt, aber das Gespräch darüber musste warten, bis sie Naomis Schwester gefunden hätten. Sollten sie sie nicht finden … Nun, darüber wollte er gar nicht nachdenken.
Die eine Möglichkeit, die ihm einfiel, war, wie seine Frau Privatermittler zu werden. Aber er war nicht sicher, was Naomi davon gehalten hätte. Die Misserfolge des vergangenen Jahres hatten beide verunsichert zurückgelassen, auch im Umgang miteinander. Zum ersten Mal seit sie in sein Leben getreten war, zögerte Jerome, ganz offen mit Naomi zu sprechen.
Er wünschte, jemand hätte ihm beigebracht, wie eine Ehe funktionierte. Ohne Mutter und Vater aufgewachsen, hatte er nur seine Pflegemutter Mrs. Cottle gehabt, Gott sei ihrer Seele gnädig, die verwitwet gewesen war. Er wollte Naomi ein guter Ehemann sein.
Sie kam näher, lehnte sich auf der Suche nach einer Umarmung an ihn. Überrascht legte er seinen einen Arm um sie und erinnerte sich an das erste Mal, dass sie sich geliebt hatten. Ihr Gesicht unter seinem. »Es wird alles gut«, sagte er zu ihr und wünschte, er wäre zufriedener mit sich selbst gewesen.
Jeromes früheste Erinnerungen an Naomi, als sie gerade erst bei ihnen aufgenommen worden war: zunächst verängstigt und dann ganz die Draufgängerin, bevor sich diese Eigenschaft zu stillem Mut wandelte. Sie rannten über die Felskämme am Rand von Opal, stöberten die Zaubersteine auf, die die Versteinerung der Zeit ihnen dort hinterlassen hatte: Quarz und Jaspis, glänzende Achate, die sie mit ihren T-Shirts polierten, und die allgegenwärtigen Opale. Mit etwas Spucke brachte man sie zum Leuchten.
Ihre zweite Lieblingsbeschäftigung war die Suche nach alten Artefakten der Urbevölkerung. Teile seines Erbes wie Splitter seiner eigenen Knochen aus der Erde. Manchmal fanden sie Pfeilspitzen – oder taten so, als wären es Pfeilspitzen, auch wenn es sich wahrscheinlich bloß um dreieckige Felssplitter handelte. Ein paarmal fanden sie Orte im Wald, die wie sehr alte Lagerplätze wirkten, untypisch weite Lichtungen, auf denen Bohlenhäuser gestanden haben mochten. An diesen Orten gab es Steinhaufen, unter denen sich Schätze verbargen. Heute war Jerome traurig, dass er sie nicht aufbewahrt hatte. Hornlöffel und verrottende Lederbeutel, die bei der sachtesten Berührung zerfielen.
Bisweilen gab es Stellen im Wald, wo die Kiefern auf eine bestimmte Art zusammenstanden, und dann sah Jerome Naomis Gesichtsausdruck an, dass sie sich an etwas erinnerte, auch wenn sie ansonsten alles hatte vergessen müssen. In solchen Momenten nahm er sie bei der Hand und zog sie mit sich, weg von diesen Orten. Er lenkte sie ab, indem er ihr erzählte, was er über seinen Stamm gelesen hatte – später würde er herausfinden, dass die Informationen nur teilweise stimmten –, etwa dass die Familien seiner Vorfahren deren Habseligkeiten an Bäume banden, wenn sie gestorben waren.
Dann gingen Naomi und er zurück zum Farmhaus, in dem sie lebten, suchten die Unterseiten des Geästs aller Bäume ab und hofften, ein Überbleibsel seiner Vorfahren zu finden. Es spielte gar keine Rolle, dass sie nie etwas fanden. Er war mit ihr zusammen, und nur das zählte.
»Wenn das nicht die Kinderfinderin ist!«
Detective Lucius Winfield erhob sich von seinem Schreibtisch und streckte eine seiner großen Hände aus, während die Deckenlampen seines Büros die Naturkrause auf seinem Kopf zum Funkeln brachten. Naomi erwiderte sein Lächeln. In seiner Gegenwart fühlte sie sich stets wohl. Sie nahm im Ledersessel Platz, blieb aber nicht still sitzen. Naomi spürte, dass die Uhr tickte.
»Was ist los?«, wollte der Detective wissen. Winfield kannte Naomi seit beinahe einem Jahrzehnt – seit den ersten Fällen vermisster Kinder, die sie bearbeitet hatte. Einige davon waren seine Fälle gewesen. Oft heuerten die Eltern Naomi an, wenn die Ermittlungen der Polizei keine Ergebnisse brachten. Winfield hatte kein Problem damit, einen Fall zu teilen, wenn das zu Ergebnissen führte.
»Ich versuche immer noch, meine Schwester zu finden«, erklärte Naomi. Sie erläuterte, was sie im vergangenen Jahr alles versucht hatten, ausgehend von der spärlichen Handhabe ihres Gedächtnisses. Sie erzählte dem Detective davon, wie sie und Jerome alte Farmregister und Volkszählungsunterlagen durchkämmt, Dutzende Erdbeerfelder in den fruchtbaren Tälern Oregons besucht hatten. Sie waren nach Arizona und Kalifornien gefahren und hatten die Hersteller unterirdischer Bunker aufgesucht, um herauszufinden, ob es eine Liste von Käufern gab. Sie hatten Dutzende Männer befragt, die wegen Kindesentführung einsaßen. Ein Abstrich ihrer DNA war in diverse Datenbanken eingegeben worden, um zu sehen, ob es eine Übereinstimmung an unidentifizierten Leichen gab. Sie hatten sich sogar über internationale Kinderhändlerringe informiert. Nichts. Sie konnte noch nicht einmal herausfinden, wer sie war. Es war, als wäre sie an jenem Tag geboren worden, an dem sie entkommen war, neunjährig aus dem Boden gewachsen.
Aber dann hatten sie und Jerome eines Tages an einer Tankstelle gehalten, auf einer Landstraße tief im Obstanbaugebiet. Ein Truck voller migrantischer Landarbeiter hatte neben ihnen gehalten. Die Frauen und Kinder saßen hinten, braun gebrannt und schwankend von zu viel Sonne. Sie hatten leere Plastikkanister hervorgeholt, um sie mit Wasser aus dem Schlauch aufzufüllen. Es war Jerome, der ein lupenreines Spanisch sprach, der eine Unterhaltung mit den Tanknachbarn begann. Eine alte Frau bekreuzigte sich und sagte, ja, sie erinnere sich an einen solchen Ort. Es war ein böser Ort gewesen, nahe einem Dorf namens Elk Crossing.
»Danach war es wie ein Wettlauf mit der Zeit«, erzählte Naomi dem Detective. Sie und Jerome hatten die Felder gefunden und dann den Bunker im angrenzenden Wald. Aber die verrottete Falltür war eingebrochen, die unterirdischen Räume leer. Ihre Schwester war schon lange fort. Naomi schätzte, dass ihr Entführer ihre Schwester nach Naomis Flucht mitgenommen hatte.
»Das tut mir leid«, sagte Winfield, und seine Stimme war voller Mitgefühl. »Es muss furchtbar für dich gewesen sein, dort runterzugehen.«
Naomi nickte und schluckte den Schmerz hinunter. »Also sind wir zurück zum Büro der Sondereinheit, und dort habe ich gehört, dass ihr hier mehrere verschwundene Straßenkinder habt. Einige davon wurden gefunden, sind Opfer von Mord geworden.«
Detective Winfield lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und legte die Hand auf die Schreibtischplatte.
»Ich hätte wissen sollen, dass dich das in die Stadt lockt.«
»Fünf Mädchen, alle erstochen und aus dem Fluss gezogen«, stellte Naomi fest. »Mindestens ein Dutzend weitere Straßenkinder werden vermisst, den Aussagen ihrer Freunde zufolge. Womöglich habt ihr es mit einem neuen Green River Killer zu tun.«
»Ich weiß«, gab Winfield zurück. »Wir ertrinken in Arbeit da draußen.« Er gestikulierte erschöpft, meinte die Stadt jenseits der Mauern seines Reviers. »Du hast ja gesehen, wie es läuft. Obdachlose überall. Und all die Arten, wie die Gefährdeten ausgenommen werden. Menschenhandel, Verbrechen, Krankheiten, Mord. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, so viele Fälle müsste ich lösen.«
Naomi zog die Brauen zusammen. »Was ist mit Sozialarbeitern und Gemeindebehörden?«
»Die ertrinken ebenso.«
»Hast du den Fall deswegen an die lokale FBI-Dienststelle abgegeben?«
»Ich habe gar nichts abgegeben, die haben ihn mir abgenommen.« Sein Ton war scharf. Sie sah den aufflackernden Zorn. »Wenn du helfen willst, nur zu gern.« Seine Stimme wurde wieder weicher. »Du weißt, wir alle geben unser Bestes. Ich weiß, dass du das tust, und ich ebenso. Aber ich kann auch nicht mehr machen als meine Arbeit. Ich habe momentan mehr als 50 offene Fälle. Wie viele hast du?«
Naomi schwieg, denn das hatte gesessen. Sie hatte genau null Fälle, wenn sie ihre Schwester nicht mitzählte.
Sie hatte leicht reden, leicht urteilen. Nun regte sich das schlechte Gewissen und das sagte sie auch. »Tut mir leid.«