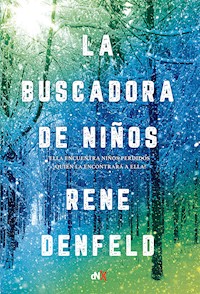5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Naomi Cottle
- Sprache: Deutsch
Vor drei Jahren, als ihre Familie nach einem Weihnachtsbaum in den frostigen Wäldern von Oregon suchte, verschwand Madison Culver. Drei Jahre - und immer noch keine Spur von der damals Fünfjährigen. Ist sie tot? Doch eine Leiche hat man bisher nicht finden können. Madisons Eltern wenden sich in ihrer Verzweiflung an die »Kinderfinderin« Naomi, eine Privatermittlerin mit dem unheimlichen Talent, Vermisste aufzuspüren. Da sie in ihrer Kindheit selbst einmal verschleppt wurde, kann sie sich besonders gut in solche Fälle hineinversetzen. Während Naomi nach und nach die schrecklichen Tatsachen im Fall Madison aufdeckt, durchdringen Scherben eines dunklen Traums ihre Erinnerung … Ein atemberaubender, literarischer Pageturner, erzählt mit den wechselnden Stimmen von Naomi und einem außergewöhnlich fantasievollen Kind. Publishers Weekly: »Intensiv und einfallsreich, herzzerreißend und überraschend ... Der Schluss raubt den Lesern den letzten Atem.« CrimeReads: »Ein ergreifend schöner, schauriger Roman über eine knallharte, lebensechte Heldin.« Booklist: »Denfelds Roman greift auf Elemente des Horrors, des Krimis, des Märchens und sogar der Liebesgeschichte zurück, um das Erbe der Gewalt und die Widerstandsfähigkeit der Schwächsten unter uns zu erkunden.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Claudia Rapp
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe The Child Finder
erschien 2017 im Verlag Harper Collins Publishers.
Copyright © 2017 by Rene Denfeld
Copyright © dieser Ausgabe 2022 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Titelbild: Arndt Drechsler-Zakrzewski
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-987-9
www.Festa-Verlag.de
Für Arid
1
Das Zuhause war ein kleines gelbes Häuschen in einer leeren Straße. Es hatte etwas Entmutigtes an sich, aber daran war Naomi gewöhnt. Die junge Mutter, die ihr die Tür öffnete, war zierlich und sah viel älter aus, als sie war. Ihr Gesicht wirkte angespannt und müde.
»Die Kinderfinderin«, stellte sie fest.
Sie setzten sich auf eine Couch in einem leeren Wohnzimmer. Naomi registrierte einen Stapel Kinderbücher auf dem Tisch neben einem Schaukelstuhl. Garantiert war das Zimmer des Kindes noch genau wie zuvor.
»Es tut mir leid, dass wir nicht früher von Ihnen gehört haben«, sagte der Vater, der in einem Sessel am Fenster saß und seine Hände gegeneinanderrieb. »Wir haben alles versucht. So viel Zeit ist …«
»Sogar eine Hellseherin«, fügte die junge Mutter mit einem gequälten Lächeln hinzu.
»Man sagt, Sie sind die Beste darin, verschwundene Kinder aufzuspüren«, setzte der Mann nach. »Ich wusste nicht mal, dass es Ermittler gibt, die das tun.«
»Nennen Sie mich Naomi«, bat sie.
Die Eltern musterten sie: kräftig gebaut, gebräunte Hände, die aussahen, als wüssten sie, was Arbeiten heißt, langes braunes Haar, ein entwaffnendes Lächeln. Sie war jünger, als sie erwartet hatten – sicher nicht älter als Ende 20.
»Woher wissen Sie, wie man sie findet?«, fragte die Mutter.
Sie schenkte ihnen das strahlende Lächeln. »Weil ich weiß, was Freiheit ist.«
Der Vater blinzelte. Er hatte von ihrer Vorgeschichte gelesen.
»Ich würde gern ihr Zimmer sehen«, sagte Naomi nach einer Weile und stellte ihren Kaffee ab.
Die Mutter führte sie durchs Haus, während der Vater im Wohnzimmer blieb. Die Küche sah steril aus. Da stand eine altmodische Keksdose, deren Rand Staub angesammelt hatte: Auf dem dicken Bauch stand Omas Plätzchen. Naomi fragte sich, wann diese Oma wohl zum letzten Mal zu Besuch gewesen war.
»Mein Mann findet, ich sollte wieder arbeiten gehen«, sagte die Mutter.
»Arbeiten ist gut«, gab Naomi sanft zurück.
»Aber ich kann nicht«, sagte die Mutter, und Naomi verstand. Du kannst dein Haus nicht verlassen, wenn dein Kind jeden Augenblick zurückkommen könnte.
Die Tür führte in ein Zimmer voller Traurigkeit. Ein schmales Bett mit einer Tagesdecke mit Disney-Motiven. Eine Reihe von Bildern an der Wand: fliegende Enten. MADISONS ZIMMER, stand in Klebebuchstaben über dem Bett. Dann gab es noch ein kleines Bücherregal und einen größeren Schreibtisch, auf dem ein Durcheinander aus Kulis und Filzstiften herrschte.
Über dem Schreibtisch hing eine Lesetabelle von ihrer Vorschullehrerin. SUPERLESERIN, stand dort. Für jedes Buch, das Madison im Herbst, bevor sie verschwunden war, gelesen hatte, gab es einen goldenen Stern.
Es roch nach Staub und abgestandener Luft – der Geruch eines Zimmers, das seit Jahren unbewohnt geblieben war.
Naomi trat an den Schreibtisch heran. Madison hatte gezeichnet. Naomi konnte sich vorstellen, wie sie von ihrer Zeichnung aufstand und zum Auto hinausrannte, während ihr Vater ungeduldig nach ihr rief.
Es war ein Bild eines Weihnachtsbaums voller schwerer roter Kugeln. Daneben stand eine Gruppe Figuren: eine Mama und ein Papa mit einem kleinen Mädchen und einem Hund. Meine Familie, verkündete die Bildunterschrift. Eine typische Zeichnung für ein kleines Kind, mit großen Köpfen und Strichmännchen. Naomi hatte Dutzende solcher Bilder in ähnlichen Zimmern gesehen. Jedes Mal fühlte sich das an wie ein Stich ins Herz.
Sie nahm ein liniertes Schreibheft vom Tisch, blätterte durch die ungelenken, aber überschwänglichen Einträge, die mit Wachsstift-Zeichnungen verziert waren.
»Sie konnte schon gut schreiben für ihr Alter«, merkte Naomi an.
»Sie ist gescheit«, erwiderte ihre Mutter.
Naomi ging zum offenen Kleiderschrank. Darin eine Ansammlung bunter Pullover und oft gewaschener Baumwollkleidchen. Madison mochte heitere Farben, das konnte sie sehen. Naomi fuhr mit dem Finger am Ärmelbündchen eines Pullovers entlang, dann betastete sie einen zweiten. Sie zog die Brauen zusammen.
»Die sind alle ausgefranst«, stellte sie fest.
»Sie hat immer daran gezupft – an allen. Hat die Fäden aufgedröselt«, erklärte die Mama. »Ich habe dauernd versucht, sie dazu zu bringen, es zu lassen.«
»Wieso?«
Die Mutter hielt inne.
»Ich weiß es nicht mehr. Ich würde alles tun …«
»Sie wissen, dass sie höchstwahrscheinlich tot ist«, wandte Naomi sacht ein. Sie hatte festgestellt, dass es besser war, es einfach auszusprechen. Besonders wenn so viel Zeit vergangen war.
Die Mama erstarrte.
»Ich glaube nicht, dass sie tot ist.«
Die beiden Frauen blickten einander an. Sie waren etwa im selben Alter, aber Naomis Wangen besaßen eine gesunde Röte, während die Mama von Angst gezeichnet war.
»Jemand hat sie entführt«, sagte die Mutter mit Nachdruck.
»Wenn sie entführt wurde und wir sie finden, dann ist sie nicht mehr dieselbe, wenn sie zurückkommt. Das muss Ihnen von vorneherein klar sein«, sagte Naomi.
Die Lippen der Frau zitterten. »Wie kommt sie denn zurück?«
Naomi machte einen Schritt auf sie zu, kam nahe genug, dass sie einander fast berührten. In ihrem Blick lag etwas Großes, Überwältigendes.
»Sie wird Sie brauchen, wenn sie zurückkommt.«
Zuerst glaubte Naomi nicht, dass sie die Stelle finden würde, obwohl sie die Wegbeschreibung und die Koordinaten hatte, die ihr die Eltern gegeben hatten. Die schwarze Straße war nass vom Winterdienst, die Seiten voller Schneematsch. Zu beiden Seiten des Wagens erstreckte sich die Aussicht endlos: Berge dunkelgrüner, schneebedeckter Fichten, schwarze Steilhänge und weiß bestäubte Gipfel. Sie fuhr seit Stunden, hoch in den Skookum National Forest hinein, weit weg von der Stadt. Das Gelände war unwirtlich und brutal. Eine wilde Landschaft voller tiefer Spalten und Gletscherwände.
Etwas Gelbes blitzte auf: zerrissene Überreste Absperrband, die von einem Baum hingen.
Wieso hatten sie hier angehalten? Es gab hier nichts.
Naomi stieg achtsam aus dem Auto. Die Luft war kalt, das Licht grell. Sie nahm einen tiefen, beruhigenden Atemzug. Dann trat sie ins Gehölz und war in Dunkelheit getaucht. Ihre Stiefel knirschten im Schnee.
Sie malte sich aus, wie die Familie beschlossen hatte, einen ganzen Tag darauf zu verwenden, rauszufahren und ihren Weihnachtsbaum zu schlagen. Wie sie anhielten und sich in dem kleinen Weiler Stubbed Toe Creek frische Donuts holten. Eine der vielen alten Straßen nahmen, die sich in die verschneiten Berge hinaufschlängelten. Um ihre eigene, ganz besondere Douglasfichte zu finden.
Schnee und Eis überall ringsumher. Sie stellte sich vor, wie die Mama sich die Hände am Gebläse des Wagens wärmte, das kleine Mädchen auf dem Rücksitz eingemummt in einen rosafarbenen Parka. Wie der Vater entschied, dass dies der richtige Ort war – vielleicht war er es leid gewesen, einen Platz zu suchen. Wie er rechts ranfuhr, den Kofferraum aufmachte, um die Säge herauszuholen, wie seine Frau sich schüchtern in den Wald vorwagte, während ihre Tochter rasch vorausstürmte …
Es war binnen weniger Augenblicke geschehen, hatten sie ihr erzählt. Gerade war Madison Culver noch da, im nächsten Moment war sie fort. Sie waren ihren Spuren gefolgt, solange sie konnten, aber es hatte heftig zu schneien angefangen, und während sie sich noch voller Schrecken aneinanderklammerten, waren die Spuren verschwunden.
Als man dann Suchtrupps rief, hatte sich der Schneefall zum Gestöber gesteigert. Zwei Tage später wehte ein Schneesturm heran und die Straßen wurden gesperrt. Sie nahmen die Suche wieder auf, als die Straßen ein paar Wochen später freigeräumt waren. Keiner der Ortsansässigen hatte irgendetwas gesehen oder gehört. Im folgenden Frühling wurde ein Leichenspürhund in den Wald geschickt, aber auch der kam ergebnislos zurück. Madison Culver war verschwunden, und man nahm an, dass ihre Leiche unter dem Schnee begraben lag oder von wilden Tieren verschleppt worden war. Niemand konnte lange im Wald überleben. Erst recht kein fünfjähriges Mädchen in einem rosafarbenen Parka.
Hoffnung war eine schöne Sache, dachte Naomi, als sie durch die stillen Bäume nach oben blickte und die reine, kalte Luft ihre Lunge füllte. Sie war der schönste Teil ihrer Arbeit, wenn sie mit dem Leben belohnt wurde. Der schlimmste, wenn sie nur Trauer brachte.
Zurück beim Auto holte sie ein neues Paar Schneeschuhe und ihren Rucksack heraus. Sie trug bereits den warmen Parka, eine Mütze und dicke Stiefel. Der Kofferraum ihres Wagens war voller Kleidung und Ausrüstung, um jegliches mögliche Terrain zu durchsuchen, von der Wüste über die Berge bis zu den Städten. Alles, was sie brauchte, hielt sie hier hinten bereit.
In der Stadt hatte sie ein Zimmer im Haus einer engen Freundin. Dort bewahrte sie ihre Akten, die Schallplatten, noch mehr Kleidung und einige Erinnerungsstücke auf. Aber für Naomi fand das wahre Leben unterwegs statt, während sie ihre Fälle bearbeitete. Vor allem in Gegenden wie dieser, wie sie festgestellt hatte. Sie hatte Kurse zum Überleben in der Wildnis besucht, ebenso wie solche zu Suche, Bergung und Rettung, aber wonach sie sich richtete, war ihre Intuition. Für Naomi fühlte sich die gefährlichste Wildnis sicherer an als ein Zimmer mit einer Tür, die von der anderen Seite verschlossen war.
Sie begann genau an der Stelle, wo Madison verloren gegangen war, saugte die Umgebung in sich auf. Es war kein formelles Absuchen, mit dem sie anfing. Stattdessen behandelte sie die Gegend wie ein Tier, das sie gerade erst kennenlernte: ein Gefühl für den Körper bekommen, seine Gestalt begreifen. Es handelte sich um ein kaltes Tier mit hervorstehenden, geheimnisvollen, gefährlichen Körperteilen.
Nach wenigen Schritten zwischen den Bäumen verschwand die Straße hinter ihr, und ohne den Kompass in ihrer Jackentasche und die Spuren hinter sich hätte Naomi vielleicht jeglichen Orientierungssinn verloren. Die hohen Fichten verwoben sich über ihr zu einem Baumkronendach und verdeckten beinahe völlig den Himmel. Hier und da fiel die Sonne schräg durchs Geäst und sandte Lichtstreifen bis zum Boden hinab. Sie konnte sehen, wie leicht es wäre, sich hier zu verirren. Sie hatte von Leuten gelesen, die in der Wildnis gestorben waren, weniger als eine halbe Meile vom nächsten Pfad entfernt.
Diese Bäume bildeten einen Primärwald und der schneebedeckte Waldboden war überraschend frei von Gestrüpp. Der Schnee war gegen die rötlichen Stämme geweht und zu Mustern geformt worden. Der Untergrund hob und senkte sich ringsumher – das Kind hätte in endlos viele Richtungen davonstapfen können, und die kleine Gestalt wäre binnen weniger Augenblicke verschwunden.
Zu Beginn nahm sich Naomi stets die Zeit, die Welt, aus der das Kind verschwunden war, lieben zu lernen. Es war, als würde sie vorsichtig ein verdrehtes Knäuel Wolle entwirren. Eine Bushaltestelle, die zu einem Fahrer führte, der zu einem Kellerraum führte, der umsichtig mit Teppichen schalldicht gemacht worden war. Ein überfluteter Graben, der zu einem Fluss führte, wo die Traurigkeit am Ufer wartete. Oder ihr berühmtester Fall, ein acht Jahre zuvor vermisster Junge, der in jener Schulkantine gefunden wurde, aus der er verschwunden war – allerdings sechs Meter darunter, wo sein Entführer, ein Nachtwächter, sich einen geheimen Schlupfwinkel in einem Vorratsraum hinter einem stillgelegten alten Heizkessel im Keller gebaut hatte. Niemand hatte gewusst, dass dieser Raum existierte, bis Naomi die ursprünglichen Grundrisse der Schule hervorgesucht hatte.
Jeder Ort, von dem jemand verschwand, war ein Portal.
Tief im Wald lichteten sich die Bäume abrupt, und Naomi stand am Rand einer steilen weißen Klamm. Vom Grund starrte der Schnee ausdruckslos zu ihr hoch. Auf der anderen Seite schraubte sich das Land zu schwindelerregenden Bergen hinauf. Ganz weit drüben erinnerte ein gefrorener Wasserfall an einen angreifenden Löwen.
Die Bäume waren in Weiß gehüllt; eine Himmelsvision.
Es ist März, dachte sie, und hier oben ist immer noch alles eingefroren.
Naomi stellte sich ein fünfjähriges Mädchen vor, zitternd und verirrt, das durch den Wald wanderte, der ihm endlos erscheinen musste.
Madison Culver wurde seit drei Jahren vermisst. Sie wäre jetzt acht Jahre alt – wenn sie überlebt hätte.
Auf dem Rückweg den Berg hinunter befand sich ein einsamer Laden, so unter Schnee und Moos verborgen, dass sie beinahe daran vorbeigefahren wäre. Das Ding war wie eine Blockhütte gebaut, mit einer maroden Veranda. STRIKES STORE, verkündete das verblichene, handgeschriebene Schild über der Tür.
Der leere, unasphaltierte Parkplatz war von einer dünnen Schicht frischen Schnees bedeckt. Naomi bog ein. Sie dachte, der Laden wäre vielleicht verlassen. Aber nein, er war bloß nicht gut in Schuss. Die Tür klimperte hinter ihr zu.
Die Fenster waren so schmutzig, dass drinnen ewiges Dämmerlicht herrschte.
Der alte Mann hinter dem Tresen hatte ein Gesicht voller geplatzter blauer Äderchen. Seine schmuddelige Mütze sah aus, als wäre sie an seinem schütteren grauen Haar festgeklebt.
Naomi registrierte die staubigen, ausgestopften Tierköpfe hinter ihm, die Patronen unter dem schmierigen Glas des Tresens. Die Gänge waren breit genug, um Schneeschuhen Platz zu lassen. In den Ecken stapelten sich Ersatzteile für Autos; die Metallregale waren vollgestopft mit allem, von billigen Spielsachen über Makkaroni-Packungen bis hin zu den Schnapparmen von Tierfallen.
Es waren die Makkaroni, die ihr ins Auge fielen. Naomi kannte sich gut genug aus, um einen Lebensmittelladen von einem Touristenshop am Wegesrand zu unterscheiden. Sie nahm sich eine abgelaufene Tüte Nüsse und eine Limonade.
»Leben hier oben immer noch Menschen?«, fragte sie neugierig.
Der alte Mann zog ein misstrauisches Gesicht. Ihr ging auf, dass es sich um ein Waldschutzgebiet handelte. Da gab es wahrscheinlich Auflagen.
»Klar doch«, gab er säuerlich zurück.
»Wie überleben die denn?«
Er sah sie an, als wäre sie eine Idiotin. »Jagen, Fallenstellen.«
»Das muss ein kaltes Tagwerk sein hier oben«, stellte sie fest.
»Hier oben ist alles kaltes Tagwerk.«
Er blickte ihr nach, als sie ging und die Tür hinter ihr zufiel.
Sie quartierte sich in einem kleinen Motel am Fuße der Waldgrenze ein, dem absolut letzten Ort, an dem man unterkommen konnte, ohne ein Zelt aufzustellen – oder eine Höhle ins Eis zu graben.
Das Motel wirkte heruntergekommen. Daran war sie gewöhnt. In der Lobby stand zu viel abgewetztes Mobiliar herum. Eine Gruppe rotgesichtiger Bergsteiger drängte sich in dem kleinen Raum, überall Ausrüstung und Schweißgeruch.
Naomi bestaunte ständig all die kleinen Welten, die außerhalb der ihren existierten. Jeder Fall schien sie in ein neues Land mitzunehmen, mit unterschiedlichen Kulturen, Überlieferungen und Menschen. Sie hatte frittiertes Brot in Reservaten gegessen, Wochen auf einer alten Sklavenplantage im Süden verbracht, sich von New Orleans einlullen lassen. Aber ihr Lieblingsstaat war dieser, ihr Zuhause Oregon, wo jede Straßenbiegung ihr einen völlig anderen Ausblick zu liefern schien.
Auf dem Tresen stand ein Plastikständer voller Landkarten. Sie nahm sich eine und bezahlte sie beim Einchecken. In mehr als acht Jahren Ermittlungsarbeit hatte sie den Überblick über die Zahl der Hotelzimmer verloren.
Sie hatte mit dieser Arbeit begonnen, als sie 20 war. Ungewöhnlich früh, das wusste sie, für eine Detektivin. Aber, wie sie manchmal reuevoll anmerkte, sie war dazu berufen. Am Anfang, als sie noch von der Hand in den Mund lebte, hatte Naomi auf den Sofas der Familien geschlafen, die sie anheuerten. Viele von denen waren zu arm, um eine Hotelrechnung zu übernehmen. Mit der Zeit lernte sie, dass sie pro Fall abrechnen musste, und riet den Familien dazu, ihre Bemühungen doch, wenn nötig, zu crowdfunden. Auf diese Weise verdiente sie genug, um sich zumindest ein Zimmer leisten zu können.
Es war nicht der Schlaf, den sie brauchte – sie konnte überall schlafen, selbst zusammengerollt in ihrem Auto. Es war das Alleinsein. Es war die Gelegenheit zum Nachdenken.
Jedes Jahr wurden mehr als 1000 Kinder in den Vereinigten Staaten als vermisst gemeldet – tausend Arten zu verschwinden. Viele davon waren Entführungen, die auf das Konto eines Elternteils gingen. Andere schreckliche Unfälle. Kinder starben in verlassenen Gefriertruhen, in denen sie sich versteckt hatten. Sie ertranken in Steinbrüchen und verliefen sich im Wald, genau wie Madison. Viele wurden nie gefunden. Etwa 100 Fälle jährlich waren belegte Entführungen durch Fremde, auch wenn Naomi glaubte, dass die Dunkelziffer weit höher war. Über die Entführungen wurde am meisten geschrieben, aber sie übernahm jeden Fall eines vermissten Kindes.
Naomi faltete die Landkarte auf dem Bett auf – und weiter auf und noch weiter auf.
Sie machte die Stelle aus, an der Madison verschwunden war, und zog einen winzigen Kreis darum – einen Kreis in einem endlosen Meer aus Grün. Ihre Finger folgten spinnengleich den nahe gelegenen Straßen, und sie musste feststellen, dass die Entfernungen dazwischen zu groß waren, um sie in Betracht zu ziehen.
Wo bist du, Madison Culver? Fliegst du mit den Engeln, ein silbernes Fleckchen auf einer Schwinge? Träumst du, begraben unter dem Schnee? Oder ist es möglich, dass du immer noch lebst, nachdem du drei Jahre verschwunden warst?
An jenem Abend aß sie im Diner, der ans Motel angrenzte, und ließ ihren Blick über die Einheimischen wandern: bullige Männer in Holzfällerhemden, Frauen mit Regenbogenglitzer auf den Lidern, eine Gruppe grantig aussehender Jäger. Die Kellnerin goss ihr eine weitere Tasse Kaffee ein und nannte sie Schätzchen.
Naomi warf einen Blick auf ihr Handy. Nun, da sie wieder in Oregon war, sollte sie in ihrem Zimmer vorbeischauen, im Haus ihrer Freundin Diane. Und was noch wichtiger war, sie sollte Jerome anrufen und sich die Zeit nehmen, ihn und Mrs. Cottle zu besuchen – die einzige Familie, an die sie sich erinnern konnte. Es war zu lange her.
Mit demselben Gemisch aus Furcht und Sehnsucht, das sie stets verspürte, dachte sie an Jerome, der vor dem Farmhaus stand. Ihr letztes Gespräch war schrecklich nahe an etwas herangetänzelt, dem sich zu stellen sie nicht bereit war. Sie steckte ihr Handy wieder ein. Sie würde später anrufen.
Stattdessen leerte sie ihren Teller – gebratenes Hähnchensteak, Mais, Kartoffeln – und nahm den Vorschlag der Kellnerin, ein Stück Kuchen zum Dessert zu essen, dankend an.
Später in ihren Träumen stellten sich die Kinder, die sie gefunden hatte, in Reihen auf und bildeten eine Armee. Als sie aufwachte, hörte sie sich selbst noch flüstern: »Übernehmt die Welt.«
2
Schneemädchen konnte sich an den Tag erinnern, an dem es geboren worden war.
Im leuchtenden Schnee war sie erschaffen worden – zwei müde Arme ausgestreckt wie ein Engel – und ihr Schöpfer war da, sein Gesicht ein Heiligenschein aus Licht.
Er hatte sie mit Leichtigkeit hochgehoben und über seine Schulter gelegt. Ein intensiver, warmer, beruhigender Geruch ging von ihm aus, wie das Innere der Erde. Sie konnte ihre Hände sehen, die Fingerspitzen seltsam blau; sie waren unbeweglich wie Stein. Ihr Haar schwang um ihr Gesicht, die Enden von Eis beschwert.
Vom Gürtel des Mannes schlenkerten lange, pelzbewehrte Wesen. Sie sah, wie die winzigen Krallen nach der leeren Luft über dem weißen, wabernden Schnee griffen.
Ihre Augen fielen zu und sie schlief wieder ein.
Als sie erwachte, war es dunkel wie im Innern einer Höhle. Draußen fiel Schnee. Sie konnte ihn nicht sehen, aber sie konnte es spüren. Wie komisch, dass man etwas so Leises wie den Schneefall hören kann.
Der Mann saß vor ihr. Es dauerte einen Moment, bis ihre fiebrigen Augen sich an das schwache Licht gewöhnt hatten. Es gab hier doch eine Lampe, aber mit ihren Augen stimmte irgendwas nicht, deswegen sah sie alles verschwommen und rötlich eingefärbt.
Sie lag in einem kleinen Bett – im Grunde war es ein Brett an der Wand, verhüllt mit Fellen und Decken. Die Wände um sie herum bestanden aus Lehm. Äste staken daraus hervor. Der Mann saß auf einem hölzernen Stuhl, der aus Ästen und Zweigen geflochten war, wie man es vielleicht aus Büchern kannte. Wie ein Stuhl, auf dem ein gütiger Großvater sitzen mochte, oder Väterchen Zeit.
Sie begriff, dass sie sehr krank war. Ihr Körper wurde von Schmerzen beherrscht, und sie fühlte, dass ihre Wangen heiß und glitschig waren. Fieberkrämpfe schüttelten sie. Ihre Zehen schmerzten. Ihre Finger schmerzten. Ihre Wangen auch, und ihre Nase.
Der Mann deckte sie mit weiteren Fellen zu und wirkte gereizt, besorgt. Er gab ihr kaltes Wasser zu trinken. Besah sich ihre Finger. Die sahen ganz falsch aus, als wären ihnen dicke, neue Häute gewachsen. Er nahm sie in seinen Mund, um sie zu wärmen.
Sie wollte sich übergeben, aber ihre Bauchhöhle fühlte sich eiskalt an. Sie dämmerte weg, war dann wieder wach, weg und wach.
Als sie erneut wach wurde, flößte der Mann ihr noch mehr Wasser ein. Das Wasser schmeckte eisig. Sie schlief wieder ein.
Da war jemand, den sie brauchte, und im Fieber schrie sie nach ihr, immer wieder, aber die Worte, die aus ihrem Mund kamen, schienen den Mann nicht zu erfreuen. Er betrachtete ihre Lippen und wurde zornig. Hielt ihr mit der Hand den Mund zu. In ihrem Schrecken biss sie ihn. Er zog die Hand zurück und schlug zu, eine harte Ohrfeige, die sie schwanken ließ. Dann ging er weg.
Sie wand und warf sich in endlosen Fieberträumen herum. Ihre Finger schwollen an, bis sie wie lustige Zeichentrick-Hände aussahen, aber für sie war das überhaupt nicht lustig. Die Blasen platzten und die Flüssigkeit spritzte auf die Decken. Sie weinte vor Schmerz und Angst.
Als der Mann zurückkam, versuchte sie, mit ihm zu sprechen, sich durch ihre geschwollenen Lippen zu entschuldigen. Sein Blick folgte erneut ihren Lippenbewegungen, und wieder wurde er zornig.
Sie schrie die Worte wieder und wieder heraus, und diese Worte waren Mami, Papi.
Er drehte sich um und ging weg.
Der Mann krakelte ein B auf eine quadratische Kreidetafel. Er hatte die Lampe heruntergeholt und das Licht warf Schatten in alle Ecken. Die Höhle war in gelbes Licht getaucht.
Sie war wach, die Felle und Decken um sie herum eine Wiege voller Schweiß. Wieder spürte sie, dass draußen der Schnee fiel. Mit großen Augen starrte sie den Mann an.
Der begutachtete erneut ihre Finger und machte dann ein komisches, klickendes Geräusch, das Gutheißung ausdrückte. Sie hielt ihre Finger im Licht der Lampe hoch, als hätte sie sie nie zuvor gesehen. Die Schwellung war zurückgegangen, aber die Haut verfärbte sich seltsam lila und schwarz. Es sah fast so aus, als würde sie sich häuten, wie bei einer Eidechse.
Vielleicht verwandelte sie sich zu etwas Neuem.
Der Mann besah sich auch ihre Zehen unter den Decken, nachdem er ihr die Schuhe und Socken ausgezogen hatte, und zum ersten Mal sah sie, dass auch die Zehen fett und geschwollen waren, die Haut ein schreckliches Rot und Lila. Die winzigen Zehennägel sahen aus, als könnte man sie einfach abzupfen.
Er hielt die Tafel hoch. B? Sie nickte schwach, und er wirkte zufrieden.
»Ist dein Name B?«, fragte sie. Ihre Stimme war ein heiseres Flüstern.
Er starrte bloß auf ihre Lippen, antwortete aber nicht.
»Wie bin ich hierhergekommen? Wo sind meine Mami und mein Papi?«
Mr. B schüttelte den Kopf.
Schneemädchen geriet in Panik. Sie war noch immer vom Fieber geschwächt, aber sie versuchte, sich zu erheben, sich an diesem fremden Mann vorbeizudrängen, um zu den Eltern zu gehen, die ganz sicher vor der Höhle warteten. Er wurde zornig und drückte sie hart aufs Bett zurück. Sie kämpfte konfus und verwirrt gegen ihn an, schlug mit den Armen, trat mit den Beinchen.
Wieder verpasste Mr. B ihr eine heftige Ohrfeige. Dann packte er ihre Arme, quetschte sie dabei so fest zusammen, dass es wehtat und sie wimmern musste. Sie fuhr entsetzt und unter Schmerzen zurück, drängte sich hastig gegen die Lehmwand inmitten der Felle und Decken und starrte ihn mit großen Augen an.
Er stand auf, wirkte in seiner Wut riesengroß, und dann wandte er sich abrupt um und ging weg.
Schneemädchen hatte keine Ahnung, wie lange es in diesem Fieberzustand verbracht hatte, während ihr Körper sich häutete und eine neue Schicht zum Vorschein kam – Finger, die unter dem Schwarz rosafarben wurden, bis sie sie endlich wieder bewegen konnte, auch wenn die Spitzen silbrig vernarbt blieben. Ihre Zehen behielten alle Nägel und schrumpften zu hübschen rosa Knöpfchen.
Ihre Wangen fühlten sich nicht mehr rau an, wenn sie sie in den Händen barg, und wenn sie schlief, war es ein tiefer Schlaf.
Es war dunkel in der Höhle, aber durch die groben Bretter über ihr kam genug Licht herein, dass sie ein Gefühl dafür hatte, wann es Tag war und wann Nacht.
Wenn sie aufwachte, brachte Mr. B etwas zu essen und einen alten Metalleimer, in den sie ihr Geschäft verrichtete. Sie hatte Angst, den Eimer als Töpfchen zu benutzen, aber das schien Mr. B nicht zu stören. Er nahm ihn ganz selbstverständlich mit, wenn er wegging.
Mr. B kam und ging über eine Leiter, die er von einer Falltür herabließ. Manchmal trug er eine Weste mit lauter Taschen.
Er antwortete nie, wenn sie sprach oder flehte oder weinte. Ihre Worte verhallten leer und bedeutungslos, prallten an ihm ab.
Manchmal stürzte sie sich auf ihn, trat und zappelte, weil sie glaubte, dass diejenigen, die sie wollte, auf der anderen Seite der Falltür warteten. Sie musste nur dorthin gelangen! Aber sie lernte, es gar nicht erst zu versuchen, denn dann wurde Mr. B jedes Mal wütend und tat ihr weh.
Wenn er fort war, brüllte und schrie sie gefühlt für Stunden, bis ihre Stimme heiser war. Aber nichts geschah. Irgendwann übermannte sie die Überzeugung, dass ihre Eltern doch nicht gleich draußen vor der Höhle warteten. Sie waren fortgegangen. Vielleicht für immer. Vielleicht hatten sie sie hiergelassen, weil sie böse gewesen war.
Sie überlegte angestrengt, was sie falsch gemacht hatte. Lag es daran, dass sie der Rennmaus in der Schule den Schwanz kaputt gemacht hatte? Das wollte sie doch gar nicht; sie hatte nur versucht, Checkers hochzunehmen, und die äußerste Schwanzspitze war in ihrer Hand abgebrochen, einfach so. Sie war so darüber erschrocken, was sie getan hatte, dass sie das kleine Stückchen vom Schwanz in der Einstreu des Käfigs versteckt hatte, und als die Lehrerin später fragte, wer Checkers verletzt hatte, hatte sie es nie zugegeben. Sie dachte sehr oft an das graue Stückchen Mäuseschwanz, das unter den Zedernspänen vergraben lag.
Nach einer Weile hörte sie auf zu sprechen. Mr. B, der ihr eine Brühe brachte, die ganz fettig und falsch schmeckte, und sie mit den Decken einmummelte, nahm ihr Schweigen ohne ein Wort seinerseits hin.
Als er ging, zog er die Leiter hoch. Und die Falltür verschloss er immer.
Ranger Dave war groß und dürr und sah sehr müde aus. Seine Ranger-Station befand sich hoch oben am Gipfel des Elk River Distrikts – fast 40 Meilen südlich der Stelle, wo Madison verschwunden war.
Naomi fuhr die steile Gebirgsstraße hinauf, die zu beiden Seiten von harten Schneewällen bewacht wurde, und passierte unterwegs etwas, das wie der misslungene Versuch, eine Jagdhütte zu errichten, aussah. Das Dach der Hütte war eingebrochen, die Fenster leere, wunde Stellen. Eine große Eule hockte auf dem Dach – sie musste sich mit einem zweiten Blick vergewissern, dass das Tier echt war.
Die Ranger-Station war kühl und erstrahlte in weichem Licht. Die Fenster reflektierten die Wolken, ließen sie über den Boden wandern. Als wäre man in einer Kathedrale, dachte Naomi.
Ranger Dave stand an seinen Fenstern und blickte auf sein riesiges Reich hinaus.
»Hab Ihre Nachricht bekommen«, sagte er. »Hab Sie gegoogelt und ’n paar Leute angerufen. Ein Kollege in Salem hat gesagt, dass Sie mehr als 30 Kinder gefunden haben.«
Sie nickte.
»Glauben Sie, dass Sie jedes Kind finden können?«, fragte er.
»Warum nicht?«, fragte sie lächelnd zurück.
Er zeigte aus dem Fenster. »Wir haben hier oben über 400.000 Hektar Wälder, Gletscher, Seen und Flüsse. Mindestens zweimal im Jahr verirrt sich irgendjemand – um genau zu sein, war ich gerade erst da draußen und habe ein paar schlecht ausgerüstete Felskletterer gerettet.«
Naomi registrierte die vielen aufgereihten Plakate nahe seinem Schreibtisch, die im Plärren des kleinen Elektroheizgeräts flatterten.
»Aber wenn ich helfen kann, bin ich ganz Ohr.«
Naomi würde sich hüten. Es lag nicht daran, dass sie etwas gegen Hilfe hatte – sondern daran, dass man nie wissen konnte, wer in den Fall verwickelt sein mochte. Das hatte sie auf die harte Tour gelernt. Einer ihrer Fälle hatte einen Sexhändlerring auffliegen lassen, der von korrupten Polizeibeamten geleitet wurde.
»Ich hätte gern die Berichte Ihrer Suchaktion«, bat sie höflich.
»Natürlich«, gab er zurück, nunmehr kurz angebunden. Er zog eine Schublade auf.
Dann reichte er ihr eine Akte, die ordentlich beschriftet war: Culver, Madison. Innen war ein Bild an den Aktendeckel getackert: ein blondes Mädchen mit einem breiten Lächeln. Für ihr erstes Schulfoto trug sie einen hübschen Pullover.
»Lassen Sie mich wissen, wenn Sie irgendwelche Überreste finden«, sagte er.
Sie nickte, hatte plötzlich Tränen in den Augen. Bilder drangen auf sie ein, schwammen durch ihre Gedanken. 30 Kinder hatte sie gefunden? Ja, das stimmte.
Aber nicht alle waren am Leben.
Sie wandte sich den Suchplakaten an der Wand zu. Madison hing ganz vorn, grinste mit Zahnlücke vom Poster. Dahinter ein Wanderer, der in einem Schneesturm verschwunden war; eine Gruppe Felskletterer von außerhalb, die in der extrem eingeschränkten Sicht eines Whiteouts verloren gegangen waren; ein Pilzsammler und zahlreiche weitere Opfer ihrer eigenen Fehleinschätzung oder der Wetterverhältnisse.
Naomi entspannte sich ein wenig. Es schien kein Muster dahinterzustecken. Manchmal führte ein vermisstes Kind zu weiteren Vermissten – in einigen Fällen einer ganzen Reihe weiterer Vermisster.
In der Mitte hing ein Plakat von vor zehn Jahren: eine junge Frau mit blitzenden Augen und langen schwarzen Haaren. Sarah ist eine erfahrene Bergsteigerin. Sie verschwand während eines Sturms.
Ganz am Ende hing ein vergilbtes Schwarz-Weiß-Plakat. Darauf war ein kleiner Junge abgebildet, der sich vor 40 Jahren im Wald verirrt hatte. Naomi hielt inne, um den Text zu lesen.
Ranger Dave beobachtete sie dabei, folgte mit den Augen dem sanften Profil ihres Gesichts.
»Ich lasse die Plakate hängen, bis die Leichen gefunden werden«, erklärte er.
Sie drehte sich zu ihm um. »Mich interessieren die Leute, die hier oben leben.«
Er schien erschrocken. »Na ja, wir haben ein paar Ansiedlungen von ganz früher, die von den Neuregelungen ausgenommen sind, und einige Weiler in den unteren Lagen. Den meisten ist es zu kalt und abgelegen, um zu bleiben.« Er lachte. »Abgesehen von ein paar wenigen alten Käuzen.«
»Einem davon bin ich begegnet. Er hat einen Laden, nicht weit von dem Gebiet, wo Madison verschwunden ist.«
»Earl Strikes? Der ist harmlos.«
Sie wandte den Blick ab. Jeder war harmlos, bis man es besser wusste.
Sie nickte in Richtung Fenster, in dem sich Millionen weiß bemützter Bäume spiegelten. »Können Sie mir sagen, wo die alle leben?«
»Alle? Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Es gibt hier keine offizielle Erfassung.«
Er stand viel zu nahe bei ihr. Sie rückte ein Stück von ihm weg.
Naomis Blick glitt zum Ring an seinem Finger und sandte ihm dann ein warnendes Funkeln ins Gesicht. Sie würde nie verstehen, wieso Tragödien ausgerechnet das in den Menschen hervorbrachten. Wenn sie litten, schienen sie sich ineinander vergraben zu wollen und ließen dabei völlig außer Acht, welche Distanz sie schufen.
Aber er versuchte lediglich, ihr etwas vom Schreibtisch in die Hand zu drücken.
Es war ein Positionsanzeiger, der an einem Gürtel befestigt war. »Ich möchte, dass Sie das mitnehmen, falls Sie planen, die Umgebung abzusuchen.« Er schenkte ihr ein schiefes, gequältes Lächeln. »Ich will nicht, dass Sie auch noch verloren gehen.«
Sie nahm es ihm ab und betrachtete das Ding misstrauisch.
Sie war sich bewusst, dass der grundlegende Widerspruch in ihrem Leben der war, dass sie gleichzeitig argwöhnisch und vertrauensselig, ängstlich und furchtlos war, sogar sehr häufig beides gleichzeitig.
Ranger Dave seufzte. »Ich werde nicht wissen, wo Sie sind, es sei denn, Sie schalten ihn ein. Und ich hoffe, dass Sie das nicht tun, es sei denn, Sie sind wirklich in Not. Denn dann komme ich, so schnell ich kann.«
An diesem Abend lag sie bequem ausgestreckt in ihrem warmen Motelzimmer, den Heizkörper neben sich ackernd, und las Ranger Daves Akte über Madison. Der Mann verstand sein Geschäft. Die Akte war voller Karten und Kurvenblätter.
Es gab unter anderem eine Gelände-Analyse und Skizzen der Umgebung. In ihrer Laufbahn hatte Naomi Dutzende Male solche Berichte gesehen, normalerweise in den Akten der Kommissare und der Leiter von Suchtrupps.
Sie fragte sich, wie viel die Unterlagen nützten und ob es nicht bloß Bollwerke gegen die Unvernunft waren.
Zwischen den Zeilen spürte sie seine Traurigkeit:
Madison Culver ist ein fünfjähriges Mädchen. Ihre Eltern sagen, dass sie gern liest, schreibt und Spaziergänge in der Natur unternimmt. Sie hatte sich sehr darauf gefreut, einen Weihnachtsbaum zu holen.
Feldnotizen: Hindernisse: Schlucht im Westen, Tiefschnee, Temperaturen unter null, schlecht gekleidet (Sportschuhe).
Pluspunkte: keine.
Verhaltensprofil der vermissten Person: Madison würde nicht sehr weit umherwandern. Sie wird zunehmend verwirrt und unterkühlt, was möglicherweise dazu führt, dass sie Kleidungsstücke verliert. Sie könnte sich gegen Ende eingegraben haben und ist daher wahrscheinlich unter dem Schnee begraben.
Im Endstadium einer Unterkühlung war den Opfern oft unerträglich heiß, sodass sie sich ihrer Kleidung entledigten und dann nackt im Schnee oder Eis starben, so viel wusste Naomi. Manchmal fingen sie zuletzt zu graben an – die Gründe verstand niemand, aber vielleicht übernahm schlicht der älteste Teil ihres Hirns die Führung – und starben unter der Schneedecke wie in einem selbst ausgehöhlten Tunnel.
Naomi las bis zur letzten Seite, wo der Schluss der Geschichtete wartete.
Nachdem sie sich letzten Dezember verirrt hatte, kam Madison höchstwahrscheinlich sehr bald um. Wir haben ihre Eltern darüber informiert, dass die Suche mit Leichenspürhund keine Ergebnisse brachte, was bei Raubtierbestand zu erwarten war. Beileidskarte an die Eltern. Ermittlungsakte siehe State Police, Detective Winfield.
Naomi blätterte zurück, um das Foto erneut zu betrachten: die kleine, adrette Madison mit dem herzförmigen Gesicht, dem flachsblonden Haar und den langen Ohren, die aussahen, als wären sie einem alten Mann gestohlen worden, fehl am Platz, liebenswert niedlich. Ihr Lächeln strahlte ihr aus dem Foto entgegen, verlieh ihr etwas Zauberhaftes, strahlte pure Freude aus.
Die Welt durfte nicht auch noch dieses Kind verlieren.
Naomi träumte wieder, nur dass es diesmal der große Traum war. Sie nannte ihn den großen Traum, weil es im Grunde ein Albtraum war, über die Vergangenheit – über ihre furchtbare Herkunft. Es war wie die Geschichte in der Bibel, in der Gott die Erde erschuf und, was formlos und öd gewesen war, grün und lebendig wurde. Etwas an diesem Wort ›groß‹ zog sie an, zog an ihr mit einem Weh, das jenseits allen Begreifens lag.
Im Traum war es Nacht und sie war wieder ein nacktes Kind, das quer über ein dunkles Feld rannte. Sie besaß gar kein Alter, warf ihren Namen und das falsche Selbst von sich ab, wie sie sich auch ihrer Kleidung entledigt hatte. Die Felder waren nass und schwarz und klebrig. Ihre Füße wühlten die Erde auf, die nackten Knie hoben sich bei jedem Schritt und sie konnte den Wind in ihrem Haar spüren, auf ihrer Wange und um ihre hilflosen, ins Leere greifenden Hände herum.
Furcht war wie eine Nachtrose in ihrem Innern erblüht, und sie rannte, rannte, um zu entkommen.
Etwas stimmte nicht. Sie blieb stehen. Die Welt wurde ringsumher geboren, aber irgendetwas fehlte.
Sie drehte sich um und …
Naomi war mit einem Ruck hellwach, atmete schwer. Die Laken waren um ihre Füße verheddert: Sie war wieder gerannt im Schlaf.
Draußen wob eine blasse Dämmerung Silberfäden in den Himmel.
Naomi lag keuchend da und spürte, wie sich der Traum verflüchtigte, dem Morgendunst vor dem Fenster gleich. Sie hatte den großen Traum immer wieder einmal gehabt, seit sie damals gefunden worden war. Aber in den vergangenen Wochen, seit sie entschieden hatte, für diesen Fall nach Oregon zurückzukommen, hatte er sich mit beängstigend lebhafter Häufigkeit wiederholt.
Je mehr sie sich ihrer Vergangenheit näherte – und damit auch Jerome –, desto mehr war es, als brächte der Traum das dunkle, möglicherweise furchterregende Versprechen von Antworten mit sich.
Sie stand auf, um sich mit der Kaffeemaschine des Motels eine Tasse Tee zu machen.
Dann schlang sie das Laken um sich, setzte sich ans Fenster und sah zu, wie die Sonne über den Bergen aufging. Wie immer, nachdem sie den Traum gehabt hatte, versuchte sie, die Wahrheit freizulegen. Welcher Teil war Realität, welcher entsprang ihrer Fantasie? Sind die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, wahr oder gründen sie auf dem, was wir im Traum aus ihnen machen?
Naomis früheste Erinnerung bestand darin, dass sie nackt im Dunkeln über ein Erdbeerfeld gerannt war, auf ein Feuer zu, das am Waldrand knisterte. Eine Gruppe Migranten in einer Lichtung, ein Säugling ruhte auf einem Schoß. Eine Stimme geisterte vom rauchigen Lagerfeuer zu ihr herüber:
Lieber Gott, seht euch das an. Komm her, Liebes.
Jemand wickelte sie in eine warme Decke ein, wischte ihr mit einem warmen, tröstenden Stück Stoff über das Gesicht.
Was tun wir denn jetzt?
Sie säuberten sie und gaben ihr zu essen und wickelten sie in eine warme Sarape, einen breiten, gewobenen Schal, der nach Schweiß und Trost roch, und sie hockte sich zitternd und mit riesigen Augen ans Feuer. Das Gespräch ums Feuer war leise und gereizt verlaufen. Dann ist es beschlossene Sache. Wir werden sie zu diesem Sheriff bringen. Komm her, Liebes, du kannst neben mir liegen.
Aber Naomi war zu verängstigt, um zu schlafen. Sie blieb beim verglimmenden Feuer hocken, bis ihre Füße taub wurden, während ihr Blick stetig den Wald absuchte.
Am nächsten Morgen, als sie sie in den Truck setzten, nach wie vor in die Sarape gewickelt, ließ der Schock sie beinahe katatonisch wirken. Der Wind, der durchs Fenster hereinwehte, hob ihr Haar und wisperte das süße Versprechen eines Morgens. Sie war entkommen. Sie war frei.
Sie erinnerte sich an alles, was danach kam. Alles, was davor lag, war verloren gegangen. Sie hatte alles ausgeblendet, ausgeschaltet. Es war, als wäre sie in jenem Moment geboren worden, frei von jeglicher Erinnerung. Vielleicht, so dachte sie, war das, was ihr widerfahren war, zu furchtbar, um sich daran zu erinnern. Sie hatte nur die Träume und die darin verborgenen, schrecklichen Andeutungen dessen, was sie erlitten hatte.
Ihr ganzes Leben lang war sie vor beängstigenden Schatten davongelaufen, die sie nicht länger sehen konnte – und auf dieser Flucht rannte sie direkt ins Leben hinein. Mit den Jahren hatte sie entdeckt, dass das Sakrament des Lebens keinerlei Erinnerung erforderte. Wie ein Blatt, das vom Morgentau trank, hinterfragte sie weder den Sonnenaufgang noch den süßen Geschmack auf der Zunge.
Sie trank einfach.
3
Eines Morgens wachte Schneemädchen auf und die Welt fühlte sich anders an. Das Fieber war fort. Sie setzte sich in ihrem Nest aus Fellen und Decken auf und sah sich mit klarem Blick um. Dann kletterte sie aus dem Bett und stellte einen Fuß nach dem anderen auf den Lehmboden.
Nichts bewegte sich unter ihr: Die Welt stand still.
Wo war sie? Was war geschehen? Sie fing an zu weinen.
Und dann ging ihr auf, dass sie selbst eine andere war. Sie tastete ihre Rippen, ihre Hüften, ihre Beine ab, bis hinunter zu ihren immer noch wunden Füßen. Sie betrachtete ihre neuen Hände, rosig und wie gerade erst geboren. Wie ein Mädchen in einem Märchenbuch war sie in einer gänzlich anderen Welt erwacht.
Schneemädchen kannte sich mit Märchen aus. In solchen Geschichten aßen Kinder vergiftete Äpfel und schliefen dann für Jahre; sie rieben über Steine und wünschten sich dabei etwas, verwandelten sich in wilde Tiere; sie tranken Tee und schrumpften; fielen Tunnel hinab und erwachten in Ländern, die von verrückten Hutmachern und gütigen Königen regiert wurden. Da gab es Kinder, die aus Erde geformt, aus Teig gerollt oder aus dem Eis geboren wurden.
Vielleicht war sie auch einen magischen Tunnel hinuntergefallen und war so an diesen Ort gekommen, dachte Schneemädchen. Vielleicht war sie selbst frisch erschaffen worden, aus Schnee gerollt und aus Wünschen geformt.
Sie ritzte weitere Buchstaben und Formen tief in die Wände, während sie versuchte, sich daran zu erinnern, was vorher gewesen war. In einer Ecke entdeckte sie eine schwache Kontur in der Lehmwand, als hätte ein anderes Kind vor ihr etwas hier eingeritzt. Der Gedanke ließ sie erschauern. Ihre Finger fuhren die Form nach. Sie fühlte sich an wie die Zahl Acht.
Sie betastete die Form und grübelte darüber nach. Was hatte sie zu bedeuten?
Abends brachte Mr. B ihr zu essen, und sie aß und fiel rasch in tiefen Schlaf.
Manchmal besuchten sie Teile der Wälder mitten in der Nacht. Zweige drangen in ihren Körper ein, krochen tief hinein, bis in die geheimsten Orte. Ihr Körper gehörte den Wäldern, und wenn die Wälder von Zeit zu Zeit kamen und in sie hineinkrochen – nun ja, das war der Preis, den man zahlte.
Den man wofür zahlte?, fragte ihr Herz.
Den man zahlte, um zu leben, antwortete ihre Seele.
Morgens wachte sie auf und Mr. B war fort. Sie schloss die Augen und fuhr mit den Fingern die Worte nach, die sie tief in die Wände geritzt hatte, hielt dann inne und tastete nach der Spalte zwischen ihren Beinen. Sie hielt den Riss fest und fing an zu weinen, ganz heftig und ganz allein.
Schneemädchen blieb eine ganze Weile in der Höhle. Die mochte irgendwann einmal eine Art Keller gewesen sein, aber nun war es eine Höhle. Sie war klein und perfekt und dunkel.
Sie lernte, dass es so etwas wie Zeit gar nicht gab. Es gab nur Schnee. Der fiel leise über ihr herab, manchmal leichter und mit Frühlingsregen vermischt, manchmal dicht und schwer, aber früher oder später war er immer wieder da.
In der Dunkelheit, in die nur wenig Licht drang, berührte sie die Lehmwände, streckte die Hände aus, so hoch sie konnte, fühlte die Knoten und Knollen feuchter Wurzeln, roch ihren seltsamen, primitiven Duft. Sie stellte sich auf das Schlafbrett und versuchte, die Holzlatten der Falltür über ihrem Kopf zu erreichen, aber die Bretter schwebten gerade außerhalb ihrer Reichweite.
Oft war sie einsam und weinte. Sie machte sich klein auf dem Lager, hielt ihre Knie umfasst, schaukelte vor und zurück – wie ein Baby im Innern seiner Mutter. Sie riss ein Stück Holz vom Schlafbrett und tastete sich mit den Händen über das Erdreich, ritzte Wörter in die Wände. Sie grub die Buchstaben tief in den Lehm, um sich hoffentlich zu erinnern. Sie zeichnete auch ganze Bilder: Wesen aus einer anderen Welt, darunter ein Hund mit dem Namen Susie und ein großer, lieber Mann mit dem Namen Vater.
Auf den Erdboden zeichnete sie eine große Gestalt mit dem Namen Mama. Sie legte sich hinein und tat so, als würde sie ihr gehören. Sie umschlang ihren eigenen Körper und lutschte am Daumen wie ein Baby.
Wenn Mr. B zurückkehrte, hörte sie seine Schritte über sich knarren.
Jedes Mal wenn er sie besuchte, brachte er die Laterne mit, und selbst wenn die Laterne die Wände erhellte – die mit der Zeit zunehmend von Hieroglyphen ihrer Vorstellungswelt bedeckt waren –, sah er darin nichts Verkehrtes. Er betrachtete die mit Ritzzeichen übersäten Wände und lächelte, als hätte sie ihm ein Geschenk gemacht.
Vielleicht kann er nicht lesen, dachte sie. Der Gedanke bereitete ihr Vergnügen. Vielleicht wusste und konnte sie etwas, das er nicht konnte.
Nach wie vor sprach er nie ein Wort und schien sie auch nicht zu hören, wenn sie redete. Sie begriff, dass es in dieser Welt keine gesprochene Sprache gab. Alles war still.
Sie erwartete die Besuche von Mr. B, der die Laterne mitbrachte. Wenn sie mit ihm zusammen war, dann war alles in Ordnung.
Mr. B brachte ihr das Essen in einer Aluschale, die ihr ein vages Echo bescherte: Etwas Ähnliches hatte irgendwann einmal irgendjemand ein Fertiggericht genannt. Mr. B benutzte die Aluschalen immer wieder. Das wusste sie, denn da war häufig derselbe eingetrocknete Soßenrand in den Rillen.
Das Essen in der Schale war nicht das, woran sie gewöhnt war: Es war Schnee-Nahrung. Es gab eine Art fettiges Schmorgericht mit einem strengen und moschusartigen Geschmack. Die weichen Fleischbrocken schmeckten wie das Innere der Erde. Sie konnte fühlen, wie sich ihre Adern beim Essen mit Nährstoffen füllten, so als wäre sie einer der Bäume draußen, der die Milch des geschmolzenen Schnees in sich aufsog.
Nachdem sie gegessen hatte, schlief sie, tief in die Berge von Fellen gekuschelt. Und dann träumte sie auch, von Schnee und Eis und Fingern, die nach ihr griffen.
Eines Morgens war sie aufgewacht und Mr. B war neben ihr auf dem Lager gewesen. Er sprang auf, als hätte sie ihn bei irgendetwas erwischt. Sie genoss doch seine Wärme, seinen Trost. Sie hatte von einer Frau geträumt, deren Name Mama war und die sich mit einem Mädchen auf einem Sofa eingekuschelt hatte, während eines langen, schläfrigen Nachmittags, und aus dem Fernseher plärrte verschlafen eine weitere Folge Tom und Jerry.
Mr. B stand im Dunkeln da. Unter der kratzigen Decke war sie nackt. Sie erinnerte sich nicht daran, dass sie sich ausgezogen hatte. Sie wollte einen Weg finden, Mr. B zu fragen, was geschehen war. Aber sie hatte Angst, ihn wütend zu machen. Also verbarg sie ihr Gesicht in der Decke und gab vor zu schlafen.
Nach einer Weile ging er fort. Er zog die Leiter hinter sich hinauf. Sie hörte, wie er die Falltür verschloss. Die verbogene Aluschale hatte er neben ihr auf dem Boden liegen lassen. Sie leckte sie sauber und drehte sie dann um. Im schwachen Licht konnte sie die unten eingeprägten Buchstaben ausmachen: die Mahlzeit für den hungrigen Mann.