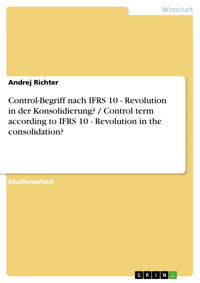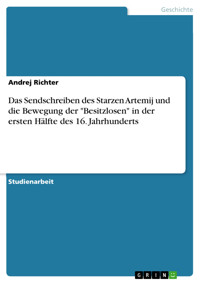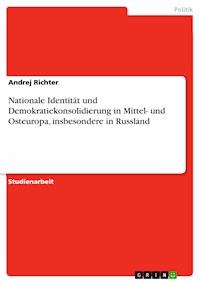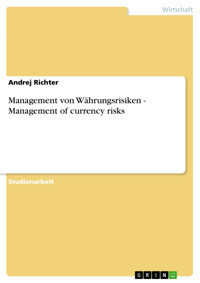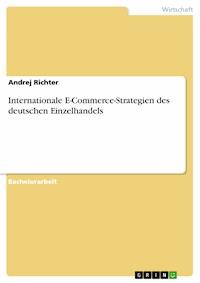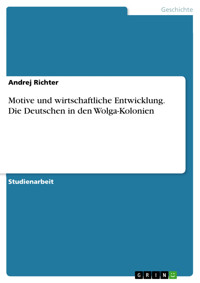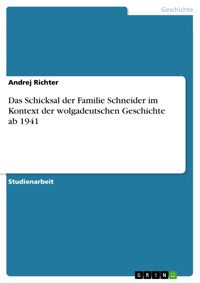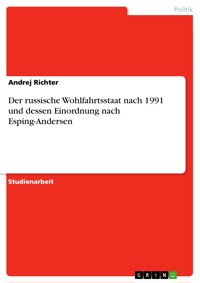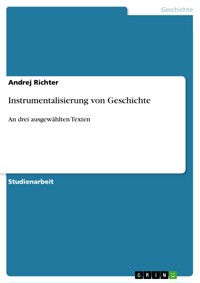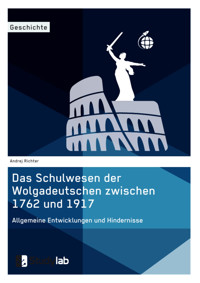
Das Schulwesen der Wolgadeutschen zwischen 1762 und 1917. Allgemeine Entwicklungen und Hindernisse E-Book
Andrej Richter
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Deutschen in Russland blicken auf eine lange Geschichte zurück. Bereits im 9. Jahrhundert sind erste vereinzelte deutsche Spuren aus der damaligen Kiever Rusʼ überliefert. Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert trafen schließlich große Gruppen deutscher Kolonisten im Russischen Reich ein. Die Deutschen verfügten dabei über kein „angestammtes Territorium, sondern lebten in verschiedenen Teilen des Landes“. Größere Fraktionen von deutschen Siedlern gab es in und um Moskau sowie St. Petersburg, in Bessarabien, in den baltischen Provinzen, im Gouvernement Voronež, im Kaukasus, im Schwarzmeergebiet, in Sibirien, in Wolhynien und in den beiden Gouvernements Samara und Saratov am rechten und linken Ufer der Wolga. Diese Arbeit befasst sich mit letzterer Gruppe, den von Katharina II. in den beiden Manifesten vom 14. Dezember 1762 und 22. Juli 1763 an die Wolga gerufenen Siedlern und damit der zahlenmäßig größten deutschen Kolonie in Russland. Dabei ist der Entstehungs- und Entwicklungsprozess des Schulwesens innerhalb der deutschen Minderheit im Wolga-Gebiet zwischen den Jahren 1762 und 1917 spezifischer Gegenstand dieser Untersuchung. Die Gestaltung des Schulunterrichts bildete seit der Einwanderung der Wolgadeutschen eine „der wichtigsten Fragen des Gemeinschaftslebens der Kolonisten“. Die Entwicklung des Schulwesens ging dabei stets „Hand in Hand“ mit dem wirtschaftlichen Fortschritt in den Siedlungen der Deutschen. Diesem Prozess wird vor dem Hintergrund des auslaufenden 18. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts mit Hilfe folgender zwei Leitfragen nachgegangen: 1. Wie ist die allgemeine Entwicklung des wolgadeutschen Schulwesens von 1762 bis 1917 zu beurteilen? 2. Welche Hindernisse bestanden für die Entwicklung der Kolonistenschulen in diesem Zeitraum?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
1.1. Themenstellung
1.2. Gang der Untersuchung und Forschungsstand
2. Die Anfänge der deutschen Ansiedlung in Russland
3. Die Europäisierung des russischen Bildungswesens in der petrinischen Zeit
4. Das bestehende russische Schulwesen im 18. Jahrhundert
5. Das wolgadeutsche Schulwesen
5.1. Besiedlung des Wolga-Gebiets durch Deutsche
5.2. Ausgangslage und schwere erste Jahre im Siedlungsgebiet um Saratov
5.3. Organisation und Aufbau der ersten Schulen durch die Kirche
5.4. Die drei wolgadeutschen Grundschultypen
5.4.1. Kirchenschulen
5.4.2. Private Gesellschafts- und Genossenschaftsschulen
5.4.3. Staatliche deutsche Zemstvo-Schulen
5.5. Die Schulmeister
5.5.1. Schwere erste Jahre
5.5.2. Feßlers Reformen
5.5.3. Kampf um Lehrerseminare
5.6. „Russifizierung“ des Schulwesens
5.7. Das katholische wolgadeutsche Schulwesen im Besonderen
6. Zusammenfassung
Bibliographie
1. Einführung
1.1. Themenstellung
Die Deutschen in Russland blicken auf eine lange Geschichte zurück. Bereits im 9. Jahrhundert sind erste vereinzelte deutsche Spuren aus der damaligen Kiever Rusʼ überliefert.[1] Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert trafen schließlich große Gruppen deutscher Kolonisten im Russischen Reich ein. Die Deutschen verfügten dabei über kein „angestammtes Territorium, sondern lebten in verschiedenen Teilen des Landes“.[2] Größere Fraktionen von deutschen Siedlern gab es in und um Moskau sowie St. Petersburg, in Bessarabien, in den baltischen Provinzen, im Gouvernement Voronež, im Kaukasus, im Schwarzmeergebiet, in Sibirien, in Wolhynien und in den beiden Gouvernements Samara und Saratov am rechten und linken Ufer der Wolga[3].
Diese Arbeit befasst sich mit letzterer Gruppe, den von Katharina II. in den beiden Manifesten vom 14. Dezember 1762 und 22. Juli 1763 an die Wolga gerufenen Siedlern und damit der zahlenmäßig größten deutschen Kolonie in Russland.[4] Dabei ist der Entstehungs- und Entwicklungsprozess des Schulwesens innerhalb der deutschen Minderheit im Wolga-Gebiet zwischen den Jahren 1762 und 1917 spezifischer Gegenstand dieser Untersuchung. Die Gestaltung des Schulunterrichts bildete seit der Einwanderung der Wolgadeutschen[5] eine „der wichtigsten Fragen des Gemeinschaftslebens der Kolonisten“.[6] Die Entwicklung des Schulwesens ging dabei stets „Hand in Hand“ mit dem wirtschaftlichen Fortschritt in den Siedlungen der Deutschen.[7] Diesem Prozess wird vor dem Hintergrund des auslaufenden 18. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts mit Hilfe folgender zwei Leitfragen nachgegangen.
1. Wie ist die allgemeine Entwicklung des wolgadeutschen Schulwesens von 1762 bis 1917 zu beurteilen?
2. Welche Hindernisse bestanden für die Entwicklung der Kolonistenschulen in diesem Zeitraum?
1.2. Gang der Untersuchung und Forschungsstand
Die Untersuchung und Analyse des wolgadeutschen Bildungswesens[8] ist von den historischen Entwicklungen der politisch-rechtlichen, soziokulturellen und ökonomischen Sphären abhängig. Aufgrund dessen wird in den ersten drei Kapiteln der geschichtliche Rahmen der wolgadeutschen Siedler knapp skizziert. Dabei werden in Kapitel 2 zunächst die Anfänge der deutschen Besiedlung in Russland dargestellt. Kapitel 3 und 4 widmen sich schließlich dem russischen Bildungswesen, um im folgenden Kapitel 5 das wolgadeutsche Schulwesen in den Kontext zu stellen. Der kurzen Beschreibung der petrinischen Europäisierungsbestrebungen im Bildungsmilieu, folgt die zusammenfassende Untersuchung des bestehenden Schulsystems in Russland zur Zeit der Ansiedlung der Deutschen an die südliche Wolgaregion. Anschließend wird zu Beginn des fünften Kapitels in 5.1. die Siedlerstruktur und das Ausmaß der wolgadeutschen Besiedlung erläutert. Aufbauend auf der Beschreibung der ökonomischen und organisatorischen Ausgangslage in Kapitel 5.2., wird in 5.3. auf den Aufbau der ersten wolgadeutschen Schulen eingegangen. Schließlich werden in Kapitel 5.4. die wichtigsten Grundschultypen vorgestellt und deren Entwicklung wiedergegeben. Kapitel 5.5. widmet sich dem Schulmeister, einer Schlüsselposition in der Entwicklung des wolgadeutschen Schulwesens. Abgeschlossen wird das fünfte Kapitel durch Untersuchungen über die „Russifizierung“ des Schulwesens an der Wolga. Abschließend gibt Kapitel 6 eine Zusammenfassung. In der gesamten Arbeit wird deskriptiv-analytisch vorgegangen.
Die Beantwortung der beiden Leitfragen erfolgt – gemäß dem bisherigen Forschungsstand – hauptsächlich anhand der Quellen und Literatur, die ausschließlich protestantische Wolga-Dörfer und ihre Schulen darstellen. Kapitel 5.7. geht kurz auf das katholische wolgadeutsche Schulwesen ein. Im Übrigen wird bewusst eine Abgrenzung zu den Mennoniten[9] und der Herrnhuter Brüdergemeinde in Sarepta[10] vorgenommen. Diese hatten nämlich spezielle Bedingungen für ihre Übersiedlung an die südliche Wolga ausgehandelt. Unter anderem deshalb entwickelten sie sich nicht nur in Bezug auf wirtschaftliche Aspekte zu „Muster-Kolonien“, sondern auch in kultureller Hinsicht und folglich im Schulwesen.[11] Aufgrund dessen können sie nicht als repräsentativ für das wolgadeutsche Bildungssystem behandelt werden.
Der Stand der Forschung zur allgemeinen Geschichte der Wolgadeutschen ist sowohl in der russischen als auch deutschen Literatur „relativ gut wiedergespiegelt“.[12] Es existieren zahlreiche Bibliographien hierzu.[13] Allerdings blieb das wolgadeutsche Geistesleben dabei „stets Stiefkind der Forschung“.[14] Bis auf die Werke von Süss[15] und Woltner[16] findet man kaum ergiebige Monographien über das Schulwesen der Wolgadeutschen. Hingegen wurde oftmals versucht die Thematik mit Aufsätzen zu umreißen. Leider dienten diese häufig nicht wissenschaftlichen, sondern politischen Interessen mit zum Teil „stark subjektiv gefärbten Anschauungen“.[17] Ein weiteres Problem liegt darin, dass der Großteil der Darstellungen des russlanddeutschen Schulwesens „stets aus protestantischer Sicht geschrieben wurde“.[18] Die katholischen Dörfer und ihre Schulen – immerhin machten sie zu Beginn rund ein Drittel der Kolonien aus – wurden in den gängigen Arbeiten nicht berücksichtigt. So ist es auch bezeichnend, dass selbst der katholische Pfarrer Beratz[19] die katholischen Siedlungen „mit Schweigen übergeht“.[20] Stricker versucht in seiner Arbeit zwar katholische Schulanstalten explizit zu berücksichtigen, maßt sich jedoch – nach eigener Aussage – keineswegs an diese große Lücke zu füllen und benennt folglich dieses Desiderat der Forschung.[21] Ansonsten finden sich bei Bonwetsch und Woltner einzelne Abschnitte, von sehr geringem Ausmaß, zum katholischen wolgadeutschen Schulwesen.[22]
Die Quellenlage hat sich seit dem Zerfall der Sowjetunion verbessert. Der eingeschränkte Zugang zu den russischen Archiven zu Zeiten des Kalten Krieges wurde weitestgehend aufgehoben. So erarbeiteten 1993 Brandes und Neutatz bereits eine Übersicht der Quellenmaterialien der Archive in Saratov und Engels (bis 1931 Pokrovsk) über die Anfänge der Wolga-Kolonien.[23] Die vorliegende Arbeit fußt auf einzelnen abgedruckten Quellenauszügen in den Arbeiten von Bauer, Bonwetsch, Klaus, Kufeld, Schmidt, Süss, Woltner und Feßlers Autobiographie.[24]
2. Die Anfänge der deutschen Ansiedlung in Russland
Die ersten deutschen Spuren in Russland reichen bis in die Zeit der Kiever Rusʼ zurück.[25] Fürstin Olʼga, die interimistisch für ihren minderjährigen Sohn Svjatoslav von 945 bis 961 regierte, richtete an Otto I. die Bitte um Entsendung geeigneter geistlicher Lehrer für die junge Kiever Christenheit. Otto I. kam diesem Gesuch nach und entsandte im Jahre 961 Adalbert aus dem Kloster St. Maximin in Trier nach Kiev.[26] Später verstand es Jaroslav der Weise (Großfürst von Kiev 1019-1054) durch wohlbedachte Heiratspolitik die Kiever Rusʼ mit den führenden Häusern Europas zu verbinden. Zwei seiner Söhne gingen Ehen mit deutschen Adeligen ein.[27] Doch nicht nur fürstliche Familien des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation widmeten dem wachsenden Reich im Osten ihre Aufmerksamkeit. Deutsche Kaufleute begannen mit der Kiever Rusʼ zunehmend Handel zu treiben: „Киев привлекал немецких купцов роскошью и обилием товаров как русского, так и восточного и византийского происхождения“.[28]
Während aus dieser Zeit der Kiever Rusʼ nur sporadische Spuren deutscher Händler überliefert sind und diese sich letztlich mit dem Einfall der Mongolen und der Zerstörung Kievs im Jahre 1240 allmählich verlieren, liefern wohlerhaltene Dokumente aus der Zeit der Novgoroder Hanse mehr Informationen über das rege Leben und Treiben deutscher Kaufleute in den Städten Nordrusslands.[29] Dort werden die Deutschen „von alters her“, das heisst seit den Anfängen der normannischen Präsenz vermutet. Wobei die meisten erhaltenen Dokumente mit zahlreichen ausführlichen Beschreibungen aus der Zeit nach 1241 stammen. Später spielten unter Ivan III. – der Große (Großfürst von Moskau 1462-1505) – und Vasilij III. (Großfürst von Moskau 1505-1533) deutsche Handwerker und Waffenschmiede im Kampf gegen das tatarische Joch und der „Sammlung der russischen Erde“ durch das Moskauer Großfürstentum eine bedeutende Rolle. In diese Zeit fällt wohl auch die Gründung der nemeckaja sloboda[30], der „Fremdenvorstadt“.[31] Diese entstand im Nordosten Moskaus am Fluss Jausa. Nach russischem Verständnis und Recht war die sloboda ein Ort, an dem sich Freie und Nicht-Orthodoxe ansiedeln durften. Wegen der Dominanz der deutschen Sprache war diese Vorstadt vorwiegend deutsch geprägt. Unter der Herrschaft Ivan IV. – der Schreckliche (Zar 1547-1584) – wurde diese gezielt mit Gelehrten, Handwerkern, Kaufleuten, Offizieren und Technikern besiedelt.[32] Es kam unter Ivan IV. Regierungszeit jedoch auch zu Versklavung zahlreicher deutscher Kriegsgefangener aus den eroberten westlichen Gebieten, die in Russland wirtschaftlich ausgebeutet wurden.[33] Matthäi sieht zusammenfassend in der Regierungszeit Ivan III. und seines Enkels Ivan IV. „die ersten ernstlichen Versuche, ausländische Kräfte nach Rußland zu ziehen, um dadurch einige Gewerbszweige zu vervollkommnen“.[34] Dabei spielte die nemeckaja sloboda eine sehr wichtige Rolle im ökonomischen und kulturellen Leben der Hauptstadt als auch des ganzen Landes.[35]
Im 17. Jahrhundert wurde schließlich Peter I. – der Große (Zar 1682-1725) – ein ständiger Besucher und Förderer der nemeckaja sloboda und seiner vorwiegend deutschstämmigen Bewohner. Peter der Große, der als „beispiellose Personifikation der regierungsseitigen Europäisierungsbestrebungen“[36] in die Geschichtsbücher eingegangen ist, ließ auf dem Boden der deutschen Vorstadt eine der ersten Manufakturen Russlands errichten, gewährte deutschen Kaufleuten gewisse Exklusivrechte im Handelsbereich und besetzte Berufsgruppen wie Mediziner, Apotheker und Offiziere, wie der brandenburgische Gesandtschaftssekretär Korn in seinem Tagebuch feststellte, mehrfach durch Deutsche.[37] Für die Anwerbung von ausländischen Fachkräften erließ Peter I. bereits am 16. April im Jahre 1702 das erste Berufungsmanifest des Zarenreiches und leitete somit erstmals offiziell die systematische Herbeiführung fremdländischer Arbeitskräfte in das russische Reich ein. Als Motiv wurde Folgendes formuliert: „[…] zum Wohl des Volkes des russischen Staates, damit unsere Untertanen mehr und besser lernen können und im Handelswesen geschickter werden.“[38] Diesem Ruf folgten vor allem Offiziere und Soldaten. So machten zu Beginn des 18. Jahrhunderts Ausländer, hier vor allem Deutsche, mehr als 50 Prozent innerhalb der Generalität und Admiralität der russischen Armee aus.[39] Ferner war in den 1730er Jahren laut Brüggen „die gesamte Staatsleitung in den deutschen Händen“.[40] In der Regierungszeit von Anna Ivanovna (Zarin 1730-1740) und Elisavet Petrovna (Zarin 1741-1762) wurde die Anwerbung von Ausländern in das Russische Reich fortgesetzt und schließlich auch der Versuch unternommen die südlichen Wolga-Gebiete mit Hilfe von Kolonisten zu besiedeln, jedoch vorerst ohne bleibenden Erfolg.[41] Insgesamt beinhaltete das russische Gesetzbuch der Jahre 1701 bis 1750 32 Gesetze, die Ausländer betrafen und 22 Erlasse des Senats, die die Bestimmungen dieser Gesetze vervollständigten.[42]
3. Die Europäisierung des russischen Bildungswesens in der petrinischen Zeit
Die Europäisierungsbestrebungen insbesondere durch Peter I. hatten auch Auswirkungen auf das Bildungsmilieu des Russischen Reiches. Der Kaiser, durch die Epoche der Aufklärung beeinflusst, erkannte, dass der gesamtkulturelle Zustand des Landes von der Bildung und Erziehung seiner Bewohner abhing.[43] Peter betrachtete somit die Umgestaltung des Bildungswesens als „vorrangige Aufgabe“[44] und versuchte durch Reformen dieses an westliche Standards heranzuführen.[45] Umgekehrt „spielte Russland für Westeuropa […] die Rolle eines Versuchsgeländes für die Verbreitung aufklärerischer Gedanken mit einem fruchtbaren Nährboden für die praktische Verwirklichung aller Ideen.“[46] Hierbei kam es vor allem zwischen dem „Alten Russland“ und dem „Gelehrten Deutschland“, wie die beiden Länder von manch Ideologen bezeichnet werden, zum mannigfaltigsten kulturellem Austausch.[47]
Dabei agierten der deutsche Philosoph und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz und Peter I. als „geniale Initiatoren“ dieses Symposiums.[48] Dies ist durch den zahlreichem Schriftverkehr über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten belegt, welcher wesentlich den russischen Zaren in seinem Reformvorhaben des Bildungsmilieus beeinflusste. Leibniz regte den russischen Kaiser an die Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg zu gründen, begabte Ausländer in das Land zu holen, ein Lehrerkollegium für die Organisation der Bildung und Erziehung von Jugendlichen einzurichten und ein dreistufiges Bildungssystem mit Grund-, Mittelschulen und Universitäten zu schaffen. Die letzten beiden Punkte wurden zu den Hauptfragen der Gestaltung des russischen Bildungswesens im 18. Jahrhundert, um die gestritten und diskutiert wurde.[49]
Nach Beendigung des 20-jährigen Krieges mit Schweden setzte der Zar das Akademiekonzept nach Leibniz um und gründete im Jahre 1724 die Russische Akademie der Wissenschaften in der damaligen Hauptstadt St. Petersburg.[50] In der Folge kamen „scharenweise“[51] Wissenschaftler an die Neva, wobei von den ersten 16 angeworbenen ordentlichen Mitgliedern der Akademie zwölf Deutsche waren.[52] Sie führten in der Akademie eine Organisationsstruktur nach deutschem Vorbild ein, deren Posten, Titel und Aufteilung in Wissenschaftsgebiete beinahe bis in das 20. Jahrhundert Bestand hatte.[53] Nach Ansicht Peter I. sollte diese geschaffene Akademie die noch vorhandenen Lücken im russischen Bildungssystem schließen. Dazu sollten an der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg Wissenschaftler ausgebildet werden, um pädagogische Tätigkeit unter anderem im russischen Schulwesen ausüben zu können.[54]
Auch spielten die städtischen deutschen Schulen in Russland für das zaristische Bildungswesen eine bedeutende Rolle.[55] Stricker führt die Anfänge deutscher Schulen in den Städten Russlands bis fast an das Jahr 1600 zurück.[56] Dabei waren diese Schulen „unlösbar mit der Kirche verbunden“.[57] Eine Verquickung, die bisher in Russland zur damaligen Zeit fehlte.[58]