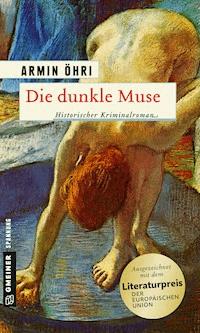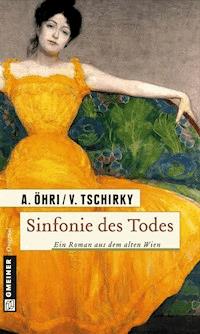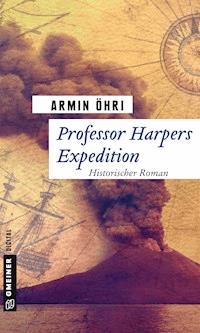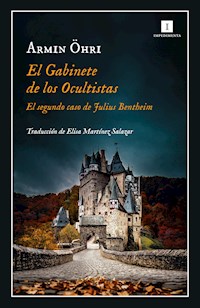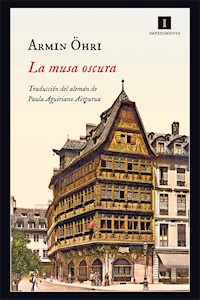Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julius Bentheim und Albrecht Krosick
- Sprache: Deutsch
Der alte Herzog von Gerolstein liegt tot in seinem Herrenhaus. Bei ihren Ermittlungen stoßen Tatortzeichner Julius Bentheim und sein Freund Albrecht Krosick auf ein Netz aus Intrigen, Mord und Gewalt. Unversehens geraten sie in den Einflussbereich einer Geheimloge und schon bald kommt es zu mysteriösen Verwicklungen mit gefährlichen Doppelagenten und zänkischen Frauenzimmern. Auch die Insassen eines Irrenasyls sowie ein verschrobener Adliger, der angeblich mit dem Teufel im Bunde steht, sorgen für Gruselspannung in der Metropole an der Spree.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armin Öhri
Das schwarze Herz
Julius Bentheim ermittelt
Zum Buch
Berlin 1868 Die preußische Polizei wird an den Tatort eines grausigen Verbrechens gerufen. Gemeinsam mit seinen beiden Polizei-Aspiranten und Freunden Julius Bentheim und Albrecht Krosick macht sich Kommissar Gideon Horlitz auf den Weg zum Herrenhaus des Herzogs von Gerolstein, das ein wenig außerhalb der Stadt gelegen ist. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf ein Netz aus Intrigen, Mord und Gewalt, und unversehens geraten sie in den Einflussbereich einer geheimen Loge. Es kommt zu mysteriösen Verwicklungen mit französischen Komponisten, gefährlichen Doppelagenten und zänkischen Frauenzimmern. Auch die Insassen eines Irrenasyls sowie ein verschrobener Adliger, dessen Bekanntschaft Julius und Albrecht bei einer Soiree machen und von dem es heißt, er habe einen Werwolf in seinem Gefolge und stehe mit dem Bösen im Bunde, sorgen für Gruselspannung in der Metropole an der Spree.
Der Liechtensteiner Schriftsteller Armin Öhri, geboren 1978, lebt in Grabs im St. Galler Rheintal. »Das schwarze Herz« ist der vierte Berlin-Krimi des Autors um seinen Protagonisten, den jungen Tatortzeichner Julius Bentheim. Armin Öhri erhielt den »European Union Prize for Literature«, seine Werke wurden mehrfach ins Ausland übersetzt. Er ist Gründer des Liechtensteinischen Literatursalons und Präsident des Liechtensteinischen Autorenverbands »IG Wort«.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lesser_Ury_-_Am_Kurfürstendamm_(1910).jpg
ISBN 978-3-8392-6786-8
Widmung
Für Saskia
Motto
In der schwindenden Dunkelheit sah er den verstümmelten Leichnam. Sein Mund klebte von geronnenem Blut.
(Guy Endore: Der Werwolf von Paris)
Vorwort
Mindestens eine Aussage in diesem Werk ist falsch.
(Albrecht Krosick)
*
Anmerkung: Dieses Werk muss mindestens eine falsche Aussage enthalten. Angenommen, es täte es nicht: In diesem Fall ist das Vorwort wahr, wenn es falsch ist, und falsch, wenn es wahr ist. – Was eigentlich unmöglich ist.
(Professor Alfredo Casanelli, Inhaber des Lehrstuhls für Logik an der Università degli studi di Bologna; 17. Mai 1869)
Erstes Kapitel
Der Tatort, das altehrwürdige Anwesen des Herzogs von Gerolstein, lag etwas mehr als eine Meile vor der Berliner Stadtgrenze. Hier, im Dorf Weißensee, kam der Fernhandelsweg nach Norden durch, und rings um das beinah zirkelrunde Stillgewässer, das dem Dorf seinen Namen gegeben hatte, fügten sich Gutshäuser und großzügig angelegte Gartenanlagen in die Uferlandschaft.
Weit ausladende Bäume säumten die holprige Straße, als Julius Bentheim und Albrecht Krosick – Tatortzeichner der eine, Polizeifotograf der andere – mit ihrem Freund und Vorgesetzten Kriminalkommissar Gideon Horlitz, jenem bekannten und in Fachkreisen als äußerst bibliophil geltenden Homme de Lettres, in einem Landauer vorfuhren. Das mysteriöse Ableben des Hausherrn und die damit verbundene Aufnahme einer gerichtlichen Untersuchung verlangten die Anwesenheit der drei Herren aus dem Stadtpalais Grumbkow, dem Berliner Polizeipräsidium. So traurig der Anlass ihres Kommens auch sein mochte – Arbeit war Arbeit, und in diesem speziellen Fall waren besonders die beiden jungen Polizeiaspiranten begierig darauf, die Hinterlassenschaft des exzentrischen Herzogs persönlich in Augenschein zu nehmen, zumal sich hartnäckig das Gerücht hielt, der Verblichene habe sich zu Lebzeiten der Alchemie und den dunklen Wissenschaften verschrieben.
Julius Bentheim dachte sich sein Teil bei diesen Ammenmärchen. Rücklings aus der Kutsche steigend, den Blick über die Schultern nach hinten gerichtet, ließ er bereits das Auge schweifen, um das Ziel ihres Ausflugs zu betrachten: Ein mächtiges Gemäuer in Form von gestapelten Steinbruchscherben und lokalen Findlingen umgab das Grundstück. Weit in die Höhe geschossene, dichte Trauerweiden vermochten es, dem zufällig vorbeikommenden Wanderer tief und nachhaltig ins Bewusstsein zu dringen, wo sie unweigerlich einen melancholischen Eindruck hinterließen.
Kaum hatten die Neuankömmlinge das schmiedeeiserne Zufahrtstor durchschritten, als sie auch schon das imposante Herrschaftshaus erblickten. Vor ihnen thronte es auf einer Anhöhe, hinter der das spiegelglatte Wasser des Weißen Sees zu erahnen war. Das Gebäude hinterließ bei Julius einen doppelten Effekt. Einerseits beeindruckten ihn die Größe, die Ausmaße und der Protz mit all seinen Verzierungen; andererseits wirkte es zu überladen für seinen Geschmack. Überall reckten sich stolze Giebel zum Himmel empor, die Fassade war teilweise neoklassizistischen Ursprungs, an manchen Stellen aber brach ein Überbleibsel gotischer Baukunst hervor. Groteske, wild blickende Statuen von Dämonen und Teufeln prägten das Bild.
Unheil verkündende dunkle Wolken lagen über dem Anwesen. Ein kalter und zugleich rauer Wind fegte über ihre Köpfe hinweg, als Horlitz, Krosick und Bentheim endlich vor dem Hauptportal standen und an der Klingel zogen.
Es vergingen zwei Minuten, bis sie ein schlurfendes Geräusch vernahmen. Mit einem Krächzen öffnete sich die Tür, und die Ermittler blickten in das gestrenge Gesicht eines älteren Mannes, der eine schäbige Livree trug und einen goldenen Kerzenständer in der Hand hielt.
»Die Herren wünschen?«
Bentheim sah sich den Diener genauer an. Seine knochigen Wangen und die hohe Stirn erinnerten an einen Asketen, und im Kerzenschimmer besaßen die geriatrischen Zuckungen, die in unregelmäßigen Abständen seine Handbewegungen zu befallen schienen, ein eindringliches, wenn auch komisches Flair.
»Darf ich Ihnen unsere Karte geben?«, sprach ihn Horlitz höflich an, sowie sie über die Schwelle getreten waren. Besagte Visitenkarte mit einer auffällig barschen Bewegung an sich reißend, starrte der Livrierte sie mit zusammengekniffenen Augen an.
»Noch mehr Polizisten?« Es war eher eine Feststellung denn eine Frage. Der alte Mann drehte sich um, tief aufseufzend, und winkte mit der Hand. »Folgen Sie mir, meine Herren! Bitte, so kommen Sie doch.«
Krosick und Bentheim, die hinter Horlitz in der Eingangshalle standen, nickten sich einvernehmlich zu, bevor sie wieder nach ihren Gepäckstücken griffen und zum Diener aufschlossen. Der Boden, über den sie Albrechts Kamera und seine weiteren Fotoutensilien schleiften, bestand aus rohen Pflastersteinen. An den Wänden prangten Bilder barocker Meister: schwere, düstere Ölgemälde. Von der mit Stuckwerk verzierten Decke hingen goldene Kandelaber herab, wodurch Julius erst auffiel, dass an keinem einzigen Ort Petroleumlampen brannten. Einzig das Flackern der Kerzen warf verzerrte Schatten an die Wände, und das wilde Pfeifen des aufkommenden Sturms, das von draußen hereindrang, ließ den Tatortzeichner erschaudern. Es war eine gespenstische Atmosphäre, und so war es nicht weiter verwunderlich, dass just in diesem Haus ein Mord geschehen war.
Der Diener führte die neu eingetroffenen Gäste in die oberen Stockwerke, vorbei an ausgestopften Tieren – Wölfe, Bären, einige Adler –, blank gereinigten Ritterrüstungen und anderem Trödel. Der ganze Ort war eine Ansammlung seltener Kuriositäten, wobei Bentheim gewillt war, sogar den seltsamen Diener dem Inventar zuzuordnen.
Sie betraten den Schauplatz des Verbrechens durch eine robuste, mit Messing beschlagene Eichentür. Vom Fenster des Zimmers, das sich zu einem Innenhof hin öffnen ließ, blickte ihnen das geistlose Mondgesicht eines jungen Polizisten entgegen; ein weiterer Gendarm führte sie in den Raum, in dem der Mord begangen worden war. Insbesondere den Kommissar begrüßte der Mann herzlich.
»Gut, dass Sie es sich einrichten konnten«, meinte er gemütvoll, wobei seine Miene dunkel wie eine Gewitterwolke war. »Wir haben nichts angerührt, Herr Kommissar. Alles ist noch so, wie wir es vorgefunden haben.«
Gideon Horlitz nickte dem Polizisten dankbar zu und fuhr sich mit der Rechten durch die grau melierten Haare. Mit gespanntem Interesse beobachtete Julius Bentheim seinen Freund und Mentor, wie dieser gedankenverloren vor sich hin starrte. Horlitz, 56 Jahre alt und mit Hang zum Bäuchlein, war ein Experte auf dem Gebiet der Kriminalistik. Nach 15 langen Jahren als Obristwachtmeister in einem Dragonerregiment war er in den Polizeidienst gewechselt. 1848 war er an der Auflösung der Preußischen Nationalversammlung durch die Armee beteiligt gewesen; ein Umstand, viel zu peinlich, um ihn je zu erwähnen – und Julius schien es, als verrenne sich der Kommissar bisweilen in seinen Fällen, bloß um diese Scharte in seinem Lebenslauf auszuwetzen.
Dieses Sich-in-etwas-Hineinsteigern war vor Monaten zur Obsession geworden. Silvester vor zwei Jahren hatte der Kommissar seinen Schützlingen den Vorschlag gemacht, den Jahreswechsel an seiner statt in der Märkischen Schweiz zu feiern. Er selbst könne beruflich nicht weg, und Clara, seine Gattin, wolle nicht allein verreisen. Was ungesagt blieb und Albrecht und Julius damals nicht wussten: Clara Horlitz lag im Sterben. Je mehr der Krebs in ihr wucherte, desto tiefer versenkte sich ihr Mann in die Arbeit.
Da stand er also neben Bentheim, die Stirn in Falten gelegt. Sein Blick schweifte durchs Zimmer, während ein unverständliches Murmeln über seine Lippen drang. Währenddessen ließ Albrecht Krosick den Kommissar und seinen Freund stehen und durchschritt zweimal den Raum, um sich auf eigene Faust ein Bild von dem grausamen Verbrechen zu machen. Das Zimmer war so kurios wie die anderen Räume in diesem seltsamen Haus, die sie später noch zu Gesicht bekommen sollten. An den Wänden hingen flämische Grafiken und Stiche, ein präparierter Luchs starrte Krosick mit seinen glasigen Murmelaugen entgegen, auf einer überdimensionierten Schreibtischplatte lagen eine Aktenmappe und ein Stapel loser Blätter – unbezahlte Rechnungen, Korrespondenz sowie die aktuelle Ausgabe von Eugenie Marlitts Goldelse. In einer Ecke befand sich eine wuchtige, jedoch wurmstichige Standuhr. Genau gegenüber in der Wand klaffte das Loch eines geöffneten Wandsafes.
Vor dem Schreibtisch stand eine klobige Kleidertruhe auf dem Parkettfußboden, der aus lauter auf Hochglanz polierten Polygonen zusammengesetzt war. Der Fotograf ging um den Tisch und erblickte zu seinen Füßen den Toten.
Der Mann lag ausgestreckt auf dem kahlen Boden, neben ihm ein umgekippter Bürostuhl. Um den Kopf hatte sich eine dunkle Lache ausgebreitet. Das Blut war bereits geronnen. Albrecht ging in die Knie, um die Leiche genauer anzusehen. Was er da im flackernden Kerzenschein erblickte, erschreckte ihn: unmöglich, das Gesicht des Mannes zu erkennen. Der Mörder hatte ganze Arbeit geleistet, denn sein tödlicher Schuss hatte den Kopf in seiner Gänze zerfetzt. Es war undenkbar, auch nur annähernd zu sagen, wie der Tote zu Lebzeiten ausgesehen haben mochte, und unwillkürlich erfasste den Fotografen ein Schaudern. Er wollte eben wieder aufstehen, als ihm ein seltsamer Umstand ins Auge fiel: Der Tote trug Handschuhe.
Plötzlich verspürte der Fotograf einen Druck auf seine Schulter.
»Na, Albrecht, haben Sie ebenfalls die Handschuhe bemerkt?« Wie eine Salzsäule stand Gideon Horlitz hinter ihm und deutete auf die Leiche. »Seltsam, nicht wahr?«, meinte er vielsagend. »Weshalb trägt der Herzog Handschuhe? Vielleicht hat es nichts zu bedeuten, womöglich aber auch alles. Dies ist eine Frage, der wir nachgehen müssen, meine Herren. Vorerst jedoch: Widmen Sie sich Ihrer Arbeit. Julius, hier! Zeichnen Sie! Und Sie, Albrecht, ich will Fotos von der Leiche, von dem Safe, von der Standuhr, einfach von allem.«
Horlitz lächelte verschwörerisch. Dann drehte er sich um, ging auf einen der Polizisten zu und bat diesen, den Sachverhalt des Verbrechens zu erklären. Unverzüglich begann der junge Mann mit dem Bericht. Der Hausdiener, so der Beamte, habe am frühen Morgen ein Telegramm zum Molkenmarkt an die Mordkommission geschickt, auf dem Anwesen derer von Gerolstein sei ein Verbrechen verübt worden; der ehrwürdige Herzog Rudolf sei einem schändlichem Raubmord zum Opfer gefallen. Und tatsächlich deute die Indizienlage auf diese Version hin. Der Hausherr sei tot, sein Tresor ausgeraubt, und in einem Zimmer der unteren Etage sei ein Fenster eingedrückt worden.
»Hat der Diener kein Geräusch gehört?«, fragte Horlitz leicht irritiert.
»Er gab zu Protokoll, er habe ungefähr um Viertel vor drei einen dumpfen Laut vernommen, sich aber nichts dabei gedacht und weitergeschlafen.«
Für einen kurzen Moment äugte Gideon Horlitz in Richtung der Standuhr, murmelte wieder Unverständliches in seinen Bart und schritt noch einmal quer durch den Raum. Julius Bentheim, bereits damit beschäftigt, für die Tatortskizzen vor seinem geistigen Auge ein Gitternetz über dem Boden auszubreiten, trat ihm widerwillig aus dem Weg.
Hin und wieder bückte sich der Kommissar, um etwas genauer zu betrachten. Alles saugte er detailgetreu in sich auf, jedes einzelne Staubkorn fixierte er angestrengt, doch schielte er immer wieder zur Uhr hinüber und verzog das Gesicht zu einem spitzbübischen Grinsen.
Krosick und Bentheim wussten, dass ihr Freund in diesen Phasen angestrengten Nachdenkens nicht gestört werden wollte, und so ließen sie es auch bleiben, ihn über das ominöse Geheimnis der Uhr zu befragen. Der Tatortzeichner holte ein Etui mit diversen Stiften hervor, während sich Albrecht daranmachte, sich mit ganz praktischen Fragen der Tatortfotografie auseinanderzusetzen: Wohin mit dem Stativ? Welche Perspektive sollte er wählen? Welcher Blendenwert war in diesem schlecht ausgeleuchteten Zimmer geeignet, und welche Verschlusszeiten sollte er einhalten?
Mit geübten Handgriffen spitzte Julius einen Grafitstift nach dem anderen an, wobei er sein Augenmerk unentwegt auf das Zifferblatt der Standuhr richtete. Doch konnte er nichts Außergewöhnliches bemerken: Die beiden Zeiger zeigten auf die Neun und auf die Drei, die Sekundenangabe betrug etwa 50 Sekunden. Erst bei genauerem Hinsehen fiel ihm auf, dass auf dem Boden vor der Uhr einige Scherben lagen. Das war aber auch schon das einzig Seltsame.
Gideon Horlitz schien mehr gesehen zu haben als der Tatortzeichner. Enttäuscht über die eigene Unfähigkeit, die Indizien zu deuten, wandte sich Julius einem der beiden Polizisten zu, um wenigstens etwas Verwertbares über den Toten zu erfahren. Der Kriminalkommissar klopfte inzwischen die Wände ab, kroch auf allen vieren auf dem Boden umher und gebärdete sich so schrullig und eigenartig, dass die beiden Gendarmen ihn ratlos anschauten. Julius zuckte gelassen mit den Schultern. Bei Gideon musste man auf alles gefasst sein.
Etliche Minuten später trat der Kommissar fröhlich gelaunt an Bentheims Seite: »Julius, Albrecht! Kommen Sie Ihren Pflichten nach. Ich habe alles gesehen, was es zu sehen gibt, und bin Ihnen sehr verbunden, meine Herren.«
»Aber«, entgegnete der Tatortzeichner, »Sie haben den Toten ja noch gar nicht genauer begutachtet.«
»Das ist vorerst auch wirklich nicht nötig«, antwortete Gideon jovial. »Was mich antreibt, ist erst einmal die Lust auf ein paar Buletten, später dann vielleicht noch eine Berliner Weiße!«
Und so ließ der Kriminalkommissar seine beiden Polizeiadepten verdutzt am Tatort zurück.
Zweites Kapitel
Einige Stunden später, es ging schon auf neun Uhr zu, erreichten Bentheim und Krosick – bis auf die Knochen durchgefroren – das Revier am Molkenmarkt, wo sich das Polizeipräsidium und die Stadtvogtei gemeinsam im ehemaligen Palais des Oberfeldmarschalls von Grumbkow befanden. Gleich daneben, im früheren Palais des Grafen von Schwerin, hatte seit 1771 das Kriminalgericht seinen Sitz genommen. Der gesamte Gebäudekomplex galt wegen der oft willkürlich ausgeübten Polizeigewalt als Ort des Schreckens. Als die beiden jungen Männer jedoch an diesem Novembertag des Jahres 1868 in Gideons Büro saßen, war davon nichts zu spüren. Albrecht hatte seine Fotos bereits entwickelt und die Abzüge abgegeben, Julius deponierte die Tatortzeichnungen auf dem Bürotisch. Ihnen beiden war es ein Anliegen, in Gideons Gegenwart die vergangene Nacht noch einmal Revue passieren zu lassen. Auf der Tischplatte standen drei heiße, dampfende Tassen Lindenblütentee, und allmählich erfüllte ein aromatischer Geruch den Raum.
Der Kommissar führte das Getränk an die Nase und inhalierte kurz. Zufrieden seufzend stellte er die Tasse, ohne aus ihr getrunken zu haben, zurück auf den Tisch.
»Wie finden wir den Mörder?«, fragte Julius beiläufig, worauf ihn Horlitz mit hochgezogenen Augenbrauen spöttisch anstarrte.
»Sie meinen eher: Was war das Motiv des Mörders?«
Bentheim, der nicht verstand, worauf der Beamte hinauswollte, erklärte sich: »Ich frage mich lediglich, welche unsere nächsten Schritte sein werden.«
»Denken Sie logisch, mein lieber Julius! Glauben Sie denn wirklich, ein dreister Räuber hätte sich auf das weitläufige Gelände des Anwesens geschlichen, wäre dort eingebrochen, hätte auf Anhieb das Zimmer mit dem Safe gefunden, diesen geöffnet und wäre schließlich morgens um drei auf den Hausherrn gestoßen, der sich dann – rein zufällig natürlich – angezogen mit Hemd und Krawatte von dem bösen Buben erschießen lässt? Das klingt ziemlich überdreht. Und nebenbei ist es albern. Nein, Julius, denken Sie logisch! Wir sind hier nicht in einem Ihrer heiß geliebten Kolportageromane.«
Bohrend blickte ihm Horlitz in die Augen. Als von dem Tatortzeichner keine Antwort kam, meinte er vorwurfsvoll: »Es ist doch sonnenklar, dass uns der Hausdiener belogen hat. Ist Ihnen das nicht aufgefallen?«
Bentheim schüttelte den Kopf, und mechanisch massierte er sich die linke Hand, deren Ringfinger und kleiner Finger er in Königgrätz auf dem Schlachtfeld eingebüßt hatte.
Zu seiner Verwunderung nickte Albrecht Krosick. Wenngleich Julius wusste, dass das kriminalistische Gespür seines Freundes sein eigenes bisweilen übertraf, war er doch gespannt auf dessen Ausführungen; jene Ausgeburten der Hirnwindungen, die Bentheims deduktives Denken in den Schatten stellten. Stets war er aufs Neue überrascht, wenn er erleben durfte, wie sein Freund skurrile Aspekte schier unlösbarer Kriminalfälle enträtselte. So war es beim Fall der Dunklen Muse gewesen, bei den seltsamen Vorgängen um den Bund der Okkultisten oder bei der geheimnisvollen Dame im Schatten. Und so war es auch diesmal. Inzwischen waren sie auch keine Studenten mehr, seit sie im Frühjahr ihre Jus-Prüfungen bestanden hatten, sondern Aspiranten für den Polizeidienst.
»Nun gut, Julius, geliebter Freund und Zechbruder«, begann Albrecht ausgelassen. »Laut Aussage des Hausdieners war um Viertel vor drei ein dumpfes Geräusch zu vernehmen: allem Anschein nach der Mörder, der sich Zutritt ins Haus verschafft hatte. Jetzt zeigt aber die Standuhr im Zimmer, wo die Tat geschehen ist, ebendiese Zeit an. Ein Zeiger ist auf der Neun, ein anderer auf der Drei.«
»Was beweist, dass der Diener recht hat«, warf Bentheim ein.
Krosick schüttelte missbilligend den Kopf.
»Es wäre ein überaus großer Zufall, wenn die Uhr just zu jener Zeit stehen geblieben wäre, als der Mörder ins Haus gekommen war. Hast du nicht die Glasscherben auf dem Boden bemerkt?«
»Doch.«
»Natürlich. Dumme Frage – du musstest sie ja zeichnen. Also ist dir aufgefallen, dass die Uhr exakt dem Tresor gegenüber steht.«
Erneut nickte der Tatortzeichner.
»Und du hast sicherlich bemerkt, dass der Safe gewaltsam geöffnet wurde.«
»Ja, es wurden einige Kugeln auf ihn abgefeuert.«
»Dann darf ich dir somit die Lösung des Rätsels präsentieren?«
Bentheim rollte die Augen. »Nur zu.«
»Nun gut«, begann Krosick in der für ihn typischen, leicht nervigen Art, anderen gegenüber aufzutrumpfen. »Der Eindringling steht also vor dem Safe und versucht, ihn zu öffnen. Er zieht die Pistole, zielt auf den metallenen Kasten und drückt einige Male ab, weshalb der Tresor fünf Dellen aufweist. Auf dem Boden davor haben die Polizisten denn auch fünf Patronenhülsen, jedoch nur vier Projektile gefunden. Irgendwo, Kollege Julius, muss also noch eine weitere Kugel sein.«
Bentheim pfiff anerkennend.
Der Tatortfotograf fuhr fort: »Ein Schuss wurde also reflektiert, schwirrte ziellos durch den Raum und traf – zufällig – das Zifferblatt der Standuhr genau in seiner Mitte. Die gläserne Einfassung zersplitterte, womit wir auch die vielen Scherben am Boden erklären können. Die Kugel aber fuhr durch das Uhrwerk und brachte die Uhr zum Stehen. Ich habe mir das Gehäuse etwas genauer angesehen, Julius. Die beiden Zeiger wurden durch den Eintritt der Kugel zwar blockiert, doch müssen sie sich in diesem blockierten Zustand noch kurz gedreht haben.«
»Wie das?«, fragte Julius verblüfft. »Die Uhr zeigte doch Viertel vor drei, wie es der Hausdiener zu Protokoll gegeben hat.«
Nun war es Horlitz, der mit wissender Miene lächelte. »Die Uhr zeigte etwas in der Nähe von Viertel vor drei, denn um diese Uhrzeit können die Zeiger keine gerade Linie bilden und gleichzeitig auf der Neun und der Drei stehen. Das ist nicht möglich.«
Julius zog seine Mercier, die ihm einst ein Onkel vermacht hatte, aus der Westentasche und blickte prüfend auf das Zifferblatt. Mit wenigen Handgriffen drehte er die Rädchen der Zeigerjustierung. Allmählich dämmerte ihm, worauf seine Freunde hinauswollten.
»Verstehen Sie nun, was ich meine?«, fragte der Kommissar mit siegesgewisser Gelassenheit.
»Es war also gar nicht Viertel vor drei«, stellte Julius fest. »Aber wie spät war es dann tatsächlich?«
»Geben Sie mir Ihre Uhr!«, bat ihn Horlitz.
Bentheim löste die Mercier von ihrer Kette, um sie dem Kommissar zu reichen. Dieser griff nach ihr und verstellte die Zeiger, bis sie genau zwölf Uhr anzeigten.
»Sehen Sie, Julius«, erklärte er, »ich bewege jetzt langsam die beiden Zeiger. Sehen Sie es? Erst jetzt, etwa 32 Minuten nach zwölf Uhr zeigen die beiden Zeiger in die entgegengesetzten Richtungen. Und wenn ich weiterdrehe, so geschieht dies immer in einem Abstand von einer Stunde und ungefähr sechs Minuten.«
Aufgeregt hielt er Julius die Uhr vors Gesicht.
»Genau genommen zeigen der Minuten- und der Stundenzeiger um null Uhr 32 und acht Elftel Minuten zum ersten Mal in die total entgegengesetzte Richtung. Noch in dieser Nacht, als Sie beide am Tatort beschäftigt waren, habe ich es ausgerechnet. Darauf immer wieder im genauen Abstand von einer Stunde und fünf Minuten und fünf Elftel einer Minute, also ungefähr 27 Sekunden.«
Bentheim hatte verstanden.
Horlitz ereiferte sich weiter: »Haben Sie den Stand des Sekundenanzeigers an der Wanduhr betrachtet, Julius? Ja? Haben Sie das getan? Die Uhr zeigte ungefähr 50 Sekunden oder vielleicht auch 51 an. Mathematisch gesehen müsste der präzise Zeitpunkt jedoch bei 49 Sekunden plus eine Elftel-Sekunde gelegen haben. Das wiederum beweist, dass der Mord gar nicht morgens um drei stattfand, sondern schon viel früher. Das Uhrwerk ist mechanisch, die 50 war bereits erreicht. Die exakte Tatzeit lässt sich anhand des Sekundenzeigers auch leicht berechnen. Auf den Tresor wurde genau um 21 Minuten und 49 Sekunden nach zehn Uhr geschossen! Der Mord muss kurz zuvor geschehen sein. Quod erat demonstrandum!«
Bentheim blieb die Luft weg. Zumindest theoretisch musste er sich eingestehen, dass die eben gehörte Schlussfolgerung plausibel war. Dennoch kam er nicht umhin, den Advocatus Diaboli zu spielen und wenigstens zwei oder drei Punkte anzumerken.
»Angenommen, die Zeiger haben sich gedreht«, warf er ein, »und angenommen, die Uhr ist einfach früher schon stehen geblieben – sagen wir mal: vor zwei Tagen oder vor einer Woche, was weiß ich?«
»Ihre Skepsis ehrt Sie«, entgegnete Horlitz. »Rein mathematisch gesehen müssen wir diese Varianten ausschließen, da ansonsten eine Rechnung oder auch eine Kalkulation der Wahrscheinlichkeit, oder wie immer man das auch nennen mag, vollends überflüssig wäre.«
Dem Tatortzeichner schwirrte der Kopf.
Was, wenn die Uhr gar nicht exakt lief? Oder wenn sie bereits vorher falsch justiert gewesen war? Wenn sie vor- oder nachging? Er wollte zu einer zweiten Entgegnung ansetzen, als der Kommissar, der seine Gedanken zu lesen schien, abwehrend die Hand hob und mit gutmütiger Stimme sprach: »Lassen Sie das, Julius! Es ist alles eine Frage der deduktiven Logik. Warten wir doch einfach ab, wie sich die Sache entwickelt. Alles andere wäre müßig.«
Gedankenverloren lehnte sich Julius Bentheim in seinem Sessel zurück. Wenn der Hausdiener sie über den Zeitpunkt des Mordes belogen hatte, so stellte sich unausweichlich die Frage, welchen Nutzen er sich davon erhoffte.
»Wir haben also den Mörder gefunden«, sagte Bentheim mehr zu sich selbst, als ihn Horlitz auch schon unterbrach.
»Sehen Sie die Sache nicht so engstirnig, Julius. Die Tatsache, dass der Diener uns falsch informiert hat, beweist noch lange nicht, dass er auch der Täter ist.«
Empört hob Julius den Kopf. »Nun hören Sie doch! Der reiche Herzog wird ermordet. Keiner der Nachbarn will etwas gehört oder gesehen haben. Und schließlich belügt uns der kauzige Diener auch noch offensichtlich. Da muss man doch nur eins und eins zusammenzählen, um auf die Lösung zu kommen. Der Kerl gehört ins Gefängnis!«
»Nicht so ungestüm, junger Freund«, besänftigte der Kommissar das aufbrausende Naturell seines Tatortzeichners. »Die Dinge sind meistens nicht so, wie sie zu sein scheinen. Zugegeben, alles spricht gegen den Diener. Doch haben Sie nicht seine zitternden Handbewegungen gesehen? Glauben Sie wirklich, dieser schwache, wahrscheinlich von der Schüttellähmung befallene Mann hätte den Safe mit wohlplatzierten Schüssen öffnen können? Ich bin überzeugt, dass dieser alte Herr nie dazu imstande gewesen wäre, die Pistole auch nur annähernd gerade zu halten. Nein, Julius, der Diener ist nicht der Täter.«
»Aber weshalb sollte er den tatsächlichen Mörder decken?«
»Eben das herauszufinden, wird unsere nächste Aufgabe sein«, meinte Horlitz, wobei in seiner Stimme ein enthusiastischer Unterton mitklang, der stets zu hören war, sobald sein Spürsinn geweckt oder zumindest gereizt worden war. Er sah zur Bürodecke hoch und schwelgte für kurze Zeit in Gedanken, bevor er sich brüsk an Bentheim wandte und mahnend sprach: »Überlegen Sie das nächste Mal, bevor Sie jemanden verdächtigen. Ich mag Ihnen ein warnendes Beispiel anführen, wenn Sie gestatten?«
Bentheim seufzte geschlagen, während der Kommissar, den diese ostentative Missbilligung überhaupt nicht störte, fröhlich zu seinen Ausführungen ansetzte: »Einer meiner ersten Fälle drehte sich um die Entführungsaffäre Schadow«, erzählte er im Plauderton. »Sie haben den Namen vermutlich schon einmal gehört. Emil Schadow. Ein angesehener Mann aus der Oberschicht. Preußischer Junker, wie er im Buche steht. Dieser Schadow also wurde eines Tages auf offener Straße verschleppt – direkt vor dem Haupteingang zum Zoologischen Garten. Ein Einzeltäter hielt den Junker mehrere Tage gefangen, ohne dass es der Gendarmerie gelang, dem Kriminellen auf die Spur zu kommen. Der Entführte saß die ganze Zeit mit verbundenen Augen auf einem Stuhl. Niemals bekam er seinen Peiniger zu Gesicht. Man gab ihm zwar zu essen, doch sein Sitzfleisch wurde arg strapaziert, wie Sie sich leicht vorstellen können. Als der Entführer ein hohes Lösegeld forderte und dieses von der Familie des Opfers auch überreicht bekam, erhielten wir eine Nachricht, wo Schadow aufzuspüren war. Wir fanden ihn schließlich gefesselt und geknebelt in einem verlassenen Lagerhaus in der Gartenstraße vor dem Hamburger Tor. Damals war das noch eine übel beleumdete Gegend, voll mit Ganoven, Huren und zugezogenen Arbeitern. Wenige Tage später verhafteten unsere Leute einen einschlägig vorbestraften Halunken, der zu den üblichen Verdächtigen gehörte. Immer wieder war der Mann durch Einbrüche und Gewalttaten aufgefallen und besaß für die Tatzeit überdies kein hieb- und stichfestes Alibi. Eine klare Sache, dachten sich die Leute von der Ermittlung und wollten die Affäre schon ad acta legen. Zum Glück des Delinquenten war ich bei einem der Verhöre anwesend, woraufhin er aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Wissen Sie auch, wieso?«
Unisono verneinten Bentheim und Krosick.
»Weil ich den Mann mit einem Seil einen Knoten machen ließ.«
»Einen Knoten?«, wiederholte Albrecht verblüfft. »Ich glaube, ich verstehe nicht ganz.«
»Der Mann war sichtlich nervös. Natürlich. Das ganze Verhör hindurch fuhr er sich mit der linken Hand durch die Haare oder kratzte sich an der Nase. Das brachte mich auf eine Idee. Ich gab dem Strolch ein Seil und befahl ihm, einen Knoten zu machen. Das Ergebnis war der Knoten eines Linkshänders. Die Schlingen und Verknüpfungen jedoch, mit denen das Opfer gefesselt gewesen war, waren die Knoten eines Rechtshänders gewesen. Der Verdächtige konnte unmöglich der Entführer sein. Wir mussten den Mann also laufen lassen. Der Teufel liegt im Detail. Ich hoffe, Sie haben etwas aus dieser Anekdote gelernt, meine Herren.«
So sprach er und setzte endlich die Tasse Tee an die Lippen.
Drittes Kapitel
Am Abend dieses denkwürdigen Tages sahen sich Albrecht und Julius bemüßigt, den Mordfall für einige Zeit Mordfall sein zu lassen und in die schillernde Welt der preußischen Gesellschaft einzutauchen. Die Markgräfin Dorothea von Sternau, eine ebenso vermögende wie schrullige alte Jungfer, hatte die Schönen und Reichen zu einer Soiree auf ihren Landsitz geladen. Anlass zur Feier gab der Geburtstag ihrer Schoßhündchen, zweier kleiner und verwöhnter Promenadenmischungen, welche die ehrenwerte Dame vor einigen Jahren beim Prenzlauer Tor aufgelesen hatte. So exzentrisch und verschroben der Grund für dieses fröhliche Beisammensein auch war – den beiden Freunden war es einerlei; sie nutzten die Gunst der Stunde, um Beziehungen zum Hochadel zu knüpfen.
Die Huld ihres Besuches in diesem ausgewählten Zirkel lag in einem äußerst delikaten Fall begründet, den Julius und Albrecht einst mit Bravour und zur völligen Zufriedenheit der alten Gräfin gelöst hatten: Sternaus Liebesbriefe waren verschwunden gewesen. Diener und Hausgesinde wurden verdächtigt. Die adlige Herrin beschuldigte Sekretäre und Köche, Diebe der verfänglichen Korrespondenz zu sein. Sie verstieg sich gar so weit, Spione und ausländische Kriminelle für das Verschwinden ihrer amourösen Zeilen verantwortlich zu machen.
Da ihm seine Zeit zu kostbar war, um sie mit derartigen Belanglosigkeiten zu vertrödeln, übergab Kommissar Horlitz den Fall seinen zwei Adepten. Diese fassten die Gelegenheit beim Schopf. Binnen weniger Stunden hatten Albrecht und Julius den ganzen Sachverhalt entwirrt, und die Lösung hatte ihre Ursache in einem ganz profanen Umstand: Gräfin Dorothea, die vergessliche Jungfer, hatte schlicht und einfach die Briefe verlegt. Sie steckten als Lesezeichen in einem Buch, das Julius in ihrer Bibliothek auf der Lesekommode fand – pikanterweise in Abbé Prévosts unrühmlicher Geschichte des Chevaliers des Grieux und der Manon Lescaut. Die Ausgabe war völlig zerlesen und ihre erotischsten Stellen mit roter Tinte umrandet.
Wie dem auch sei, jedenfalls quetschten sich die zwei Freunde gegen acht Uhr abends zwischen geparkten Kutschen und Droschken hindurch, bis sie vor dem schmiedeeisernen Eingangstor der Villa Sternau standen, und zeigten einem der Türsteher, die man in lächerliche silberne Fantasie-Uniformen gesteckt hatte, ihre mit Blattgold umrandeten Einladungen.
Der Diener begutachtete die krakelige Handschrift seiner Herrin, blickte Julius leicht irritiert an und reichte ihm die Karte wortlos zurück. Der Tatortzeichner lächelte sinnig, denn er wusste um den kuriosen Inhalt des Textes:
Ich werde tunlichst darauf achten, dass die Luft in meinem Salon Ihren kriminellen Spleen verscheuchen wird.
Herzlichst, Ihre Gräfin D.
Es erübrigte sich zu sagen, dass der Unterschied zwischen »kriminell« und »kriminalistisch« noch nicht in die Hautevolee vorgedrungen war.
Julius und Albrecht betraten das Grundstück und fanden sich in einem der schönsten Gärten außerhalb der Berliner Zoll- und Akzisemauer wieder. Sorgfältig gestutzte Buchsbäume bildeten mehrere Quadrate, in denen die Gemüsebeete nicht bloß nützlich sein sollten, sondern ein dekoratives Element abgaben. Das Blaugrün des Lauchs stach ab vom lichten, hellen Grün des winterlichen Feldsalats. Dazwischen hatte man Rosenkohl und ein paar Steckrüben eingebettet und an den Ecken und Kreuzungen der Vierecke kleine Teiche ausgehoben, die von hölzernen Stangen überdeckt waren, welche ihrerseits von Kletterrosen überwuchert wurden. Auf mit Kies bestreuten Pfaden zwischen den Quadraten hindurch verlief der Weg zum Haus. Alles war von unzähligen Fackeln beleuchtet und in ein irisierendes Licht getaucht. Im Frühling und Sommer, wenn bei den meisten Pflanzen die Blütezeit gekommen war, würde die Anlage ein unvergessliches Bild abgeben.
Ein weiterer Diener empfing sie an der Eingangspforte und führte sie ins Gebäude, das aus ockerfarbenem Stein bestand. Der weitere Weg ging vorbei an prächtigen Möbeln und hinein in einen mondän eingerichteten Saal, dessen Fenster hin zum Garten zeigten. Etliche Gäste waren bereits anwesend, und der Diener kündete Bentheim und Krosick an, wie es einst wohl ein sklavischer Nomenklator der alten Römer gemacht haben würde: Laut und deutlich rief er ihren Vor- und Zunamen und räusperte sich, bevor er die Berufe des Tatortfotografen respektive Tatortzeichners erwähnte, die hier, bei den oberen Zehntausend, nicht gerade als gesellschaftsfähig galten.
Die Damen und Herren drehten sich für einen Augenblick zur Tür und bedachten ihre Wenigkeit mit einem belanglosen Nicken, und dann kam auch schon Gräfin Dorothea angerauscht, ihre zwei obligaten Schoßhündchen auf den Armen. Julius begrüßte sie warmherzig und kramte eine Bockwurst aus der Hosentasche hervor, die er speziell für diesen Augenblick eingepackt hatte.
»Sieh an, ein Geburtstagsgeschenk für meine Lieben!«, entfuhr es der erfreuten Dame. »Ach, es ist erbärmlich«, plauderte Gräfin Dorothea drauflos, »ich kokettiere und kokettiere, aber niemand würdigt mich auch nur eines Blickes. Glauben Sie, ich finde hier einen Gatten?« Und ohne dass der Angesprochene auch nur eine Silbe hätte antworten können, fuhr sie fort. »Dort drüben, sehen Sie, Julius? Dort steht Hermann von Thile, einer unserer Unterstaatssekretäre. Daneben parlieren die Herren Fontane, Möllhausen und Galen. Gehen Sie nicht hin, ich warne Sie; die reden ohne Unterbruch über ihre miesen Texte. Und da hinten, der mit dem Sektglas in der Hand, das ist ein Minister. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, was er ministriert; ich bin doch immer so zerstreut und vergesse diese Dinge gleich wieder. Sowieso, diese Politik … Haben Sie übrigens meine neue Fassade bewundert?«
Bentheim verneinte.
»Das ist schade«, bemerkte sie mit Nachdruck. »Äußerst bedauerlich. Die Steine habe ich extra aus La Gaude kommen lassen. Das liegt in Frankreich, müssen Sie wissen. Aber Sie sind ein Studiosus; ich rede und rede, und Sie wissen das bestimmt besser als ich.«
Julius hüstelte leicht irritiert, streichelte ihren Hunden über die Köpfe und entschuldigte sich mit dem Verweis, einen Bekannten unter den Gästen entdeckt zu haben, den Journalisten Friedrich Goedsche. Gräfin Dorothea nahm ihm die Notlüge ab.
Wenig später, nach einer Anstandspause von fünf Minuten, die Julius und Albrecht im Eingangsflur auf und ab gehend hinter sich gebracht hatten, betraten sie erneut den Raum. Albrecht schnappte sich ein Glas Champagner von einem der Tabletts und gesellte sich mit Julius zu einer Ansammlung Männer und Frauen, die gerade dabei war, heftig über die weltpolitische Lage und insbesondere über die neu gegründete preußische Provinz Hessen-Nassau zu disputieren. Das Gespräch zog sich hin und wurde allgemein, bis schlagartig die Damen der Runde verstummten. Ihre Augen waren auf die Saaltür gerichtet, wo soeben ein junger, dandyhaft wirkender Gentleman Stellung bezogen hatte. Groß und dominant, mit viriler Ausstrahlung, betrachtete er herausfordernd die Gesellschaft.
»Das ist er«, seufzte die Frau zu Albrechts Linken. »Er sieht verdammt gut aus. Wenn er nur nicht diesen Pakt geschlossen hätte …«
»Verzeihen Sie. Aber welchen Pakt?«, erkundigte sich der Tatortfotograf.
Die Dame starrte ihn verständnislos an.
»Sie kennen den Vicomte de Rastignac nicht?«
»Ich hatte noch nicht das Vergnügen.«
»Meiden Sie ihn!«, befahl ihm die Frau mit Nachdruck. »Man erzählt sich, er pflege Freundschaft mit Werwölfen. Er steht mit dem Bösen im Bunde.«
Obgleich es sich einer Dame gegenüber nicht ziemte, lachte Julius, der dem Gespräch gefolgt war, unwillkürlich auf.
»So, so«, meinte Albrecht süffisant. »Trägt Ihr Vicomte denn ein Kainsmal? Als Franzose wird er am Ende gar ein Katholik sein. Das wäre bei uns bereits Grund genug, ihn aufzuhängen.«
»Zwei Gründe«, warf Julius leichthin ein. »Franzose und Katholik.«
»Sie belieben zu scherzen«, entgegnete die Frau sichtlich verärgert, bevor sie sich brüsk abwandte.
Julius zuckte mit den Achseln und schickte sich in eine weitaus interessantere Konversation mit einem alten Baron, der zufällig in der Nähe stand.
Drei Stunden später, als die Soiree zu Ende war und die letzten Gäste das Haus verließen, sollte jener besagte Vicomte tatsächlich vor dem Tatortzeichner Aufstellung beziehen und ihn in ein völlig unerwartetes Gespräch verwickeln. Sie standen auf dem Gehweg vor der Villa Sternau: Julius, Albrecht und der Franzose. Die Haare des Ausländers waren leicht pomadisiert, der Anzug tadellos geschnitten, das Gesicht glatt rasiert und die Augen stechend.
»Dacascos Rastignac«, stellte er sich freundlich lächelnd vor, ohne auch nur in Erwägung zu ziehen, seinen Titel oder zumindest sein Adelsprädikat zu nennen. »Und Sie sind die Herren Bentheim und Krosick, nicht wahr? Die berühmten Polizeiaspiranten, wie mir die reizende Gräfin Dorothea heute mitgeteilt hat.«
Er besaß den unvermeidlichen Akzent all jener, die hinter Lothringens Nordosten lebten. Das I betonte er, das R sprach er viel zu oft mit, wo es im Deutschen oft verschluckt wird, und das im Französischen stumme Anfangs-H übersah er auch in seinen Übersetzungen.
Mit der gebotenen Bescheidenheit fügte Julius an, dass sie bloß ihre Arbeit taten wie jeder andere anständige Mann auch. Sein Gegenüber erschien Bentheim trotz – oder vielleicht gerade wegen – seiner Jugend einnehmend und liebenswürdig zu sein. Um den Hals des Franzosen hing ein grauer Schal, der auf Höhe der Schultern mit einem roten Tatzenkreuz geschmückt war. An den Fingern der rechten Hand glänzten zwei teure Ringe.
»Ich habe heute Morgen die Gazetten gelesen, Herr Bentheim, die National-Zeitung, die Vossische und die Spenersche. Ich muss schon sagen, diese Geschichte mit dem toten Herzog hat ein richtiges Rauschen im Blätterwald verursacht. Haben Sie bereits einen Anhaltspunkt?«
»In Bezug auf wen oder was?«
Julius gab sich wortkarg. Langsam fröstelte er ein wenig.
»Natürlich in Bezug auf den Täter«, lachte der junge Vicomte auf. »Solche Mördergeschichten interessieren mich ungemein. Sie wissen schon: Marie-Catherine Cadière und Jean-Baptiste Girard, die Marquise de Brinvilliers und der Chevalier Godin de Sainte-Croix, Catherine Monvoisin oder Gilles de Rais und so weiter und so fort.«
»Leider muss ich Sie insofern enttäuschen, als ich verpflichtet bin, zu unseren laufenden Ermittlungen keine Auskünfte zu geben.«
»Wie schade, wie betrüblich«, sinnierte der Franzose, der diese Floskel zweifellos erwartet hatte. »Aber ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise und verabschiede mich gleichzeitig von Ihnen. Ich sehe, mein Kutscher fährt gerade vor.«
Als ob es den Moment abgepasst hätte, raste ein Viergespann um die Ecke. Schnaubend blieben die Klepper vor den drei Männern stehen, ihre Nüstern tropften, ihr Atem qualmte in den Schwaden. Die Kalesche war gänzlich in Schwarz gehalten, die Insignien an der Seite zeigten zwei Ritter auf einem Pferd, darunter standen Name und Nummer des Gefährts; es war eine Velid 13-666, eine edle und keineswegs billige Sonderanfertigung. Vicomte Dacascos griff nach dem Schieber, der die Tür entriegelte, und bestieg den Wagen. Ein letzter Gruß noch aus dem Inneren, und dann stob das Gespann davon.
Der schwarz gekleidete Kutscher, der bislang Bentheims Sichtwinkel verborgen geblieben war, schwang die Peitsche, und dem Tatortzeichner war es, als ob der nach hinten gerutschte Jackenärmel des Mannes einen dunklen, dicht behaarten Arm entblößte. Im Schein der nächsten Laterne kehrte die Kalesche um und preschte erneut an Julius und Albrecht vorüber.