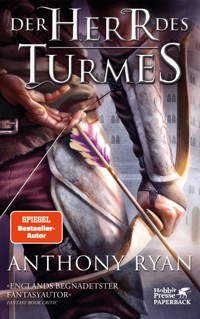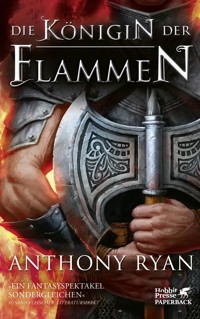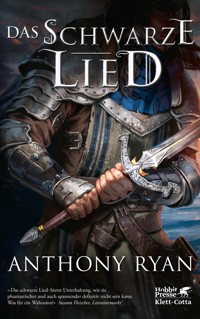
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Fantasy in einer unvergleichlich sagenhaften Atmosphäre« Fantasy Book Review »Das Schwarze Lied« ist der action- und spannungsgeladene Abschluss der Rabenklinge-Reihe um den Helden Vaelin al Sorna, den unzählige Fantasyleserinnen und -leser in ihr Herz geschlossen haben. Mehr als je zuvor ist Vaelin in Gefahr und sie droht ihm vorderhand von einem wahnsinnigen Kriegsherrn, aber vor allem von ihm selbst. Die Stahlhorde hat das Ehrwürdige Königreich verwüstet, indem sie einen Feuer- und Blutsturm entfesselte. Kehlbrand, der Anführer dieser gewaltigen Streitmacht, ein Warlord, der sich selbst für ein gottgleiches Wesen hält, richtet nun seine gierigen Augen auf die anderen umliegenden Reiche. Es gibt niemanden, der diesen Wahnsinnigen aufhalten könnte, außer vielleicht einen: Vaelin al Sorna. Vaelin ist aber auf der Flucht und seine Armee ist schwer angeschlagen und befindet sich in Auflösung. Und da ist noch ein größeres Übel. Das Schwarze Lied, das sein eigenes Lied des Blutes ersetzen soll, welches ihn einst zum unbezwingbaren Kämpfer machte, ist kein Segen mehr, sondern ein Fluch...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 825
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Anthony Ryan
Das schwarze Lied
Rabenklinge 2
Aus dem Englischen übersetzt von Sara Riffel
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Black Song. Raven’s Blade 2« im Verlag Orbit, London
© 2020 byAnthony Ryan
Für die deutsche Ausgabe
© 2021, 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: © Birgit Gitschier, Augsburg
unter Verwendung einer Illustration von © Federico Musetti
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP – Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98813-0
E-Book ISBN 978-3-608-11670-0
Inhalt
Karten
Erster Teil
Obvars Bericht
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Zweiter Teil
Obvars Bericht
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Dritter Teil
Obvars Bericht
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Vierter Teil
Obvars Bericht
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dramatis Personae
DIE REICHE DER KAUFMANNSKÖNIGE
DIE HORDE DER DUNKELKLINGE
DER TEMPEL DER SPEERE
ANDERE
Danksagung
Gewidmet der Erinnerung an Lloyd Alexander, Verfasser der Chroniken von Prydain – jener wunderbaren Serie, mit der mein lebenslanges Abenteuer als Fantasyleser und -autor begann
Karten
Erster Teil
•••
Selbst die größte Lüge
Wird zerschlagen
Von der schärfsten Klinge.
– Seordahnisches Gedicht, anonym –
Obvars Bericht
Luralyn fragte mich einst: »Was ist es für ein Gefühl zu sterben?«
Ich spürte den Wunsch nach Trost, der hinter dieser Frage stand, deshalb sagte ich: »Man hat das Gefühl zu fallen. So als würde die Welt zu einem winzigen Lichtpunkt zusammenschrumpfen, während man selbst in einen ewigen Abgrund stürzt. Dann … ist auch der verschwunden, und um einen herum ist nichts mehr.«
Diese reichlich poetische Antwort war jedoch, wie ich gestehen muss, eine Lüge. Natürlich kann ich nur für mich selbst sprechen – für andere gleicht der Tod womöglich einem sanften Hinübergleiten in einen endlosen Schlaf. Mein Tod allerdings bot keinen solchen Trost.
Schon als ich spürte, wie Al Sornas Klinge meine Wirbelsäule traf und am Rücken wieder austrat, wusste ich, dass die Wunde tödlich war. Der Schmerz war genauso quälend, wie man ihn sich vorstellt. Doch Schmerz war mir vertraut. Immerhin war ich Obvar Nagerik, erwählter Kämpe der Dunkelklinge, und an Ruhm unter den Stahlhast nur von ihm selbst übertroffen. Zahlreich waren meine Schlachten, und ich kann ohne Prahlerei behaupten, dass ich nicht mehr wusste, wie viele Menschen ich schon getötet hatte. Ich weiß es bis heute nicht. Ein solches Leben geht nicht ohne unzählige Verletzungen einher, wobei manche sich stärker ins Gedächtnis einprägen als andere. Der Pfeil, der in der Schlacht der drei Flüsse meinen Arm bis auf den Knochen durchbohrte. Der Schwerthieb, der an dem Tag, als wir das erste große Heer des Kaufmannskönigs zerschlugen, mein Schlüsselbein traf. Doch keine Wunde schmerzte so sehr wie die, die Al Sorna mir zufügte, oder verletzte so tief meinen Stolz. Nach all den Jahren bin ich mir immer noch nicht sicher, was mehr wehtat: durch die Brust aufgespießt zu werden oder das sichere Wissen, dass ich durch die Hände dieses verfluchten Eindringlings, dieses Namensdiebes sterben würde. Seine Worte hatten mich wütend gemacht, und damals kam niemand, der meinen Zorn erregte, mit dem Leben davon.
Er ist kein Gott. Du bist kein Teil einer göttlichen Mission. All das Gemetzel, das du angerichtet hast, ist wertlos. Du bist ein Mörder im Dienst eines Lügners … Das waren seine Worte. Verhasste Worte, die mich rasend machten. Schlimmer wurden sie noch durch die Wahrheit, die in ihnen lag und die das Lied der Jadeprinzessin mir offenbart hatte, auch wenn ich sie im Herzen schon weit länger kannte.
Damals klammerte ich mich wohl nur aus blankem Zorn an mein Leben, als das Blut in meiner Kehle hochsprudelte und meinen Lungen die Luft nahm. Als mich der Schmerz von Kopf bis Fuß durchzuckte und meine Gedärme sich entleerten und mir nur allzu bewusst wurde, dass der einst mächtige Obvar bald bloß noch ein mit Exkrementen besudelter Leichnam im gleichgültigen Angesicht der Eisensteppe sein würde. Selbst da ließ ich meinen Säbel nicht los, und meine Arme besaßen noch genügend Kraft, um die Klinge aus Al Sornas Fleisch zu ziehen. Er blieb aufrecht stehen, während ich schwankend einen Schritt zurück machte und dabei irgendetwas brabbelte. Wut und Schmerz ließen mich vergessen, was genau ich damals sagte, doch ich möchte gerne glauben, dass es etwas Trotziges, vielleicht sogar Erhabenes war. An der bleichen Farbe seiner Haut erkannte ich, dass auch er sterben würde. Keine Furcht, dachte ich, als ich den Säbel hob, um ihm den letzten Hieb zu verpassen. Zumindest darin lag eine gewisse Befriedigung. Obwohl ich wohlverdient in dem Ruf stand, grausam zu sein, hatte ich nie gerne Menschen getötet, die um ihr Leben bettelten.
Der eisenbeschlagene Huf des Hengstes traf meinen Oberschenkel und brach den Knochen wie trockenes Reisig. Ich stürzte zu Boden. Mir blieb keine Zeit, mich abzurollen, selbst wenn ich die Kraft dazu besessen hätte. Die Tritte des Pferdes prasselten einem Eisenregen gleich auf mich ein, zerschmetterten Knochen und rissen mir das Fleisch auf. Ich hatte geglaubt, der Schmerz von Al Sornas Todesstoß wäre das Schlimmste, was mir je widerfahren könnte. Ein Irrtum. Ich hatte nicht das Gefühl, als würde ich fallen. Ich sah keinen schrumpfenden Lichtpunkt, der mich in wohltuende Leere hinabsandte. Stattdessen spürte ich nur das Entsetzen und die Qualen eines Mannes, der von einem wütenden Pferd zu Tode getrampelt wird. Dann zog etwas an mir, und ich empfand eine neue Art von Schmerz, tiefer, allumfassender – ein Schmerz, der nicht nur meinen Körper erfasste, sondern sich bis in mein tiefstes Innerstes brannte. Irgendwie begriff ich, dass mir die Essenz meiner Seele herausgerissen wurde, wie Fleisch, das von Knochen gekratzt wird.
Bald ging die Empfindung in ein übelkeitserregendes, zermürbendes Gefühl der Orientierungslosigkeit über. Im Gegensatz zu der Lüge, die ich Luralyn erzählte, fiel ich nicht, als ich starb, sondern geriet ins Taumeln. Ein ganzer Schwarm Bilder und Gefühle strömte auf mich ein und ließ keinen Platz mehr für zusammenhängende Gedanken. Auch wenn ich keine körperlichen Qualen empfand, war dies in vielerlei Hinsicht schlimmer, denn es brachte meine tiefsten Ängste zum Vorschein, die panische, verzweifelte Erkenntnis, dass nach dem Leben nichts als ewiges Chaos folgte. Die Panik ließ jedoch nach, als sich aus dem Wirbeln der Bilder allmählich eine klare Erinnerung herausschälte. Ich schaute mit dem Blick eines Kindes in die kalten, wütenden Augen meiner Mutter hoch. Du frisst mehr als die verfluchten Gäule, schimpfte sie und schubste mich weg, als ich nach den Haferfladen greifen wollte, die sie gebacken hatte. Andere Mütter sind mit Nachkommen von göttlichem Blut gesegnet, aber ich bringe einen Fresssack zur Welt. Sie warf eine Pfanne nach mir und jagte mich aus dem Zelt. Geh und stiehl Essen von den anderen Bälgern, wenn du so hungrig bist! Komm ja nicht vor Einbruch der Nacht wieder.
Die Erinnerung zersplitterte, ging ein weiteres Mal in Chaos über, bis erneut ein vertrautes Bild vor mir auftauchte. Luralyns Gesicht an dem Tag, als ich gegen Kehlbrand kämpfte. Diese Erinnerung kannte ich gut, weil ich so oft zu ihr zurückgekehrt war, oder ich glaubte zumindest, sie gut zu kennen. Früher hatte in meiner Erinnerung stets der Kampf im Mittelpunkt gestanden, das Gefühl, wie Fäuste auf Fleisch trafen, der Eisengeschmack meines Blutes, als Kehlbrand mir die heftigste Tracht Prügel meines gesamten Lebens verabreichte. Aber diesmal war es anders – ich sah nur Luralyns Gesicht, in hilfloser Wut verzerrt und von Tränen überströmt. Kehlbrands Schläge waren dagegen bloß Ablenkung. Dann veränderte sich ihr Gesicht, rundete sich zu dem einer erwachsenen Frau, rief die ärgerliche, aber hartnäckige Mischung aus Lust und Verlangen in mir wach.
Du bist widerlich, Obvar.
Ihre Miene war jetzt herablassend, halb von der untergehenden Sonne und dem trüben Flackern der unzähligen Feuer im Lager am Großen Felsen beleuchtet. Ich erinnere mich, wie ansprechend sich die changierenden Farben auf der glatten Rundung ihres Gesichts ausnahmen. Auf meiner Zunge lag der Geschmack von cumbraelischem Wein, auch wenn ich damals noch nicht wusste, woher er stammte, und es mich auch nicht kümmerte. Hinter ihr sah ich die großgewachsene Gestalt ihres Bruders, der sich über den Leichnam auf dem Altar beugte. Tehlvar war im Tod nackt, wie es die Tradition gebot; sein muskulöser Körper ein bleiches, schlaffes Ding, mit verkrustetem Blut beschmiert, das aus der Messerwunde in seiner Brust ausgetreten war. Der Tag, an dem der Große Priester Tehlvar die zweite Frage stellte, erkannte ich und sah, wie Luralyn zögernd einen Schluck aus dem Weinschlauch nahm, den mein jüngeres Ich ihr hinhielt. Der Tag, als alles begann.
Die Erinnerung entfaltete sich vor mir, und ich tauchte erneut in ein Wechselbad der Gefühle ein. Das Aufflammen von Wut und Lust bei Luralyns inzwischen gewohnter Ablehnung. Gefühle, die noch stärker wurden, als Kehlbrand sie zu sich rief und mich wegschickte. Was die beiden zu bereden hatten, war für meine Ohren nicht bestimmt. Und warum auch? Was hätte ich schon dazu sagen können? Ich sollte der Kämpe der Dunkelklinge werden, aber niemals sein Ratgeber. Die seither vergangenen Jahre liefern mir eine klarere Sicht darauf, wie ich an den Punkt in der Geschichte gelangte, an dem ich heute stehe. Inzwischen ist der Name Kehlbrand Reyerik fast schon ins Reich der düsteren Legenden eingegangen. Ich dachte, es hätte mit dem Moment meines Todes begonnen, aber jetzt weiß ich, es fing mit jenem ungeschlachten Hünen an, der in das dunkle Lager zurückstapfte, fest entschlossen, seiner Enttäuschung mit üblen Taten Luft zu machen. In seinem Herzen wusste der Hüne, dass er nicht mehr als ein Schoßhündchen war, stark und bösartig, aber trotzdem nur ein Hund.
Ist das der Tod?, fragte ich mich, als sich die Erinnerung erneut wandelte, der Große Felsen und das Lager vom wirbelnden Dunst fortgerissen wurden. Die Kränkungen, die einem zu Lebzeiten zugefügt wurden, ewig aufs Neue durchleben zu müssen? Und wenn ja, konnte ich dann wirklich behaupten, es nicht verdient zu haben?
Als die Sicht wieder klarer wurde, schien sich mein Verdacht zu bestätigen. Mich erwartete ein weiterer Moment, den ich lieber vergessen hätte. Ich stand neben Kehlbrand in der Kammer unter der Grabstätte der Unsichtbaren. Die Leichen der Priester, die wir erschlagen hatten, waren inzwischen fast schon verwest. Verdorrtes Fleisch bröckelte von trockenen Knochen in dieser uralten, heißen Höhle. Der Gestank des Todes hing aber immer noch in der Luft.
Ich erinnerte mich, wie Kehlbrand mich damit überraschte, dass er nach dem Fall von Leshun-Kho zum Großen Felsen zurückkehren wollte. Eigentlich wäre nach einem großartigen Sieg wie diesem eine Nacht der feuchtfröhlichen Ausschweifungen angebracht gewesen. Der Hunger, für den meine Mutter mich als Kind gescholten hatte, plagte mich weiterhin, und mit dem Eintritt ins Mannesalter waren noch andere Gelüste hinzugekommen. Die Dunkelklinge erlaubte jedoch keine Siegesfeier. Nachdem das Schlachten vorbei war und Luralyn ihre Auswahl unter den Gefangenen getroffen hatte, übergab Kehlbrand die Stadt einem vertrauenswürdigen Skeltir mit zehntausend Kriegern, um sie vor einem Gegenschlag aus dem Süden zu schützen.
»Du willst nach Keshin-Kho marschieren?«, hatte ich gefragt. In meiner Brust mischte sich eifrige Vorfreude mit Besorgnis. Auch wenn ich stets begierig auf einen Kampf war, stellte die große Festungsstadt doch ein respekteinflößendes Ziel dar, selbst für unser ständig wachsendes Heer.
»Nein, alter Freund«, sagte er. »Wir gehen nach Hause. Es ist Zeit, sich vorzubereiten.«
»Worauf?«
Seine Augen verengten sich leicht, während er seine Schwester ansah. Seit dem Fall der Stadt hatte Luralyn eine ziemlich grimmige Miene aufgesetzt. Wahrscheinlich lag es an ihrer Zimperlichkeit, die mir für eine Stahlhast immer schon untypisch vorgekommen war. Kehlbrand hingegen hatte seiner Schwester bis jetzt stets bedingungslos vertraut. »Ich bin mir noch nicht ganz sicher«, sagte er und stieg in den Sattel, »aber ich muss dich um etwas bitten, wenn auch nur ungern.«
»Du bist der Mestra-Skeltir«, erinnerte ich ihn. Selbst damals vermied ich es schon, ihn bei seinem anderen, seinem göttlichen Namen zu nennen, was er geflissentlich überhörte. »Du kannst mich um alles bitten, und ich werde gehorchen.«
Er musterte mich ruhig, aber ausdruckslos. Als er antwortete, lag ein Hauch von Bedauern in seiner Stimme, was man sonst nur selten bei ihm hörte. »Ich nehme dich beim Wort, Sattelbruder«, sagte er.
Und so ritten wir nach Hause, gefolgt von der Horde der Stahlhast. Die Tuhla wurden nach Osten und Westen geschickt, um die Grenzgarnisonen anzugreifen, aber die Stahlhast ritten nach Norden, zurück zum Großen Felsen, wo Kehlbrand mich bat, mit ihm zur Grabstätte zu gehen und zu dem, was sich darunter befand.
»Berühre ihn.«
Die Oberfläche des Steins war glatt und schwarz und von goldenen Adern durchzogen, die im Licht von Kehlbrands Fackel zu pulsieren schienen. In der Nacht, als wir die Priester getötet hatten, war Luralyn vor dem Ding zurückgeschreckt, und wer könnte es ihr verdenken?
»Jemand ist auf dem Weg hierher«, fügte Kehlbrand hinzu. »Ein Gegner, den du nicht besiegen kannst.«
Ich schaute vom Stein hoch und grinste breit, um meine Unsicherheit in der Nähe des gefürchtetsten Gegenstands in den Legenden der Stahlhast zu überspielen, einem Gegenstand, der so heilig war, dass die Ewigen Gesetze die Todesstrafe vorsahen, sollte ihn jemand ohne Erlaubnis der Priester betrachten. Doch die Priester waren tot und die Ewigen Gesetze inzwischen nur noch ein Überbleibsel aus der Zeit vor Kehlbrands Aufstieg, über das kaum je gesprochen wurde. Wozu brauchten die Stahlhast Gesetze, wenn wir das Wort der Dunkelklinge hatten, das Wort eines Gottes?
»Es gibt keinen Mann, den ich nicht besiegen kann«, sagte ich.
»O doch, das kannst du mir glauben. Er hat meinen Namen gestohlen, und er wird schon bald kommen, um alles zunichtezumachen, was wir aufgebaut haben.« Kehlbrand griff nach meinem Unterarm. »Berühre den Stein.« Sein Blick war jetzt finster, unerbittlich in seiner Autorität und Entschlossenheit. Es war das Gesicht, das er zur Schau trug, wenn er mehr sein wollte als der Mestra-Skeltir, das Gesicht der Dunkelklinge. »Berühre ihn, und der mächtige Obvar wird noch mächtiger werden.«
Dem Befehl eines Gottes kann man sich nur schwer widersetzen, trotz meiner kaum verhohlenen Zweifel, was seine Göttlichkeit betraf. Vor diesem Moment hatte ich oft vermutet, seine Identität als Dunkelklinge sei nur eine List, eine Strategie, um die Menschen, die wir einst versklavt hatten, und diejenigen, die wir bald unterwerfen würden, für sich zu gewinnen. Wenn ja, dann hatte sich der Trick eindeutig als erfolgreich erwiesen. Doch als ich jetzt in seine Augen sah, begriff ich zum ersten Mal, dass Kehlbrand Reyerik die Rolle des Gottes nicht bloß spielte. In seiner Vorstellung war er tatsächlich die Dunkelklinge, und in diesem Augenblick glaubte ich es auch. Erst Jahre später erkannte ich, dass es solche kurzen Momente der Schwäche sind, die uns zum Verhängnis werden, die flüchtigen Gelegenheiten, wenn Vernunft und Zweifel von blindem Glauben und Liebe übermannt werden.
Ich spreizte die Finger, während Kehlbrand grimmig und zufrieden lächelte, und schlug mit der Handfläche auf den Stein.
Es war so, als berührte ich eine Flamme, doch der Schmerz war schlimmer als bei einer einfachen Verbrennung. Er sengte sich durch meine Hand und meinen Arm tief in mein Innerstes hinein. Weißes Feuer explodierte in meinen Augen, begleitet von einem Tosen, das so laut war, dass ich meinen eigenen Schrei nicht hörte. Das Feuer erlosch so schnell, wie es aufgelodert war, und für einen winzigen Moment sah ich mich einem Augenpaar gegenüber. Schwarze Pupillen in gelb-grün gesprenkelten Augen, eingebettet in gestreiftes Fell, dessen Muster ebenso komplex wie symmetrisch war. Ein Tiger, erkannte ich gequält, während die Augen in meine Seele hineinschauten. Ich hörte keine Worte, sah nichts außer diesen Augen, aber ich spürte die Absicht ihres Besitzers deutlicher als jede Wunde davor oder danach: Hunger. Tiefer, unbändiger, unstillbarer Hunger.
Die Augen blinzelten und verschwanden, ein grauer Dunst blieb zurück und die plötzliche Abwesenheit jeglicher Empfindungen. Als sich der Dunst auflöste, lag ich auf dem Rücken und schaute in Kehlbrands besorgte Miene hoch. »Es war anders«, sagte er mit weicher, nachdenklicher Stimme, eher an sich selbst als an mich gewandt. »Warum war es anders?«
»Anders?«, fragte ich stöhnend und ergriff seine Hand, um mir hochhelfen zu lassen.
»Du bist nicht der Erste, dem ich eine Gabe verliehen habe, Bruder. Vor dir kamen schon viele andere. Meist waren sie hinterher etwas verwirrt, empfanden aber keinen Schmerz.« Unangenehm forschend musterte er mit gerunzelter Stirn meine Züge. Er wirkte bestürzt, was untypisch für ihn war. »Spürst du es? Weißt du, was es ist?«
»Es spüren?« Angesichts meines verwunderten Ausdrucks seufzte Kehlbrand enttäuscht, worauf ich hinzufügte: »Es hat wehgetan.«
»Und sonst nichts? Du spürst gar nichts?«
Ich trat zurück und holte trotz des Gestanks in der Höhle tief und zittrig Luft. In Wahrheit spürte ich nur den Nachhall eines kürzlich überstandenen Schmerzes. Meine Arme waren so stark wie eh und je, aber nicht stärker. Und ebenso meine Sehkraft – nachdem der graue Dunst sich verzogen hatte, sah ich wieder scharf, konnte jedoch außer den Umrissen der Kammer nichts weiter entdecken. »Ich bin … ganz der Alte, Bruder.«
»Nein.« Zweifelnd schüttelte er den Kopf, und in seiner Stimme lag ein Hauch Zorn. »Deine Melodie ist anders.« Er legte den Kopf schief und sprach im Flüsterton weiter. »Ich bin nicht sicher, ob es mir gefällt.«
Er blinzelte, und ich konnte ein leichtes Schaudern nicht unterdrücken, denn in diesem Moment ähnelten seine Augen so sehr denen des Tigers, dass der Schmerz erneut in mir aufflammte. Als er weitersprach, hatte seine Stirn sich geglättet, und sein Ton klang gelassen und nachdenklich. »Na gut, es wird sich schon bald zeigen.«
»Luralyn weiß es vielleicht …«, begann ich, wurde jedoch schnell zum Schweigen gebracht.
»Nein«, sagte er im Befehlston. »Und mir wäre es auch lieber, Obvar, wenn du die Gesellschaft meiner Schwester in Zukunft meidest. Sie findet dich bestenfalls anstrengend, und dein Werben um sie war ehrlich gesagt immer schon aussichtslos, wenn nicht gar unangemessen. Schließlich ist sie die engste Angehörige der Dunkelklinge. Sie ist nicht für dich bestimmt.«
Da spürte ich es – den Stich der Kränkung. Ich war also unwürdig, das Herz seiner Schwester zu gewinnen! Sein respektloser Ton war der eines Herrn, der zu einem Sklaven spricht, und er machte mich wütend. Aber ich hörte und spürte noch mehr. Es war so, als kämen die Worte aus zwei verschiedenen Mündern, einem, der in Kehlbrands beleidigendem Ton sprach, und einem zweiten, der wie eine hinterlistige Töle zischte. Die Worte waren identisch, doch der Tonfall ließ keinen Zweifel daran, dass er log, dass jede Silbe vor Falschheit triefte. Ich hörte noch einen anderen Grund heraus, warum er nicht wollte, dass ich mit Luralyn zusammen war – obwohl es natürlich stimmte, dass sie meine Avancen stets entschieden zurückgewiesen hatte. Er fürchtet, was wir uns gegenseitig erzählen könnten.
Mein Blick glitt zum Stein zurück – bis auf die goldenen Adern, die jetzt noch stärker pulsierten, ein unscheinbarer schwarzer Sockel. Das ist seine Gabe, begriff ich. Lügen.
»Sei mir nicht böse«, sagte Kehlbrand und klopfte mir lächelnd auf die Schulter. »In deinem Herzen wusstest du, dass es immer so sein würde.« Sein Griff wurde vor lauter Mitleid fester. »Wenn wir erst die Südlande eingenommen haben, wird es jede Menge Frauen geben. König Lian Sha hat, wie ich hörte, einen ganzen Palastflügel voller hübscher Konkubinen.«
Du bist nur ein Hund, sagte mir der spöttische Ton der Töle. Den die Dunkelklinge bei Tisch mit Resten abspeist.
Der Instinkt eines Kriegers ist wertvoll und ähnelt dem eines Feiglings darin, dass er stets in Momenten großer Gefahr Alarm schlägt. Als Kehlbrand lachte und mir mit brüderlicher Zuneigung die Schulter drückte, wusste ich, dass er mich ohne Zögern töten würde, sollten meine nächsten Worte nicht dem entsprechen, was er von seinem treuesten Hund erwartete.
»Wie es die Dunkelklinge befiehlt«, sagte ich und neigte den Kopf.
Danach folgten noch weitere Erinnerungen. Wie zerfetzte Laken in einem Sturm wirbelten sie durcheinander. Der große Sieg über das Heer des Kaufmannskönigs, dessen Reihen unter dem Angriff von Luralyns Begabten auseinanderbrachen. Der Rausch des Schlachtens danach. Die Rückkehr zum Großen Felsen und die Ankunft der Jadeprinzessin, in Begleitung der Heilerin und des Namensdiebes, den Kehlbrand so lange schon erwartet hatte. Ich war es gewohnt, potenzielle Gegner auf die Gefahr hin einzuschätzen, die von ihnen ausging, und fand diesen hier zu meiner Beunruhigung schwer zu durchschauen. Groß und stark war er, aber nicht so wie ich. Klug und raffiniert ebenfalls, doch sein Scharfsinn schüchterte mich nicht ein. Ich empfand keine Furcht vor ihm. Vielleicht wurde mir das zum Verhängnis, denn wäre es anders gewesen, hätte ich ihn womöglich besiegen können.
Als Nächstes folgte das Lied der Jadeprinzessin. Die Wahrheit darin war ebenso schrecklich unausweichlich wie zuvor. Der Stein hatte mir die Fähigkeit verliehen, Lügen zu erkennen, was mir beim Glücksspiel zu einigem Reichtum verhalf. Allerdings verriet mir die Gabe nicht, wie sehr ich mich selbst belog. Über meinen verletzten Stolz wegen Kehlbrands Kränkungen tröstete ich mich hinweg, indem ich meine Stellung an seiner Seite weidlich ausnutzte. Die Stahlhast schätzen Reichtum nicht so sehr wie die Südländer. Gold und Edelsteine sind uns zwar nicht gleichgültig, wahrer Reichtum liegt für uns jedoch in dem Ruf, den jemand genießt. Und inzwischen wurde meine Legende nur noch von der der Dunkelklinge und seiner göttlich gesegneten Schwester übertroffen. Mein Ruhm wurde zu einem Schild gegen meine Zweifel – ein warmer Pelz, in den ich mich hüllen konnte, wenn die Stimme der Töle mich verhöhnte. Gegen das Lied der Jadeprinzessin half jedoch kein Schild.
Alles Lüge. Das begriff ich jetzt, als das Lied mühelos meine Abwehr überwand und in meine Seele eindrang. Seine Melodie klang schön und schrecklich zugleich. Kehlbrands Anerkennung, all seine Geschenke, die vorgetäuschte Brüderlichkeit seit frühester Kindheit. Alles Lüge. Das Lied zwang mich, ihn mit anderen Augen zu sehen, das Künstliche in jedem Gesichtsausdruck zu erkennen, die Berechnung, die hinter jedem Wort steckte. In alldem sah ich nur zwei Wahrheiten: seine Liebe zu Luralyn und seinen Glauben an die eigene Göttlichkeit. Ein Gott, der Lügen verbreitete, aber sich selbst wahrhaftig für eine lebende Gottheit hielt.
Die Erinnerung brach jäh ab, als Kehlbrand die Jadeprinzessin erschlug, und das Spektakel meines Duells mit Al Sorna blieb mir erspart. Irgendwie hatte ich das Gefühl, erstarrt zu sein, gefangen. Eine scheinbare Ewigkeit lang sah ich nichts, hörte nichts und spürte nichts außer dem Gefühl, eingesperrt zu sein. Ich glaubte, das wilde Pochen meines Herzens zu hören, aber bald wurde mir klar, dass es lediglich die Erinnerung an einen Puls war. Ich besaß kein Herz mehr und auch keinen Körper. Trotz anderslautender Behauptungen habe auch ich im Leben Furcht verspürt – nicht seltener als andere Männer, die dem Tod ständig ins Auge sehen. Allerdings hatte ich diese Angst zu beherrschen gelernt, um sie in Wut umzuwandeln, wenn die Schlacht begann. Hier gab es keine Schlacht, nur das Wissen, gefangen zu sein, wie eine Fliege in einem Spinnennetz. Furcht wurde rasch zu Entsetzen – einem Entsetzen, das einen ganz ausfüllt und zum Schreien bringt. Ich jedoch hatte keinen Mund mehr zum Schreien.
Ich hörte ein kurzes Brüllen, wütend und voller Ungeduld. Worte konnte ich keine ausmachen, begriff aber den Befehl, der darin lag: RUHE!
Ich wurde in dem Netz durchgeschüttelt, ein leises, neugieriges Knurren ertönte. In der Dunkelheit erschienen zwei vertraute Augen und musterten mich eindringlich. Er wird mich fressen! Der Gedanke stieg in mir auf, löste sich aus dem tosenden Strom der Furcht. Ich spürte den Hunger des Geschöpfs, genauso bodenlos wie zuvor. Meine Seele schien dem Tiger jedoch nicht zuzusagen, denn sein Maul blieb geschlossen. Die Erleichterung, die mich durchfuhr, schwand rasch dahin, als die kalten, starren Augen noch näher kamen. Er brüllte erneut, lauter und länger, und wieder war der Befehl klar: ICH LASSE DICH ZURÜCKKEHREN! UND DU WIRST MICH FÜTTERN!
Sein Wille umgab mich wie eine gigantische Faust, die sich um eine Mücke schließt und fest zudrückt. Dann hatte ich wieder das Gefühl, durchgeschüttelt zu werden, aus dem Netz befreit und weggeschleudert – ein Staubkörnchen, das durch endlose Leere stürzt, bis ich aufs Neue irgendwo hängen blieb, in einem anderen Netz, das diesmal aus Schmerz bestand. Er durchflutete mich, bildete feurige Kugeln, die sich in die Länge dehnten und in Gliedmaßen verwandelten. Gleich darauf kam noch mehr Schmerz hinzu, flammte grell in einem Herzen auf, das mühsam zu schlagen begann, während sich neu geschaffene Rippen darum schlossen. Aus Schmerzranken wurden Adern, und ein Vorhang aus Feuer legte sich über die nackten Muskeln eines neuen, anderen Körpers und wurde zu Haut. Der Schmerz ließ etwas nach, während sich der Körper um meine Seele herum verfestigte. Die Pein verschwand jedoch nicht ganz, sie loderte weiter wie eine heiße, wütende Flamme in meinen Eingeweiden.
Vor Freude und Qualen schrie ich auf, entzückt über die Tatsache, dass ich nun wieder eine Stimme hatte. Außerdem besaß ich Haut, mit der ich die harten Steine unter meinem Körper und einen kühlen Lufthauch spürte. Meine Freude schwand jedoch, als ich merkte, wie der Schmerz in meinem Bauch zunahm und sich rasend schnell ausbreitete. Er würde mich schon bald umbringen. Daran bestand gar kein Zweifel.
»Das Gegenmittel«, befahl eine barsche, vertraute Stimme. »Schnell!«
Ein scharfer Geschmack auf meiner Zunge. Ich würgte krampfartig, während er meine Kehle hinabwanderte. Wieder flammte kurz Schmerz in meinen Eingeweiden auf, dann war er verschwunden, gestillt von dem widerlichen Gebräu, das ich geschluckt hatte.
»Mach die Augen auf«, sagte dieselbe Stimme, und ich spürte kräftige Finger, die mein Kinn packten. Tränen flossen aus meinen Augen, als ich blinzelte. Das grelle Licht einer brennenden Fackel dicht vor meinem Gesicht ließ mich aufkeuchen. Er ragte über mir auf und schaute mir fest und forschend in die Augen.
»Hast du eine Botschaft für mich?«, fragte er in der Sprache der Südländer und blinzelte überrascht, als ich in der der Stahlhast antwortete. Die barschen Worte schienen nicht zu dem Mund zu passen, der sie hervorbrachte.
»Kehlbrand …«, krächzte ich. »Bruder?«
Er ließ mein Gesicht los und richtete sich zu voller Größe auf. Sein forschender Ausdruck verwandelte sich in ein warmherziges Lächeln. Was immer ich soeben durchgemacht hatte, die Gabe des Steins war irgendwie mit meiner Seele verbunden geblieben, denn ich hörte die Unwahrheit in seinen Worten, so klar wie eine läutende Glocke. »Schön, dass du wieder da bist, Obvar.« Mein Hund wurde mir zurückgegeben, übersetzte die spöttische Töle. Vielleicht wird er sich nun endlich als nützlich erweisen.
• • •
Die große Festungsstadt Keshin-Kho lag unter einem aschgrauen Dunst, den nicht einmal der steife Nordwind, der von der Eisensteppe heranwehte, vertreiben konnte. Die Straßen waren menschenleer, bis auf die Banden aus Stahlhast und Tuhla oder Erlösten, die überall umherstreiften und nach Beute suchten. Hier und da lagen noch ein paar Leichen herum, die meisten waren jedoch in den zwei Tagen seit dem Fall der Stadt weggeschafft worden. Die vielen schwarzen Ruinen, von denen Rauch zu der Dunstglocke am Himmel aufstieg, zeugten von der erbitterten Schlacht, die hier stattgefunden hatte.
»Dreißigtausend oder mehr«, sagte Kehlbrand, der meine Gedanken wie immer mühelos erriet. »So viel hat es mich gekostet, die Stadt einzunehmen, Obvar. Ich muss sagen, es war ein ziemliches Spektakel. Ich habe bereits einigen Gelehrten den Auftrag erteilt, einen Bericht darüber zu verfassen. Ein weiteres Kapitel im Epos der Dunkelklinge, nach gründlicher Überarbeitung natürlich.«
Er klopfte mir auf den Rücken und führte mich an der Festungsmauer entlang. Er hatte mich zur innersten und höchsten Mauer der Stadt gebracht und mir dabei von seinen Erfolgen seit meinem Tod berichtet, während mein verwirrter Geist die Details zu behalten versuchte. Ich hatte einiges verpasst – die Einnahme von Keshin-Kho war die größte Lücke. Generationen von Stahlhast hatten danach getrachtet, die Stadt zu erobern, und trotz meines orientierungslosen Zustands ärgerte es mich, am Fall der Stadt keinen Anteil gehabt zu haben.
»Keine Sorge, alter Freund«, sagte Kehlbrand. »Wenn wir weiter nach Süden vorrücken, wirst du dir noch mehr als genug Ruhm erkämpfen können. Auch wenn du es leider unter neuem Namen tun musst.«
Als ich zu ihm hochschaute, wurde mir die Merkwürdigkeit der Umstände einmal mehr bewusst. Kehlbrand war ein großgewachsener Mann, aber ich hatte ihn stets überragt, und der neue Unterschied in der Statur missfiel mir.
»Du musst dich deswegen nicht grämen«, versicherte Kehlbrand mir mit einem Lächeln, das unangenehm belustigt wirkte. »Wenn ich es richtig verstehe, ist dies nur deine erste Hülle. Vielleicht ist die nächste ja mehr nach deinem Geschmack.«
»Wo …?«, begann ich, verstummte jedoch, als mich eine neue Welle der Orientierungslosigkeit überkam. Nie gesehene Bilder schossen mir durch den Kopf und dazu unbekannte Gefühle. Eine Hülle, erinnerte ich mich. Dies ist nur eine Hülle, gestohlen von einem Mann, der durch Gift an den Rand des Todes gebracht worden war.
»Ich musste ihn zuerst zwingen, den Stein zu berühren«, hatte Kehlbrand mir kurz nach dem Erwachen gesagt, als ich benommen durchs Zimmer geirrt war. »Sonst hättest du dich in diesem Körper nicht halten können. Offenbar hat er dabei die Fähigkeit gewonnen, ungewöhnlich schnell zu rechnen. Eine eher unbedeutende Gabe, die uns aber bestimmt noch von Nutzen sein wird.«
Ich biss die Zähne zusammen und drängte den Strom fremder Erinnerungen zurück, um mich auf meine Frage zu konzentrieren. »Wo ist Luralyn?«
Kehlbrand blieb abrupt stehen, und alle Fröhlichkeit schwand aus seinen Zügen. Die Hand auf meinem Rücken ballte sich zur Faust, bevor er sie seufzend zurückzog. »Fort, alter Freund. Sie hat den Weg des Verrats gewählt.«
»Luralyn … hat dich verraten?« Die Aufrichtigkeit in seiner Stimme war unverkennbar und ebenso seine Trauer. Ich geriet erneut ins Schwanken und wäre wohl gestolpert, hätte er mich nicht im letzten Moment festgehalten.
»Du wirst schon noch alles begreifen. Jetzt«, Kehlbrand nickte zu den Straßen der Oberstadt, »musst du für mich erst einmal die Rolle spielen, über die wir gesprochen haben.«
Am Rand der Festungsmauer blieben wir stehen und schauten auf die breite Anlage aus Kaserne, Tempel und Hof unter uns. In der Mitte des Hofes war eine gewaltige Schar Männer versammelt, die unter dem wachsamen Blick eines Kontingents Stahlhast-Krieger mit gesenkten Köpfen dasaßen. Auf der Mauer darüber patrouillierten mindestens einhundert Bogenschützen, bereit, einen Pfeilhagel zu entfesseln, sollte es nötig sein. Meiner Schätzung nach waren es vielleicht sechstausend Gefangene – das war alles, was von der mehrere zehntausend Mann starken Garnison übrig geblieben war.
»Bevor wir Keshin-Kho ganz umstellt hatten, gelang es dem General noch, sämtliche Bewohner, bis auf die Soldaten, aus der Stadt zu schaffen«, sagte Kehlbrand mit widerwilligem Respekt. »Der schlaue Mistkerl. Wahrscheinlich glaubte er, seine Landsleute damit vor uns Barbaren zu schützen. Stattdessen blieb ihnen dadurch die Liebe der Dunkelklinge verwehrt, und ich muss mich mit diesem Haufen hier begnügen.« Er deutete auf die Gefangenen. »Feiglinge, die zu verweichlicht sind, um im Kampf zu sterben. Ich hatte auf mehr gehofft, aber es ist immerhin ein Anfang. Komm«, sagte er und ging zur Treppe. »Es wird Zeit, dass du deine Armee in Augenschein nimmst, General.«
Die Gefangenen regten sich, als wir uns ihnen über den Hof näherten. Die grimmige Teilnahmslosigkeit von Besiegten, die auf den Tod warten, wandelte sich beim Anblick der Dunkelklinge in Beunruhigung. Ein unbehagliches Murmeln ging durch die bunt gemischten Reihen, aus Furcht vor den Stahlhast blieben sie jedoch sitzen. Ihre Unruhe schlug in Verwirrung um, als sie mein Gesicht sahen. Einige stießen alarmierte Schreie aus, während andere, vermutlich die Veteranen unter ihnen, sofort aufsprangen und Haltung annahmen.
»Halt!«, rief Kehlbrand den Stahlhast zu, die mit ihren Säbeln auf die stehenden Männer losgehen wollten. »Ein guter Soldat zollt seinem General Respekt.«
Die Gruppe der Gefangenen nahm das eindeutig als Zeichen aufzustehen; ehemalige Feldwebel und Korporale zischten Befehle und brachten die Männer in einigermaßen ordentliche Reihen. Auch wenn sie Habachtstellung eingenommen hatten, waren alle Augen auf mein Gesicht gerichtet. Manche konnten ein argwöhnisches Stirnrunzeln nicht unterdrücken, andere starrten mich in der verzweifelten Hoffnung an, meine Gegenwart hier könnte ihre Rettung bedeuten. Während ich die Gesichter betrachtete, verspürte ich ein seltsames Wiedererkennen, bei manchen kamen mir sogar die Namen in den Sinn. Ich kenne diese Männer. Ich schloss die Augen und schüttelte den Kopf, um die Verwirrung loszuwerden. Nein. Er kannte diese Männer.
»Hast du deinen Soldaten nichts zu sagen?«, fragte Kehlbrand sanft, aber auffordernd.
Ich richtete mich auf und räusperte mich. Chu-Shin beherrschte ich nur rudimentär und erwartete deshalb, dass mir die Worte stockend über die Lippen kommen und mit den weichen Vokalen der Steppe akzentuiert sein würden. Stattdessen sprach ich fließend und ohne zu zögern, und niemand im Publikum schien den geringsten Zweifel daran zu haben, dass der Mann zu ihnen sprach, dem dieses Gesicht einmal gehört hatte.
»Ihr kennt mich«, sagte ich zu ihnen. »Ihr habt voller Loyalität und Vertrauen mit mir gemeinsam gekämpft. Mutig und tapfer habt ihr unter meinem Banner gedient, selbst an den schlimmsten Tagen, und euer Dienst ehrt mich. Heute bitte ich euch erneut um euer Vertrauen. Es wird Zeit, dass ihr die Wahrheit erfahrt, über die schändliche Art, wie wir verraten wurden. Wir haben für diese Stadt gekämpft, haben tagelang unser Blut vergossen und die Brüder an unserer Seite sterben sehen, weil uns der Kaufmannskönig Rettung versprach. Aber diese Rettung kam nicht. Jetzt weiß ich, dass damit gar nicht zu rechnen war. Der Kaufmannskönig hat nie Verstärkung losgeschickt. Wir wurden im Stich gelassen, damit er weiter in seinem Palast sitzen und seinen Reichtum genießen kann. So war es schon immer; der Wohlstand der Kaufmannskönige wurde stets mit dem Blut ihrer Soldaten erkauft.«
Die meisten starrten mich weiter in verwirrter Faszination an, manche runzelten jedoch wütend oder angewidert die Stirn. War ihr Anführer jetzt zum Überläufer geworden?
»Wisset, dass meine Worte wahr sind, denn die Dunkelklinge spricht nichts als die Wahrheit.« Mit steifem Arm deutete ich auf Kehlbrand, der jetzt gekonnt Wut und Bedauern mimte – das Abbild eines Mannes, der vom Leid eines Freundes hörte. »Er sprach zu mir, und ich erfuhr, wie wahr seine Worte sind und wie groß seine Barmherzigkeit. Er verspricht, uns am Leben zu lassen und uns von den Fesseln des Kaufmannskönigs zu befreien. Wir werden nicht länger die Sklaven der Gier eines alten Mannes sein. Unsere Frauen und Kinder werden nicht mehr in Knechtschaft leben. Das Ehrwürdige Königreich ist nichts als ein krankes Ungeheuer, das getötet werden muss. Ich, Sho Tsai, einst euer General, einst ein Narr, der sich vor einem unwürdigen Geizhals verneigte, stelle mein Schwert in den Dienst der Dunkelklinge.« Ich schwenkte den Arm zu den Soldaten herum und streckte einladend die Hand aus. »Schließt euch mir an. Zusammen werden wir die Korruption und den Schmutz der Kaufmannskönige fortkehren. Schließt euch mir an!«
Ein wütendes Murmeln lief durch die Reihen der Männer, und sie tauschten verzweifelte und verwunderte Blicke aus. Sho Tsai, der Kommandant der Roten Späher und Verteidiger von Keshin-Kho, der treueste Diener, den es am Hof des Kaufmannskönigs Lian Sha je gab, rief zum Verrat auf. Das Murmeln wurde lauter, die Worte »verrückt« und »Treubruch« waren deutlich zu vernehmen. Die ordentlichen Reihen lösten sich auf, Schreie ertönten, und einige Männer nahmen, trotz ihrer prekären Lage, Kampfhaltung ein. Ich rechnete fest damit, dass sie gleich in einem Pfeilhagel oder durch Säbelhiebe sterben würden, da sie in den Worten ihres Generals nur die Lügen eines Verräters gehört hatten.
Dann trat Kehlbrand vor.
Als er die Arme ausbreitete, verstummten die Gefangenen sofort. Die wütenden Gesichter wurden zu den ausdruckslosen Masken eines faszinierten Publikums. Ich spürte etwas, während er in die Menge hineinging, die sich vor ihm teilte – einen Machtimpuls, den ich als Einziger wahrzunehmen vermochte. Ich hatte schon länger gewusst, dass Kehlbrand durch die Berührung des Steins eine machtvolle Gabe gewonnen hatte, aber jetzt wurde mir klar, dass es mehr als eine war. Während er zwischen den Männern umherging, redete er auf sie ein, wobei sein Gesicht und seine Stimme von einer sanften, aber gebieterischen Aufrichtigkeit erfüllt waren. »Hört auf die Worte eures Generals«, sagte er und ging mit gefalteten Händen durch die Menge. »Hört, wie wahr sie sind.« Aber ich konnte sehen, dass es nicht seine Worte waren, die die Männer in seinen Bann zogen, sondern er selbst; seine bloße Gegenwart ließ Veteranen und unreife Grünschnäbel gleichermaßen auf die Knie sinken und ihn mit feuchten Augen bewundernd anstarren. Aber nicht alle – manche blieben stehen, ein paar Dutzend, die in offensichtlicher Abscheu vor ihm zurückwichen. An der geübten Schnelligkeit, mit der die Stahlhast-Wachen die wenigen Nichtbekehrten wegzerrten, ohne dass es ihren knienden Kameraden etwas ausmachte, erkannte ich, dass sich eine derartige Szene schon öfter abgespielt hatte. So hatte Kehlbrand seine Armee aus Erlösten rekrutiert. So demonstrierte die Dunkelklinge seine Überlegenheit gegenüber allen anderen Göttern.
»Ihr werdet der Same eines neuen Heeres sein«, sagte Kehlbrand seinen frisch gewonnenen Anhängern. Er hatte die Arme ausgestreckt, um ihre Anbetung zu empfangen. Die Männer hielten die Köpfe gesenkt, manche griffen mit zitternden Händen nach ihm. »Unter der Führung des Helden Sho Tsai werdet ihr erst das Ehrwürdige Königreich befreien und dann die ganze Welt, damit alle Menschen die Liebe der Dunkelklinge empfangen können.«
• • •
Im Tempel entdeckte ich zwei Dutzend gerade erst getötete Gefangene, neben zahllosen Leichen mit Verbänden, die offenkundig schon in der Nacht, als die Stadt gefallen war, ihr Leben gelassen hatten. In den Erinnerungen des Generals – immer noch ein Durcheinander unvertrauter Empfindungen und Bilder – fand ich den vagen Hinweis darauf, dass in dem Gebäude während der Belagerung die Verwundeten behandelt worden waren. Anscheinend hatte die Dunkelklinge für Versehrte keine Verwendung. Die Szenerie rief ein frisches Bild im Geist der Hülle wach, heller und klarer als die anderen. Eine Frau mit dunklen Haaren und bleicher Haut, die den Stahlhast ziemlich ähnlich sah, ein Gesicht, das auch meinem überlebenden Verstand bekannt war. Die Heilkundige, erkannte ich. Die von den Südländern Schöne Heilerin genannt wird. Sie begleitete den Namensdieb. Sherin, ihr Name ist Sherin.
Ich erinnerte mich, wie sie in der Nacht, als Kehlbrand Al Sorna zu der Grabstätte brachte, die Kratzer auf meinem Rücken behandelt hatte. In jener Nacht hatte ich recht ausgelassen gefeiert. Meine fleischlichen Gelüste hatten mich zu zwei Schwestern aus dem Wohten-Skeld geführt, denen es Vergnügen bereitete, anderen Menschen Schmerzen zuzufügen. Trotz der angenehmen Ablenkung durch die beiden, blieb meine Laune düster. Die Ankunft des Namensdiebes nach so vielen Monaten des Wartens ließ mich über Kehlbrands Lügen nachdenken. Den wichtigsten Satz dazu hatte er gesagt, bevor ich meine Gabe erhielt. Jemand ist auf dem Weg hierher … Ein Gegner, den du nicht besiegen kannst.
Eine weitere Lüge, tröstete ich mich. Nur eine spöttische Bemerkung, um meinen Stolz anzustacheln.
»Uhhh!« Die Salbe der Heilerin brannte in den Kratzern auf meinem Rücken. »Vorsicht, du fremdländisches Miststück!«, zischte ich. Als ich sie über die Schulter anblickte, sah ich nur die müde Geduld einer Frau, die zweifellos schon viele solcher Flüche gehört hatte. »Morgen töte ich deinen Mann«, sagte ich in meinem stockenden Chu-Shin. »Wusstest du das?«
Sie schaute mich an, ihr Blick war ruhig und zu meiner Verärgerung vollkommen furchtlos. »Er ist nicht mein Mann«, sagte sie, und ich hörte keine Lüge in ihren Worten. »Aber um deinetwillen bitte ich dich: Kämpfe nicht gegen ihn. Er wird dich töten.«
Ein schriller Schrei vertrieb die Erinnerung und holte mich in den Tempel zurück – der Schrei einer Frau.
»Ich habe sie unter einem Haufen Kohlen in einem Keller entdeckt«, sagte ein Stahlhast und zerrte eine Frau an den Haaren über die Fliesen. Sie war großgewachsen und etwa im selben Alter wie der General, und selbst unter der Schicht aus Kohlestaub wirkte ihr Gesicht noch recht hübsch. Ein halbes Dutzend anderer Stahlhast kam hinzu, als der Krieger die Frau losließ, die keuchend zu Boden fiel.
»Eine Himmelsdienerin«, knurrte eine Stahlhast mit scharf geschnittenen Zügen und den Narben einer Veteranin. Mit der Säbelspitze stieß sie die schmutzige Robe der großgewachsenen Frau an. »Die Dunkelklinge wird ihr die Frage stellen wollen.«
»Wozu?«, fragte ein anderer müde. »Die lehnen doch alle ab.« Er ging in die Hocke, um der Frau einen Teil des Staubs aus dem Gesicht zu wischen. »Gar nicht mal so hässlich, für eine Südländerin. Wir könnten sie an die Tuhla verkaufen. Die mögen Frischfleisch.«
Ich war beeindruckt, dass die Frau trotzig die Zähne zusammenbiss und mit wütendem Funkeln eine Gebetslitanei aufzusagen begann. Ähnliches hatte ich bereits in Leshun-Kho erlebt, als wir die dortigen Mönche getötet hatten. Alle wurden gefragt, ob sie ihren Glauben an den Himmel aufgeben wollten, um stattdessen der Dunkelklinge zu dienen, und ihre Antwort hatte nur aus einem Strom von Gebeten bestanden. Die Frau sprach ein altertümliches Chu-Shin, das ihre Peiniger nicht verstanden, von meiner Hülle hingegen mühelos entschlüsselt werden konnte. »Die Gnade des Himmels ist ewig. Das Urteil des Himmels ist ewig …«
»Wieder so eine Brabblerin«, seufzte die Veteranin und verdrehte die Augen. »Warum brabbeln die eigentlich alle?« Sie nickte dem kauernden Krieger zu. »Schone meine Ohren und schneid ihr die Kehle durch.«
Die Himmelsdienerin fuhr ungerührt mit ihrer Litanei fort, selbst als der Krieger einen Dolch aus dem Gürtel zog. Ihr wütender Blick heftete sich auf ihn, und sie schaute ihm fest in die Augen, bis er sie an den Haaren packte und ihr den Kopf nach hinten riss, um ihr die Kehle aufzuschlitzen. Da entdeckte sie mich, und ihre Augen weiteten sich in überraschtem Erkennen.
»Tempeldiener!«, keuchte sie. Erinnerungen durchströmten mich. Der hohe Tempel … der Tempel der Speere … es war zu viel, um alles sofort zu begreifen – Erfahrungen aus Jahrzehnten. Ein drahtiger Mann mit langem, dunklem Haar und abweisender Miene, der eine Lektion erteilte. Die Worte waren undeutlich, ich konnte sie nicht verstehen. Aber ich sah, dass er einen einfachen Holzstab in der Hand hielt, der mit Blut befleckt war. Der Eisengeschmack auf meiner Zunge sagte mir, dass es das Blut dieser Hülle war. In ruhigen Momenten, sagte der Lehrer, mögen die Gedanken wie ein sanfter Bach durch grüne Felder fließen. Mitten im Kampf jedoch … der Stab wirbelte in seinen Händen herum, und heftiger Schmerz explodierte in meinen Eingeweiden … sind Gedanken ein Luxus, und das Handeln muss von gut geschärften Instinkten bestimmt sein. Deshalb gib acht. Ein weiterer Hieb krachte gegen meine Schienbeine. Und lass dich verflucht noch mal nicht ständig ablenken …
Darauf folgte ein Durcheinander aus Militärdienst und Schlachten, vermischt mit flüchtigen Eindrücken eines Lebens. Ich spürte die Zuneigung Sho Tsais einer Frau gegenüber, deren Miene und Worte stets ernst waren, weswegen er sie nur noch mehr liebte. Zwei lärmende Kinder spielten in einem bescheidenen, aber gut gepflegten Garten. Der Anblick ging jedoch beinahe sofort in Chaos über – der Garten von Unkraut überwuchert, das Haus dunkel und leer, bis auf die drei Leichen darin, die, wie ich wusste, einer Seuche zum Opfer gefallen waren, von denen die Reiche der Kaufmannskönige regelmäßig heimgesucht wurden. Danach noch mehr Schlachten, Banditen und allerlei Abschaum, von seiner Klinge gefällt, während er einen Trupp Männer in roten Rüstungen von einer Ecke des Ehrwürdigen Königreichs zur anderen führte. Der Tumult beruhigte sich, als die Erinnerung erneut bei dem Lehrer mit der abweisenden Miene stehen blieb, neben ihm eine andere Gestalt, deren Gesicht verschwamm, wenn ich versuchte, den Blick darauf zu richten. Die Gestalt war von einem seltsamen Schimmern umgeben – ein verborgenes Juwel des Wissens, das von großer Bedeutung war. Wenn ich danach griff, entzog es sich mir, und ich wurde von einem kalten, Schaudern erfasst. Nur für einen Moment betrachtete ich die Welt mit zwei Paar Augen, teilte meinen Geist mit einem anderen Bewusstsein, das sich gegen mich warf wie ein Gefangener gegen die Gitterstäbe seiner Zelle.
Du bist immer noch da, erkannte ich, als das Bewusstsein schwächer wurde, sich in den Morast der Erinnerungen zurückzog und das Juwel des Wissens mit sich nahm. Was verbirgst du vor mir?
Ich blinzelte und sah die flehend leuchtenden Augen der Himmelsdienerin auf mich gerichtet, während sich die Dolchklinge in ihre Haut grub. »Halt!«, fauchte ich, worauf der Stahlhast innehielt. Alle starrten mich an. Ich trat näher und winkte die Krieger mit einer Handbewegung fort. »Verschwindet. Ich habe mit dieser Frau noch etwas zu besprechen.«
Der kauernde Krieger stieß ein Knurren aus, als er sich erhob. Sein Gesicht war angespannt, und die Brauen waren finster zusammengezogen – der geborene Mörder, der wütend war, weil ihm sein Opfer genommen wurde. »Du hast mir gar nichts zu befehlen, verfluchter Südländer!«, sagte er, und seine Finger zuckten am Griff seines Dolches.
»Du warst in der Schlacht der drei Flüsse«, sagte ich und legte den Kopf schief. Beim Klang seiner Muttersprache, so fließend gesprochen, wie es kein Südländer vermochte, legte sich die Wut des Stahlhast. Allerdings kehrte sie sogleich mit Macht zurück, als ich lächelnd hinzufügte: »Du bist vor Obvars Klinge geflüchtet. Er konnte die Scheiße riechen, die aus deinem feigen Arsch kam.«
Die Veteranin streckte die Hand aus, um den Krieger zurückzuhalten, aber es war zu spät. Ohne Zögern und mit beeindruckender Flinkheit machte der Mann einen Satz nach vorn. Blitzschnell stieß sein Dolch nach meiner ungeschützten Brust. Ich hatte die Klinge ablenken und ihn bewusstlos schlagen wollen, aber meine Hülle hatte eine andere Idee. Meine Hände bewegten sich wie von selbst, packten das Handgelenk des Kriegers, drehten es herum und brachen es wie einen Zweig, bevor sie die Waffe senkrecht nach oben stießen. Der Dolch traf den Krieger unterm Kinn. Die lange, spitze Klinge fuhr bis tief in sein Hirn hinein. Im Kampf muss das Handeln von gut geschärften Instinkten bestimmt sein, dachte ich und knurrte zufrieden. Von der Statur her mochte diese Hülle nicht überragend sein, aber sie war eindeutig nützlich.
Ich riss den Dolch heraus, ließ den Leichnam zu Boden fallen und wirbelte herum, um den anderen Stahlhast entgegenzutreten, die alle einen Schritt zurückgewichen waren und ihre Säbel halb gezogen hatten.
»Wenn ihr gegen mich kämpft«, sagte ich und richtete die blutige Klinge auf das vernarbte Gesicht der Veteranin, »kämpft ihr gegen die Dunkelklinge. Wollt ihr das wirklich?«
Die Frau biss die Zähne zusammen und funkelte mich wütend an, aber ihre Vernunft gewann sogleich die Oberhand über ihren Zorn, und sie wandte den Blick ab. »Sie muss trotzdem sterben«, murmelte sie und bedeutete den anderen, den Leichnam ihres unvorsichtigen Kameraden aufzuheben. »So lautet sein Befehl.«
Ich wartete, bis ihre Schritte verklungen waren, bevor ich neben der Himmelsdienerin in die Hocke ging. Ihr flehender Blick war nun von Argwohn verfinstert, und sie wich vor mir zurück. »Bruder?«, sagte sie und runzelte die staubverschmierte Stirn, während sie mein Gesicht musterte.
In dem Moment fiel mir ihr Name ein. Ich pflückte ihn aus dem Chaos der Erinnerungen. In den Tiefen meines Geistes verspürte ich leichte Verärgerung, an der Stelle, wo sich die Seele der gestohlenen Hülle befand. »Mutter Wehn«, sagte ich und streckte eine Hand aus. »Kommt, ich helfe Euch hoch.«
Ihr Blick ging von meiner Hand zu meinem Gesicht, und aus Argwohn wurde Gewissheit. »Ich kenne Sho Tsai seit zwanzig Jahren«, murmelte sie leise und wütend. »Du trägst zwar sein Gesicht und sprichst mit seiner Stimme, aber seine Seele besitzt du nicht. Ich kenne meinen Bruder.«
Ein reumütiges Lächeln umspielte meine Lippen, und ich senkte die Hand. »Nein, seine Seele besitze ich nicht. Aber dafür seine Erinnerungen.« Sie rutschte ein Stück zurück, als ich näher kam. Ihre Widerstandskraft war beeindruckend, obwohl sie vor Furcht zitterte. »Der Tempel der Speere«, sagte ich. »Mein alter … Lehrer dort hat mir einmal etwas gegeben. Was war es?«
Sie holte Luft und schloss die Augen, ihre Lippen bewegten sich, während sie wieder ihre Gebetslitanei flüsterte. Die Worte waren jetzt andere, doch sie sprach sie mit noch tieferer Gewissheit. »Der wahre Himmelsdiener kennt keine Furcht. Der wahre Himmelsdiener kennt keinen Schmerz …«
Zwei Hiebe über Kreuz auf die Fußsohlen. Ich packte ihren Knöchel. Immer ein guter Anfang.
Sie fuhr mit ihrer Litanei fort, selbst als ich die Klinge auf die nackte Haut ihres Fußes drückte. Die Worte flossen weiter, ohne das leiseste Wimmern. Ich hielt den Dolch fest umklammert, verwundert darüber, dass meine Hände sich weigerten, den Hieb auszuführen. Bist du das?, fragte ich Sho Tsai. Hatte er mich irgendwie mit seinen südländischen Skrupeln angesteckt? Gnade ist Schwäche, erinnerte ich mich. Mitleid ist Feigheit. Weisheit ist Lüge. Die Lehren der Priester – für mich hatten sie immer das Wesen der Stahlhast zum Ausdruck gebracht, auch wenn die Dunkelklinge verboten hatte, sie laut auszusprechen. Aber jetzt hatten sie jede Bedeutung verloren. Sie konnten meine Hände nicht dazu bringen, sich zu bewegen. Ich verspürte einfach nicht den Wunsch, dieser Frau wehzutun. Der Tod bringt Veränderungen mit sich, selbst für den mächtigen Obvar.
»Erzähl es mir einfach«, sagte ich und ließ die Frau los. »Bitte.«
Sie hielt in ihrer Litanei inne und öffnete die Augen. Allmählich gewann ihre Furcht doch die Oberhand. Tränen strömten ihr aus den Augen und bildeten Rinnsale im Schmutz auf ihren Wangen. Sie zitterte vor Angst, schüttelte aber dennoch den Kopf. Vielleicht waren es ihre Tränen, die den Ausschlag gaben. Vielleicht erzeugten sie ein Echo in Sho Tsais Geist, wühlten Gefühle darin auf, sodass ich die gesuchte Erinnerung fand.
»Du warst dabei«, erkannte ich, während die Bilder klarer wurden. Mit einem strahlenden Lächeln in ihrem verjüngten Gesicht stand Mutter Wehn in der Nähe und betrachtete den Jüngling an der Seite des Lehrers – einen Jüngling, den der General in den folgenden Jahren kennen- und lieben gelernt hatte.
Führe ihn, lehre ihn, sagte der Lehrer. Und vor allem: Beschütze ihn.
• • •
»Kein einziger Hinweis?«
Ein glänzendes Schweißrinnsal tröpfelte am Hals des Erlösten hinab, während er den gesenkten Kopf schüttelte. »Nichts mehr, seit wir den eingestürzten Tunnel gefunden haben, Dunkelklinge.«
»Und beim Kanal?«
»Nur die Leichen, Dunkelklinge.«
Kehlbrand wandte sein ausdrucksloses Gesicht wieder der röhrenförmigen Apparatur auf dem Dreifuß zu und drückte sein Auge gegen das schmale Ende. »Die Leichen«, murmelte er, »aber nicht das Pferd.« Er schwenkte die Apparatur hin und her und suchte die Landschaft unter uns ab. Ich war die zahlreichen Stufen bis zur Spitze des Turms hinaufgestiegen und hatte Kehlbrand im Gespräch mit dem schwitzenden Mann vorgefunden, einem Bewohner der Grenzlande, seiner Kleidung nach zu urteilen, die zwar robust war, aber nicht zum Kämpfen geeignet. Er war wenige Jahre jünger als ich, oder vielmehr als Sho Tsai, und besaß das schlanke, aber kräftige Aussehen eines Mannes, der sein Leben größtenteils in der Wildnis verbrachte.
»Ich«, begann der Erlöste und schluckte, bevor er weitersprach, »ich schloss daraus, dass die Fremdländer voneinander getrennt wurden, Dunkelklinge. Ein paar von ihnen verfolgte ich zur Gräberstraße; die anderen sind noch auf dem Kanal.«
»Er ist nicht auf dem Kanal«, sagte Kehlbrand und wandte sich vom Fernrohr ab. »Deswegen das fehlende Pferd.« Er starrte den Erlösten einige Herzschläge lang an, was diesem wahrscheinlich viel länger vorkam, bevor er sich mir zuwandte.
»General«, sagte er. »Darf ich dir Meister Lah Vo vorstellen, den berühmtesten Jäger der Nordpräfektur?«
Ich tauschte eine flache Verbeugung mit dem Erlösten aus, der mir offenbar genauso ungern in die Augen sah wie Kehlbrand.
»Es heißt, Lah Vo kann einen Dolchzahn fünf Meilen gegen den Wind riechen und hätte als kleiner Junge nur mit einer Steinschleuder bewaffnet einen Bären erlegt«, fuhr Kehlbrand fort. »Und doch kann er von meiner Schwester oder dem Namensdieb nicht die geringste Spur entdecken.«
»Schick mich«, sagte ich. »Ich habe mit ihm noch eine Rechnung offen, wie du weißt.«
»Du musst eine Armee ausbilden.« Kehlbrand trat zu Lah Vo, der erschauerte, als er ihm auf den Rücken klopfte und ihn zur Treppe führte. »Keine Sorge, mein Freund. Der Namensdieb ist gerissen und meine Schwester ebenfalls. Ruh dich aus und erhole dich. Ich werde schon bald neue Beute für dich haben.«
Kehlbrand wandte sich wieder dem Fernrohr zu, während die Schritte des erleichterten Jägers verklangen. »Dieses Miststück von den Ostra sollte ihn eigentlich erledigen«, hörte ich Kehlbrand murmeln. »Die Melodie war eindeutig. Jetzt höre ich nichts mehr.«
»Du wirst ihn sicher schon bald wiedersehen«, warf ich ein. »Al Sorna erschien mir nicht wie ein Mann, der vor seinen Gegnern davonläuft.«
Kehlbrand lachte leise. »Höre ich da etwa Respekt, alter Freund?«
»Ein Mann sollte seinen Feind kennen.«
»Du hast es auf einen zweiten Versuch abgesehen, was? Aber da muss ich dich leider enttäuschen. Babukir hat seine Strafe schon fast abgebüßt, und ich muss eine Verwendung für ihn finden.« Er trat vom Fernrohr zurück und musterte mich fragend. »Ich habe das Gefühl, du willst mir etwas sagen. Was ist es?«
»Ich habe mich an etwas erinnert, etwas, das der General wusste. Einen Namen, der wichtig ist.«
Kehlbrand grinste belustigt und trat näher, vermutlich um wieder auf mich herabschauen zu können. »Und was für ein Name ist das?«
Für ihn bin ich immer noch bloß ein Hund, dachte ich. Der seinem Herrn treu seine Beute bringt. Doch ein böser Hund kann eine zu vertrauensselige Hand beißen. Aber dafür muss ich zuerst sein Vertrauen gewinnen. »Der Name«, sagte ich, »des verlorenen Erben des Smaragd-Kaiserreichs.«
Erstes Kapitel
Er spürte, wie Ahm Lin starb, während er trank. Ein schwaches, kaum merkliches Ausatmen und ein letztes Erschauern, dann war sein Freund tot.
Vaelin unterdrückte die Verzweiflung, die in ihm aufsteigen wollte, und saugte die letzten Blutstropfen auf, die aus der Wunde des Steinmetzes flossen. Die dicke, metallisch schmeckende Flüssigkeit strömte in seinen Mund und brachte ihn zum Würgen. Widerwillig zwang er sich, sie hinunterzuschlucken. Schon als die ersten Tropfen seinen Magen erreichten, blühte die Gabe in ihm auf. Blitzschnell breitete sie sich in ihm aus und brachte ein Lied mit – eines, das eher einem Schrei glich.
Ohrenbetäubend laut und schmerzhaft füllte die Musik seinen Geist. Tonkaskaden überlagerten sich und ergaben trotz ihrer hässlichen Dissonanz eine Form von Melodie, in der eine feste Gewissheit lag: Der Tod nähert sich von allen Seiten. JETZT!
Vaelin sprang von Ahm Lins Leichnam weg, ging in die Hocke und duckte sich unter einem durch die Luft pfeifenden Säbel hindurch, dessen Besitzer – ein riesiger, von Kopf bis Fuß in eine Rüstung gehüllter Stahlhast – aus dem hohen Gras der Kanalböschung hervorgestürmt kam. Fluchend versuchte der Krieger es ein weiteres Mal. Er packte den Säbel mit beiden Händen und stach damit nach Vaelins Brust. Wieder schrie das Lied in Vaelins Geist auf, während sein Blick an den zerfurchten Zügen des Kriegers hängen blieb. Die Melodie erzählte von einem Mann, der in seinem Leben schon viel Blut vergossen hatte und sich in Momenten der Gewalt am wohlsten fühlte. Der überall in der Eisensteppe und den Grenzlanden gekämpft, getötet, vergewaltigt und geplündert hatte. Der nach noch mehr Gemetzel gelechzt hatte, als die Horde ins Herz des Ehrwürdigen Königreichs eindrang. Und der es außerdem versäumt hatte, das kleine Stück Blech an seiner Rüstung zu ersetzen, das er während des Angriffs auf Keshin-Kho verloren hatte. Direkt über der linken Hüfte. All das schrie das Lied innerhalb eines Herzschlags in Vaelins Geist.
Als der Stahlhast vorsprang, drehte Vaelin sich weg, sodass die Säbelklinge nur einen Zoll vor seiner Brust vorbeizischte. Dann stieß er seine Schwertspitze in die Lücke in der Rüstung des Kriegers. Die Klinge bohrte sich tief hinein, durchschnitt Adern, Sehnen und Knorpel und zertrennte die Verbindungen zwischen Bein und Hüfte. Mit einem erschrockenen Schrei brach der Krieger zusammen. Zornig starrte er zu Vaelin hoch. Seine Lippen formten einen letzten trotzigen Fluch. Vaelin zog seine Klinge heraus und schlug noch einmal zu. Das letzte Wort des Kriegers wurde von dem Blutstrom erstickt, der aus seinem Mund hervorsprudelte.
Das Kreischen des Liedes ließ Vaelin zur nächsten Bedrohung herumfahren – noch zwei Krieger der Stahlhast stürmten nur wenige Meter entfernt aus dem hohen Gras. Vaelin hackte zweimal schnell auf den Hals des Sterbenden ein und packte den behelmten Kopf des Mannes, der sich von den Schultern löste. Dem ersten Krieger, der aus dem Gras hervorrannte, schleuderte Vaelin den abgetrennten Kopf entgegen. Das Geschoss traf den Mann mitten ins Gesicht, und er taumelte überrascht und vom Blut geblendet rückwärts. Er konnte sich gerade noch die rote Masse aus den Augen wischen, bevor Vaelins Schwertspitze eines davon durchbohrte. Die Klinge fuhr durchs Hirn des Mannes, ehe ihm überhaupt bewusst wurde, dass er tot war.
Vaelin trat die zuckende Leiche beiseite und zog noch rechtzeitig sein Schwert aus der Augenhöhle des Toten, um den Hieb des zweiten Kriegers abzuwehren. Bevor der Stahlhast Gelegenheit hatte zurückzuweichen, sprang Vaelin dicht an ihn heran und hämmerte ihm die Stirn gegen die ungeschützte Nase. Dann griff er sich den Dolch aus dem Gürtel des Mannes, wirbelte herum und hieb die Klinge in die ungepanzerte Rückseite seines Oberschenkels.
Wieder schrillte das Lied, und Vaelin warf sich ins Gras, als auch schon eine Salve Pfeile kreuz und quer durch die Luft jagte. Der unglückselige Stahlhast, der noch auf den Beinen war und stolpernd den Dolch aus seinem Oberschenkel zu ziehen versuchte, wurde von drei Pfeilen in die Brust getroffen. So mühelos wie die stählernen Spitzen Rüstung und Kettenhemd durchschlugen, waren sie offenbar aus nächster Nähe abgeschossen worden. Während Vaelin auf dem Bauch davonkroch, hörte er das erstickte Todesröcheln des Kriegers. Schreie hallten vom Ufer herüber, das in Nebel gehüllt war. Hin und wieder war auch das Sirren von Bogensehnen und das Zischen abgeschossener Pfeile zu hören, aber keiner davon kam in seine Nähe.
Es ist anders, dachte Vaelin und zuckte zusammen, als die schrille Melodie des Liedes erneut ertönte. Die Tonhöhe schwankte unablässig, mal zischend wie eine Schlange, mal kreischend wie ein Falke in Not. Bei jedem Anschwellen wurde Vaelin schwarz vor Augen, und sein Herzschlag beschleunigte sich. Zudem war er von einem Hunger erfüllt, den er bislang nur selten verspürt hatte, der ihm aber dennoch nicht ganz unvertraut war. Zum ersten Mal hatte dieses Gefühl damals im Martisch von ihm Besitz ergriffen, als sein Freund im Sterben lag und Vaelin den Bogenschützen verfolgte, der ihn niedergeschossen hatte. Blutdurst war es, was das Lied mit sich brachte – den Wunsch zu töten. Es ist ein anderes Lied, wurde ihm mit zunehmender Gewissheit bewusst. Nicht mein Lied. Nicht das Lied, das er im Jenseits zurückgelassen hatte, als er in Alltor fast verblutet wäre. Nicht das Lied, nach dem er sich seither gesehnt hatte.
Wieder schwoll die Melodie des neuen Liedes in ihm an, und er hielt inne. Diesmal klang es nicht ganz so schief und weckte auch keinen Hunger in ihm. Stattdessen besaß es einen säuerlichen Ton, ein widerwilliges Trommeln der Begrüßung.
Der Huf des Pferdes stampfte nur wenige Zoll von seinem Kopf entfernt ungeduldig auf den Boden. Vaelin schaute hoch und verzog das Gesicht, als ihn ein Schwall heißen Dampfs aus Derkas Maul traf. Der Hengst legte den Kopf schief und blickte Vaelin auffordernd an. Dann schüttelte er den Hals, sodass die Zügel herabfielen.
»Ja«, knurrte Vaelin und griff nach den Zügeln. »Ich freue mich auch, dich zu sehen.«
Ein frischer Chor Schreie brach los, als er sich in den Sattel schwang, rasch gefolgt von einer weiteren Pfeilsalve. Die Pfeile trafen nur Luft, weil Derka ihn schon aus der Schussbahn getragen hatte. Der Hengst ging von selbst in den Galopp über und stürmte in den Nebel hinein. Das Lied schrillte warnend, kurz bevor eine berittene Kriegerin der Stahlhast, die eine Doppelaxt über dem Kopf wirbelte, direkt vor Vaelin aus dem Nebel preschte. Er packte die Zügel fester und wollte Derka links an der großgewachsenen Reiterin vorbeilenken, aber der Hengst hatte seinen eigenen Kopf. Erde und zerfetztes Gras spritzten auf, als er stehen blieb und wiehernd auf die Hinterbeine stieg. Das harte Krachen von zersplitternden Knochen ertönte. Derkas Huf sauste auf den Kopf des gegnerischen Pferdes nieder und schickte es mitsamt seiner Reiterin zu Boden.
Vaelin gab Derka die Sporen, aber das Lied schwoll erneut an, diesmal nicht ganz so laut, doch dafür umso schmerzhafter. Die Töne waren hart und eindringlich, schienen tief in sein Innerstes vorzustoßen und Bilder von der Belagerung in ihm wachzurufen: Die Soldaten unter seinem Befehl, die nun der Horde der Dunkelklinge zum Opfer fielen. Ahm Lins bleiches, flehendes Gesicht am Ende. Bitte … mein Geschenk an dich …