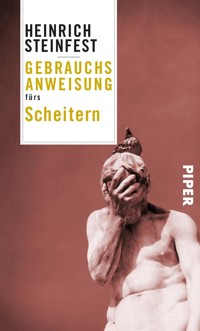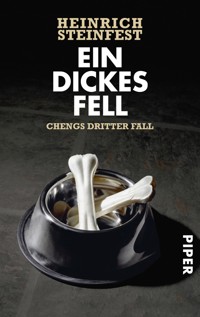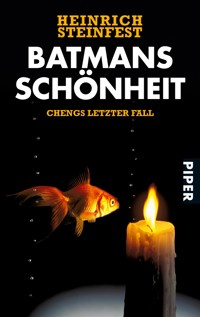19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein geheimes Buch und ein lebensverändernder Auftrag Wenn einer alles hat und alles aufgibt Ashok Oswald hat diesen Pool bauen lassen, nachdem er im Alter von 45 Jahren zu einem beträchtlichen Vermögen gekommen war. Wie jeden Morgen zieht er seine Bahnen durch das kühle Wasser, doch dieser Morgen ist besonders: Drei Fremde zwingen ihn, sein Ritual zu unterbrechen und das Manuskript herauszugeben, das Peter Bischof ihm vor vielen Jahren anvertraute. Ashok händigt es aus, aber was ist so bedeutsam an diesem Buch, dass sie zu allem bereit scheinen? Um das herauszufinden, gibt Ashok sein altes Leben auf. Ein abgründiger Roman, in dem Literatur und Leben sich aufs Originellste kreuzen. »Steinfest erzählt lustvoll, klug, mitreißend.« SZ »Ungewöhnliche Protagonisten, prachtvolle Stories und eine sehr sorgfältig gewählte Sprache.« FAZ
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Coverillustration: Heinrich Steinfest
Covergestaltung: zero-media.net, München
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Teil 1
1
2
3
4
5
6
7
8
Teil 2
9
10
11
12
13
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Teil 1
1
Ashok Oswald saß in seinem Haus und dachte nach. Dabei tat ihm der Rücken weh. Freilich nicht vom Denken, sondern davon, die vergangene Nacht in einem großen Verpackungskarton zugebracht zu haben. So wie mitunter obdachlose Menschen dazu gezwungen waren, wenn sie vor der Kälte und den Widrigkeiten einer Nacht in die leidliche Geborgenheit einer lebensgroßen oder zumindest halbwegs lebensgroßen Schachtel flüchteten und in Decken oder Müll gepackt den Schlaf suchten.
Allerdings war Oswald alles andere als obdachlos, vielmehr war er das Gegenteil. Das Haus, in dem er lebte und das ihm gehörte, war eines der prächtigsten und originellsten dieser an prächtigen und originellen Häusern nicht ganz armen reichen Gegend.
Der Karton, in den sich Ashok Oswald für eine Nacht gelegt und der ihm seinen Rückenschmerz beschert hatte, befand sich in einem der Räume an der Rückseite des Hauses, die hinaus auf das weite Grundstück mit den hohen alten Bäumen führte. Es waren jene Räume, die Oswalds Kunstsammlung beherbergten, manches äußerst Berühmte, manches demnächst Berühmte. Durch diese Räume war Oswald spät am Abend flaniert, in völliger Einsamkeit, ohne seine Frau, die ihn am Nachmittag verlassen hatte, und auch ohne seinen Leibwächter, dem er nur eine Stunde später kündigte. Wobei das eine nicht mit dem anderen in Verbindung stand. Oder nur insofern, als dass er endlich und wirklich allein sein wollte. Von Menschen verlassen, nachdem er sich eine Woche zuvor auch von seinen beiden Hunden getrennt hatte, und zwar keineswegs schweren Herzens. Er hatte den zweien nie so richtig getraut. »Hunde reicher Leute«, hatte er, der selbst so Vermögende, einmal erklärt, »sind wie Kellner in Nobelrestaurants. Sie verachten dich, während sie sich vor dir verbeugen. Im devoten Blick – dem der Hunde und dem der Kellner – liegt ein Verrat. Kein Aufbegehren, keine Revolution, aber ein Verrat.«
Er war also froh, die Hunde los zu sein, ebenso wie seinen Leibwächter. Und dass er seine Frau los war, konnte man bedauerlich nennen, sogar traurig, bedeutete aber im wahrsten Sinne eine Lösung.
Zwar gab es noch eine Köchin und einen Gärtner, aber die kehrten an den Abenden zu ihren Familien zurück, und auch sein Chauffeur lebte nicht im Haus. Für die Reinigung wiederum erschien dreimal die Woche ein Trupp junger Männer, die aus irgendeinem Krieg stammten, deren Auftragslage sich aber vom Töten hin zur Gebäudereinigung entwickelt hatte.
Er war somit an diesem Abend völlig alleine im Haus gewesen, als er die Räume seiner Sammlung durchschritt und dann eine ganze Weile vor dem kleinen, überaus delikaten Bildnis von Tintoretto stehen blieb, das er mit einer abstrakten Komposition von Piet Mondrian zusammengetan hatte. In der Tat sprach er gerne davon, er habe das eine Bild mit dem anderen gekreuzt. Er sagte, man könne das gut sehen, wie hier die farbigen Flächen des modernen Meisters in die Gesichtskonturen des alten Meisters übergingen und umgekehrt und dabei so etwas wie ein neues Wesen entstehe.
Es war ein langer Tag gewesen, der mit einem Gespräch mit seinem Anwalt geendet hatte – denn letztlich endete alles bei den Anwälten, sie waren die Pathologen und Totengräber des Lebens. Erschöpft löste sich Oswald von der Tintoretto-Mondrian-Kreuzung, die vor seinen Augen ein wenig verschwamm, sodass das »neue Wesen« die Gestalt einer Impression annahm. Eigentlich wollte er jetzt hinüber in den Wohnbereich zurückkehren, da fiel sein Blick auf ein Objekt, das er erst kürzlich erstanden hatte. Die Installation eines jungen Künstlers, den noch kaum jemand kannte. Und die an den Hyperrealismus der Pop-Art erinnerte, als einige Amerikaner das Ambiente des Alltags in ein Kunstwerk verwandelten, von der Suppendose bis zu täuschend echt aussehenden Menschen aus Glasfaser und Polyesterharz.
Oswald hatte die Installation direkt aus dem Atelier des jungen Künstlers erstanden, einen langen, fleckigen IKEA-Karton, der der Länge nach auf dem Boden lag, mit aufgeklapptem Deckel, während an den Seiten zwei grob geschnittene Gucklöcher klafften. Im Inneren befand sich eine Figur, deren Beine aus dem Karton herausstanden. Die Beine einer lebensgroßen Kasperlfigur, mit roten Schnabelschuhen an den Füßen und einem mit verschiedenfarbigen Karos gemusterten Beinkleid. Allerdings zeigten auch diese Hose und diese Schuhe – dazwischen löchrige gelbe Socken – Spuren langer Nutzung unter harten Bedingungen. Wäre in diesem Karton einer dieser perfekt nachgemachten Menschen etwa eines Duane Hanson gelegen, es wäre weniger unheimlich gewesen als diese lebensgroße und vom Leben gezeichnete Kasperlfigur, auch dadurch, dass man deren Oberkörper und Gesicht nicht sehen konnte, sich aber gut die hölzerne Fratze dieser »lustigen Person« vorstellen konnte. Auf dem Karton stand mit dickem Filzstift der bekannte Spruch des Möbelhauses geschrieben: Entdecke die Möglichkeiten.
Es mochte verrückt sein, und Oswald dachte ja auch, wie verrückt es war, als er jetzt – er, der vierundsechzigjährige Chef eines internationalen Mischkonzerns – in die Knie ging, sich auf diese Knie fallen ließ und zu der Kasperlfigur in den Karton kroch.
Oswald fühlte sich unendlich müde, und irgendwie hatte dieser Ort bei aller Ungemütlichkeit – die Enge, der harte Untergrund – und trotz des spürbaren Horrors – das grinsende Puppengesicht – etwas von einer Zuflucht. Oswald legte sich auf die Seite, mit der rechten Schulter gegen den Boden, um sich auf diese Weise von dem Antlitz der Kasperlfigur abzuwenden, dessen große, schwarz umrandete Augen ebenso wie das kräftige Rot auf Backen und Nasenspitze aus dem Halbdunkel herausleuchteten.
Wenn Oswald jetzt hier lag, dann gewiss nicht, um nachfühlen zu können, wie es für einen Obdachlosen sein musste, in einem solchen Karton zu schlafen. Er hatte diese Skulptur ja nicht etwa wegen ihres sozialkritischen Impetus gekauft – dies wäre ihm so lächerlich wie kokett erschienen –, sondern schlicht, weil sie von einem unbekannten Künstler stammte und es zu Oswalds Ehrgeiz gehörte, das Unbekannte unter das Bekannte zu mischen und dank seines Namens als bedeutender Sammler eben auch diese zu kreuzen.
Und mit Kreuzungen kannte er sich nun wirklich aus. Sie hatten ihn reich gemacht, sie hatten ihm den Weg in eine ganz andere Welt geebnet als die, aus der er gekommen war. Nicht, dass seine ursprüngliche Welt die der zu Nachtquartieren umgewandelten Kartons gewesen wäre, also bittere Armut, aber doch etwas, was man einen bescheidenen Mittelstand nennen konnte. Sein Vater Michael Oswald war Mathematiklehrer an einem Wiener Gymnasium gewesen, der als achtzehnjähriger Soldat im Zweiten Weltkrieg eine Beinverletzung erlitten hatte, die ihn ein Leben lang beim Gehen behinderte. Er sagte nie »hinken« dazu, sondern nannte es nur sein »schweres Bein«. Seine größte Leidenschaft aber war das Schachspiel. Und als Schachspieler nahm er in der Nachkriegszeit an einigen Turnieren teilnahm. Dabei lernte er 1959 die Inderin Amrita Devi kennen, die sich auf dem Weg nach Plowdiw in Bulgarien befand, zum damaligen »Kandidatenturnier« für die Schachweltmeisterschaft der Frauen, wo sie als erste Inderin antreten würde. In Wien machte sie einen Zwischenstopp, um an einem Schauturnier teilzunehmen. Und dort, in Wien, praktisch an dem Tisch, auf dem sich das Schachbrett befand und ihr gegenüber der elf Jahre ältere Michael Oswald saß, blieb Amrita Devi hängen. Das war im Mai 1959.
Unglaublich, aber doch, sie blieb in dieser Stadt, verzichtete darauf, nach Bulgarien zu reisen, so sehr hatte sie sich in diesen Mann verliebt, den zu besiegen sie übrigens nur acht Züge benötigte. Michael Oswald war ein begeisterter Amateur, aber bei Weitem kein Großmeister oder was an sprachlichen Übertreibungen der Schachsport auch immer zu bieten hatte. Amrita Devi hingegen ein Schachgenie, und es ist schwer zu sagen, was sie noch alles an Erfolgen errungen hätte – zum Beispiel die Dominanz der Sowjetrussinnen durchbrechen –, hätte sie diesen Mann nicht auf der anderen Seite eines Schachbretts kennengelernt. Um sich während dieser acht Züge und dieses Schachmatts in ihn zu verlieben. Und er sich in sie, gar keine Frage, so ernüchternd seine Niederlage gewesen war. Für den Schachspieler, nicht den Mann. Wobei es nicht nötig gewesen wäre, dass Amrita darum auf das Kandidatenturnier in Bulgarien verzichtete. Das war geradezu ein Klischee, eine Frau, die eine Karriere für einen Mann aufgab. Allerdings gab sie ja nicht etwa ihre Karriere für die seine auf, vielmehr entschied sie ganz einfach, in Wien zu bleiben, schwanger zu werden, soweit man das entscheiden konnte, und einen Sohn auf die Welt zu bringen, der zwar den Nachnamen des Vaters, aber durchaus einen indischen Vornamen tragen sollte. Was durchzusetzen gegen die österreichische Bürokratie der späten Fünfzigerjahre gar nicht so einfach war. Doch es gelang. Der Junge, der 1960 das Licht der Welt erblickte, würde den Vornamen Ashok tragen. Was so viel wie der Sorglose bedeutet und ein wenig ein Witz war angesichts eines irdischen Daseins, das eher das Gegenteil aller Sorglosigkeit darstellt. Außer vielleicht das Dasein zweier ineinander verliebter Schachspieler. Doch ein Schachspieler sollte Ashok trotz aller genetischer Einflüsse und elterlicher Einflüsterungen nicht werden. Das mochte bitter für Mutter und Vater sein, denn das Kind, das natürlich so früh wie irgend möglich an dieses »Kriegsspiel« aus Königen und Königinnen, Tieren, Bauwerken, Sportlern und einer Menge von Leuten aus der Landwirtschaft herangeführt wurde, zeigte durchaus das aus Logik, Gedächtnis und Vorausschau bestehende Talent, jedoch keinerlei Leidenschaft für diese Verfrachtung einer kämpferischen und intriganten Welt auf ein ziemlich geordnetes Brett. Das Spiel seiner Eltern – das auf gewisse Weise auch ein Liebesspiel war – langweilte ihn. Als Kind wie als Jugendlichen. Und als er schließlich vierzehn oder fünfzehn war und ihn die Pubertät bei allen Unsicherheiten und merkwürdigen Gefühlen auch zu einer gewissen Freiheit der Entscheidungen führte, verweigerte er es gänzlich, sich weiterhin an dieses Brett im Stile einer zu Boden gesunkenen Zielflagge zu setzen, das seinen Eltern so viel bedeutete.
Sein Vater geriet dann in seinen Fünfzigern in eine fatale Geschichte, die ihn seinen Lehrerjob kostete – er hatte einen Schüler geohrfeigt, der während eines Vortrags eine Naziparole gebrüllt hatte. Leider hatte die Ohrfeige des eigentlich recht zarten Herrn Oswald den Schüler zwei Zähne gekostet. Niemand konnte ahnen, dass Michael Oswald in seinen Jugendjahren geboxt hatte und auch nach dem Krieg und trotz seines Hinkens in der Federgewichtsklasse ein ziemlich passabler Rechtsausleger gewesen war.[1]
Ein Wechsel an eine andere Schule kam aus disziplinarischen Gründen nicht infrage, aber ohnehin war Oswald froh, den ungeliebten Lehrerjob aufgeben zu können und sich einen Traum zu erfüllen, der darin bestand, zusammen mit seiner Frau ein kleines Fachgeschäft für Schachbretter, Schachfiguren und Schachliteratur zu eröffnen, wo in einem Nebenraum auch Kurse für interessierte Laien angeboten wurden. Das war wahrlich keine Goldgrube, der wirtschaftliche Erfolg gering, aber die Freude der beiden Betreiber an ihrem Geschäft beträchtlich. Denn obgleich Amrita Devi, die nun Amrita Oswald hieß, ihre gerade erst begonnene Karriere mit der Geburt des kleinen Ashok und dem Umzug nach Wien aufgab – sehr zum Ärger ihrer Familie, die diese Ehe ebenso ablehnte wie den Umstand eines Mischlingskindes –, wurde sie eine ausgezeichnete Schachlehrerin. Von der auch jenes kleine Schachlehrbuch stammte, das den ungewöhnlichen Titel Wie ich eine Partie eröffne und sie mit Würde und Anstand zu einem guten Ende führe trug. Kein Bestseller, aber doch ein Werk, von dem Bobby Fischer einmal meinte, es sei auf eine wunderbare Weise durchgeknallt.
Ashok entledigte sich also in jugendlichen Jahren des Schachspiels und würde bis zum Ende seiner Tage nicht wieder zu diesem beflaggten Brett zurückkehren. Soweit man das sagen konnte, denn sein Leben war ja noch nicht ganz abgeschlossen, als er in dieses Kartonobjekt eines jungen unbekannten Künstlers schlüpfte, um dort einzuschlafen und die Nacht zu verbringen.
Aber wie war er reich geworden? Ein wahrhaftig reicher Mann! Wie man vielleicht sagte, ein wahrhaftig starker Regen oder ein Sommer bis zum Umfallen. Somit ein Extrem bezeichnend. So wie man auch sagt, Picasso war ein Genie, obwohl er eigentlich nur Maler war.
Ashok Oswald war zu einem dieser Leute geworden, die mit einem Fingerschnippen einen unsinnig großen Pool in ihren auch nicht ganz kleinen Garten setzen konnten und genau aus dieser Unsinnigkeit der Größe eine gewisse Freude bezogen. Gleich einer Katze, die einen Vogel fängt, im Maul durch die Gegend trägt, aber rein gar keinen Hunger auf ihr Opfer verspürt. Allerdings muss schon erwähnt werden, dass Oswald den unsinnig großen Pool, der im Zentrum seines von hohen, alten Bäumen herrschaftlich dominierten Gartens gleichsam als eine blaue Wunde in dunkler Erde klaffte, durchaus benutzte. In ihm schwamm. Tag für Tag. Jeden Morgen und jeden Abend. Seinen in über sechs Jahrzehnten gereiften, das Leben und die Umstände des Lebens aushaltenden Körper frühmorgens wie spätabends in dieses gechlorte Poolwasser fügte wie eine sich wiederholende Spur in einem Kriminalfall.
Er sagte gerne: mein zweiter Pool. Und sagte es nicht ohne einen Ausdruck von Bedauern. Denn bereits vierzig Jahre zuvor hatte er an dieser Stelle einen ersten Pool errichten lassen, und zwar mit einer gefliesten Verkleidung aus verschiedenen Natursteinen, als das noch gar nicht Mode gewesen war. Nämlich auf diese oder ähnliche Weise zur Natur zurückkehren zu wollen. Gleich Schmetterlingen, die wieder Larven sein möchten. Allerdings ohne aufs Fliegen zu verzichten.
Er hatte diesen ersten Pool bauen lassen, nachdem er im Alter von vierundzwanzig Jahren mit einem Mal zu einem beträchtlichen Vermögen gekommen war. Nach einem Studium zum Lebensmittelchemiker an der Wiener Universität hatte er ein sogenanntes Praktisches Jahr an einer Lebensmittelbehörde zugebracht und in seiner Freizeit in einem eigenen kleinen Labor herumexperimentiert. Weniger wie ein Wissenschaftler, wie er selbst sagte, mehr wie ein Spieler oder sich selbst unterhaltender Künstler. Vor allem als Ausgleich zur behördlichen Lebensmittelüberwachung, die ihm wie langweilige Polizeiarbeit vorkam. Faktum war, dass er in seinem Labor, das er kokett »Atelier« nannte, eine Formel entwickelte, mit der sich die künstliche Zucht von Steinpilzen würde realisieren lassen. Denn Steinpilze mussten schließlich wie alle Mykorrhiza-Pilze eine Symbiose mit den Wurzeln von Fichten oder Eichen eingehen, weshalb Oswald ein Verfahren erfand, das einen Ersatz für diese Symbiose schuf und ernsthaft eine kommerzielle Produktion ermöglichte. Etwas, das er eine »Baumfälschung« nannte und in der Folge das Konzept dieser Fälschung – die aber zu vollkommen echten Steinpilzen in großen Mengen führen konnte – an einen bekannten Lebensmittelkonzern verkaufte. Das Eigentümliche, geradezu Unverständliche war, dass dieser Konzern Oswalds Formel niemals zur Anwendung brachte, was dann doch ein wenig an die Legende von geheimen neuen Antriebsmotoren erinnerte, die in den Schreibtischschubladen der großen Autohersteller verkümmerten, verwelkten und verdarben, um auch noch den letzten Tropfen Benzin unter die Leute zu kriegen.
Wieso aber dieser Verzicht auf eine hochprofitable Pilzzucht zugunsten der professionellen oder halb professionellen oder gänzlich touristischen Schwammerlsucher?
So geschah es also, dass Oswald eine beträchtliche Summe erhielt, die er sogleich in der vernünftigsten Weise in ebenjenes Unternehmen investierte, das ihn gerade bezahlt hatte, auch wenn es nie eine Steinpilzzucht betreiben würde. So wie es auch geschah, dass Oswald wenig später von Wien nach Köln umsiedelte, um in der Forschungsabteilung jenes Unternehmens zu arbeiten und am südlichen Rand der Stadt ein Grundstück zu erwerben, auf das er zunächst einmal nichts anderes setzte als diesen einen Pool aus verschiedenfarbigen, unterschiedlich stark geschliffenen und polierten Natursteinen. Während er sich im Stadtzentrum eine kleine Wohnung mietete und immer nur zum Schwimmen zu seinem Grundstück fuhr – wobei er gerne sagte, im Hinblick auf seine Eltern, die er ja durchaus liebte, sein Schachbrett sei das Wasser.
Aber dabei blieb es eben nicht. Irgendwann, beziehungsweise nicht irgendwann, sondern nachdem er mit knapp fünfunddreißig Jahren die Leitung der Forschungsabteilung übernommen hatte und damit auch in den Vorstand jenes Nahrungsmittelkonzerns aufgestiegen war (doch selbst da noch kein Wort über die Sache mit den Steinpilzen) und im Übrigen mit anderen Erfindungen im Nahrungsmittelbereich Furore machte – Gefrierkost, die nicht nur aus Spinat und Erbsen und Rosenkohl bestand –, entschied er sich, zu jenem wunderbaren Pool auch ein ebenso wunderbares Wohnhaus errichten zu lassen. Die Schwester des Pools, wie er das nannte, das Haus.
Dieses Haus im Süden von Köln wurde von einem japanischen Architekten erdacht und errichtet, ein ovaler Baukörper, dessen gerundete Fassade durch einen Wechsel aus Klinker und Kirchheimer Muschelkalk eine in der Nähe befindliche Industriellenvilla aus den 1920er-Jahren zitierte. Man könnte sagen, dass hier eine alte Haut über eine junge Konstruktion gezogen wurde. Aus diesem sachlichen Baukörper ragte auf der Rückseite ein gewaltiger Erker heraus, ein langer Gang, dessen hohe Scheiben den Blick zu beiden Seiten der Parkanlage öffneten und der an jener Stelle endete, an welcher der Pool begann. Der dann allerdings nicht mehr jener Pool war, der hier ursprünglich gewesen war. Denn noch während der Bauarbeiten an der Villa Oswald kam es zu einem dieser Vorfälle, die verrückt klingen, aber letztlich einfach nichts anderes darstellen als eine pure Laune der Natur. Eine Laune, die darin bestand, dass ein knapp drei Kilogramm schwerer Gesteinsbrocken, der seit viereinhalb Milliarden Jahren im All unterwegs gewesen war, in genau diesen Pool fiel. Welcher im Moment des Einschlags gerade ohne Wasser gewesen war. Und obwohl der Brocken mittels seines Erdeintritts einiges seiner ursprünglichen Größe eingebüßt hatte, wie diese viel zu dick geschälten Kartoffeln, richtete er dennoch einen beträchtlichen Schaden an dem steinernen Bassin an. Immerhin nicht an dem im Bau befindlichen Oval einer modernen Villa, und verletzte somit auch keinen der Arbeiter, die dort während des Impacts tätig waren.
Eine Pointe bestand sicherlich darin, dass der Wert dieses Steins noch einiges über dem des Pools lag. Dennoch weigerte sich die Versicherung, für den Schaden aufzukommen. So oder so musste der Pool rundum erneuert werden, wobei der Architekt der Villa dies übernahm und ein Bassin schuf, das die Fassade des Ovals widerspiegelte, so wie diese das benachbarte Baudenkmal zitierte. Der erkaltete Meteorit selbst gelangte schließlich unter einen Glassturz und mitten in Oswalds Kunstsammlung. Was jemanden einmal zu der Bemerkung verführte, dies sei so, als würde man in eine Anhäufung von Computermäusen auch eine richtige, natürliche Maus setzen.
Oswald hatte den Umstand, dass ein Stein aus dem All auf sein Grundstück und in seinen Pool gestürzt war, trotz aller Zerstörung und des Verlustes seiner ersten Anschaffung als ein gutes Omen aufgefasst. Weil er meinte, es liege eine gewisse Auszeichnung darin, von einem so alten und so lange schon unterwegs gewesenen Körper ausgewählt zu werden.
Und darum sollte später das Logo des Mischkonzerns, der unter Oswalds Leitung und dem Dach des Lebensmittelkonzerns entstand, die Form dieses Meteoriten erhalten. Ein geometrisierter Meteorit, dessen emblematische Gestalt so unterschiedliche Branchen wie Solaranlagen, Baumaschinen, Küchengeräte und Medizintechnik vereinte, aber auch einen Hersteller von Privatflugzeugen, den Marktführer in Sachen Golfausrüstung und natürlich den ebenfalls den Markt anführenden Produzenten von Tiefkühlkost. Sowie ein paar kleinere, dafür zukunftsweisende Technologieunternehmen. Während die Menschheit weiterhin davon träumte, wie es wäre, könnte man Steinpilze züchten. Wenn schon das Beamen niemals gelingen würde.
Für einen unheimlichen kleinen Moment hatte Oswald das Gefühl gehabt, der Arm der lebensgroßen Kasperlfigur hätte sich auf seine Schulter gelegt. Aber das war wohl nur der blaue Fleck an seiner Schulter, der sich soeben meldete und den er sich beim Tennis zugezogen hatte. Das war am Vortag gewesen, als er zusammen mit seiner Frau Christine im Doppel gegen ein befreundetes Ehepaar angetreten war und seine Frau, die so viel jüngere, das einstige Fotomodell, ihn mit ihrem Schläger getroffen hatte. Unabsichtlich, weil so was ja absichtlich kaum geschieht. Während es hingegen ganz sicher Absicht war, dass sich Christine am gleichen Abend mit ihrem Anwalt traf, nicht nur um sich zu besprechen, sondern auch um mit ihm ins Bett zu gehen. Nicht zum ersten Mal. Nur dass sie am Tag darauf endlich die Konsequenzen zog und ihrem Mann von dieser Affäre erzählte. Die keine Affäre, sondern eine Liebe sei, wie sie sagte. Und daran anschloss, dass er, Oswald, wohl kaum wisse, was das eigentlich sei, eine Liebe.
Er fand das übertrieben, auch wenn er sich erinnerte, dass seine erste Frau, mit der er zwei Kinder hatte, Söhne, die jetzt zwanzig und zweiundzwanzig waren, etwas Ähnliches geäußert hatte, als er sich von ihr scheiden ließ. Um nämlich Christine heiraten zu können.
Und während nun also auch Christine es auf diese Weise ausdrückte, »du weißt ja gar nicht, was Liebe ist«, hatte sie ein wenig melodramatisch die kleine Klimt-Zeichnung von der Wand genommen und in ihre große Tasche getan. Bevor sie erklärte, ihn zu verlassen und noch heute zu Christian zu ziehen.
»Findest du nicht«, sagte Oswald, »dass das lächerlich klingt, Christine und Christian? Abgesehen davon, dass unser Herr Anwalt doch genauso wenig Ahnung von der Liebe hat. – Und wieso den Klimt?«
»Den hast du mir geschenkt. Schon vergessen?«
»Die meisten Frauen nehmen ihren Schmuck mit.«
»Den habe ich bereits gestern eingepackt«, erklärte Christine.
Und das war’s dann auch. Sie vollzog auf ihren High Heels, mit ihren langen Mannequinbeinen, eine Halbdrehung, sodass Oswald nur noch ihren Rücken sah, als sie, den Klimt in der Tasche, bei der Türe des Ovals hinausmarschierte.
Er war sie also los. Und in das Gefühl des Bedauerns mischte sich auch ein Aufatmen. Denn wenn man alt war und sich einen jüngeren Partner aussuchte, war das einfach ein Fehler. Eine Übertreibung, eine Lächerlichkeit und führte in letzter Konsequenz immer zu etwas Jämmerlichem. Denn es war nun mal jämmerlich, dieser Versuch, mittels eines anderen Menschen eine Zeitreise antreten zu wollen. Zeitreisen waren unmöglich, das wusste jedes Kind.
Nicht ganz so lächerlich war Oswalds eigene Sicherheit. Immerhin bekleidete er eine der Toppositionen europäischer Wirtschaftskraft und übte beträchtlichen Einfluss auf die Politik aus, wie es ja eigentlich immer die Wirtschaftsleute sind, die de facto über Krieg und Frieden und das Glück und das Elend einer Gesellschaft entscheiden. An welchen Fronten auch immer. Das führte aber ebenso zu ihrer Gefährdung, obwohl natürlich der Linksterrorismus seine Bedeutung verloren hatte. Die Leute, die heute noch Terrorakte verübten, suchten sich dafür nicht Personen wie Oswald aus, sondern die weichsten und leichtesten Ziele, fuhren in einen Weihnachtsmarkt, deponierten eine Bombe in einem Schnellzug oder schossen in einem Konzert wild um sich, um alles zu töten, was lebte. Terrorismus war eine Sache für Feiglinge und Faule geworden, und für Leute – man muss es so sagen, auch wenn es schlimm klingt – ohne jegliche Fantasie.
Nein, die Bedrohung kam gewissermaßen aus den eigenen Kreisen, wenn man zum Beispiel mafiöse Organisationen oder geheimdienstliche Apparate als einen Teil der Wirtschaft begriff, und das war ja der Fall. Das waren Leute mit einem ziemlich üblen Sportsgeist, die nicht davor zurückschreckten, unliebsame Vertreter der bürgerlichen Elite einzuschüchtern oder zu disziplinieren. Abgesehen davon, dass Rivalitäten auch in den Reihen der Wirtschaftsbosse nicht immer nur auf legale Weise ausgefochten wurden. Und darum gehörte es zu den Notwendigkeiten eines Mannes wie Oswald, nicht ohne Security unterwegs zu sein. Das galt für sein Unterwegssein in der Welt, es galt aber auch für sein Leben in den eigenen vier Wänden, sosehr es eher vier hoch zwei Wände waren.
Für diese Sicherheit in Oswalds privatem Reich war ein Leibwächter verantwortlich, selbstredend ein Schrank von einem Mann. Aber in der Art elastischer Schränke. Und diesem Mann erklärte Oswald, nur kurz nachdem Christine zusammen mit dem Klimt das Haus verlassen hatte, er sei gekündigt. Und möge bitte sogleich seinen Job beenden.
»Wieso denn?«, wollte der Leibwächter wissen, der ja schon einige Jahre an diesem Ort seinen Dienst versehen hatte.
»Es ist eine Form von Reinigung«, erklärte Oswald.
»Halten Sie mich für schmutzig?«
»Sie missverstehen das. Die Reinigung bezieht sich auf mich, nicht auf Sie. Sie brauchen es nicht persönlich zu nehmen. Nehmen Sie es sachlich.«
Der Mann war Bulgare und verwechselte sachlich mit Sache, weshalb er sich fragte, von was für einer Sache hier die Rede sei. Aber was sollte er tun? Oswald bestand darauf, dass er ging. Also ging er. Gab freilich der Firma Bescheid, in deren Auftrag er bei Oswald tätig gewesen war. Eine Firma, die sofort einen Ersatzmann schicken wollte. Doch Oswald wehrte ab, ebenso die Frage, ob ihm ersatzweise eine Frau lieber wäre. Nein, sagte er, er wolle derzeit ohne »die Anwesenheit eines Schutzes« auskommen und würde sich melden, sobald sich dieses Bedürfnis gelegt habe.
Noch während er dieses Telefonat führte, stand um die Ecke im weiten, offenen, stählernen Küchenbereich seine Köchin, auch sie Bulgarin, was aber ein reiner Zufall war. Sie sprach ein ungemein hübsches Deutsch, als sitze dieses Deutsch auf einer Schaukel mit durchsichtigen Seilen, vor allem aber gehörten ihre gefüllten Paprika und ihre Palacinka zu den exzellentesten auf der Welt. Wie auch die kunstvollen, vielschichtigen Sandwiches, die sie soeben für Oswald bereitete. Sandwiches als ein Ausdruck gewitzter Durchtriebenheit. Denn Oswald aß abends, zumindest wenn er zu Hause blieb, immer nur kalt, während seine Frau Christine abends nie etwas gegessen und konsequenterweise auch nie etwas gekocht hatte. Sie besaß diesen Körper einer Hungerkünstlerin.
Und auch der Gärtner stand noch draußen bei den Hecken, an denen er mit viel Feingefühl herumschnippelte. Er war ein älterer Mann mit unklarer Herkunft – einmal stammte er aus einer Familie israelischer Palästinenser, dann wieder aus einer Sippe libanesischer Juden. Geradezu, als sei er ein fleischgewordener Konflikt. Ein Konflikt, der sich in die ausgedehnte Gartenlandschaft eines reichen Mannes österreichisch-indischer Herkunft geflüchtet hatte.
Aber diese Köchin und dieser Gärtner waren bereits längst nach Hause gegangen, als sich Ashok Oswald zu der Kasperlfigur in den vergilbten IKEA-Karton legte und nach dem kurzen Schrecken einer eingebildeten Handauflegung tatsächlich in den Schlaf fand.
Und nun saß er also nach einer harten Nacht an dem großen Stehtisch in seiner von einem ungarischen Küchendesigner mit viel Naturstein, Beton, Glas und Teakholz komponierten Küche und hatte vor sich einen Espresso, der in dem kleinen Gefäß eine unheimliche Tiefe suggerierte. Oswald spürte die Feuchtigkeit, die sich im Laufe der Nacht in seiner Unterkleidung angesammelt hatte. Er hatte heftig geschwitzt in dem engen, warmen Karton. Und die Kasperlfigur in seinem Rücken hatte auch nicht gerade zur Kühlung beigetragen. Er erinnerte sich, mehrfach von seiner ersten Frau geträumt zu haben, von Margot, was erstaunlich war, wenn man bedachte, dass er soeben von seiner zweiten Frau verlassen worden war. Er hatte Margot kennengelernt, nachdem er in den Vorstand jenes Lebensmittelkonzerns gewechselt war und es während der Bauarbeiten zu einem Meteoriteneinschlag in seinem ersten Pool gekommen war. Was ganz unmittelbar mit dem Kennenlernen zusammenhing, da die damals sechsundzwanzigjährige Margot als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Köln und als Spezialistin für Kosmochemie jenen Brocken untersuchte, der da in Oswalds Pool gelandet war und den die Uni gerne im Dienste der Forschung in staatlichen Besitz übertragen hätte. Aber Oswald bestand nun mal darauf, diesen Weltraumstein zu behalten, auch mit der völlig unlogischen Begründung, dieser sei schließlich nicht ganz zufällig hier auf seinem Grundstück gelandet. Anstatt etwa irgendwo auf dem Gelände der Universität zu Köln, wo es ja durchaus genügend Platz dafür gegeben hätte.
Man hätte natürlich auch vermuten können, Oswalds Sturheit – sein Anwalt argumentierte erfolgreich, dass der Meteorit aufgrund seiner außerirdischen Herkunft als »herrenloser Gegenstand« zu begreifen sei, der alleine dem Finder gehöre –, dass also Oswalds Sturheit dazu diente, im Zuge solcher Streitigkeiten den Kontakt zu der zehn Jahre jüngeren Frau zu erhalten. Und genau das war der Fall. Denn so wie Oswald den Stein nicht losließ, ließ er auch Margot nicht los, obgleich es dauerte, bis sie ein Paar wurden. Er bot der Wissenschaftlerin alle Freiheiten an, wenn es darum ging, den Meteoriten zu untersuchen, bestand aber darauf, das Objekt als natürlichen Beitrag in seine künstliche Kunstsammlung aufzunehmen.
Margot wurde drei Jahre nach dem Meteoritenvorfall seine Frau, ohne darum ihre Karriere zu beenden. Wobei es einige Leute gab, die meinten, sie sei auf solche Weise doch noch in den Besitz des Steins gelangt. Als sie dann allerdings viele Jahre später dieses Haus verließ – nicht zuletzt hatte sie an diesem Ort 2002 und 2004 ihre beiden Söhne auf die Welt gebracht –, verzichtete sie darauf, den Meteoriten mit sich zu nehmen. Im Gegensatz zu ihrer Nachfolgerin, die darauf bestand, zusammen mit der Klimt-Zeichnung zu gehen und nie wieder zurückzukehren. Wobei eine gewisse Ironie darin bestand, dass Oswald dem Brocken aus dem All aufgrund seiner stellenweise goldgelben Färbung genau diesen Namen gegeben hatte: Klimt, während die offizielle Namensgebung nach dem Fundort erfolgte, also Marienburg (Köln).
Somit waren einige Zeit lang zwei Klimts in diesem Gebäude gewesen. Seit gestern hingegen gab es nur noch jenen außerirdischen Klimt, während der irdische mit der dreißigjährigen Geliebten eines Familienanwalts und demnächst von Oswald geschiedenen Frau mitgegangen war.
2
Ashok Oswald nahm einen Schluck vom kräftigen Espresso, rutschte dann vom Hocker herunter und begab sich in eins der Badezimmer, wo er sich seiner verschwitzten Kleidung entledigte. In der Folge schlüpfte er in eine Badehose und wechselte ins Freie, hinaus in den frühen Morgen, der bereits mit einiger Wärme und einem von der Nacht gereinigten blauen Himmel aufwarten konnte. Oswald bewegte sich hinüber zu dem sinnlos großen Bassin, warf sein Handtuch wie ein erlegtes Gespenst auf einen der Liegestühle und sprang ohne weitere Umstände ins Wasser.
Oswald war nicht unbedingt ein schlanker Mann, sondern besaß eine gewachsene Fülle. Aber es gab in der Welt der Menschen wie in der der Tiere gewichtige Typen, die sich bestens im Wasser zu bewegen verstanden. Und in der Tat, Oswald verfügte über diese gewisse Eleganz großer Robben, wenn er seine hundert Kilo kraulend von einem Beckenende zum anderen beförderte und mit konstanter Geschwindigkeit seine Bahnen zog. Er liebte das Kraulen, weil dabei ein wiegender Rhythmus entstand, der ihm das Gefühl gab, das Wasser selbst ziehe ihn Stück für Stück zu sich her. Zumindest, dass er mittels der eigenen wiegenden Bewegung vom Wasser getragen und befördert wurde. Während ihm das Brustschwimmen wie ein Gewaltakt gegen das Wasser vorkam. Wie Rudern oder Walfang.
So zog er also durch das Wasser beziehungsweise wurde vom Wasser gezogen, als er beim Drehen des Kopfes und dem kurzen Atemholen drei Personen zu erkennen meinte, die sich am Poolrand entlangbewegten. Er hielt aber nicht etwa an, um zu sehen, ob es Gehilfen des Gärtners waren oder Leute von der Gebäudereinigung, wie auch immer die um diese Zeit hereingekommen waren – möglicherweise war Oswalds Köchin, schließlich die Einzige, die einen Schlüssel besaß, bereits im Haus und hatte ihnen geöffnet –, sondern schwamm weiter. Es gehörte zu seinen unbedingten Prinzipien, die veranschlagte Zahl von Bahnen einzuhalten, die er abends wie morgens schwamm. Dies nicht zu tun, in irgendeiner Form oder aus irgendeinem Grund zu unterbrechen oder frühzeitig aufzugeben wäre ihm erschienen wie der Anfang vom Ende. Wie die Niederlage, von der man sich – wie gerne gesagt wird – nie wieder erholt. Nein, drei Leute, egal, was sie hier verloren hatten, konnten ihn nicht daran hindern, die verbliebenen viereinhalb Bahnen zu absolvieren. Da hätte schon etwas kommen müssen … etwas in der Art eines herabstürzenden Meteoriten.
Als er dann ein letztes Mal eine Wende vollzog, erkannte er beim Abstoßen, dass sich die drei am oberen Ende des Pools aufgestellt hatten und einer von ihnen durch eine Handbewegung zu verstehen gab, er, Oswald, möge endlich aus dem Wasser steigen. In dieser Handbewegung vereinten sich eine Strenge und Ungeduld, die diesem Menschen, wer auch immer er sein mochte, in keiner Weise zustand. Nicht hier, nicht auf diesem Grundstück. Und wäre er von der Polizei.
Aber von der Polizei war er nicht.
Oswald schwamm die Bahn zu Ende, wobei er das Tempo stärker drosselte als üblich auf den letzten Metern, willentlich der Ungeduld des mit der Hand winkenden Mannes eine Demonstration der Langsamkeit entgegensetzend. Die Armzüge mit besonderer, stark verzögerter Akkuratesse vornehmend. Zeitlupe!
Und so schlug Oswald auch in Zeitlupe an, bevor er den Kopf aus dem Wasser hob und zu den dreien am Rand des Beckens hochsah.
Er kannte sie nicht. Ein junger Mann und eine junge Frau und ein älterer Mann – jener, der ihn gestisch angewiesen hatte, aus dem Wasser zu kommen.
Was er nun auch tat, dabei aber nicht die Treppe nutzte, sondern seine hundert Kilo geschickt hochkatapultierte. Sodass er recht knapp vor den drei Fremden zu stehen kam und einige Tropfen von seinem poolnassen Körper auf sie hinüberspritzten.
»Was tun Sie hier?«, fragte er. Und erkundigte sich, ob die drei vom Reinigungsteam seien. Oder von der Gärtnerei.
»Reinigungsteam trifft es eher«, sagte der, der hier das Sagen hatte und trotz der Wärme eine schwarze Lederjacke und eine schwarze lederne Hose trug, was wohl bedeutete, dass er Teile seines Lebens auf einem Motorrad zubrachte. Und der jetzt mit einer Stimme, in der ebenfalls einiges von Schwarz steckte, Oswald anwies, sich nach drinnen zu begeben und sich etwas anzuziehen.
Oswald schüttelte lachend den Kopf und meinte, dass er ganz gewiss nicht …
Ja, er wollte sagen, dass, wenn es ihm Freude bereite, er auch die nächste halbe Stunde hier in der Badehose stehen und in die Morgensonne blinzeln könne, aber so weit kam er nicht. Der junge Mann – vielleicht doch einer aus dem Trupp der Gebäudereinigung – war vorgetreten und hatte Oswald einen kurzen, heftigen Schlag in die Magengrube verabreicht. Gerade so, dass Oswald nicht zusammenbrach, aber doch in die Knie ging und kurzfristig das Atmen einstellte. Während seine Körpermitte für einen Moment verwirrt und beleidigt die Welt als einen hässlichen Ort gewahrte.
Oswald richtete sich wieder auf und entließ ein Schwall aufgesparter Atemluft.
»So, können wir jetzt«, sagte der Lederjackenmann, während der junge Schläger wieder zurückgetreten war und seine Hände hinter dem Rücken verschränkte, so, als stelle er ein Gewehr zurück.
»Ich weiß nicht, was Sie sich davon erwarten«, meinte Oswald.
»Ich schon.«
Oswald setzte sich in Bewegung, dabei traf sein Blick den der jungen Frau. Und jetzt begriff er, sich getäuscht zu haben. Nicht der junge Mann, sondern die junge Frau hatte zugeschlagen. Er konnte es in ihren Augen lesen. Weniger eine Freude oder einen Triumph, mehr eine Bestimmtheit, mit der sie, die Frau, tat, worum sie gebeten und wofür sie bezahlt wurde. Denn sie wurde doch ganz sicher bezahlt. Was hier geschah, geschah im Auftrag. Und es fragte sich nur, in wessen und wozu. Und ob es sich eher um etwas Geschäftliches oder etwas Privates handelte. Oswald überlegte, wie weit Christian, Christines Anwalt, wohl gehen würde. Es war bekannt, mit was für Leuten er sich mitunter abgab. Aber was um Himmels willen wollte er denn? Christine hatte er doch schon. Noch einen Klimt?
Oswald wurde also in das Haus hineineskortiert, wo er in Hose und Hemd und Sandalen schlüpfte und man sich sodann zu viert in den Hauptraum begab. Dort, wo über einem mächtigen Sofa ein Gemälde von Seurat hing, Badende Frauen, Frauen, hinter denen wiederum ein Tresor im Mauerwerk steckte.
»Sie brauchen sich gar nicht die Mühe machen, mich zu foltern«, verkündete Oswald.
»So hart?«, meinte der Lederjackenmann belustigt.
»Ganz im Gegenteil«, sagte Oswald, »ich vertrage keinen Schmerz. Sie müssen sich nicht noch einmal die Mühe machen, mir wehzutun. Sie bekommen, was Sie wollen. Hier hinter dem Seurat … Sie wissen, was ein Seurat ist? Dort also ist mein Safe, ich gebe Ihnen den Code. Wenn es das ist, was Sie wollen, in meinen Safe sehen. Oder ist es der Seurat? Oder beides?«
»Weder noch«, sagte der Lederjackenmann, »obwohl ich das Bild auf etwa hundert Millionen schätze. Aber ich weiß nur zu gut, dass wenn ich dieses Gemälde abhänge, um an Ihren Safe zu gelangen, ich einen Alarm auslöse, der halb Köln aus dem Schlaf reißt. Also die, die jetzt noch schlafen. Und außerdem hat mich weder der Seurat noch ihr dummer Safe zu interessieren. Darum sind wir nicht hier.«
»Ach ja, und warum sind Sie hier? Mir mein morgendliches Schwimmen zu verderben?«
»Sie haben ein großes Mundwerk dafür, dass Sie angeblich keinen Schmerz vertragen. Ich sollte das überprüfen.«
»Nein, bitte, lassen wir das aus. Worum geht es also?«
»Um ein Manuskript.«
»Manuskript? Kann es sein, dass Sie sich in der Adresse geirrt haben? Hier gibt es keine Manuskripte.«
»Das sehen meine Auftraggeber anders.«
»Sie arbeiten also gar nicht für sich selbst.«