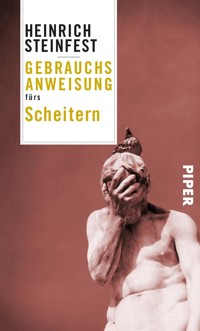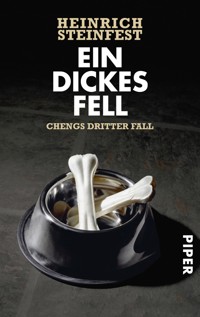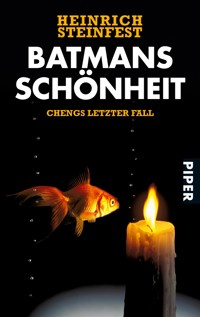9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Markus Cheng ist Privatdetektiv in Wien. Seine Geschäfte gehen schlecht, und zudem wird auch noch sein letzter Klient mit einem Loch im Kopf aufgefunden. In diesem Loch steckt ein Zettel mit einer rätselhaften Botschaft: »Forget St. Kilda«. Und ob Cheng nun will oder nicht – damit steckt er mitten im Schlamassel. Denn eine unbekannte Dame erweist sich als eine knallharte Mordmaschine mit System … Heinrich Steinfests ausgesprochen skurriler Humor und einzigartiger Schreibstil machen diesen Krimi zu etwas ganz Besonderem.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
8. Auflage April 2011
ISBN 978-3-492-95808-0
© 2007 Piper Verlag GmbH, München
Erstausgabe: Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach 2000
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagfoto: Igor Panitz
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
1
Ihre Beine waren zu dick.
Jetzt, da die ständigen Auseinandersetzungen mit Barbara ein unerträgliches Ausmaß erreicht hatten, war er geradezu wütend ob ihrer dicken Beine. Die man sich freilich nicht dick vorzustellen hat. Dick sind Beine, wenn sie nicht exakt den Vorgaben der Bekleidungsindustrie entsprechen, während kein Mensch wirklich dicke Beine als dick bezeichnet, liegen doch wirklich dicke Beine außerhalb einer geordneten Sprachregelung; wirklich dicken Beinen glaubt man nur noch mit Verbalinjurien begegnen zu können, weshalb höfliche Menschen angesichts von wirklich dicken Beinen in eine Sprachlosigkeit zurücksinken, welche nichts ändert an der peinlichen Berührung, die der Anblick dicker Beine in ihren inhaftierten Hirnen auslöst.
Da nützte auch nichts, daß Barbara alles Erdenkliche unternahm, um ihre Beine, und nicht nur diese, dem anzunähern, was einen Menschen – entsprechend der allgemeinen Lesart – von einem Unglücksfall unterscheidet.
Nie hätte Ran gewagt, sich offen über ihre Beine zu mokieren, aber sie spürte seinen Ekel, der ihr nur zu vertraut war, spürte sie ihn doch gegen sich selbst. Natürlich bezog dieser Ekel seine ungeheure Intensität auch aus ganz anderen Problemen, etwa Barbaras ungeliebter Pflicht, ihre streitsüchtige Mutter zu pflegen, die dank einer angeblich todbringenden Krankheit noch kräftiger und anmaßender geworden war, oder Rans diversen Allergien, die ihm jede Nahrungsaufnahme zur Tortur machten. Es blieb unklar, gegen was er eigentlich allergisch war, so daß die Bedrohung sich ungehemmt aufblähen konnte.
»Findest du nicht auch, daß ich zu dicke Beine habe?« Und dabei sah sie ihn haßerfüllt an, weil sie ja die Antwort kannte und gleichzeitig wußte, daß er diese Antwort niemals wagen würde auszusprechen, was sie als jämmerliche Verlogenheit empfand, während ihr aber auch klar war, daß sie durchdrehen würde, wollte er die Möglichkeit einer solchen Antwort auch nur andeuten.
»Ach Schatz, hör doch auf. Deine Beine sind völlig in Ordnung.«
Und dabei vermied er es, ihre Beine anzusehen, die sie demonstrativ zur Schau stellte, wie ein zynischer Krüppel, der seinen entstellten Körper einem voyeuristischen Publikum entgegenstreckt, welches hinter angeblichem Gleichmut seine Abscheu verbirgt.
»Du hättest sehen sollen, wie mir der Klaghofer gestern auf die Beine gesehen hat, mit Augen, als hätte er die Basedowsche Krankheit. Ich hab’ das Schwein richtig hören können, mit seinem blöden ts, ts: na, unsere hübsche Babsi, so ein schöner Arsch, und die Titten kriegen auch einen Preis, aber um Himmels willen, diese Oberschenkel, wie von einem russischen Gewichtheber.«
Ran lachte gekünstelt, ängstlich bemüht, die Sache als Altherrenfrivolität abzutun. »Aber Schatz, der Klagi ist doch ein alter Trottel. Wie kann dich so einer kümmern.«
»Interessant. Du gibst seiner Sichtweise also recht. Dich stört nur, daß er nicht verschämt wegschaut. Die alte Sau ist wenigstens ehrlich, während du dir denkst, Gott im Himmel, die Babsi hat ja Elefantiasis. Aber sagst natürlich kein Wort.«
»Du bist verrückt, völlig verrückt. Was willst du mir da anhängen? Elefantiasis – du bist Biologin und weißt nicht einmal, wie eine Elefantiasis aussieht.«
»Ich hab’ nicht gesagt, daß ich Elefantiasis habe, sondern daß du es denkst.«
Natürlich war das nicht die Art Gespräch, die einen gemütlichen Abend einleitet.
Um dem hier angesprochenen Professor Klaghofer, einem wahrlich harmlosen Spezialisten für Parasitismus, zu seinem Recht zu verhelfen, sei erwähnt, daß er zwar tatsächlich Barbara angestiert hatte, aber hätte er um den Verdacht gewußt, etwas an ihr bemängelt zu haben, er wäre geradezu erschüttert gewesen. Schließlich empfand er die junge Frau als überaus anziehend, und da der Zeitgeist in seiner ungewöhnlich immunen Seele nur selten wütete, war ihm das Problem dicker Beine nicht vertraut (weshalb viele ihn für einen Idioten oder ein Genie hielten, was er beides nicht war).
Ran überlegte, ob er den Hörer abnehmen sollte. Für ihn war die Sache erledigt. Barbara und er konnten eben nicht miteinander. Da nützte es nichts, daß sie hin und wieder im Bett Spaß miteinander hatten (und nicht einmal das war sicher, denn Barbaras leidenschaftliches Getue schien ihm ziemlich dick aufgetragen, geradezu verzweifelt). Es gab wenig, worüber sie einer Meinung waren, und so gut wie nichts, worüber nicht ausufernde Diskussionen stattfanden, und der Reiz widersprüchlicher Positionen war bald der Frustration gewichen, die aus den täglichen ermüdenden Kleinkriegen resultierte.
Inzwischen fand er sie nicht einmal mehr attraktiv, bemerkte die kleinste Abweichung von jenen Mustern, die man den Konsumenten wie Gußbeton ins Bewußtsein spritzt. Ihre sogenannten dicken Beine, ihre Fettzellenparanoia, ihr Orangenhautdebakel war da nur der Höhepunkt (dabei keine Spur von Zellulitis, in Wirklichkeit hatte sie ausgesprochen schlanke Beine). Übrigens verfügte sie über ein ausgeprägtes emanzipatorisches Bewußtsein, welches zwar nützlich war, was den politischen und philosophischen Diskurs betraf (und tatsächlich war sie so gut darin, daß sich Männer in ihrer Gegenwart gerne in eine traditionelle Unsachlichkeit flüchteten), aber wenig hilfreich angesichts makelloser Designerbeine, Bilder, die aus Hochglanzmagazinen auf das Leben der Untermenschen spuckten oder wie Reißzwecken in den Hirnen beider Geschlechter steckenblieben.
Nach dem siebenten Läuten fluchte Ranulph Field und hob den Hörer ab. Sein »Ja« war böse und endgültig – okay, wenn sie es unbedingt wollte, dann würde er ihr sagen, daß sie tatsächlich dicke Beine habe oder vielleicht auch nur zu kurze, zumindest wenn sie flache Schuhe anhatte, egal, er würde zugeben, daß er es unerträglich fand, wenn sie ewig in ihrem Essen herumstocherte, sie, die unter keiner einzigen Allergie litt, so, als würden vom Herumstochern die Beine dünner.
Aber die Stimme in der Leitung war nicht die von Barbara.
»Herr Field?«
Sein zweites »Ja« kam leer und erschöpft. Wahrscheinlich würde er nie wieder den Mumm besitzen auszusprechen, wie sehr ihm der Anblick ihrer Beine Übelkeit verursachte (worum es geht, das ist die Zellulitis in unseren Köpfen).
»Hören Sie mich?« fragte die Stimme.
»Ja, ich höre Sie. Was ist denn los? Wer sind Sie überhaupt?«
Er vernahm ein Lachen, das ihn verrückt anmutete. Ran stöhnte.
»Okay, gute Frau, wie Sie auch heißen mögen. Hier ist nicht die Telefonseelsorge. Genug gelacht für heute.«
Was immer ihn davon abhielt aufzulegen, es hielt ihn ab.
»Also, was wollen Sie?« fragte Ran.
»Ich will sehen, wie Ihnen die Angst den Hintern hochkriecht.«
»Oho.« Ran fühlte sich gleich viel besser, geradezu belustigt. Das war wohl so eine Art obszöner Anruf. Auf jeden Fall eine Inszenierung. Und weil niemand da war, der linksliberale Devotion einforderte, erlaubte er sich das Vergnügen und markierte den harten Mann. »Unbefriedigt, Kleine, was? Kannst ja vorbeikommen. Ich werde dir zeigen, wo Gott wohnt.«
»Und ob ich vorbeikommen werde. Immer wieder. Aber es wird anders sein, als du dir jetzt denkst.«
Sie hatte aufgelegt. Ran war unzufrieden. Er war kaum dazugekommen, den Tiger aus seinem Herzen zu lassen. Erneut überlegte er, wie das wäre, Barbara anzurufen und nach all den Jahren seine Verachtung herauszubrüllen, diesen ganzen Dicke-Beine-Salat, der in der alten Marinade wie Seetang trieb. Aber natürlich würde er das am nächsten Tag schrecklich bereuen, denn ganz gleich, ob sie sich wieder versöhnten oder endgültig trennten, sie arbeiteten am selben Institut, und er würde sich ewig anhören müssen, was für ein primitiver Kerl er sei. Und jede verdammte Freundin Barbaras, jede sogenannte Freundin, würde ihn schneiden, nur um dieses unbedingte Solidaritätstheater aufrechtzuerhalten.
Nein, er mußte darauf warten, daß sie als erste ausfällig wurde. Es war wie das Spiel, bei dem der gewinnt, der dem anderen, ohne zu lachen, länger in die Augen sehen kann.
Bevor es dunkel wurde, ging er noch in einen nahegelegenen Park joggen (was ihm immer weniger Freude machte, dieses Den-eigenen-Körper-Spüren, denn was er da spürte, erinnerte ihn an faules Obst oder an diese Aufläufe, die in viel zuviel Sauce schwammen). Danach duschte er, schob eine halbe Pizza Richtung Verdauung und legte sich mit Zigaretten, Wein und Wertheimers Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegungen aufs Bett. Sein Kater Batman (eitel, selbstherrlich, dominant und unwiderstehlich wie alle Katzen) hatte sich zwischen seine Beine gerollt.
Ran war eingeschlafen. Gegen zwei in der Nacht schrak er auf.
Aus dem Nebenzimmer, in dessen fensterabgewandten Teil er durch eine offene Flügeltür sah, kam ein kurzes, metallisches Geräusch. Ran war kein ängstlicher Mensch, sondern Naturwissenschaftler und folglich um Sachlichkeit bemüht. Wahrscheinlich stand im Nebenzimmer die Balkontür offen. Und wie zur Beweisführung spürte er jetzt einen leichten Windzug, der bei dieser Sommerhitze allerdings wenig Erleichterung bot.
Er nahm wieder den Wertheimer zur Hand und zündete sich eine Zigarette an. Auch Batman war erwacht und starrte gebannt ins Nebenzimmer. Seine Augen folgten einer Bewegung, vielleicht der einer Fliege. Allerdings wäre er einer Fliege sofort nachgesprungen. Statt dessen ging er hinter Rans Unterschenkel in Deckung und fauchte, was Batman selten tat. Sein schwarzer Körper zuckte.
Ran, der über seinen Brillenrand und über den Buchrand auf Batman sah, hielt dessen Verhalten für eine Instinktbewegung, für ein Kampfspiel mit einem imaginären Gegner, den Batman nur nahe genug an sich herankommen lassen wollte.
Kaum wahrnehmbar bemerkte Ran einen Lichtpunkt, der über Wände und Gegenstände des Nebenzimmers flog. Er sah das sozusagen mit der äußersten seiner Augenkameras und war nicht im geringsten gewillt, sich verrückt machen zu lassen und gleich mit beiden Augen ins Nebenzimmer zu sehen, um schließlich ja doch nur etwas völlig Simples und in keiner Weise Bedrohliches festzustellen. Daß er dann doch hinübersah, fand er inkonsequent, lächerlich und völlig normal – so sind Menschen nun mal, dachte er. Allerdings war da wirklich ein Lichtpunkt, mal rasend, mal nervös auf der Stelle tretend. Ein leichter Schauer durchlief Ran, angenehm kühl, ein kleiner Schrecken, eine kleine Unsicherheit, getragen von der Gewißheit, daß nur ein Mangel an Information Horror produzieren kann.
Und dann kam auch schon die Erkenntnis. Ran bewegte sein Buch, und mit diesem bewegte sich der Lichtpunkt. Ran besah sich den Buchdeckel, von dessen Rand ein kleines Stück Schutzfolie abstand, welches das Licht seiner Leselampe reflektierte. Ran führte das Buch wie ein Lenkrad und ließ den Lichtpunkt durch den Wohnungskosmos schießen. Dann sah er zu Batman, überzeugt davon, die Katze folge konzentriert den Bewegungen des Lichtpunkts. Doch Batman starrte auf den Fußboden des Nebenzimmers, wobei sein Körper angstvoll rückwärts wanderte und am anderen Unterschenkel Rans auflief.
Einen Moment dachte Ran, Batman sei eine wirklich blöde Katze, aber natürlich sind Katzen niemals blöd, ganz im Unterschied zu Menschen, deren angeblicher Scharfsinn nicht selten von einer übermächtigen Begriffsstutzigkeit neutralisiert wird, so übermächtig, daß manche Menschen darin einen Gottesbeweis sehen wollen.
Endlich kapierte Ran, daß Batman nicht die Muster des Rivalenkampfes durchging, sondern schlichtweg Angst verspürte. Ran richtete sich mit der Bewegung später, aber eindringlicher Erkenntnis auf.
»Was hast du denn, alter Junge?« Und damit meinte er nicht nur Batman. Er strich ihm über das Fell. Der Katzenkörper war so hart, als wäre er ausgestopft.
Ran folgte dem unverändert starren Blick des Tieres. Und da sah er den länglichen Schatten, der leider weder an eine Stehlampe noch an einen Gummibaum oder eine Vitrine erinnerte, sondern an eine von Giacomettis dürren Figuren. Da Ran zu seinem Bedauern aber keine derartige Skulptur besaß und auch sonst nichts, was einen solchen Schatten hätte werfen können, war der Schluß nicht ganz von der Hand zu weisen, daß eine Person sich im Nebenzimmer befand, in jenem Teil, den zu überblikken Ran aus dem Bett hätte steigen müssen.
Das Bett ist nun wahrlich der ungünstigste Ort, um einen Angriff abzuwehren, sei der Angreifer nun ein Mörder, die eigene Frau oder der liebe Tod persönlich. Und dennoch treibt die Angst den Menschen ins Bett und dort unter die Bettdecke, was seinen Handlungsspielraum gefährlich einschränkt. Aber er will ja gar nicht handeln, sondern sich verstecken, am liebsten alles vergessen, nichts wissen von den Scheußlichkeiten, die sich außerhalb dieses Bettes abspielen. Viele Menschen, die sich im Bett einen Film zur Steigerung des inneren Spannungszustands angesehen haben, trauen sich nach dessen Ende nicht mehr aus dem Bett heraus, gerade so, als würde ein potentieller Mörder (der durch den soeben gesehenen Film immens an Wahrscheinlichkeit gewonnen hat) seinen Opfern prinzipiell nur im Schrank, in der Küche, unter dem Klavier etc. auflauern, aber ausgerechnet vor der Intimität gebrauchter Bettwäsche zurückschrecken.
Auch Ran, der jetzt mindestens so steif wie seine Katze war, gingen derartige Gedanken durch den Kopf. Als jemand, der beruflich gezwungen war, sich mit der Verhaltensforschung auseinanderzusetzen, überlegte er, was all die Menschen davon abhielt, die durch nichts begründete Sicherheit des Bettes aufzugeben. Eine Frage, die ihn nun unglücklicherweise selbst betraf. Alles, was ihm dazu einfiel, war wenig hilfreich. Natürlich konnte man das Bett mit einem Nest, einer Höhle, dem mütterlichen Schoß, einem fliegenden Teppich assoziieren und mußte berücksichtigen, daß das immerhin der Ort war, von dem aus man die Realität hinter sich ließ (um freilich einer ebenso unerfreulichen zuzusteuern), aber erklärte das die völlig absurde Vogel-Strauß-Mentalität der meisten Bettbenutzer?
Diese Überlegungen führten leider nicht dazu, daß Ran seine Starre aufgab, um endlich nachzusehen, wer oder was diesen Schatten verursachte, oder um zumindest in Panik in die Küche zu rennen und nach dem größten Messer zu greifen. Dazu hätte Ran nicht einmal das Nebenzimmer betreten müssen, da von beiden Räumen eine Tür in den Vorraum ging, der zu Küche, Badezimmer und immerhin einer Ausgangstür führte, was ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre. Diese Einsicht traf allerdings Batman, der vom Bett sprang und mit der ihm gegebenen Schnelligkeit und Umsicht durch die offene Tür in den Vorraum gelangte (darum bestehen Katzen auf offene Türen, während der in grotesken Sicherheitsüberlegungen gefangene Mensch sich hinter Stahlbalken und einer Unzahl von Schlössern verbarrikadiert, um dann in seiner eigenen Wohnungsfalle zu hocken). In der Küche waren nicht nur Messer zu finden, sondern auch Verstecke, die sich für ein Wesen von der Größe und Geschmeidigkeit Batmans ausgezeichnet eigneten. Er war kein Hund, er würde nicht als Held sterben.
Ran hingegen tat erwartungsgemäß das Unsinnigste und Dümmste und scheinbar seiner Spezies Entsprechende und kroch zur Gänze unter die Decke (was natürlich niemand erfahren würde, stünde es nicht hier).
Zwar hörte Ran die Schritte nicht, die auf ihn zukamen, aber er spürte sie, gerade so viel Instinkt besaß er noch. Er hielt sich die Hand vor den Mund, um den lauten Klang seines Keuchens abzudämpfen, und krampfte sich zusammen, um nur ja keine verräterische Bewegung aufkommen zu lassen. Und war zu blöde vor Angst, das Lächerliche seines Tuns zu erkennen.
Und er betete. Nicht zu Gott, der ohnedies nicht geholfen hätte, sondern wie eben Menschen beten, wenn die Todesangst ihnen ihre Selbstachtung raubt und sie zu jeder Vertragsunterzeichnung bereit wären, nur um noch ein weiteres Stück geräucherten Lebens anhängen zu dürfen. Dabei tötet ihnen die Langeweile des Daseins den Nerv – wird dieses aber endlich unterbrochen durch den Schlag eines an Drama, Tragödie und Lustspiel geschulten Schicksals, sehnen sie sich nach der Langeweile zurück, so wie sich karitative Organisationen nach Hungerkatastrophen sehnen oder die progressive Kunst nach dem bürgerlichen Unverständnis.
Ran spürte das Gewicht des Schattens auf seiner Bettdecke. Aber selbst in dem unerfreulichen Geisteszustand, in dem er sich befand, glaubte er nicht an überirdische Zeitgenossen und war sich also sicher, daß so ein Schatten nicht ohne jemanden auskam, der ihn warf.
In Wirklichkeit führte der Schatten – ganz im Einklang mit den Naturgesetzen, schließlich war nun die Bettlampe die stärkste Lichtquelle – vom Bett weg. Was Ran spürte, das war ganz einfach das Gewicht einer menschlichen Hand. Aus dieser Hand brach ein einzelner Finger aus und drückte durch die Decke sanft auf Rans Nacken.
Der Schrei, der ihm aus dem Mund brach wie eine unerwartete Erbschaft, war heiß wie Hühnerbrühe und wie diese nur eine Bedrohung für den, der sich an ihr verbrennt. Er spuckte und hustete, aber er blieb in der Schweiß- und Angstkammer seiner Bettdeckenbehausung.
Als er sich endlich beruhigt hatte, hörte er ein Lachen aus dem Nebenzimmer, das sich hörbar auf den Balkon entfernte.
Mit dem Mut, den die Nacherzählung gebiert, riß er die Bettdecke zur Seite und richtete sich auf. Tränen der Wut stiegen ihm in die Augen. Seine Wohnung lag im Parterre, und der Balkon führte auf einen begrünten und radikal beblumten Innenhof, den eine Gruppe arbeitswütiger älterer Damen dazu benutzte, jede natürliche Regung der Natur mit den Mitteln militanter Kleingartenkultur zu unterbinden. Der Balkon lag keine dreißig Zentimeter oberhalb des Bodens.
Nun stand Ran auf ihm, zwischen Topfpflanzen und Sperrmüll, frierend trotz Hitze, und blickte auf die vom Mondlicht beschienene florale Kunstwelt.
Er hatte das Lachen wiedererkannt; es war dieselbe Frau gewesen, die ihn Stunden zuvor angerufen hatte. Was natürlich keinen Romanleser überrascht, sehr wohl aber Ran, der wie die meisten wirklichen Figuren unfähig war, sich andere Bedrohungen als die alltäglichen vorzustellen (während ein Romanleser, der ja als solcher wenig zu verlieren hat, leichten Herzens alles Fatale, Abartige und Bösartige begrüßt und auch verlangt).
Als Ran nun allein auf dem Balkon stand, im Rücken die Sicherheit einer hell erleuchteten Wohnung, vor sich den menschenleeren und von jeder Natur verlassenen Garten, kam er nicht umhin, darüber nachzudenken, wer einen Grund haben könnte, ihm einen derartigen Schrekken einzujagen. Wie in solchen Geschichten üblich, fiel ihm natürlich die eine oder andere Entgleisung ein, aber beim besten Willen nichts, was eine derartige Handlung gerechtfertigt hätte.
2
Natürlich waren alle gekommen. Jedes Jahr im August gab der Leiter des Instituts, der allseits beliebte Professor Edlinger – dank Television selbst jenen bekannt, die in der Gosse der Bildungsarmut schmorten –, eine Party, die keinem geringeren Anlaß diente, als die Beliebtheit Edlingers unter Beweis zu stellen.
Ganz zwanglos, meine Herrschaften, ganz zwanglos, betonte der Professor Jahr für Jahr, denn er sah sich gerne leger. Und tatsächlich trug er nie eine Krawatte, selbst wenn ihn der Bundespräsident empfing. Selbstverständlich empfing der Bundespräsident dann nicht irgendeinen dahergelaufenen tagespolitischen Furz, sondern einen großen Denker und Forscher. Und ab einer bestimmten Größe des Denkens und Forschens störte es nicht einmal mehr den Bundespräsidenten (dessen Pedanterie in Sachen äußere Form der untertänigen Erscheinung ja gefürchtet war), daß einer nicht nur ohne Krawatte erschien, sondern auch in einem Anzug, dessen meistbelastete Stellen an die Fettaugen in Rindsuppen erinnerten. Das Recht auf ein zwangloses Erscheinungsbild besaßen eben nur noch die wirklich großen Denker sowie Leute, die man nicht einmal mehr ins Arbeitsamt hineinließ.
Wer nun gezwungen ist, zwischen diesen Extremen irgendeine mediokre Identität zu suchen, hat zumeist einen guten Grund, seinen Hang zu bohemehafter oder gar gedankenloser Vernachlässigung der äußeren Form hintanzuhalten. Weshalb auf Edlingers Partys Edlinger selbst der einzige blieb, dessen Anblick höhere Zwanglosigkeit verriet. Und damit auch der einzige, der in einem optischen Widerspruch stand zum glanzvollen Rahmen der eigenen Veranstaltung.
Das, was Edlinger Jahr für Jahr hartnäckig als »meine kleine Party« bezeichnete, war ein Zweihundert-Personen-Fest im Garten seiner Hietzinger Villa. Wofür Edlinger natürlich in keiner Weise verantwortlich war – er war ja ein bekannter Gegner von Partys –, sondern seine Gattin, eine zur bürgerlichen Wissenschaft konvertierte Aristokratin, die einige materielle Werte und inszenatorische Vorlieben in die Ehe eingebracht hatte, welche Edlinger nun mit seiner berühmten Gleichgültigkeit ertrug.
Und da stand er also, der Professor, in seinem ältesten, speckigsten Anzug, selbstbewußt, brillant, brillant selbst noch als Zuhörer, aber nicht ohne einen leichten Zug von Verlegenheit angesichts der opulenten Übertreibungen dieser Feierlichkeit.
Neben ihm seine Gattin Florence in einem schwarzen Bustierkleid von Helmut Lang, eine noble Erscheinung, die den großen Denker sozusagen komplettiert. Soeben gratuliert ein Minister dem Professor Edlinger zum Geburtstag (der ja gar nicht gefeiert wird), zeigt sich untröstlich, leider gleich wieder zu einer Sitzung zu müssen, weil bla, bla … Edlinger ist freundlich, freut sich über ein halbes Jahr verfrühte oder verspätete Geburtstagswünsche, hört aber schon nicht mehr zu, denn er weiß, daß dieser Minister keine zwei Tage mehr im Amt sein wird, was dieser Minister nicht weiß, allerdings ahnt, und deshalb nervös an seiner Krawatte herumfingert, während er Edlinger eine Projektförderung zusichert, die dieser sich bereits vom Nachfolger des Ministers hat zusichern lassen.
Ranulph Field stand mit einigen jüngeren Leuten etwas abseits, wenig interessiert an deren Gespräch über das Verhältnis von Epilepsie und Börsenkursen, und nippte an seinem Whisky. Trotz der schattigen Gartenanlage war die Hitze unerträglich. Die Krawatte zu lockern half da auch nichts. Das Hemd klebte am Rücken, und in den Schuhen spielten sich erste Verwesungsprozesse ab.
Als einer der Assistenten Edlingers hatte er natürlich Anwesenheitspflicht. Gegen Partys war nichts zu sagen, aber er vertrug die Hitze nicht und haßte es, bei dreißig Grad in einem Kultursack zu stecken; er war der typische Träger kurzer Hosen.
Ran hielt nach Barbara Ausschau. Die letzten Tage hatte er sich zu elend gefühlt. Sein nächtliches Erlebnis machte ihm zu schaffen. Natürlich würde er mit niemandem darüber reden, schon gar nicht mit Barbara, er war ja nicht verrückt. Zumindest noch nicht, dachte er wehleidig. Er sehnte sich nach Barbara, weil ihm nichts Besseres einfiel. Ihr dämlicher Beziehungskrieg würde ihn ablenken. Das war eben die Normalität, die er nun schmerzlich vermißte.
Jemand tippte ihm auf die Schulter. Er wandte sich um und sah in das breite, rotwangige Gesicht des australischen Botschafters H. P. Thomson, dieses fürchterlich gesunden Menschen, der sich unentwegt auf den Bergen herumtrieb, österreichisches Wildwasser bepaddelte und im Winter auf Langlaufskiern die verschneiten Weiten des Landes durchmaß. Dabei war er ein kleiner, eher dicklicher Mann, ein unmäßiger Trinker, dessen Bewegungen auf die Schwerfälligkeit aller Diplomaten hinwiesen, aber er war ein begeisterter Landschaftssportler, der dieses Land großartig fand, geradezu das Land für einen Freiluftmenschen. Die Diplomatie begeisterte ihn weniger, aber das verlangte auch niemand. Er war für seine deftige Ausdrucksweise bekannt, vor allem wenn er getrunken hatte, und er hatte immer getrunken, weshalb alle froh waren, vor allem sein Attaché, wenn er auf den Banketten nicht erschien. Hin und wieder versicherte er dem Bundespräsidenten – in einem vom Sekretär des BP vorgeschriebenen Wortlaut –, daß er, der BP, auch in Australien ein bekannter und beliebter Mann sei (was natürlich eine glatte Lüge war, denn warum ausgerechnet in Australien, aber der BP … nun, sagen wir, er hatte den Bezug zur Realität verloren, und da war nun wirklich niemand, der daran etwas ändern konnte oder wollte).
»Hallo H.P.«, sagte Ran, der auch aus Australien stammte, aber bereits vor eineinhalb Jahrzehnten als Zwanzigjähriger nach Österreich gekommen war. Eigentlich nur für ein Studienjahr, aber dann war er – ohne einen ersichtlichen Grund – geblieben. Die deutsche Sprache bereitete ihm fast keine Probleme, und er empfand bis zum heutigen Tage eine Art Triumphgefühl, der Fürsorge seiner Eltern entkommen zu sein.
Ran und H.P. (den nur H. P. nennen durfte, wer wie er gerne kurze Hosen trug) hatten sich bei einer Bergwanderung in den Triebener Tauern kennengelernt und festgestellt, daß der eine ein Assistent, der andere ein Freund Edlingers war.
»Also wirklich, Ranulph, altes Stinktier«, sagte H.P. und grinste sein Gesicht zu einer phänomenalen Breite, »von der Gräfin solltest du lieber die Finger lassen. Sicher, ich verstehe dich, das ist ja wirklich ein zuckersüßes Frauchen, und es wäre ja auch ewig schade, wenn so ein Prachtweib im Verlies eines katholischen Treuegelübdes verkommen würde. Andererseits, wenn Edlinger das herausbekommt, dann gnade dir Gott.«
Ran sah H.P. verständnislos an. »Was ist los, H.P., hast du die Bar leer gesoffen, ich versteh’ kein Wort.«
»Junge, ruhig Blut. Über meine Lippen kommt kein Wort. Auch wenn Edlinger mein Freund ist und ein Bundesgenosse im Alter, ich will nicht miterleben, wie er dir den Schädel spaltet. Also einmal ernstlich, Ranjunge: Daß du seine Alte vögelst, ehrlich, ich bin der erste, der das versteht, die Puritaner gehören ins Fegefeuer. Aber dann solltest du schon aufpassen, daß die Sache im Schließfach bleibt. Ich will dich nicht belehren, Junge, aber selbst wenn er darauf verzichtet, dich von irgendeinem Schlächter behandeln zu lassen, deinen Job verlierst du, und ich schwör’ dir, keiner wird dich nehmen. Nicht weil sie Edlinger lieben, da liebt keiner den anderen, ganz im Gegenteil, für die wirst du ein toller Bursche sein, weil du es dem Alten gezeigt hast, bloß wird dich keiner mehr anstellen wollen. Das nennen sie gelebte Solidarität. Ja, mein Junge, die alte Welt. Solange sie sich politisch nicht fertigmachen können, halten sie zusammen.«
Ran schluckte. Und fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn.
Da war wieder die Unsicherheit, die er aus Kindertagen kannte, die natürlich jeder aus Kindertagen kennt, dazu ist man schließlich Kind, um sich mit den Ungerechtigkeiten, Verleumdungen und Schuldzuweisungen anzufreunden. Die Schuldzuweisung ist schließlich einer der zentralen Aspekte unserer Zivilisation, wobei die tatsächliche Schuld vollkommen bedeutungslos ist. Entscheidend ist die Bedeutung des Klägers; ist er bedeutender als der Beschuldigte, so geht es nur noch darum, Haltung zu bewahren oder jemanden zu finden, der sich durch noch größere Bedeutungslosigkeit schuldig gemacht hat.
»Hör zu, H.P., ich versichere dir, daß ich nicht das geringste mit Edlingers Frau habe. Ich kenne sie ja kaum, die war doch nie am Institut. Und bei der alljährlichen Party mache ich meinen Knicks, und das war es dann auch schon. Überhaupt, wer verstreut einen solchen Unsinn?«
H.P. strich sich nachdenklich über seinen mächtigen Schnauzer.
Eine Schuhbürste, wie seine Frau abfällig behauptete, eine österreichische Schuhbürste, und tatsächlich war dieser Schnauzer eine Anpassung an das Erscheinungsbild des heimischen Naturmenschen; davon war H. P. überzeugt.
»Na ja, Ranjunge, das ist natürlich etwas verwirrend. Ich muß dir wohl glauben. In deiner Lage wäre Lügen sowieso sinnlos. Die Hyänen haben das Aas gerochen, ob natürlich oder synthetisch, ist denen egal.
Brusberg hat mir davon erzählt, dieser Deutsche, der Edlingers Bücher verlegt. Ein fürchterlicher Mensch, wenn du mich fragst – na ja, ich konnte die Deutschen nie leiden. Ist dir das schon aufgefallen, sie reden andauernd von ihren Autos; triffst du einen Deutschen, schon erzählt er dir irgendeine blöde Geschichte von seinem Auto. Auch die Deutschen, die Autos ablehnen, reden die ganze Zeit von ihrer Aversion gegen Autos, das sind überhaupt die Schlimmsten. Ein Autovolk ist das, ein schreckliches Autovolk, fanatische Autophobe oder fanatische Autophile.«
»H.P., bitte!«
»Verzeih, aber die regen mich nun einmal auf. Also, der Brusberg hat mir das zugeflüstert. Der hat mir tatsächlich ins Ohr gespuckt. Aber ich sag’ dir, der Brusberg hat sich das nicht ausgedacht. Und mach bloß nicht den Versuch, den Brusberg danach zu fragen, woher er das hat. Du bist jetzt superheiße Kuhscheiße, mein Junge. Eine verdammte Menge Leute wird alles tun, um dir aus dem Weg zu gehen; keiner will sich verbrennen, keiner will in die dampfende Kacke steigen.«
»Und was ist mit dir? Du verbrennst dich nicht?«
H. P. lachte. »Hast schon recht. Ich sollte aufpassen, auf welche Kochplatte ich meine Pfoten da lege. Aber im Ernst, Ranjunge, als Diplomat darf ich mir das erlauben. Solange ich nicht wirklich Position beziehe. Und vor so einer Dummheit bewahre mich der heilige Doyen.«
In diesem Moment sah Ran Barbara. Sie trug ein schwarzes Seidentuch, das sie um Unterleib und Brust gewickelt hatte, und Ran kam nicht umhin, ihre Beine diesmal nicht als dick zu empfinden, was sie ja auch nie gewesen waren. Sie sah großartig aus, weshalb auch der Typ an ihrer Seite so gut dazu paßte. Ran kannte ihn nicht. Unsympathisch wie alle Kerle, die dreinschauen, als arbeiteten sie als Modepuppen für Herrn Calvin Klein.
Ran dachte, wie wenig er selbst zu Barbara paßte, jetzt einmal abgesehen von der ständigen Streiterei. Ran war eher der langweilige Typ, nicht hübsch, nicht häßlich, keine Verunstaltungen, aber auch sonst nichts, an dem ein Blick hängenblieb. Brillenträger ohne Sex-Appeal (also eher wie ein Brillenträger aus den Sechzigern), sportlich in Maßen, eben einer von den vielen, die sich an Sonntagen auf Tennisplätzen Zerrungen zuziehen oder sich nach Jahren im Fitneßstudio darüber wundern, daß sie zwar kaum abgenommen haben, aber dafür zu immer leichteren Gewichten greifen müssen. Nicht, daß Ran sich bisher viele Gedanken darüber gemacht hatte. Denn er bildete sich tatsächlich ein (eine Einbildung, die allerdings genau in diesem Moment ihr Ende nahm), daß er genug Charme, Esprit, Witz und was weiß der Teufel für schwammige Eigenschaften besaß, um die Mittelmäßigkeit seiner äußeren Erscheinung wettzumachen.
Nachdem Barbara ihren Schönling auf dem weißen Kies geparkt hatte, trat sie auf Ran zu. Sie sah umwerfend aus (schließlich hockte sie ja nicht zu Hause vor dem Fernseher oder dem Eiskasten, wo ein jeder Mensch, auch der sogenannte schöne Mensch, eingefallen, verhärmt, blaß und blöde wirkt, schlichtweg in seine tatsächliche Häßlichkeit zurückfällt) – ihre Augen groß, hart, blau und kriegerisch wie ein titanischer Traum, die Haut aus schneeweißem Polyester, mittendrin Lippen aus der Parfümerie, rot wie ein Goldmann-Krimi.
»Du kleines Häufchen Dreck.«
Genau das sagte sie und war auch schon wieder weg, bei ihrem Neuen, dessen Blick verriet, daß ihm unverständlich war, mit was für einer Billigware sich Barbara bisher abgegeben hatte.
H. P. zupfte an seinem Schnauzer, verzweifelt, weil ihm keine witzige Bemerkung einfiel. Nebenstehende sahen zu Ran, als wollten sie die kurze, aber präzise Angabe Barbaras überprüfen.
Ran wurde übel. Der viele Whisky war jetzt alles andere als ein guter Unterbau. Gerne hätte er sich an Ort und Stelle übergeben, was aber nach seinem Empfinden die Sache noch schlimmer gemacht hätte. Also bellte er seine Übelkeit zurück und ging eilig (notgedrungen eine Spur zu eilig) ins Haus, das wie alle Häuser reicher Leute vieles hatte, nur keine auffindbaren Toiletten. Weil er sich aber nicht mehr zurückhalten konnte, übergab er sich in dem von der Dame des Hauses liebevoll aufgezogenen Wintergarten; nicht so ein Wintergarten aus dem Versandkatalog, sondern eine prächtige, üppige Dschungelkulisse, wo man unter Umständen auch eine Leiche unterbringen konnte, ohne daß gleich sämtliche Kinder darüber stolperten. Und wo eine Leiche nicht aufgefallen wäre, richtete auch das bißchen Erbrochene keinen großen Schaden an.
Als er aus dem Wintergarten trat, bleich, aber wenigstens um eine Sorge leichter, lief er Frau Edlinger direkt in die Arme, die man natürlich Frau Professor zu nennen hatte, obwohl sie einen eigenen Doktortitel besaß, der aber im Sturm, den so ein ehemännlicher Professorentitel auslöst, untergegangen war.
Sie zeigte mit dem Finger auf Ran, genaugenommen auf die Stelle zwischen den Augen, also dort, wo eine professionell abgeschossene Kugel idealerweise in ihr Opfer eintritt. Der Finger lag gerade in der Luft, und bei oberflächlicher Betrachtung hätte man ihn auch für eine Messerklinge halten können.
»Sie!« sagte die Frau Professor, und es klang, als hätte sie endlich den Schuldigen für alles Schlechte in dieser Welt gefunden.
»Was bilden Sie sich eigentlich ein?« fuhr sie fort, ohne die Position ihres Fingers zu verändern. »Was ist es denn? Ist es Neid, Rachsucht, Eitelkeit? Sind Sie ein Psychopath? Oder werden Sie dafür bezahlt? Was bringt Sie dazu, ein derart ekelhaftes Gerücht zu verbreiten? Hat mein Mann Sie vielleicht einmal zu hart angefaßt, Ihren debilen Eifer zuwenig gelobt oder Ihnen zu selten über Ihre Gießkanne von einem Schädel gestreichelt? Und dann haben Sie wohl irre in sich hineingekichert und sich Ihren stupiden Racheplan zurechtgelegt.
Himmel, was bilden Sie sich ein. Sie wären der letzte, ich schwöre Ihnen, der allerletzte. Sie haben nichts, absolut nichts.
Man braucht Sie nur anzusehen und weiß sofort, daß Sie vollkommen hohl sind, nicht bloß dumm, sondern tatsächlich vollkommen hohl. Es gibt Leute, die bestehen zur Gänze aus Dreck.
Aber nicht einmal dazu haben Sie es gebracht. Sie stinken nicht einmal; Sie sind so charakterlos, daß Sie nicht einmal mehr Gestank verbreiten. Wahrscheinlich beneiden Sie meinen Mann nicht nur um seinen Erfolg, sondern ganz einfach auch darum, daß er ein Mensch ist, während Sie selbst nur noch aus der eigenen geruchslosen Ausdünstung bestehen. Ein Querulant an sich.
Wer Sie als Dreck, als Abfall bezeichnet, der überschätzt Sie bei weitem; und wer Sie überschätzt, der glaubt Ihnen vielleicht Ihre perfiden Lügen.
Hören Sie, Fielding, oder wie Sie heißen, ich lasse mir von keinem Menschen, aber erst recht nicht von einem Kretin wie Ihnen, meine Ehe zerstören.
Und ich werde nicht mit meinem Mann darüber sprechen, weil ich ihm eine derartige Aufregung ersparen möchte. (Was nur die halbe Wahrheit war.) Sie, Fielding, Sie werden diese Verleumdung zurücknehmen – stellen Sie es als dummen Scherz dar.
Schlimm genug, daß ja trotzdem etwas hängenbleibt, aber ich sage Ihnen: Nehmen Sie es zurück. Nehmen Sie Ihren Dreck zurück, und füllen Sie sich selbst damit an, vielleicht wird dann doch noch ein, wenn auch mickriges, aber immerhin ein Stück Mensch aus Ihnen.
Sie haben mich verstanden, denke ich doch. Sollten Sie aber nicht begreifen, sollten Sie Ihren Größenwahn nicht ablegen wollen, wäre ich gezwungen, jemanden zu engagieren, der darauf spezialisiert ist, Zauderern unter die Arme zu greifen.«
Sie zog den Finger und die ganze Hand und den ganzen Arm und schließlich den ganzen Körper zurück, schenkte ihm noch einen Blick, der ihre volle Entschlossenheit zum Ausdruck brachte, und stellte sich wieder in die Party, stellte sich wieder neben ihren Mann, lächelte und plauderte, wie man es von ihr erwartete, während der Professor immer mürrischer wurde und das neue Buch eines Kollegen durch den Kakao zog, was die Anwesenden ausgesprochen reizend fanden.
Ran verließ die Villa, setzte sich in ein Taxi, sank zurück, vollkommen desinteressiert an dem Umweg, den der Fahrer jetzt vorschlug.
»Machen Sie, was Sie wollen«, sagte Ran.
Die Frage, warum er nicht versucht hatte, seine Unschuld zu behaupten, stellte sich ihm nicht. Denn natürlich wäre das sinnlos gewesen. Die Art, wie der Finger auf ihn gerichtet gewesen war, hatte ihm von Anfang an klargemacht, daß er der letzte in diesem Spiel war, dem man ein Recht auf Unschuld zugestehen würde. Er mußte froh sein, daß man ihm die Chance gab, die Schweinerei zu beseitigen, die er nicht verursacht hatte (an der er aber schuld war).
Zu Hause legte er sich in die Badewanne. Sein Körper fühlte sich schlecht an, wie mißlungenes Kartoffelpüree, harte Stücke im Brei. In seinem Kopf konnten sich diverse Blasmusikkapellen und die Hardrocker von AC/DC auf keine gemeinsame Komposition einigen. Ran ging unter. Sein höchst eingeschränkter Lebenswille, sein alter, aber niemals eingestandener Wunsch, lieber den Toten als den Lebenden anzugehören, und nicht zuletzt die Auswirkungen mehrerer Gläser mittelmäßigen Whiskys führten dazu, daß Ran beinahe vergaß, wieder aufzutauchen.
Es war eigentlich ein Geräusch aus seinem Magen (der – wie bei Mägen häufig der Fall – die allgemeine Selbstaufgabe nicht mitbekommen hatte), welches Ran daran erinnerte, wieder aufzutauchen. Er ließ das erkaltete Wasser aus, blieb aber in der Wanne, duschte, damit das Kartoffelpüree in seinem Körper wieder eine erträgliche Temperatur annahm. Er hatte den Duschkopf zwischen seine Oberschenkel gepreßt und sah sich auf der silbergrauen Plastikoberfläche wie in einem Spiegel. Sein Schädel war durch die Form und Wölbung des Duschkopfs ein wenig in die Länge gezogen, ohne unnatürlich zu wirken.
»Hallo Ranulph«, sprach er sein Duschkopfgesicht an, »was ist bloß schiefgegangen. So schlecht fand ich das Leben bisher gar nicht. Manchmal sogar großartig.«
Das Gesicht auf dem Duschkopf bewegte die Lippen naturgemäß synchron mit denen Rans, aber der Blick verriet, daß es sich beim besten Willen an nichts erinnern konnte, was die Bezeichnung »großartig« verdiente.
Wesentlich erschreckender als dieser spöttische Zug in Rans Spiegelbild war der Umstand, daß nun hinter seinem Spiegelbildgesicht, etwas kleiner, weil weiter hinten im Raum, das Gesicht einer Frau auftauchte. Sie lachte tonlos, aber ein Ton war auch gar nicht nötig, damit Ran dieses noch nie gesehene, aber bereits zweimal gehörte Lachen wiedererkannte.
Die Badewanne ist ein so gefährlicher Ort wie das Bett, weshalb es nicht verwundert, daß in Kriminalgeschichten wie auch im wirklichen Kriminalleben die Leute mit Vorliebe in Betten und Badewannen umgebracht werden, wo das Opfer hilflos ist (nicht selten durch Nacktheit), aber nicht ganz ohne Würde (wie etwa auf der Toilette, wo immer seltener Verbrechen verübt werden).
Das Kartoffelpüree kochte, wie man sich vorstellen kann. Nicht vor Wut, sondern vor Angst.
Ran hielt den Duschkopf etwas höher, um die Frau besser sehen zu können. Glücklicherweise vergaß er dabei, sich selbst zu betrachten; der Anblick der eigenen angstvollen Visage hätte ihm nicht gerade geholfen. Was er sah, das waren ihre langen braunen Haare, ein eher schmales Gesicht (was vielleicht nur auf den Duschkopf zurückzuführen war), stark geschminkte Augen, schwarz und klebrig. Aber vor allem nahm er ihr Lachen wahr, den nur leicht geöffneten Mund. Ihr Lachen war gewaltig auch ohne Ton und Grimasse. Er erkannte ihre Freude darüber, seine Hilflosigkeit zu betrachten – darum tauchte sie ja gerade dann auf, wenn er im Bett lag oder in der Badewanne, gerade einer Ohnmacht entkommen, müde, kraftlos, nackt, umfassend nackt.
Und sich dieser umfassenden Nacktheit schmerzlich bewußt, war er endlich bereit, auch einmal einen kleinen Beitrag zu leisten, ließ den Duschkopf fallen, schwang sich aus der Wanne und griff nach einem Handtuch, um sein Geschlecht zu bedecken. Mein Gott, er war ein Mann, fuhr es ihm durch den Schädel, kein Boxer oder Karatekämpfer, aber doch wohl kräftig genug, um so einem Weib den Arm zu verdrehen.
Den maßgebenden Teil seiner Nacktheit bedeckt, hatte er ein wenig an Sicherheit gewonnen, weshalb er sich rasch umwandte, um irgend etwas zu unternehmen.
Aber die Frau war bereits wieder verschwunden. Sie war ungewöhnlich schnell, schnell wie ein Alien, und Ran überlegte, ob er vielleicht an Halluzinationen leide. Nun – wenigstens diese Sorge brauchte er sich nicht zu machen. Denn am Spiegel seines Badezimmerschrankes klebte ein Zettel, der auch bei Berührung ein solcher blieb. Das bewies immerhin die Existenz dieser Frau. Zudem sollte so ein Zettel die Geschichte ein Stückchen vorwärtstreiben. Tat er aber zunächst nicht, denn der Sinn der Nachricht blieb Ran völlig verborgen:
REMEMBER ST. KILDA
3
Das Telefon läutete. Seit dem einen Anruf, der die Vernichtung seiner Person eingeläutet hatte, wurde Ran unruhig, wenn das Telefon klingelte.
Es war Andreas X. Faux, Leiter einer interdisziplinären Kunst- und Künstlerfinanzierungsgesellschaft. Ran hatte ihm vor einiger Zeit als bezahlter Experte beigestanden, als es darum gegangen war, eine für Enten ideale Teichlandschaft in der Wiener Secession einzurichten. Seither hatte Ran noch an einigen Projekten teilgenommen, jedesmal überrascht, wie hoch die Budgets dieser Leute waren, solange die Show nur aufwendig genug war, ein internationales Niveau behauptet wurde, innovative Praktiken zur Anwendung kamen und sich jede Menge Kuratoren auf die Zehen traten. Die Frage nach dem Sinn dieser Projekte, also der Inszenierung eines zeitgemäßen Kunstgefühls, stellte sich Ran nicht, nicht nur, weil er nichts davon verstand – war er doch bloß das Werkzeug in den Händen eines Künstlers –, sondern weil er auch begriffen hatte (entgegen seiner eigenen romantischen Vorstellung von Kunst), daß das Projekt weit hinter die Projektfinanzierung zurückfiel und daß folgerichtig die gelungensten Projektfinanzierungen völlig ohne Projekt auskamen, da die Künstler ja gar keinen Hehl daraus machten, daß im Zuge der Verkapitalisierung aller Gesellschaftsbereiche nicht nur, sondern vor allem die sogenannte Avantgarde (die Marke Avantgarde) die vollkommene Unterwerfung praktiziert, ja im Grunde erst mittels dieser Unterwerfung den Anspruch, Kunst zu sein, erfüllt. Was natürlich gerade in der Kunst nichts Neues ist – neu ist, daß der Kontextkünstler (der alle, die sich dem Kontext bzw. der Kontextproduktion verweigern, für faschistoid hält) trotz seiner Habtachtstellung vor Industrie, Innovationssteuerung und Finanzierungsästhetik eine gewisse rebellische Körperhaltung zum besten gibt, und sei es nur, indem er schneller, undeutlicher und nichtssagender redet als die von der Avantgarde ungeküßt gebliebenen Menschen. Denn bei aller Bestrebung, die Kunst im allgemeinen aufzulösen und sie solcherart aus dem Betrachtungsanspruch des Kleinbürgers zu befreien, will der Künstler sich selbst natürlich nicht im allgemeinen auflösen, wie er ja auch sich selbst nicht aus dem Betrachtungsanspruch des Kleinbürgers befreien will, von dem er weiterhin, zumindest als Intellektueller, mißverstanden und gehaßt werden möchte. Indem jemand schneller, undeutlicher und nichtssagender redet als alle anderen, glaubt er, die Vorstellung des Kleinbürgers vom Intellektuellen als einem arroganten, vertrottelten und anmaßenden Menschen in geradezu idealer Weise zu erfüllen. Und liegt damit absolut richtig.
Fauxi kündigte Ran an, ihn in einer Viertelstunde abholen zu wollen. Ran hatte sie völlig vergessen, die Einladung nach Altneudörfl, wo die Kontextinitiative Hausbau ihre soeben fertiggestellte Skulptur vorstellte: einen Flughafen mit allem Drum und Dran, Landebahn, Tower, Duty-free-Shop, sogar einigen kleineren Passagiermaschinen. Natürlich hatte es Proteste gegeben – zunächst, da die Anrainer nicht einsehen wollten, warum gerade in ihrer gottverlassenen Gegend ein Flughafen von beträchtlicher Größe entstehen sollte. Also erklärte man den Leutchen, daß es sich bei diesem Flughafen nicht um einen wirklichen Flughafen handelte, in dem Sinn von Wirklichkeit, daß Flugzeuge starten und landen, sondern um eine sozusagen fotorealistische Skulptur, aber kein Ready-made, wozu ja ein gebrauchter Flughafen genügt hätte, und auch keine soziale Skulptur, da – entgegen letzten Trends, die sich eben auch schon überholten – die Benutzung der diversen Einrichtungen dieses künstlichen Flughafens durch wirkliche Menschen nicht vorgesehen war, ja, ganz im Gegenteil, verboten war, so wie es verboten war, auf einem Rembrandt herumzukratzen – d.h., der Kontext bezog sich weniger auf das Ereignis Flughafen als auf die zukünftige Konservierung von Kulturgut.
Ende der Leseprobe