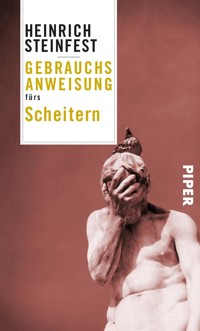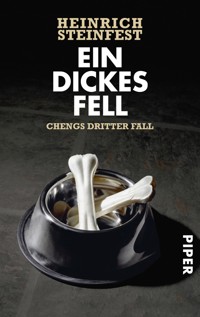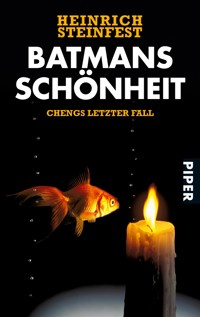14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Fälscher, der ein Killer ist Oliver Roschek ist angesehener Wombatforscher und wurde zuletzt in Australien gesehen. Seine Frau Astrid bittet Frau Wolf und Cheng, ihren Mann wieder aufzuspüren. Die beiden Detektive nehmen den lukrativen Auftrag an, obwohl Flugzeuge nicht zu ihren bevorzugten Transportmitteln zählen. Doch in Roscheks Ferienhaus angekommen, fehlt jede Spur von ihm – stattdessen treffen sie auf vier sonderbare Urlauber. Könnte einer von ihnen der Fälscher sein, jener weltweit gesuchte Auftragsmörder? Hat er gar den Wombatforscher auf dem Gewissen? Nicht ausgeschlossen, denkt Cheng, und dann machen die vier ernst. »Ein Kriminalfall, der sich ständig verändert. Ein scharfer Blick auf die Seltsamkeiten unserer Gegenwart. ›Gemälde eines Mordes‹ ist ein starkes Buch, fein komponiert, wie seine Gemälde.« SWR Kultur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: FinePic®, München
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Disclaimer
–
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Die Szene mit Udo Lindenberg ist natürlich frei erfunden, die ganze Geschichte ist frei erfunden, und Ähnlichkeiten mit real lebenden Figuren und vor allem real existierenden Staaten und real ablaufenden Schweinereien ergeben sich daraus, dass diese Geschichte in einem Paralleluniversum spielt. Das Wort »parallel« sagt es ja eigentlich, weniger im Sinn von gleichzeitig als von gleichartig. Es bestehen Parallelen zwischen den Welten, man möchte meinen, aufgrund einer gewissen Zwangsläufigkeit des Schrecklichen wie des Komischen.
In letzter Zeit lese ich unentwegt und in spöttischem Ton von Sofa-Pazifisten und frage mich, ob man denn nicht vielmehr von Sofa-Militaristen sprechen müsste, von Leuten, die da gemütlich und behaglich auf ihren Sofas sitzen oder auf ihren auch recht behaglichen Abgeordnetenbänken und sich anderswo den totalen Krieg wünschen. Die da also fröhlich weiter Waffenlieferungen fordern und fördern und einem endlosen Sterben wieder mal fürs Vaterland und die Freiheit und den Ruhm das Wort reden. Anstatt nämlich ihrerseits in dieses endlose Sterben zu ziehen. Nein, sie sitzen ganz waffennärrisch und selbstzufrieden auf ihren gemütlichen und behaglichen Sofas, wie das auch die Pazifisten tun, was mir aber bei Pazifisten viel weniger als ein Widerspruch erscheint, das gemütliche, behagliche Sofa.
Ein unbekannter Philosoph in einer nie gesendeten Talkshow
Viele Menschen sind im Kriege glücklicher als im Frieden, vorausgesetzt, dass die unmittelbaren leidvollen Folgen der Kampfhandlungen sie persönlich nicht allzu schwer treffen.
Der durchaus bekannte Philosoph Bertrand Russell in Macht und Persönlichkeit
Bücher sind zum Lesen da, selbst die unverschämt wertvollen.
Bruce Willis im Film Marauders, auf die Erstausgabe von Berge des Wahnsinns von H. P. Lovecraft zeigend
Das ist ganz einfach das tollste Wesen, das mir je begegnet ist.
Der Zoologe Oliver Roschek über einen australischen Wombat in seinem Buch Meine Zeit mit Toby
1
Es war merkwürdig, dass Cheng jetzt, da er fast sechzig war, immer öfter für einen Japaner gehalten wurde und nicht für einen Chinesen, der er abstammungsgemäß schließlich war und worauf man ihn so viele Jahre und Jahrzehnte immer wieder angesprochen hatte. Was ihm stets unangenehm gewesen war, ihm, dem in Wien geborenen und aufgewachsenen und immer nur Wiener gewesenen Markus Cheng. Irrtümlich als Chinese bezeichnet zu werden, während es ja bloß seine sogenannten Wurzeln waren, die aus China stammten. Er pflegte zu sagen, ein Baum bestehe doch in erster Linie aus seinem kräftigen Stamm und seinen Zweigen und den Blättern und der schönen Fähigkeit, tagsüber Kohlenstoffdioxid zu verbrauchen und Sauerstoff herzustellen. Auf den Einwand, dass auch eine Wurzel nicht ganz unwichtig sei, wenn man die Zufuhr von Wasser und Nährstoffen bedenke, konterte Cheng mit dem Hinweis, dass vielleicht seine Wurzel chinesisch sei, diese aber von Anbeginn an in der Wiener Erde gesteckt habe. Und auf die Erde komme es schließlich an.
Und doch war es zuletzt mehrfach geschehen, dass ihn Leute, die ihn eben erst kennengelernt hatten – etwa Kunden der Detektei Wolf, in der er als Sekretär und Assistent arbeitete –, nicht nach seinen chinesischen, sondern seinen japanischen Wurzeln gefragt hatten. Natürlich keine Japaner oder Chinesen, so wenig, wie ein Tiroler oder Steirer den Fehler gemacht hätte, einen anderen Tiroler oder Steirer fälschlicherweise für einen Steirer oder Tiroler zu halten.
Vielleicht rührte es von einer gewissen Ähnlichkeit Chengs mit dem japanischen Schauspieler Hiroyuki Sanada her, der in Filmen wie 47 Ronin und Mortal Kombat mitgespielt hatte. Filme, die Cheng als Filmfreund und als jemand, der sich mit Filmen gerne in den Schlaf wiegte, natürlich kannte – oder des Schlafes wegen halb kannte. Von irgendwelchen Ähnlichkeiten war er hingegen so gar kein Fan, egal ob chinesisch oder japanisch. Wenn überhaupt, so sagte er, besitze er eine gewisse Verwandtschaft mit einer der Figuren auf Caravaggios Gemälden im Kunsthistorischen Museum, sagte aber nicht, welche. Möglicherweise meinte er auch nur die Hell-Dunkel-Wirkung von Caravaggios Gestalten. Denn diese Wirkung besaß Cheng tatsächlich. Gleich, wie die Lichtverhältnisse waren, schien er stets halb im Schatten und halb im Licht zu stehen. Selbst das für sein Alter ungemein volle Haar, das er zuletzt wieder etwas länger hatte wachsen lassen, verfügte über diese Wirkung, indem sich Schichten von immer noch sehr schwarzem Haar mit Stellen weiß gewordenen Haars abwechselten. Doch im Gegensatz zum Caravaggio-artig farbigen Helldunkel seines Gesichts machte das Haar den Eindruck, es spiegele sich darauf die stark komprimierte Version eines Films von Fellini. Also nicht etwa Fellinis Stadt der Frauen, weil der ja bereits in Farbe gedreht worden war, sondern natürlich La dolce vita. Ohne dass dies aber dem Eingriff eines Friseurs zu verdanken gewesen wäre. Denn sosehr dieser Wechsel von Schwarz und Weiß künstlerisch anmutete, handelte es sich um Chengs eigene Natur. Botanisch gesprochen um seine Krone.
Cheng, der so lange als der einarmige Detektiv gegolten hatte, war nun nicht mehr der einarmige Detektiv, sondern der einarmige Sekretär. Und zwar der Sekretär jener Frau Wolf, die einst seine Sekretärin gewesen war, nun jedoch die Detektei leitete und also seine Chefin geworden war. Und beide – er fast sechzig, sie bereits etwas über sechzig (was man ihm nicht ansah, ihr schon, aber das war gut so) – fühlten sich durchaus wohl in ihren neuen Rollen.
Gar nicht wohl hingegen fühlte sich Cheng in diesem Taxi, in dem er saß und das ihn an den südwestlichen Rand von Wien brachte, zu einer Adresse, die nicht unweit der Wotrubakirche lag. Ein Mitte der 1970er-Jahre nach den Entwürfen des Bildhauers Fritz Wotruba errichtetes Gotteshaus, zusammengesetzt aus 152 Betonwürfeln, keine große Kirche, aber ungemein wuchtig und bei aller Wucht höchst elegant. Eine Kirche, die jüngere Menschen an einen Transformer erinnern mochte, aber halt keinen bunt lackierten, sondern einen gräulichen und bräunlichen und auf eine kräftige Weise schwermütigen. Wie man sich vielleicht dachte, so sehe Gott aus, wenn er traurig war. Und irgendwie war die Vorstellung eines zur Traurigkeit fähigen Gottes recht tröstlich. Was wiederum den eigentlichen Sinn eines solchen Bauwerks darstellte.
Diese Kirche hatte in einem der früheren Fälle Chengs irgendeine Rolle gespielt. Irgendeine. Genau konnte Cheng es nicht mehr sagen. Er vergaß jetzt unheimlich viel. Je länger etwas zurücklag, umso mehr verschwamm es, tauchte in einen Nebel. Cheng sagte dazu: »Meine Vergangenheit ist eher ziemlich abstrakt.« Während er das jüngst Geschehene bestens behalten konnte. Also umgekehrt zur gerne kolportierten Anschauung, demente Leute würden zumeist vergessen, was gerade erst geschehen war, und sich dafür an das lang Zurückliegende erinnern. Aber dement war er ja nicht, sondern hellwach, konzentriert, gewitzt, nur dass er sich einfach an vieles nicht erinnern konnte, was früher geschehen war. Kein Mann ohne Eigenschaften, aber mit eingeschränkter Vergangenheit. Was wohl auch mit dem »Ding in seinem Kopf« zu tun hatte. Doch davon später.
Wenn gerade gesagt wurde, Cheng fühle sich unwohl in diesem Taxi, dann, weil das Innere vollkommen überheizt war und Cheng auf sein Ersuchen hin, der Fahrer möge die Heizung herunterdrehen, von diesem darüber belehrt wurde, wie es sein würde, einen ganz Tag lang in einem kalten Wagen zu sitzen. Dabei war Cheng ohnehin nur mit einem Anzug und dünnen Lederschuhen bekleidet – er hielt Mäntel für ein Zugeständnis an die Hässlichkeit einer vom Wetter stark verunsicherten Menschheit. Lieber fror er, als sich mittels Mantel zu verunstalten. Doch auch ohne Mantel schwitzte er in diesem Wagen. Worauf er deutlich hinwies, aber der Fahrer argumentierte dagegen. Er erzählte, aus Sri Lanka zu stammen, wo es selbst im Dezember noch an die dreißig Grad habe. Und nicht drei Grad wie hier in diesem scheußlichen Wiener Dezember.
Cheng hätte gerne gefragt, wieso der Mann dann nicht in Sri Lanka geblieben sei, wenn es dort so schön warm war, dazu achtzig Prozent Luftfeuchtigkeit, aber klar, das war nicht die Frage, die man jemandem stellte, der wohl kaum ohne schmerzlichen Grund sein Land verlassen hatte. Schon gar nicht, wenn er Taxifahrer geworden war. Denn nach Chengs übertriebener Auffassung besaß der Beruf des Taxifahrers ähnlich dem Beruf des Kaffeehauskellners einen teuflischen Ursprung.
Das war gewiss ein Vorurteil. Aber Cheng war von der Macht der Vorurteile überzeugt, die jeder Mensch mit sich herumtrug. Wozu in seinem Fall eben auch das Vorurteil gegen alles Chinesische gehörte, das wie die meisten Vorurteile von einer Art irrationaler Abwehr bestimmt war. Jedes Vorurteil war reiner, dummer Unsinn und doch geprägt von einem inneren Schrecken. Und dieser Schrecken fundamental.
Dabei gab es auf dieser Welt wahrlich monströsere Gestalten als Taxifahrer zu beklagen. Doch diese anderen erschienen Cheng nun mal gänzlich erdgebunden, Taxifahrer hingegen aus tieferen, unterirdischen Zonen zu stammen. Um jetzt nicht das Wort Dämonen zu gebrauchen.
Faktum war, dass dieser eine hier während der etwas mehr als halbstündigen Fahrt nicht willens war, die Heizung zu senken – auch wenn er auf dem Display seines Mercedes herumfingerte, so dürfte er die Temperatur eher noch höher gestellt haben –, erzählte dafür aber ausgiebig von den Schönheiten der sri-lankischen De-facto-Hauptstadt Colombo. Was Cheng überhaupt nicht interessierte. Er wollte ganz sicher keinen Ort besuchen, an dem ein tropisches Regenklima herrschte. Hitze und Regen waren für ihn wie Elend und kein Erbarmen, die Hitze elendiglich, der Regen erbarmungslos und in dieser Kombination eher einer Strafe zuzuordnen.
Cheng hasste es zu schwitzen. Der oft behauptete gesundheitliche Nutzen des Schwitzens war ihm gleichgültig. Im Grunde war er ein Mann, der lieber aus Stein als aus Fleisch bestanden hätte. Steine erschienen ihm so viel würdiger und edler als jeder Mensch. Und das sagte er auch gerne, ohne damit einen Witz machen zu wollen: »Im nächsten Leben werde ich ein Stein.«
Wobei das Tragische war, dass dieses nächste Leben gar nicht mehr so weit entfernt lag.
Cheng stieg kurz nach vier Uhr aus dem Taxi, als gerade die Sonne unterging und jenem Rest von Schnee, der stark verdreckt an den Straßenrändern und auf den kleinen Rasenflächen klebte, einen rötlichen Anschein verlieh, was Cheng an Nasenbluten auf einer Skipiste erinnerte.
Das Haus, vor dem er stand, war eine mittelgroße Jahrhundertwendevilla, womit also nicht die Jahrhundertwende vor zwanzig Jahren gemeint war, sondern die viel schönere vor hundertzwanzig Jahren (und sei’s nur der Reiz, der sich daraus ergibt, dass etwas länger zurückliegt als etwas anderes).
Er betätigte den Knopf neben der mit einem Kameraauge ausgestatteten Gegensprechanlage, aus der jedoch keine Stimme drang, die wissen wollte, wer er sei. Denn immerhin wurde er erwartet.
Eigentlich hätte Frau Wolf diesen Termin wahrnehmen sollen, aber sie hatte kurzfristig in die Slowakei reisen müssen, wo ein steinalter Onkel von ihr lebte, der auf die hundert zuging. Er war ins Krankenhaus eingeliefert worden, und Frau Wolf wollte persönlich darauf achten, dass das Projekt der Hundertjährigkeit nicht durch eine falsche oder unsachgemäße Behandlung gefährdet wurde. Wobei sie eigentümlicherweise meinte, dieser Onkel sei ein miserabler Mensch gewesen, wenn nicht ein Monster, sie es aber genau darum gut finde, wenn er den Prozess des Hinwelkens so lange als möglich am eigenen Leib durchmachen müsse.
Frau Wolf war eine ausgesprochen zynische Person. Aber nicht ohne Herz.
Und Cheng? Auch er war nicht ohne Herz. Aber sein Herz war – entsprechend seinem Wunsch fürs nächste Leben – ein Herz aus Stein. Was nicht bedeutete, dass es hart und böse und kalt war. Eher so, wie es sich anfühlt, wenn man sich an einem warmen, aber nicht heißen Tag auf eine sonnenbeschienene steinerne Bank setzt.
So war sein Herz.
Und mit einem solchen Herz trat er nun durch die von einem Surren begleitete, automatisch sich öffnende Eingangstüre und begab sich auf zuerst schmalen, dann sich weitenden Stufen hinauf zu einer Terrasse, die wie ein umgekippter Halbmond dem Entree des Gebäudes vorgelagert war.
Dort empfing ihn ein Mann, den Cheng im ersten Moment für Helmut Qualtinger hielt, den berühmten Schauspieler und die Verkörperung der österreichischen Seele, wenn man sich diese österreichische Seele mit einer vergnüglichen Form von Niedertracht vorstellte. Aber klar, der Qualtinger war bereits 1986 verstorben und auch nie Anwalt gewesen. Dieser Mann schon, der Cheng jetzt die Hand reichte. Eine Hand, wie wenn man zehn Kilo Mais oder Reis zu spüren bekommt, etwas Rieselndes, aber ungemein schwer, und einen dabei der Gedanke ereilt, wie das wäre, unter einem Berg von Getreide zu ersticken.
Stimmt, nicht nur die Hand, der ganze Mann war von jener Masse, unter die man nicht geraten wollte. Gut hundertzwanzig Kilo. Eine gewaltige Körpermitte, ein mächtiger Schädel, seine auch unter dem maßgeschneiderten Jackett sichtbar fleischigen Arme, bloß die Beine so dünn, dass man sich um die Statik der ganzen advokatischen Konstruktion sorgen konnte.
Der Mann stellte sich als Dr. Kollmann vor und erklärte, als Anwalt der Familie Roschek zu fungieren und in dieser speziellen Situation von Frau Roschek um Beistand gebeten worden zu sein. Worin nun diese spezielle Situation bestehe, werde Cheng gleich erfahren.
Mit einer kleinen Geste, als könnte man mit einem einzigen Finger einen Luftgeist skalpieren, wies der Anwalt Cheng an, durch die hohe gläserne Flügeltüre ins Innere zu treten. Ein Inneres, das entgegen der hundertzwanzig Jahre alten Haushülle vollkommen zeitgenössisch eingerichtet war. Einzig die Stuckatur am Plafond des hohen Raums, in den der Anwalt Cheng führte, rief einem die Vergangenheit ins Bewusstsein. Ansonsten besaß alles jenen aufgeräumten Chic, der bei aller Ausgewogenheit den Eindruck machte, als werde hier irgendein Verbrechen kaschiert.
Inmitten dieses aufgeräumten Chics stand eine auch nicht ganz unelegante Frau, die gewiss einmal eine Schönheit gewesen war. Aber da war irgendetwas zwischen einem Zuviel an Bitterkeit und einem Zuviel an Zigaretten und Tabletten, vielleicht sogar einem Zuviel an yogaartiger Verbissenheit gewesen, was ihrer Schönheit zugesetzt hatte. Nicht das Alter. Das Alter wird gerne überschätzt, es ist das Leben, das uns zerstört.
Sie mochte auf die sechzig zugehen. Sehr schlank, so eine Martini-Schlankheit, wenn man zwar jede Menge nicht ganz kalorienarmer Martinis zu sich nimmt, sonst aber kaum etwas anderes.
Dr. Kollmann stellte diese Frau als Astrid Roschek vor.
Cheng reichte ihr die Hand (man war kürzlich wieder zum Händeschütteln zurückgekehrt, auch wenn es sich noch immer wie ein verzichtbares Abenteuer anfühlte). Ihre Hand besaß nun rein gar nichts Rieseliges, erfüllte schon eher Chengs Bedürfnis nach etwas wie einem aufgewärmten Stein.
Zu dritt nahm man in dunklen Lederfauteuils Platz, die um einen gläsernen Couchtisch gruppiert waren. Darauf neben einer kleinen Bronze und einem größeren Aschenbecher mehrere locker verteilte Journale, wobei Cheng mit raschem Blick den Bruch innerhalb dieser Ansammlung erkannte, dadurch nämlich, dass zwischen den obligaten Mode-, Architektur- und Kunstzeitschriften auch ein zoologisches Fachjournal lag. Das einfach nicht zum Rest passte. Das englischsprachige Zoological Journal of the Linnean Society.
Dieses Journal war ein Fingerzeig auf den abwesenden Mann des Hauses, wie Cheng nun gleich erkennen würde. Gewissermaßen ein winzig kleiner Aufschrei.
Zuerst aber entschuldigte sich Cheng dafür, dass nicht Frau Wolf – sie wurde ausschließlich und immer Frau Wolf genannt –, dass also Frau Wolf nicht erschienen sei. Er erwähnte die slowakischen Umstände, jedoch nicht diese gewisse Perfidie, die hinter Frau Wolfs Engagement für einen fast Hundertjährigen steckte.
Er als ihr Sekretär wäre aber gerne bereit, sich anzuhören, worin ein möglicher Auftrag durch Frau Roschek und ihren Anwalt bestehe.
Dieser Anwalt war es nun, der betonte, wie wichtig es sei, gleich von Beginn an keinerlei falschen, wenn auch typischen Schlüsse zu ziehen.
»Und das bedeutet was?«, fragte Cheng und lehnte sich zurück, dabei sein Kinn mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand stützend.
Dr. Kollmann erklärte, dass Frau Roscheks Ehemann verschwunden sei. Oliver Roschek. Nicht hier, nicht um die Ecke, sondern auf der anderen Seite der Erdkugel, in Australien, wohin er, der Zoologe – ach ja, darum! –, gereist war, um seine Forschungen über den Wombat fortzusetzen.
Wombat?
Ein Höhlen grabender, pflanzenfressender Beutelsauger, erklärte der Anwalt. Ausgestattet mit einem erstaunlichen Abwehrmechanismus, symbolisch gesprochen mit einem Hintern aus Stahl, mit dem er seinen eigenen Bau verschließen könne, auf dass sich seine Fressfeinde an diesem Hintern ihre Zähne ausbissen. Naturwissenschaftlich gesprochen ein von Knorpeln und Knochen und zäher Haut verstärktes Hinterteil, das etwa für einen angreifenden Dingo zum unlösbaren Problem wurde. Leider nicht für jene Autos, die Wombats überfuhren, woran kein noch so starkes Hinterteil etwas ändern konnte.
Oliver Roschek hatte vor Jahren über ein bestimmtes Wombatmännchen ein Buch verfasst, eine Mischung aus wissenschaftlichem Bericht und doch sehr persönlicher Schilderung des Verhältnisses zwischen einem Tier und dem ihn beobachtenden Menschen. Man könnte auch sagen, einem Menschen und dem ihn beobachtenden Tier. Meine Zeit mit Toby war in mehrere Sprachen übersetzt und zumindest in Deutschland und Australien ein Bestseller geworden, allerdings von der Wissenschaftsgemeinde seines literarisch-erzählerischen und mitunter recht romantischen Stils wegen auch heftig kritisiert beziehungsweise ignoriert worden. Aber das lag eben Jahre zurück, und es war dem kein weiteres Wombatbuch gefolgt. Umso weniger, als sich Roschek wieder seinem eigentlichen Forschungsgebiet, der Anpassungsfähigkeit von Tieren im städtischen Raum, gewidmet hatte und an einem Buch arbeitete, das den Titel Die andere Wiener Gesellschaft tragen sollte (wobei er zum Zwecke dieser Untersuchung auch immer wieder an andere Orte reiste, um Vergleiche der »Wiener« mit anderen »Städtern« vorzunehmen).
So ganz dürfte Oliver Roschek aber seine Wombatgeschichte nicht vergessen haben, denn zwei Wochen zuvor war er zu einer Reise nach Australien aufgebrochen, war nach Sydney geflogen und von dort mit einem Mietwagen ins Kangaroo Valley gereist, um in einem Hotel nahe jenem Areal abzusteigen, in dem eine größere Anzahl der eher einzelgängerisch lebenden Nacktnasenwombats lebte. Unter ihnen jener Toby, den Oliver Roschek vor gut acht Jahren studiert hatte, als sie beide jünger gewesen waren, der damals zweiunddreißigjährige Zoologe und der gerade erst zur Geschlechtsreife gelangte zweijährige Wombat.
Roschek schien von einem australischen Kollegen eine wichtige Nachricht bezüglich des in die Jahre gekommenen Toby erhalten zu haben. Etwas, was ihn dazu gebracht hatte, seine Arbeit an Die andere Wiener Gesellschaft zu unterbrechen und nach Australien zu reisen. Es sah so aus, als sei er problemlos in dem Viersternehotel angekommen, von wo er seiner Frau noch mehrere Fotos geschickt und mit ihr über Skype gesprochen hatte, bevor er einen Tag später das nahe gelegene Areal aufsuchen wollte, in dem die Wohnhöhle Tobys lag.
Ein Besuch, von dem Roschek nicht zurückgekehrt war, wenn er ihn überhaupt angetreten hatte. Faktum war, dass er aus seinem Hotelzimmer verschwunden und nicht wieder aufgetaucht war. Und zwar ohne etwas zu hinterlassen, was eine Spur war, eine Nachricht, ein Abschiedsbrief, etwas Dramatisches wie etwa ein Flecken von Blut auf dem Sitz seines Wagens, weniger Dramatisches wie zoologische Ausrüstungsgegenstände irgendwo im Bendeela-Areal oder wenigstens jemanden, der ihn noch durchs Gehölz hatte streifen sehen. Nichts. Nur die unbezahlte Rechnung eines Hotelzimmers, das Roschek für eine ganze Woche gemietet hatte. Und eben der auf dem Hotelparkplatz zurückgelassene Mietwagen, in dem man ein paar seiner Haare, ein paar Fasern seiner Kleidung entdeckt hatte. Das waren zwar Hinterlassenschaften, aber sie bewiesen nicht viel mehr, als dass dieser Mann überhaupt existiert hatte. Und nicht, ob er noch lebte oder tot war. Oder was oder wer ihn veranlasst haben mochte, sich gleichsam in Luft aufzulösen.
»Ich will und muss ganz offen sein«, erklärte Dr. Kollmann und blickte dabei seine Klientin an, die ihm ein zustimmendes Nicken schenkte, »Herr und Frau Roschek trennen zwanzig Jahre. Und Frau Roschek ist in hohem Maße vermögend. Ein Vermögen, an dem ihr Mann jedoch wegen eines Ehevertrages …«
»Den Sie aufgesetzt haben«, sagte Cheng.
»Den ich aufgesetzt habe«, bestätigte Dr. Kollmann, »und der Herrn Roschek keinerlei direkten Zugriff auf dieses Vermögen zubilligt. Ihm allerdings in den letzten zehn Jahren ein Leben allein für seine Wissenschaft ermöglicht hat. Ohne darum irgendeine störende Lehrtätigkeit ausüben oder sich um Forschungsgelder anstellen zu müssen. Ich sage Ihnen das darum, weil der Verdacht nicht nur der australischen, sondern auch der hiesigen Behörden in die Richtung führt, Herr Roschek habe sich einfach einer Ehe, die bislang für ihn vorteilhaft war, derer er nun aber müde wurde, durch simple Flucht und simples Untertauchen und ein neues Leben unter neuem Namen entzogen. Die in Australien schließen ein Verbrechen aus. Auf eine Entführung bestehe keinerlei Hinweis. Und so weiter. Man kann sagen, Herrn Roscheks Verschwinden hat nicht gerade zu einer großen Aufregung geführt. Und die österreichischen Kollegen scheinen ohnehin andere Sorgen zu haben.«
»Sie aber nicht«, sagte Cheng.
»Verständlicherweise«, meinte der Anwalt, wurde aber nun von Frau Roschek unterbrochen, die mit einer Stimme redete, in der recht viel Überheblichkeit lag, die Überheblichkeit ihrer einstigen Schönheit, aber auch die ihres originellen Verfalls.
»Glauben Sie mir«, sagte sie, »hätte Oliver mich verlassen wollen, hätte es nicht der Schmierenkomödie eines vorgetäuschten Wombatbesuchs bedurft. Das hätte er genauso gut auch hier tun können. Wir leben nicht im Mittelalter, und ich bin nicht Heinrich VIII, nicht einmal Elisabeth I.«
»Die war auch nie verheiratet«, meinte Cheng.
»Aber ein wenig rachsüchtig«, antwortete Frau Roschek. »Es ist jedenfalls großartiger Unsinn, wenn man eine dubiose Flucht meines Mannes aus der Ehe annimmt. Eher ist es ein Beweis für die Faulheit derer, die das untersuchen sollen.«
»Und da kommen Sie ins Spiel«, sagte der Anwalt. »Sie und Frau Wolf, die wir gerne dafür bezahlen, genau das nicht zu sein.«
»Faul«, setzte Cheng das fehlende Wort ein.
»Richtig«, bestätigte Dr. Kollmann. »Wir wollen, dass Sie nach Australien fliegen, sich an diesen Ort begeben, zu diesem Hotel, wo Herr Roschek zuletzt war und wo übrigens noch immer sein Koffer steht …«
»Sie wollen, dass wir den Koffer zurückbringen?«
»Wenn Sie darin etwas Relevantes finden, dann schon«, sagte Dr. Kollmann, »aber das könnte ich freilich selbst tun. Nein, Sie sollen die Spuren finden, die die Polizei nicht gefunden hat oder nicht finden wollte und die zu Herrn Roschek führen.«
»Und wenn wir auf ihn stoßen?«
»Informieren Sie uns, und wir sehen weiter.«
»Was nicht einfach sein dürfte«, erklärte Cheng, »wenn er gar nicht gefunden werden möchte.«
»Das ist die Prämisse, von der nicht auszugehen wir Sie bezahlen. Vielmehr meinen wir, dass er sehr wohl gefunden werden möchte.«
Cheng entgegnete, es sei schwierig, einen Auftrag zu übernehmen, bei dem eine gewisse Wahrheit vorgegeben werde.
»Soweit ich sehe«, sagte der Anwalt, »sind Ihre Honorarforderungen beträchtlich.«
Das stimmte. Frau Wolf und ihr Sekretär waren nicht gerade darum bemüht, billiger als die Konkurrenz zu sein. Im Gegenteil.
»Sie wollen aber sicher nicht«, meinte Cheng, »dass wir Ihnen letztlich eine Lüge servieren.«
Es war wieder Frau Roschek, die mit ihrer Stimme aus weichem Eisen meinte: »Servieren Sie mir meinen Mann, und wie viel Wahrheit und wie viel Lüge dabei herauskommt, das können Sie uns überlassen.«
»Gut. Sie kennen die Konditionen von Frau Wolf.«
Der Anwalt nickte, meinte dann aber, es dürfe keinen Aufschub geben. Er könne noch heute eine Reservierung von zwei Tickets für morgen Nachmittag mit Emirates nach Sydney vornehmen lassen.
»Solche Eile?«, fragte Cheng mit einem Lächeln, das seinen kurzen Kinnbart – auch dieser in Schwarz und Weiß, praktisch der Vorspann zu La dolce vita – in Schwingung brachte wie ein leichter Wind ein Feld von Weizen.
»Es ist eine primäre Bedingung, dass es so rasch geht«, sagte Dr. Kollmann.
»Wir haben schon genug Zeit verloren«, bestätigte die Dame des Hauses, über die Cheng natürlich bereits einiges in Erfahrung gebracht hatte. So war Frau Roschek als junge Frau nach dem Unfalltod ihrer Eltern in den Besitz eines beträchtlichen Vermögens gekommen, dabei aber von einem Onkel maßgeblich beraten worden. Ein Onkel, den sie bald zum Teufel gejagt und ihren ererbten Rüstungsbetrieb an ein französisches Konsortium verkauft hatte. Anschließend führte sie eine ganze Zeit lang ein Jetset-Leben, war wegen ihrer Kurzzeitbeziehung mit Elvis Costello in die Medien geraten, später auch noch wegen des spektakulären Ankaufs eines Autografs von C. G. Jung, nur um dieses Schriftstück aus unerfindlichen Gründen gegen ein Gemälde von Willem de Kooning zu tauschen. Dann aber war sie mit großer Plötzlichkeit aus den Medien und dem Jetset verschwunden, nach Wien zurückgekehrt, hatte die riesige elterliche Villa in Döbling gegen eine sehr viel kleinere nahe jener Wotrubakirche eingetauscht – sie schien gerne zu tauschen – und sich einem bei aller Zurückgezogenheit recht selbstzerstörerischen Lebensstil gewidmet, allerdings auch dem Tierschutz verschrieben. Und genau in diesem Zusammenhang lernte sie den zwanzig Jahre jüngeren Zoologen Oliver Ernst kennen, der wegen seines guten Aussehens von Kollegen neidisch-spöttisch als der Coverboy der Verhaltensbiologie bezeichnet wurde. Und der in der Tat in der einen oder anderen Talkshow auftrat, wenn man halt auch noch den Kommentar eines Biologen benötigte und selbigen nicht nur aus berufenem Mund, sondern zudem aus einem hübschen Gesicht vernehmen wollte.
Astrid Roschek unterstützte seine Forschung. Beließ es aber nicht dabei und heiratete ihn. Und er heiratete sie und nahm ihren Namen an. Auch wenn das bedeutete, einen Namen aufzugeben, unter dem er ja bereits einiges publiziert hatte. Aber sein Argument wog schwerer, es schon als Kind blödsinnig gefunden zu haben, als Nachnamen einen Vornamen zu tragen.
So skandalträchtig nun Teile von Frau Roscheks Leben gewesen waren, jene zehn Jahre ihrer Ehe mit Oliver wurden es nicht. Mit einem Mann, der trotz seines guten Aussehens allein durch seine Wombat- und Stadttierforschung aufgefallen war und nicht etwa durch etwas, was man Frauengeschichten und ein wildes Leben nannte. Zumindest war das der äußere Anschein.
»Und das Visum?«, fragte Cheng. »Wir benötigen für Australien doch ein Visum.«
»Das ist mit einem Eilantrag rasch übers Internet zu erledigen«, erklärte Dr. Kollmann, »so was braucht nicht mehr als eine Stunde.«
Zu dumm, dachte sich Cheng, der überhaupt keine Lust aufs Fliegen hatte, meinte aber: »Gut. Dann muss ich jetzt mit Frau Wolf telefonieren.«
»Tun Sie das.« Es war Frau Roschek, die das sagte. Dabei wies sie Cheng mit einer kleinen, präzisen Handbewegung den Weg in einen Nebenraum, wo er ungestört sein würde.
Cheng nahm diesen Weg und fragte sich, wieso Frau Roschek und ihr Anwalt nicht selbst nach Australien flogen. Andererseits war es eben schon so, dass es genau dafür Detektive und Detektivinnen gab. Arbeit zu übernehmen. Und möglicherweise beim Aufdecken eines Abgrunds in selbigen zu geraten. Darin hatte letztlich Chengs gesamtes Berufsleben bestanden.
Er betrat einen ziemlich dunklen Raum, in dem aber hell und punktuell erleuchtet ein gut zwei Meter hohes Foto hing. Darauf war lebensgroß Frau Roschek zu sehen, als sie noch recht jung war. Lange her und doch unverkennbar. Sie mit ihren langen blonden Haaren, so Anfang der 1980er-Jahre. Augen, Nase und Mund wie mit einem einzigen wohlfeilen Strich vom lieben Gott ins Gesicht gezeichnet, perfekt verbunden, ohne jegliche Vorahnung auf den Verfall der späteren Jahre. Neben ihr, etwas kleiner … ja, allen Ernstes Andy Warhol, er mit Anzug und Krawatte und umgehängter Kamera. Mit ausdruckslosem Blick. Sie hingegen lacht. Und trägt dabei einen Hut, der so aussieht, als sei er von Joseph Beuys. Und wirklich erkennt man seitlich im Hintergrund, allerdings mit dem Rücken zum Betrachter, einen Mann in der für Beuys so typischen Anglerjacke, aber eben ohne Hut. Was bei Beuys eigentlich schwer denkbar war, dass er sich ohne Hut hatte aufnehmen lassen, wenn auch von hinten.
Das riesige Foto wirkte in diesem Raum ausgesprochen sakral. Und ganz unten, mit blauem Filzstift an den Rand geschrieben, las Cheng – während er bereits mit Frau Wolf verbunden war – die Inschrift: Astrid und die beiden Alten. Und sprach diesen Titel jetzt auch in sein Smartphone hinein.
»Was für eine Astrid?«, fragte Frau Wolf.
»Unsere Auftraggeberin, falls wir das übernehmen wollen«, antwortete er. »Astrid Roschek.«
»Und welche Alten?«
»Nein, das ist nur ein Foto mit Andy Warhol und Joseph Beuys und der jungen Frau Roschek«, erklärte Cheng, begann dann aber, über den Fall zu sprechen, über das Verschwinden eines Wombatforschers, und dass man bereits am nächsten Tag zu der Flugreise nach Sydney aufbrechen müsse, wolle man den Auftrag übernehmen. Wobei Cheng seinen Bericht damit schloss, dass er sagte: »Sie wissen, wie ich das Fliegen hasse.«
»Ich weiß«, sagte Frau Wolf. »Wir müssen das nicht tun. Andererseits war ich noch nie in Australien. Und wenn wir diese Sache nicht machen, müssen wir eine andere Sache machen, die wir vielleicht noch mehr bereuen als einen Flug nach Sydney. Sie wissen doch, wie das mit dem Schicksal ist.«
»Ich verstehe schon«, seufzte Cheng und verwies auf die Notwendigkeit eines Online-Eilantrags für ein australisches Visum.
»Gut. Erledigen Sie das. Und unterschreiben Sie die Abmachung mit dem Anwalt. Er kennt ja unser Honorar.«
»Er kennt es«, bestätigte Cheng und meinte, man habe es wieder einmal mit Leuten zu tun, die gerne etwas mehr zahlten, weil ihnen das ein Gefühl von Sicherheit gab.
»Dann fahre ich noch heute zurück«, sagte Frau Wolf, »und wir treffen uns morgen am Flughafen. Die Winterwäsche können wir ja zu Hause lassen.«
Als hätte er je Winterwäsche besessen, dachte sich Cheng, der notorische Anzugträger und ebenso notorische Mantelverweigerer, dessen einziges Zugeständnis an die Kälte ein dünner Seidenschal war (was umso bezeichnender ist, wenn man wusste, dass Markus Cheng seinen linken Arm vor langer Zeit im Schnee eingebüßt hatte, ein abgetrennter Arm, der in einer österreichischen Gletscherspalte verloren gegangen war). Cheng ließ sich von der Kälte nicht berühren, von der Hitze leider schon.
Er kehrte zurück in den großen Wohnraum der Roschek’schen Villa und bestätigte, dass Frau Wolf und er die Sache übernehmen würden.
»Sehr gut«, sagte Dr. Kollmann und legte ein Papier auf den Tisch, welches die Auftragserteilung bestätigte, darunter diverse Punkte aufgelistet waren, die gewährleisten sollten, dass keinerlei Details über die Sache an die Öffentlichkeit gerieten oder letztlich in einem gottverdammten Filmdrehbuch landen würden. Und was man sonst noch alles mit dem Wissen über das Ehepaar Roschek würde anfangen können.
»Jetzt wäre es noch ganz gut zu wissen«, sagte Cheng, »wer die Person ist, die Herrn Roschek kontaktiert hat … Sie sagten, ein australischer Kollege …«
»Wir wissen nicht, wer das war«, erklärte Dr. Kollmann und sah hinüber zu seiner Klientin.
»Oliver hat es mir nicht gesagt«, bestätigte diese. »Aber das soll Sie nicht wundern. Mich haben seine Wombat- und sonstigen Tiergeschichten nicht groß interessiert. Wir sind also nicht jeden Abend zusammengesessen, nur damit er mir erzählen konnte, warum der Kot von Wombats die Form von Würfeln besitzt.«
»Im Ernst? Würfelförmig?«
»So heißt es. Dass man daraus aber eine Forschung macht … nun gut. Das war eben sein Ding.«
»Ich dachte«, sagte Cheng, »Sie hätten Ihren Mann über irgendeine Tierschutzaktion kennengelernt.«
»Das haben Sie gelesen, nicht wahr?«
»Das habe ich gelesen.«
»Und Sie wissen ja, was man von Dingen halten sollte, die man liest.«
»Okay. Und wie also sind Sie sich begegnet?«
»Überaus romantisch«, antwortete Frau Roschek, »er saß auf seinem Fahrrad, und ich habe ihn mit meinem Sportwagen angefahren. Dabei hat er sich den Fuß gebrochen. Als ich ihn im Spital besuchte, hat er scherzhaft gefragt, ob ich das absichtlich getan hätte. Und ich habe geantwortet, dass er recht haben könnte. Dass ich Männer, die mir gefallen – und er hat mir ja gefallen – umzufahren pflege.«
»Das muss ihn überzeugt haben.«
»Anstatt sich über die Höhe des Schmerzensgelds zu unterhalten, hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten würde. So was geschieht manchmal.«
»Ich gestehe, das gefällt mir«, sagte Cheng, »dennoch wüsste ich gerne jemanden unter seinen Wissenschaftskollegen, der mir weiterhelfen könnte.«
Frau Roschek nannte zwei Namen, die sich Cheng notierte, Freunde und Kollegen ihres Mannes, aber das waren eben Personen aus der Wiener Stadttier- und Verhaltensforschung. Jedoch nicht der Name von jemandem, der aus Australien angerufen haben könnte, um die Notwendigkeit eines Wombatbesuchs mitzuteilen. Da würden Cheng und Frau Wolf schon selbst draufkommen müssen. Wenn es überhaupt von Bedeutung war.
Dr. Kollmann erklärte, postwendend zwei Tickets auf die Namen Wolf und Cheng für einen Emirates-Flug in der Businessclass zu buchen, die beim Schalter der Fluggesellschaft hinterlegt würden. Natürlich noch keinen Rückflug. Denn die Suche nach Oliver Roschek würde nun mal dauern, so lange sie dauerte.
»Und wenn die ausgebucht sind?«, artikulierte Cheng einen kleinen Hoffnungsschimmer.
»Gewiss nicht«, versicherte der gut vorbereitete Anwalt.
Na, immerhin, dachte sich Cheng, werde er beim Komfort der Businessclass – wie viel menschlicher Schande die Errichtung solcher Luxusausstattung auch immer bedurfte – von keinem Sitznachbarn erdrückt werden. Denn wenn er an das Reisen dachte – selbst wenn die Reise bloß ein paar U-Bahn-Stationen andauerte –, empfand er die Welt als stark geschrumpft. Wie eine Hölle, die eben schon recht voll war und in die immer noch mehr Leute dazukamen. Beziehungsweise umgekehrt, in Abwandlung dieses berühmten Satzes von Shakespeare: »Die Hölle ist leer, alle Geschäftsleute sind hier!«
Nachdem sämtliche Formalitäten erledigt waren, die das »Geschäft« zwischen der Detektei Wolf und der durch Dr. Kollmann vertretenen Astrid Roschek regelten, verabschiedete sich Cheng, konnte aber im Hinausgehen nicht an sich halten, wandte sich kurz um und fragte Frau Roschek, ob das wirklich Joseph Beuys sei, den man da ohne Hut auf dem großformatigen Foto sehe, während sie, die junge Roschek, wie man so sagt, bildhübsch, dessen Hut trage und sich dabei an die Schulter von Andy Warhol lehne.
Statt die Frage zu beantworten, wollte Astrid Roschek wissen: »Und wie haben Sie Ihren Arm verloren?«
»Stimmt, man muss nicht alles wissen«, antwortete Cheng, unterdrückte aber die Bemerkung, dass er seinen verlorenen Arm schließlich nicht in einem theatralisch beleuchteten Extraraum aufgehängt habe, in den er seine Gäste zum Telefonieren schicke.
Er ging also aus dem Haus und trat die hellen Stufen abwärts, die aus dem Dunkel wie vergessener Schnee herausleuchteten, während ein Rest von echtem Schnee auf der abschüssigen Wiese spärlich herumgammelte.
Vor dem Haus wartete bereits das bestellte Taxi. Cheng stieg ein und gab dem Fahrer nicht nur seine Wohnadresse in der Lerchenfelder Straße an, sondern beschrieb ihm auch recht genau – Navi hin oder her –, welche Route er nehme solle.
Dabei entpuppte sich der Fahrer allen Ernstes als ein Finne.
»Ich hatte noch nie einen finnischen Taxifahrer«, sagte Cheng.
»Und ich noch nie einen japanischen Gast, der so gut Deutsch spricht«, antwortete der Fahrer.
»Sie täuschen sich«, sagte Cheng. Mehr sagte er nicht, sondern vertiefte sich in ein kleines Büchlein, das er aus der Innentasche seines Jacketts zog und das er bei sich zu führen pflegte, wenn er einem möglichen Gespräch ausweichen wollte. Für ein paar Monate war es dann immer der gleiche, schmale Band, bevor Cheng den Text schließlich so gut wie auswendig kannte und einen anderen auswählte. Dabei bevorzugte er antiquarische Taschenbuchware, die zerlesen und biegsam sein Jackett nicht verbeulte. Im Moment war es ein sehr kleines und sehr dünnes Ratgeberbüchlein mit dem Titel: 33 Sätze, die absolut keinen Sinn ergeben, aber von bedeutenden Leuten stammen – und dazu 33 Versuche einer Erklärung.
Es war einer dieser wunderbaren Zufälle, dass Cheng soeben einen Satz las, der ausgerechnet von einem finnischen Staatsmann stammte, welcher gesagt haben soll: Wenn du die Intelligenz Gottes beleidigen möchtest, schenk ihm zum Geburtstag eine Herde Kühe.
Aha?!
2
Da saß er also in diesem Airbus A380 und hielt ein Glas in jener Hand, die ein Glas zu halten verstand.
Man hatte bereits den Zwischenstopp in Dubai hinter sich und befand sich auf dem vierzehn Stunden dauernden Flug nach Sydney, wo der Flieger, wenn alles gut ging, auf einem nach einem australischen Flugpionier benannten internationalen Airport landen würde. Cheng, der Flugängstliche, hatte den Namen des Pioniers gegoogelt und festgestellt, dass dieser bei einem Flug über einem Randmeer des Indischen Ozeans verschollen war. Im Jahre 1935, achtunddreißigjährig. Cheng fand, dass das kein gutes Zeichen war, und fragte sich, wieso ein Flughafen ausgerechnet nach einem verunglückten Piloten benannt wurde. Das kam ihm vor, als locke man das Unglück an. So, als würde man ein öffentliches Schwimmbad nach einem untergegangenen U-Boot taufen.
Und er wusste, wovon er sprach, gehörte es doch seit Kurzem zu seiner wöchentlichen Routine, Wassergymnastik zu betreiben. Weniger in einem sportlichen Sinn – er hielt Sport für eine Form von Krieg – als im Sinne des Vergnügens, in warmem Wasser zu stehen und seinem Körper ein wenig sanfte Bewegung zuteilwerden zu lassen. Weshalb er durchaus froh darum war, dies in einem Schwimmbad tun zu können, welches den Namen Ottakringer Bad trug, so wie das gleichnamige Bier. Und nicht etwa U 3, benannt nach Seiner Majestät Unterseeboot 3, das 1915 von einem französischen Zerstörer versenkt worden war. (Stimmt, U3, so hieß immerhin auch eine Wiener U-Bahn-Linie, aber daran dachte Cheng jetzt nicht, sondern nur an sein geliebtes Ottakringer Bad und die Freude, zwischen alten Damen und alten Herren ein wenig herumzuwackeln.)
Etwas, das ihm in den kommenden Tagen sicherlich abgehen würde, obgleich rund um Australien ja recht viel Wasser war. Aber Wasser mit Haien.
Cheng saß an seinem Platz wie in einem speziellen Kabinett, das freilich über den Charme einer superluxuriösen Campingtoilette verfügte. Dazu ein toller Service, keine Frage, er hatte schon mehrere Gläser ausgezeichneten Whiskys konsumiert. Das war nämlich das Letzte, was er tun wollte, nüchtern bleiben, während man in einigen Tausend Metern Höhe die Umwelt verschmutzte.
Den Werbespruch »Kommen Sie begeistert an!« hatte er für sich in ein »Steigen Sie besoffen aus!« umgewandelt. Dabei war es üblicherweise nicht seine Art, beim Trinken zu übertreiben. Aber wie gesagt, er verabscheute diese Fortbewegung, er verabscheute die ganze Reiserei. Dass die Erde rund war, hielt er eher für ein Zeichen, dass es gut und richtig war, dort zu bleiben, wo man war, anstatt auf einer runden Fläche praktisch dauernd herunterzukugeln. Dennoch hatten Beruf und Schicksal ihn einige Male von Wien weggebracht und damit auch in eine ungesunde Höhe.
Es war jetzt Nacht, und Frau Wolf, die im »Kabinett« gleich nebenan war, hatte ihren Sitz in ein vollkommen flaches Bett verwandelt. Wie die meisten Passagiere hier. Der ganze Raum war eingehüllt in ein bläuliches Licht. Gleich dem Sirenenlicht der Polizei. Allerdings einer beruhigten, romantischen Polizei, die darauf vertraute, dass endlich auch mal alle Verbrecher in den Schlaf gesunken waren.
Cheng schlief nicht. Das »Ding in seinem Kopf« hatte sich gemeldet. Schmerzlich. Er nannte es ausschließlich »das Ding«, auch in den Gesprächen mit seinem Arzt, der Cheng nach dem Auftreten der ersten Symptome zum MRT geschickt hatte. Dieses merkwürdige Vergessen der eigenen Geschichte, je länger sie zurücklag, aber auch häufige Kopfschmerzen, die sich durch keinen Wetterumschwung und keine Veranlagung erklären ließen, sowie eine bedrängende, weder durch schlechtes Essen noch ein Zuviel von irgendwas begründbare Übelkeit.
Die Schichtbilder der Kernspintomografie aus seinem Schädel hatten es offenbart: bereits zwei Zentimeter groß und ausgestattet mit der unbedingten Wut des Wachstums.
Er selbst hatte sich gewundert, wie wenig es ein Schock gewesen war. Allerdings war es auch nichts, worauf er mit Galgenhumor reagiert hätte. Vielmehr hatte er einfach zur Kenntnis genommen, dass etwas geschehen war, womit er schon immer gerechnet hatte. Und das ihm sehr viel lieber war als eine andere Krebsart, die er befürchtet hatte, nämlich Darmkrebs. Klar, das war ein ziemliches Klischee, dass ein Mensch, der ein Leben lang in Büchern gelesen hatte, sich vor allem aber so gefühlt hatte, als sei er selbst die Figur aus einem Buch, naheliegenderweise einem Detektivroman, nun an etwas erkrankt war, das in seinem Kopf steckte und nicht etwa in seinem Darm oder seiner Lunge. Denn das schien bereits gewiss, dass es sich um einen primären Hirntumor handelte, also nicht etwa eine Absiedelung aus dem Tumor eines anderen Organs, sondern um einen, der aus unerfindlichen Gründen im Gehirn selbst entstanden war und sich mit der Konsequenz eigenständigen Daseins aus den Zellen des Nervensystems gebildet hatte. Fremd, wie von einem anderen Stern, aber doch in diesem Kopf wurzelnd.
Bei einem solchen Bild – und Cheng dachte dieses Bild – war es nun kein Wunder, wenn er von »dem Ding« sprach, durchaus in Anlehnung an den Filmtitel Das Ding aus einer anderen Welt.
Was nun allerdings noch gar nicht geklärt war, war die Frage, ob es sich um ein gutartiges oder ein bösartiges Ding handelte, denn die Symptome konnten das eine wie das andere bewirkt haben. Dessen sichtbare Gestalt auf dem MRT offenbarte nicht seinen Geist: seine relative Frömmigkeit oder absolute Gewalt. (Irritierend war bei alldem gewesen, dass die »Gestalt« dieser Wucherung Cheng für einen Moment an einen winzig kleinen Arm samt Hand erinnert hatte, so als wollte sich sein in einer Gletscherspalte verloren gegangenes Körperteil auf diese Weise zurückmelden. Was nun aber im Widerspruch zur Fremdheit eines Wesens aus einer anderen Welt gestanden hätte und von Cheng als Ausdruck einer krankheitsbedingten Sinnestäuschung verworfen wurde.) Es schien sich jedenfalls um ein Gliom zu handeln, einen Tumor, der sich aus den Stützzellen des Nervengewebes gebildet hatte.
In zwei Wochen hatte Cheng einen Termin für eine feingewebliche Untersuchung des Dings in seinem Kopf, eine Biopsie, die den wahren Charakter des Tumors würde bestimmen können, zumindest, welcher Art von Gliom er zugehörte, worin sein Ziel bestand und in welcher der vier Kategorien zwischen langsam und sehr schnell man ihn einzustufen hatte. Woraus sich wiederum die genaue Behandlungsmethode und ihre Alternativen würden ableiten lassen.
Zwei Wochen, in denen sein Arzt aber ganz sicher davon abgeraten hätte, in ein Flugzeug zu steigen und praktisch vierundzwanzig Stunden lang dem in solchen Höhen üblichen Druck ausgeliefert zu sein. Abgesehen vom übermäßigen Konsum schottischer und irischer Spirituosen (bloß das Angebot eines erstklassigen japanischen Whiskys hatte Cheng abgelehnt). So, als wollte er einen Geist mit einem anderen bekämpfen.
Zwei Wochen auch, in denen Zeit war, Oliver Roschek zu finden. Zwei Wochen und nicht mehr. Aber all das hatte er mit keinem Wort gegenüber Frau Wolf erwähnt.
Und während da also fast alle schliefen oder dösten und das Blaulicht einer besänftigten Polizei den Raum erfüllte, war Cheng von einem heftigen Kopfschmerz überfallen worden. Der anders war als der Kopfschmerz früherer Tage, als dieser ohne jene spezielle Übelkeit ausgekommen war. Was mit dem »Raum fordernden Prozess« in seinem Gehirn zu tun hatte, wie es sein Arzt ausdrückte. Genau so stellte er sich das auch vor, dass der Fremdling in seinem Kopf mehr und mehr Raum beanspruchte, ohne dafür etwas Gutes tun zu wollen, ganz im Gegenteil.
Anstatt nun aber endlich mit dem Whisky aufzuhören, nahm Cheng einen letzten Schluck, den er jedoch weniger trank, als dass er ihn einatmete und über diesen Moment der Atmung versuchte, etwas Druck aus seinem Kopf zu nehmen. Klar, das war mehr ein Bild als eine tatsächliche Handlung, half ihm aber dennoch.
Trotzdem trieb ihn die Übelkeit aus seinem Sitz heraus und brachte ihn dazu, die Toilette aufzusuchen, wo er sich auf den geschlossenen Deckel setzte, sich zurücklehnte und mit offenen Augen den Schwindel ertrug, der über ihn gekommen war wie ein Ballon aus stechenden Farben.