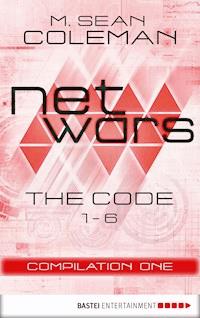3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Alex Ripley
- Sprache: Deutsch
Jane Hewitt ist geheilt, ihr Krebs im Endstadium verschwunden. Und das nach nur einem Besuch bei der Wunderheilerin Megan. Offenbar besitzt die Frau eine unglaubliche Gabe. Doch schon am nächsten Tag stirbt Jane in den Armen ihres Mannes Ian. Ist Megan Schuld?
Wohl kaum - denn die Wunderheilein liegt selbst seit Jahren im Koma. In seiner Not wendet Ian sich an die einzige Person, die ihm jetzt noch helfen kann: Dr. Alex Ripley. Die Ermittlerin und Theologin ist spezialisiert auf die Erklärung übersinnlicher Phänomene.
Fasziniert von Megans Fall reist Alex nach Holy Island vor der Küste von Nordwales - und steckt schon bald mitten in einer Untersuchung, die sehr viel düsterer und gefährlicher ist als Alex es sich jemals hätte ausmalen können. Ian ist nämlich nicht die erste Person, die sich über Megan und ihre Unterstützer beschwert. Aber er ist der einzige, der noch am Leben ist ...
Düster und hochspannend - ein Thriller mit einer besonderen Ermittlerin, in dem nichts so ist wie es scheint.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Jane Hewitt ist geheilt, ihr Krebs im Endstadium verschwunden! Und das nach nur einem Besuch bei Megan, einer Wunderheilerin, die offenbar eine unglaubliche Gabe besitzt. Doch am nächsten Tag stirbt Jane in den Armen ihres Mannes Ian. Ist Megan Schuld? Wohl kaum – das erst 15-jährige Mädchen liegt nämlich seit Jahren im Koma! In seiner Not wendet Ian sich an die einzige Person, die ihm jetzt noch helfen kann: Dr. Alex Ripley, spezialisiert auf die Erklärung übersinnlicher Phänomene. Fasziniert von Megans Fall findet sich Ripley auf Holy Island vor der Küste von Nordwales wieder – und mitten in einer Untersuchung, die sehr viel düsterer und gefährlicher ist als Ripley es sich hätte ausmalen können: Ian ist nämlich nicht die erste Person, die sich über Megan und ihre Unterstützer beschwert. Aber er ist der einzige, der noch am Leben ist …
Über den Autor
M. Sean Coleman begann seine schriftstellerische Laufbahn als Scriptwriter für »Hitchhikers Guide to the Galaxy (Per Anhalter durch die Galaxis) Online«(h2g2.com). Seitdem hat er Shows für MSN, O2, Sony Pictures International, Fox, die BBC und Channel 4 geschrieben und produziert, für die er mehrfach mit Preisen ausgezeichnet wurde. Er wohnt in London und schreibt Romane, Graphic Novels und Drehbücher.
M. SEAN COLEMAN
DAS SCHWEIGEN DER ANGST
Ein Alex-Ripley-Thriller
Aus dem Englischen von Dr. Arno Hoven
beTHRILLED
Deutsche Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by M. Sean Coleman
Titel der britischen Originalausgabe: »A Hollow Sky«
Originalverlag: Red Dog Press, Oxfordshire
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dorothee Cabras
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © Shutterstock – Valerijs Novickis | gyn9037 | Kevin Standage | catalina.m
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-6967-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt.
Matthäus 21,22
Oktober
Dunkelheit. Dunkelheit. Dunkelheit. Sie hatte schon immer die Dunkelheit gehasst. Für gewöhnlich jagte sie ihr Angst ein. Aber sie war jetzt schon so lange allein in der Dunkelheit, dass sie sich beinahe daran gewöhnt hatte. Aber nur beinahe.
Sie war natürlich nicht wirklich allein. Häufig gab es Stimmen um sie herum, die außerhalb der Finsternis waren. Mummy war meistens da. Und redete ständig. Erzählte ihr, was in der Welt so passierte. Sang ihr ein Lied, während sie ihr sanft die Haare bürstete. Sagte, wie hübsch sie sei. All die Dinge, die sie vor dem Anbruch der Dunkelheit nie getan hatte. Sie wusste stets, wenn Mummy da war, noch bevor sie zu sprechen begann.
Manchmal, wie heute, war die Finsternis zudem kalt. Das machte das Atmen schwieriger. Als wäre erneut eisiges Wasser überall um sie herum. Das in sie hineinkroch. Das ihren Mund und ihre Lunge füllte. Sie war inzwischen so lange in der Dunkelheit dahingetrieben. Sie hatte genug davon.
Hör auf damit, du Dummerchen. Sei nicht so niedergeschlagen.
Sie spürte, dass Mummy hereinkam. Nur ein kleines, schwaches Licht in der Ecke ihres Bewusstseins. Hallo, Mummy.
»Hallo, mein Schatz.«
Weit weg und doch gleich hier. Heiter und gut gelaunt wie immer.
»Bist du wach?«
Immer. Und nie.
Plötzlich Wärme, die auf ihrer Stirn erblühte. Ein Kuss. Sie konzentrierte sich darauf, wollte die Wärme unbedingt dazu bringen, dass sie sich ausbreitete. Wünschte sich, dass das Licht sich ausweiten würde und sie schließlich aufwachen könnte. Aber wie immer verschwand das Licht wieder, und die Kälte kehrte zurück.
Jemand anderes war auch da. Traurig. Gebrochen. Müde. Mummy brachte oft Leute mit, die sie besuchten. Leute, die ihr Licht brauchten. Wer auch immer heute hergekommen war, hatte große Schmerzen. Es war definitiv eine Frau. Jetzt hielt sie ihre Hand.
Ich kann helfen.
So viel Schmerz, der sich von ihrer Hand ausbreitete, ihren Arm hochstrahlte und sich über ihren Rücken ausdehnte. Er fuhr an ihrem Rückgrat hoch und runter, wie eine Abfolge kleiner Stromschläge. Oder wie winzige Nadeln, die auf sie einstachen.
Das ist zu schwierig. Ich kann nichts mehr tun.
Aber sie musste mehr tun. Sie musste es in Ordnung bringen. Mummys Hand auf ihrer Schulter gab ihr Kraft.
Der Schmerz dieser Frau war blau. Weiß. Schartig und scharf. Er stach auf sie ein. Schnitt in sie hinein. Pikste ihre Haut. Und sie bekämpfte ihn mit all ihrer Kraft.
Gib nicht auf! Jetzt dauert es nicht mehr lange.
Sie konnte schon die Wärme fühlen, die sich von ihrem Hals herab ausbreitete – in ihren Arm hinein, auf ihre Hand zu. Es geschah. Die Wärme verließ sie, und die Kälte verschluckte sie. Sie war zurück unter Wasser. Zurück in der Dunkelheit.
Nacht … Nacht.
Diese ruhige, unauffällige Straße in einem Küstendorf in Nordwales war ein so unwahrscheinlicher Ort für ein Wunder, wie man es sich nur vorstellen konnte. Der Himmel war von einem matten Grau, das mit dem farblosen Kieselrauputz der Häuser und den tristen Stores verschmolz. Selbst die zerbrochenen Gehwegplatten aus Beton besaßen das gleiche düstere Grau.
Jane Hewitt starrte auf die Eingangstüren, die an ihrem Beifahrerfenster vorbeihuschten. Sie spürte ein nervöses, aufgeregtes Kribbeln in der Magengrube. Tat sie gerade etwas Dummes? Sie glaubte es nicht. So viele Geschehnisse – Zufälle vielleicht – waren zusammengekommen, um sie heute hierher zu bringen. Man mochte es »Schicksal« nennen. Man mochte es »göttliches Eingreifen« nennen. Man mochte es einen »Glücksfall« nennen. Jane wusste – wusste es absolut, kategorisch –, dass dies Gottes Wille war.
Ihr Ehemann Ian seufzte, als sie eine T-Kreuzung erreichten. Der Blinker gab ein monotones Klicken von sich. Sie widerstand dem Drang, ihren Mann anzuschauen, denn sie hatte nicht vor, ihm einen Vorwand zu geben, sie erneut zu fragen, ob sie sicher war, dies tun zu wollen. In den letzten paar Tagen hatte er ihr schon mindestens zehn Mal diese Frage gestellt.
Er teilte ihren Glauben nicht. Ian ging nur in die Kirche, weil es sie glücklich machte. Und wenn sie dahingeschieden war, würde er wahrscheinlich nie wieder eine Kirche betreten. Sie wünschte, es wäre anders, doch sie verstand es. Das Wenige an Glauben, das er einst besessen hatte, war an dem Tag verloren gegangen, als sie in seinem Beisein ihre Diagnose erhalten hatte. Drei kleine Wörter: Krebs im Endstadium.
Sie hatte versucht, ihn davon zu überzeugen, dass so etwas geschickt wurde, um sie beide zu prüfen. Dass dies alles Teil eines größeren Plans war. Aber sie hatte es in seinen Augen gesehen. Er glaubte nicht mehr. Es machte sie traurig zu wissen, dass er keinen Trost im Glauben finden würde, wenn sie verschieden war. Darum war sie hier. Darum war sie sicher, dass sie dies tun musste. Selbst wenn es zu spät für sie war – sie wollte, dass Ian seinen Glauben wiederfand.
Sie zuckte zusammen, als das Auto abermals über einen Abflussdeckel rumpelte. So viel Schmerz jagte durch ihren Körper: Es war eine ständige Herausforderung für ihre Kräfte. Heute hatte sie nicht die ganze Dosis ihres schmerzlindernden Mittels eingenommen. Sie wollte, dass ihr Geist so klar wie möglich war. Ausnahmsweise wollte sie alles fühlen.
Sie bogen in ein ziemlich neues Wohngebiet ein: größere Straßen mit breiten Bürgersteigen, die gepflegte Rasenflächen vor den Häusern einrahmten. In einem der Vorgärten beugte sich ein dreister Zwerg in einen kleinen Teich hinein, und sein blankes Gesäß zeigte zur Straße hin. Der Anblick brachte Jane zum Lächeln.
»Das muss das Haus sein«, sagte Ian.
Sie schaute nach vorn zu einem großen Bungalow am Ende der Sackgasse und spürte plötzlich einen Knoten im Magen. Es war das Haus, das sie auf der Website gesehen hatte, als sie Informationen zu Megan Shields im Internet nachgeschlagen hatte. Das also ist es. Ihr Blick verweilte auf dem Gebäude, und sie nahm die Einzelheiten begierig in sich auf, während Ian am Bordstein anhielt und aus dem Wagen stieg.
Das Haus hatte man frisch gestrichen. Die leuchtend rote Tür, die sich am Ende eines gepflegten gepflasterten Zugangswegs befand, war breit und einladend. Mit einem gewissen Abstand zum Haus stand zur Linken eine Doppelgarage. Zu beiden Seiten eines umgebauten Kleinbusses waren zwei identisch aussehende Range Rover geparkt – schwarz und elegant, neues Modell. Den Bus hatte man in zarten Blau- und Weißtönen lackiert und die Farben so vermischt, dass Wolken dargestellt wurden. Die Fenster wurden von Gardinen mit Falten eingerahmt, und die Worte Die Gabe Gottes – Die Kraft zu heilen schmückten die Wagenseite.
Jane holte tief Luft und unterdrückte abermals diese quälende kleine Stimme in ihrem Innern, die sagte: Ist es richtig, dass du Gottes Plan für dich infrage stellst? Immer und immer wieder hatte sie sich diese Frage gestellt. Zu guter Letzt hatte sie eine Antwort gefunden, mit der sie leben konnte: Gott hätte Megan Shields nicht die Kraft zu heilen gegeben und Jane nicht auf einen Weg geführt, auf dem sie dieses Mädchen entdeckte, wenn das nicht ein Bestandteil seines Plans gewesen wäre. Dies war eine Belohnung für ihren lebenslangen unzerstörbaren Glauben. Dies war Gottes Geschenk an sie. Eine weitere Nacht. Das war alles, worum sie bat.
Ian öffnete die Beifahrertür und beugte sich neben ihr nach unten; der Rollstuhl stand in einem schrägen Winkel zur Wagenseite. Ihr Mann sah müde aus. Seine Augen, in denen sich üblicherweise ein Strahlen und ein Lächeln gezeigt hatten, wirkten jetzt trüb und traurig. Und sein dichtes, dunkles Haar war von einem Grau durchzogen, das vor sechs Monaten noch nicht existiert hatte; dessen war sie sich sicher. Selbst seine Arme, die durch das jahrelange Laufen und Radfahren so geschmeidig und stark geworden waren, sahen nun dünner aus.
»Es ist noch nicht zu spät, deine Meinung zu ändern«, sagte er.
Sie wollte nicht erneut die stets gleichen Argumente durchkauen. Nicht jetzt. »Du hast es versprochen«, erinnerte sie ihn.
Sein Urteil über diese Sache war falsch. Da war sie sich ganz sicher. Genau dies musste sie tun, und er hatte versprochen, sie zu unterstützen. Sie würde jetzt ganz bestimmt keinen Rückzieher machen. Er nahm ihre Hände in seine und schaute ihr in die Augen. Leid und Liebe. Sie lächelte flehentlich: Du hast es versprochen.
Ian seufzte. Behutsam und zugleich mühelos hob er sie hoch, so wie er es im Laufe der vergangenen Monate so viele Male getan hatte, und setzte sie in den Rollstuhl. Er drückte leicht ihre Schulter, als sie den Weg zu jener breiten roten Tür entlangfuhren.
Ein junger Mann, der so gut aussehend war, dass er fast einem Engel glich, öffnete die Tür, noch bevor sie sie erreichten. Seine blonden Locken wippten auf und nieder, als er zur Begrüßung eine halbe Verbeugung machte. Seine wasserblauen Augen tanzten vergnügt über Janes Gesicht, und sein Lächeln erwärmte sie.
»Sie müssen Jane sein«, sagte er. Seine Stimme klang sanft und beruhigend, war allerdings tiefer, als sie erwartet hatte.
Sie lächelte, als er hinter ihren Rollstuhl trat, die Hände um die Griffe legte und sie über die Türschwelle schob. Liebe und Kraft strahlten von diesem Gebäude aus und umhüllten sie bereits in einer warmen Umarmung.
Ian Hewitts Finger packten fester zu, als der junge Mann auf ihn zuging, um Janes Rollstuhl zu übernehmen. Doch nur einen Augenblick lang weigerte sich Ian, ihn loszulassen. Er erhaschte ein winziges herausforderndes Aufblitzen in den kalten blauen Augen. Dies stand im Widerspruch zu der beruhigenden, affektiert klingenden Stimme, mit der dieser blond gelockte Mann sie beide begrüßt hatte. Als Ian nachgab, lächelte der junge Mann angesichts seines klitzekleinen Sieges. Während er Jane fortschob, drängte sich Ian unwillkürlich das Gefühl auf, dass ihm seine Frau gerade fortgenommen wurde.
Er ließ es zu, dass seine Vorurteile sein Urteilsvermögen trübten; das wusste er freilich. Obgleich er keinerlei Beweise besaß, dass Megan Shields’ Mutter eine Betrügerin war, hatte er es sich nicht verkneifen können, seinen Zynismus zum Ausdruck zu bringen. Er glaubte einfach nicht an Wunderheiler. Jane hatte ihn sogleich zum Verstummen gebracht. Megan Shields sei anders, hatte sie ihm gesagt. Sie sei etwas Besonderes.
Als er über Megan recherchiert hatte, war er erschüttert gewesen. Nicht wegen der unzähligen glühenden Berichte, in denen es um unheilbare Krankheiten und Leiden im Endstadium ging, die das Mädchen angeblich geheilt hatte, sondern wegen Megans eigener Lebensgeschichte.
Im Alter von acht Jahren hatte Megan Shields mit einer Sonntagsschule einen Ausflug zu einem heiligen Ort in Nordwales gemacht und war dabei von ihrer Gruppe getrennt worden. Als man sie schließlich wiedergefunden hatte, trieb sie mit dem Gesicht nach unten in einem kleinen Teich, der sich in einem uralten Baderaum befand. Die Leute glaubten, es wäre zu spät; sie dachten, Megan wäre ertrunken.
Wundersamerweise starb das kleine Mädchen nicht. Im Krankenhaus erlangte sie sogar für kurze Zeit das Bewusstsein wieder und sprach zu ihrer Mutter, die darüber außerordentlich erleichtert war. Megan erklärte, es sei schlichtweg nicht die Zeit für sie, um zu sterben – sie habe noch wichtige Dinge zu erledigen. Kurz danach war Megan eingeschlafen und dann – während sich ihre Mutter in einem Sessel neben ihrem Bett ausruhte – in ein Koma gefallen. Und dies blieb so.
Während Tage in Wochen übergingen und Monate zu Jahren wurden, veränderte sich nichts am Zustand der jungen Megan. Sie war einfach in einen Schlaf gefallen; und alles, was ihre Ärzte tun konnten, bestand darin abzuwarten, ob sie jemals wieder aufwachen würde. Ihre Mutter Anne, die drei Kinder hatte und alleinerziehend war, verbrachte jeden Moment, den sie erübrigen konnte, neben dem Bett ihrer Tochter und betete darum, dass sich deren Zustand änderte. Sie wartete auf ein Zeichen, dass ihr kleines Mädchen zu ihr zurückkommen würde.
Im Laufe der Zeit wurde Megan so etwas wie eine Berühmtheit auf der Kinderstation: das Mädchen, das nicht aufwachte. Ein schlafendes Dornröschen, das jedoch wirklich lebte. Kinder auf der Station saßen abwechselnd bei ihr; sie spielten mit ihren Puppen auf ihrem Bettende, lasen ihr mit brüchigen, stotternden, leisen Stimmen Geschichten vor oder erzählten ihr von den eigenen Behandlungen.
In der Zwischenzeit fand Anne, ihre Mutter, Trost im Gebet. In ihrem Glauben wurde sie ermutigt von einem freundlichen jungen Priester, der in das Dorf gezogen war. Reverend Francis Rodwell machte Krankenhausbesuche auf ehrenamtlicher Basis und brachte Blumen und Geschenke von Leuten aus der Dorfgemeinde, die Megan alles Gute wünschten. Anne und er unterhielten sich oft stundenlang und gingen eine recht merkwürdige Freundschaft ein. Gemäß Anne Shields war es Francis Rodwell gewesen, der ihr zuerst die Augen für das geöffnet hatte, was geschah.
Anne stammte aus einer religiösen Familie, doch ihr Glaube hatte mit der Zeit nachgelassen. Außerdem hatte sie, wie sie selbst zugab, ein ziemlich wildes Leben geführt. Bis zu Megans Unfall. Da hatte sie wieder zu beten begonnen. Reverend Rodwell war es nun gewesen, der darauf hinwies, dass Megans Heimsuchung womöglich einem höheren Zweck diente, als Anne gedacht hatte.
Mit jedem Kind, das Megan besuchte und das dann später, geheilt von seinen Leiden, das Krankenhaus verließ, wurde Annes Überzeugung stärker: Megans Leben war unterbrochen worden, damit sie anderen helfen konnte. Und es waren nicht nur Kinder, denen Megan half. An ihrer Zimmertür erschienen bald Patienten von anderen Stationen, mit einem kleinen Geschenk in der Hand und der leisen Bitte auf den Lippen, ob sie zusammen mit Megan beten durften. Wie konnte Anne ihnen so etwas verweigern? Es war doch schließlich Gottes Wille.
Annes Part bei diesem ganzen Unterfangen war es, was Ian am meisten beunruhigt hatte. Er vermochte es nicht zu verstehen, wie man als Mutter – während Megan gefangen im Koma dalag – es erlauben konnte, dass zahllose Fremde in den Raum der Tochter eindrangen, die Hände auf sie legten und danach behaupteten, durch ihre Gabe geheilt worden zu sein. Derweil Megan selbst keine Stimme und auch keine andere Wahl hatte. Was war das für eine Mutter, die so etwas tat?
Ian war sogar noch erschütterter gewesen, als er danach herausgefunden hatte, dass Megans Heilungen für ihre Familie zu einer Art von Geschäft geworden waren. Nach drei Jahren im Krankenhaus zeigte Megan noch immer keinerlei Anzeichen, dass ihr Koma enden könnte. Die Ärzte allerdings blieben davon überzeugt, dass sie irgendwann aufwachen würde. Megans Gehirnfunktionen waren immer noch normal; und Scans zeigten auf, dass sie allem Anschein nach auf Stimulationen in Form von menschlicher Gesellschaft und Gesprächen um sie herum reagierte. Und mit Sicherheit bekam sie eine Menge davon.
Reverend Rodwell hatte es schließlich auf sich genommen, eine Spendensammlung durchzuführen, um Anne zu helfen, ein für Megan geeignetes Haus zu kaufen, damit sie heimkehren konnte, egal, ob sie bei Bewusstsein war oder nicht. Der Aufruf hatte Hunderttausende von Pfund erbracht. Zusammen mit den großzügigen finanziellen Geschenken, die glückliche Besucher Annes Portemonnaie zukommen ließen – im Austausch gegen ein wenig Zeit mit ihrer Tochter –, ermöglichte das gespendete Geld, dass Megan die Klinik verlassen und in ein für sie speziell errichtetes Haus umziehen konnte. Dort hatte sie ein auf ihre besonderen Bedürfnisse eingerichtetes Zimmer, wo rund um die Uhr für sie gesorgt wurde.
Während der nächsten drei Jahre entwickelten sich Megans Heilungen zu einem wachsenden Geschäft. Leute aus aller Welt strömten in Scharen herbei, um dieses besondere Mädchen zu sehen, das in aller Stille zu einer jungen Frau heranwuchs, und beteten mit ihr in der Hoffnung, dass ihre eigenen Leiden geheilt wurden. Es kamen weiterhin viele Spendengelder herein. Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehgesellschaften bezahlten für exklusive Storys; und freigebige Wohltäter hinterließen Megan in ihren Testamenten große Erbschaften.
Das war der Teil der Geschichte, bei dem Ian regelrecht schlecht wurde. Er konnte die Vorstellung nicht abschütteln, dass Megans Mutter mit der Krankheit der eigenen Tochter Kasse machte. Dass sie den Glauben der Leute benutzte, um sie an Megans Seite zu locken – mit leeren Versprechungen auf Hoffnung und Wunderheilungen, im Austausch gegen sogenannte Geldspenden. Ian roch förmlich den Betrug. Doch andererseits war er ein sehr großer Zyniker, wie er sich selbst eingestand. Obendrein gab es sicherlich genug Zeugnisse, um Annes Ansicht zu unterstützen, dass Megan tatsächlich heilen konnte. Ob Ian nun daran glaubte oder nicht: Jane tat es. Und das war eines der wenigen Dinge, die ihr geblieben waren.
Er hatte zwar nicht gewollt, dass sie hierherkam, und mehrere Male versucht, es ihr auszureden; doch nun waren sie beide hier, und daher sollte er seine Bedenken für sich behalten. Um ihretwillen. Immerhin gab es für sie keine finanziellen Verpflichtungen. Was für einen realen Schaden konnte ein kleines Gebet schon anrichten?
Widerwillig folgte er dem jungen Mann und hörte das Quietschen der Rollstuhlräder auf dem Holzfußboden, während sie die breite Diele entlanggingen. Es war ruhig im Haus. Einer dieser moschusartigen Raumdüfte lag in der Luft, daneben gab es noch einen schwachen Geruch nach Desinfektionsmitteln – medizinisch und steril. Von irgendwoher aus dem Haus erklangen die unverwechselbaren Töne eines Zeichentrickfilms für Kinder, dessen Figuren in einem amerikanischen Tonfall sprachen; die Musik war hier im Flur nur gedämpft zu hören. Es herrschte eine schummrige Beleuchtung, und die Diele war nur spärlich dekoriert.
All das erinnerte Ian an das Pflegeheim, in dem er seine Mutter in ihren letzten Jahren besucht hatte, bis sie schließlich der Alzheimer-Krankheit erlag. Geräusche hinter den Kulissen. Eine respektvolle Ruhe. Dieser gleiche Eindruck von klinischer Gemütlichkeit, die ihn stets dazu brachte, sich über die eigene Zukunft Sorgen zu machen.
Er spähte durch die offenen Türen zur Linken und Rechten, während sie daran vorbeigingen. Eine große Küche, weiß und modern. Ein riesiger Kühlschrank im amerikanischen Stil, so rot wie die Haustür. Die Oberflächen sauber und glänzend. Keinerlei Hinweise darauf, dass dort ein regelmäßiges Familienleben stattfand.
Weiter den Gang hinunter war ein kleiner Gesellschaftsraum, wo zwei Kinder, die acht oder neun Jahre alt sein mochten, auf einem riesigen cremefarbenen Ledersofa nebeneinandersaßen. Sie waren Bruder und Schwester – Zwillinge, ihrem Aussehen nach zu schließen. Auf ihren Gesichtern spiegelte sich das bunte Licht wider, das der Fernsehapparat in der Ecke ausstrahlte. Das Mädchen schaute auf und verengte die Augen, sodass es ein wenig mürrisch blickte, bevor es seine Aufmerksamkeit wieder dem Zeichentrickfilm zuwandte. Unterdessen brach sein Bruder in schallendes Gelächter aus. Was für ein normales, fröhliches Geräusch. Hier jedoch wirkte es irritierend.
Eine große, elegante Frau, die Ende dreißig sein mochte, tauchte in einer Türöffnung am Ende des Hausflurs auf. Sie trug makellose, teure Kleidung, und ihr Haar war perfekt frisiert; allerdings hatte sie zu viel Make-up aufgelegt. Sie schien eine reservierte Körperhaltung einzunehmen, obgleich sie die Hände zu einer Geste des Willkommens ausgebreitet hatte. Das Lächeln auf ihren Lippen vermochte die Härte kaum zu kaschieren, die in ihrem Augenausdruck lag. Sie war misstrauisch. Ian fragte sich, ob sie sein Unbehagen spüren konnte. Er lächelte sie ebenfalls an, doch ihre Augen waren schon auf Jane geheftet.
»Herzlich willkommen«, sagte sie. Ihre Stimme klang ein wenig rau, wie die einer Raucherin. »Ich bin Anne. Megans Mutter.« Sie beugte sich unbeholfen nach vorn, um Jane die Hand zu schütteln.
»Vielen, vielen Dank, dass wir herkommen dürfen«, antwortete Jane. Sie klang unnatürlich fröhlich. War nervös und aufgeregt, wie Ian begriff.
Anne schaute ihn an, als sie sich wieder aufrichtete; auf ihren Lippen war das Lächeln eingefroren. Er streckte die Hand über Janes Schulter hinweg und musste dabei den Arm um den jungen Mann herum bewegen, der immer noch die Rollstuhlgriffe hielt. Annes Händedruck war schlaff und weich. Nichtssagend.
»Megan ist bereit für Sie«, verkündete die Frau, wobei sie ihr Augenmerk auf Ian richtete – in dieser Art, wie es Leute oft taten, wenn sie einer Person in einem Rollstuhl begegneten. Es wurmte ihn jedes Mal gewaltig.
Falls Jane dies aufgefallen war, so ließ sie es sich durch nichts anmerken. »Großartig«, sagte sie. »Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen.«
Annes lächelnde Lippen zuckten. »Gut, gut«, antwortete sie; ihre Finger nestelten an den Knöpfen ihrer Jacke herum. »Bevor wir jedoch hineingehen, müssen Sie mir noch ein paar Unterlagen ausfüllen. Nur der Ordnung halber, verstehen Sie?«
»Natürlich«, erklärte Jane strahlend.
Anne musste bemerkt haben, dass Ian die Stirn gerunzelt hatte. »Es ist nichts, was einen beunruhigen müsste«, fügte sie in herablassendem Ton hinzu. »Wir führen gern Buch über Megans Besucher, sodass wir mit ihnen in Kontakt bleiben können. Vor Gott sind wir alle eine große Familie.«
Ian konnte sich nur mühsam davon abhalten, mit den Augen zu rollen, während er den anderen in ein kleines Wartezimmer folgte, in dem ein großer Holzschreibtisch, zwei Stühle und ein Trinkwasserspender standen. Der junge Mann stellte einen Stuhl zur Seite, an dessen Platz er dann Jane an den Tisch schob.
»Danke, Simon«, sagte Anne, setzte sich auf den Stuhl hinter dem Schreibtisch und räusperte sich.
Sie gab Ian mit einer Geste zu verstehen, dass er sich zu ihnen gesellen sollte. Als er zögerte, drehte sich Jane unbeholfen in ihrem Rollstuhl, um ihn anzuschauen. Ihr Gesichtsausdruck brach ihm fast das Herz. Stumm drängte sie ihn, sich zu fügen und keinen Aufstand zu machen. Tu einfach das, worum sie bitten, damit ich das hier haben kann. Er würde alles tun, um sie glücklich zu machen. Insbesondere jetzt. Er nahm neben ihr Platz, ergriff ihre Hand und drückte sie ein wenig.
Anne hatte recht gehabt; der Papierkram war einfach zu erledigen. Ian schrieb Janes Namen und ihre Anschrift nieder, machte ein paar Angaben zu ihrem Gesundheitszustand und hinterließ eine Telefonnummer, unter der sie zu erreichen waren. Unten auf dem Formular gab es eine Verzichtserklärung, in der darauf hingewiesen wurde, dass eine Heilung nicht garantiert werden konnte, was Ian als eine Selbstverständlichkeit abtat.
Er reichte Jane den Stift und ließ sie selbst unterschreiben. Ihre Hände waren so dünn geworden. Sie hatte fast keine Kraft mehr, um zuzugreifen. Durch ihre papierdünne Haut konnte er die Knochen und Venen erkennen. Es schmerzte ihn, mitansehen zu müssen, wie sie sich mit einer Tätigkeit abmühte, die einst eine Selbstverständlichkeit für sie gewesen war.
»Alles klar«, sagte Anne und steckte die Unterlagen in eine Mappe. »Sollen wir jetzt?«
Wie aufs Stichwort trat Simon vor, um eine Doppeltür am anderen Ende des Raumes zu öffnen. Ein Schlafzimmer kam zum Vorschein, das in hellen, kindlichen Farben eingerichtet war. Ian stand auf, bevor der junge Mann zu ihnen beiden zurückkehren konnte, drehte Janes Rollstuhl herum und schob ihn auf die Tür zu. Simon zögerte; es war ihm eindeutig unangenehm, dass ihm diese Aufgabe abgenommen wurde. Ian bemerkte, wie Anne ihrem jungen Gehilfen entschieden zunickte. Lass ihn das machen. Simon zeigte ein falsches Lächeln, als sie an ihm vorbeigingen.
Obwohl das Zimmer in hellen Farben eingerichtet war und überall einen jugendlichen Eindruck vermittelte, fühlte es sich unheimlich und beklemmend an. Beinahe makaber. Megan hatte man auf Kissen hochgelagert. Sie war geradezu schmerzlich dünn, ihre Haut durchscheinend weiß. Ihre Augen waren geschlossen, und sie hatte dunkle Ringellocken. Auf ihre Wangen hatte jemand ein wenig Farbe aufgelegt; und Ian kam unwillkürlich der Gedanke, dass sie wie eine Puppe aussah, die angekleidet und angemalt worden war und jetzt darauf wartete, lebendig zu werden. Nichts von alldem konnte die Schläuche und Tropfe verbergen, die sie in einer Weise ernährten und am Leben erhielten, zu der ihr Körper nicht mehr fähig war. Was für eine Art von Leben ist das hier für sie?
Ian blieb stehen, denn er war nicht imstande, weiter in den Raum hineinzugehen. Jane schaute zu ihm hoch; ihre Augen waren voller Fragen und Furcht. Wirst du mich aufhalten? Er schüttelte den Kopf. Sie beide waren so lange miteinander verheiratet, dass jeder von ihnen die Gedanken des anderen erraten konnte. Er würde sie nicht aufhalten, doch er glaubte nicht, dass er imstande war, daran teilzunehmen.
»Ich werde draußen auf dich warten«, sagte er. »Einverstanden?«
»Ich komm schon klar«, antwortete sie.
Er schob Jane an die Seite von Megans Bett und blieb nur lange genug dort stehen, um Janes Gesicht zu sehen, als sie zaghaft den Arm ausstreckte und die Hand auf die des jungen Mädchens legte.
Er bemerkte einen merkwürdigen Gesichtsausdruck bei Anne Shields, als sie begriff, dass er nicht dabei sein würde. Es war das erste Mal, dass er so etwas wie ein echtes Gefühl in ihren Augen erblickte. Sie sah verletzt aus. Nicht verärgert oder traurig, sondern verletzt. Offensichtlich konnte sie seinen Zynismus spüren, und es schmerzte sie eindeutig, dass er nicht an die Gabe ihrer Tochter glaubte.
Ian zog sich in das Wartezimmer zurück und schloss hinter sich die Doppeltür. Sobald sie mit einem Klicken zufiel, stellte er seine Entscheidung infrage. Sollte er nicht zumindest versuchen, seine Frau mehr zu unterstützen? Er holte tief Luft. Nein, er hatte recht. Wäre er in dem Raum geblieben, hätte er Jane abgelenkt. Dies war ihre Angelegenheit. Ihre letzte Hoffnung. Wenn er ehrlich zu sich war, wusste er, dass er sich dagegen sträubte, dort zu sein, weil er nicht die Enttäuschung in ihrem Gesicht sehen wollte, wenn sich nichts an ihrem Zustand verbesserte.
Er wandte sich dem Trinkwasserspender zu, schenkte sich einen Becher ein und leerte ihn in einem Zug. Aus einer Reihe von Lautsprechern, die hoch oben in der Wand eingesetzt worden waren, setzte Choralmusik ein. Ian ertappte sich dabei, spöttisch zu lächeln. Es war alles so geschickt inszeniert. Wie diese scheußlichen New-Age-Zufluchtsorte oder Massagesalons mit Walgesängen und Weihrauchgeruch: Alles war mit der Absicht konzipiert, die perfekte Gemütsverfassung zu erzeugen. Ein Placebo und eben kein echtes Heilverfahren.
Er würde sich aus dieser negativen Stimmung herausreißen müssen, bevor Jane aus diesem Raum zurückkam. Sie würde seine Unterstützung brauchen – und nicht eine selbstgefällige Äußerung wie »Ich hab’s dir ja gesagt«. Ian setzte sich auf eines der Sofas und blickte auf die Ansammlung von Broschüren und Zeitschriften auf dem Couchtisch. Sie alle warben entweder für eine Ortsgemeinde oder unterstützten Megans Arbeit.
Er schaute sich eine kleine Hochglanzbroschüre an, in der es um eine Gruppenandacht in der Ortskirche ging. Eine einzigartige Erfahrung. Offen für jedermann. Kopfschüttelnd warf er das Heft wieder auf den Tisch. Was würden diese Leute tun? Das arme Mädchen nach draußen schieben und es vor einer Menschenmenge in einer Kirche abstellen? Wie viel Geld würde man damit scheffeln? Nach den Autos in der Einfahrt und der Einrichtung des Hauses zu urteilen, die er gesehen hatte, wurde nichts davon für kleines Geld gemacht.
Ian schaute auf seine Uhr und bemühte sich, etwas durch die geschlossene Tür zu hören. Die Choralmusik hatte ein bewegendes Crescendo erreicht. Aus dem Flur drangen die Geräusche eines Streits zwischen den beiden jungen Geschwistern herein. Dann folgte ein lautes Geheul, das den Klang der Musik teilweise überdeckte. Was für eine Art von Leben ist das hier für die beiden?
Ian stand auf und schritt vor der Tür auf und ab. Selbst wenn er gut drauf war, hasste er es zu warten, und es fühlte sich so an, als wären sie im Verlauf des vergangenen Jahres sehr oft dazu gezwungen gewesen: Sie hatten auf Fachärzte gewartet, auf Röntgenaufnahmen, auf die Chemotherapie, auf die Strahlentherapie, auf irgendeine Therapie, auf den Beratungsdienst, auf noch mehr Fachärzte, auf Krankenschwestern, auf Ärzte, auf Spezialisten. Schlechte Nachrichten häuften sich auf schlechte Nachrichten, die alle mit der gleichen wohlüberlegten Besonnenheit übermittelt wurden. Schwierig, jedoch vertraut für jene, die solche Nachrichten überbrachten. Niederschmetternd für Jane und Ian.
Bei alldem war Jane stark und gelassen geblieben. Sie hatte weiterhin darum gebetet, die Kraft zu haben, um gegen den Krebs zu kämpfen, der sie auffraß. Ian hatte auch versucht, für sie stark zu bleiben, doch er wusste, dass sie seine zunehmende Frustration fühlen konnte. Es war nicht fair! Warum sie? Warum geschah dies seiner schönen, fürsorglichen, wundervollen Jane? Nur die Besten sterben jung.
Als sie ihr erzählt hatten, dass die letzte Behandlungsrunde erfolglos geblieben war und es jetzt nichts mehr gab, was sie tun konnten, hatte Ian gespürt, dass ihn das letzte bisschen Kampfgeist verließ. Seine Frau war dem Tod geweiht. Sie sprachen davon, das Lebensende zu planen. Palliative Pflege. Hospize. Nichts von alldem konnte er sich anhören.
Jane hatte viel Zeit damit zugebracht, sich mit dem Krankenhausseelsorger zu unterhalten, der ihr Kraft gab, wenn nicht gar Hoffnung. Ian hatte ihn nur einmal kurz getroffen und fand ihn optimistisch und charismatisch. Freundlich und unterstützend. Genau das, was Jane gebraucht hatte – und genau das, was Ian, wie er befürchtete, ihr nicht zu geben vermochte.
Und es war der Krankenhausseelsorger gewesen, durch den Jane diesen Ort hier entdeckt hatte. Er hatte sie Reverend Francis Rodwell vorgestellt, der ihr von Megan erzählt und ihr diese unwiderstehliche Hoffnung auf Heilung wie einen Köder vor die Nase gehalten hatte. Ian musste sich einfach Sorgen darüber machen, wie Jane sich fühlen würde, wenn sie erkannte, dass auch dies hier sie nicht retten würde.
Er schenkte sich einen weiteren Becher Wasser ein und drückte das Plastik an seine Lippen. Ein erstickter Schrei hallte aus dem Schlafzimmer hinter der Tür. Jane! Ian ließ den Becher fallen; das Wasser spritzte auf den Fußboden und an seinem Bein hoch. Er hätte sie da drinnen nicht allein lassen sollen.
Ian stürzte zur Tür hinein – und blieb abrupt stehen. Jane stand neben dem Bett. Sie hielt sich zwar am Bettgestell fest, doch sie war tatsächlich auf ihren Beinen! Und zwar ohne fremde Hilfe! Seit mehr als sechs Monaten hatte sie nicht mehr gestanden, ohne von anderen gestützt zu werden. Ihr Ausruf war ein Schrei reinen Glücks gewesen. Über ihre Wangen liefen Tränen, doch sie lachte. Ian konnte seinen Augen nicht trauen.
»Janey? Bist du okay?«
Es war eine lächerliche Frage. Sie stand auf ihren eigenen Beinen! Er konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal so okay ausgesehen hatte.
»Megan, mein Schatz«, sagte Anne in säuselndem Ton. Sie hielt mit der einen Hand die ihrer Tochter fest. Mit der anderen Hand hatte sie die von Jane umfasst. »Gib Jane die Kraft, die sie benötigt, um diese Krankheit auszustoßen. Im Namen Gottes, Megan. Benutze deine Gabe, um ihren Schmerz zu heilen.«
Ian ging einen Schritt auf Jane zu und streckte den Arm aus, um sie zu stützen, doch sie schüttelte den Kopf. Sie wollte dies allein machen. Ihre Hand glitt zu ihrer Seite hoch, und sie öffnete die steife Rückenstütze aus Plastik.
»Jane, nein«, mahnte Ian, dem es nicht gelang, die Panik in seiner Stimme zu unterdrücken.
Die Stütze war das Einzige, was ihrem vom Krebs geschwächten Rückgrat etwas Halt gab. Ohne sie könnten ihre Rückenwirbel in sich zusammenfallen. Jane schüttelte abermals den Kopf, als die Stütze neben ihren Füßen zu Boden fiel. Jane zuckte nicht einmal. Wenn überhaupt, dann stand sie ein wenig gerader da.
Sie lächelte ihn an. Ihre Augen waren geweitet vor Freude und Erleichterung, als wären die Schmerzen zusammen mit der Rückenstütze von ihr abgefallen. Selbst Ian musste sich eingestehen, dass seiner Frau etwas Wunderbares widerfahren war.
Er ging mit ausgestreckten Händen auf sie zu, während sie einen vorsichtigen Schritt vom Bett weg unternahm. Mit bedächtiger Genauigkeit hob sie die Füße und setzte sie auf. Sie lachte. Eine Explosion der Freude, als sie seine Hände in ihre nahm und sich ihre Blicke trafen.
Ihre Augen funkelten, ihre Blicke tanzten über sein Gesicht. Sie strahlte. Dann machte sie einen weiteren Schritt. Und noch einen. Ian trat langsam zurück; er führte und ermutigte sie wie ein Kleinkind, das seine ersten Gehversuche unternahm. Sie lachten beide. Sie weinten beide. Es existierte nichts anderes als dieser eine wundervolle Moment.
»Es hat geklappt«, stellte sie halb flüsternd fest. »Ich bin geheilt worden.«
Und Ian glaubte ihr.
Auf dem Heimweg hatten Jane und Ian die ganze Zeit im Auto miteinander geredet. Ein aufgeregtes Stimmengewirr, geprägt von Fassungslosigkeit, Erstaunen und Euphorie. Jedes Mal wenn Ian zu seiner Frau hinübergeblickt hatte, war ein Leuchten von ihr ausgegangen, hatte sie Glückseligkeit ausgestrahlt. Ihr ganzes Verhalten war verändert gewesen.
Natürlich konnten sie noch nicht wissen, was für eine medizinische Reaktion bei ihrer Krankheit tatsächlich ausgelöst worden war, als die Begegnung mit Megan stattgefunden hatte. Aber Ian konnte nicht abstreiten, dass irgendwas passiert war. Jane hatte jenes Haus auf ihren eigenen zwei Beinen verlassen: Dabei hatte sie sich zwar auf seinen Arm gestützt und langsam einen Fuß vor den anderen gesetzt, doch sie hatte dies geschafft.
Ian wollte nicht irgendetwas beschreien, indem er alle paar Minuten fragte, wie sie sich fühlte. Er genoss es einfach, sie gleichzeitig so gelassen und so glücklich zu sehen. Vielleicht hatte sie ja recht gehabt, daran zu glauben. Möglicherweise musste er selbst ein wenig mehr Glauben haben. Wenn irgendetwas ihn überzeugen würde, dass es eine allmächtige Kraft gab, dann doch wohl dieses Ereignis.
Jetzt, da sie mit einem Glas Wein in der Hand an ihrem Esstisch saßen – nachdem sie ein leckeres Abendessen verzehrt hatten – und die Stereoanlage ihre alten Lieblingssongs spielte, verspürte Ian ein Gefühl von Zufriedenheit, das er kaum zu bestimmen vermochte. Er hatte die Hoffnung aufgegeben, und jetzt hatte er seine Frau zurück. Es fühlte sich nach mehr an, als er verdiente. Er war glücklich, sich auf seinem Platz zurückzulehnen und ihr zuzuhören, wie sie sich für das Wunder bedankte.
Er hatte sogar seinen Zynismus abgelegt und eine Spende für Megans Stiftung hinterlassen – als klitzekleines Dankeschön für das Geschenk, das sie ihnen gemacht hatte. Vielleicht war er auch zu streng gewesen, als er Annes Handlungsweisen verurteilt hatte. Was, wenn es wirklich irgendeinen großen Plan gab und Megans Gabe ein Teil davon war? Es würde bedeuten, dass es ihr immer schon bestimmt gewesen war, ins Koma zu fallen und ihre Lebenskraft einzusetzen, um anderen zu helfen. Er konnte nicht umhin, sich zu fragen, ob wirklich all jene, denen Megan half, es so verdienten wie seine Jane. Gab es dort draußen so viele gute Menschen?
»Wir könnten zu diesem kleinen Haus in Paris zurückkehren«, sagte Jane aufgeregt.
Den ganzen Abend über war sie Hunderte von Möglichkeiten durchgegangen. Orte und Vorhaben, von denen sie beide Abstand genommen hatten, da sie angenommen hatten, sie niemals wieder sehen oder in die Tat umsetzen zu können.
»Das wäre fantastisch, nicht wahr?«, antwortete er.
Es fühlte sich so seltsam an, über eine Zukunft zu reden, von der die Ärzte ihnen versichert hatten, dass sie beide sich nicht mehr an ihr würden erfreuen können. Wundervoll seltsam. Ian spürte auch, wie sich die seit Langem in seinem Körper angestaute Anspannung langsam verflüchtigte. Er hatte überhaupt nicht richtig bemerkt, wie viel von seiner Energie durch die Sorge um Jane absorbiert worden war. Oder vielmehr durch die Sorge, dass ihm ein Leben ohne Jane drohte.
Als sie aufstand, stützte sie sich dabei auf eine Tischecke. Eine Bewegung, die so plötzlich und dennoch so bedächtig erfolgte. Sie grinste ihn an. »Komm her«, sagte sie und streckte ihm die Hand entgegen.
Einen Augenblick lang stellte sich Ian die Frage, ob er sich all das nur einbildete. Das hier konnte nicht wirklich passieren, oder? Er stand auf und ergriff ihre Hand; und jetzt erst wurde ihm bewusst, dass gerade ihr Hochzeitslied gespielt wurde.
Sie begannen einen einfachen, langsamen Tanz. Ian legte die Arme um ihre Taille und stützte sie, nur für den Fall. Als Etta James darüber sang, dass ihre Liebe schließlich herbeikam, dachte er: Endlich. Wie passend. Er konnte sich nicht erinnern, sich jemals glücklicher gefühlt zu haben.
Jane hob den Kopf, um ihm ins Gesicht zu sehen, und er beugte sich hinab, küsste sie zunächst sanft und dann, als sie es erwiderte, mit mehr Leidenschaft. Küssen, Intimität, Leidenschaft. Dies alles war ebenfalls kein Thema mehr gewesen. Ian spürte ein Kribbeln im Bauch, als wäre es ihr erstes Mal.
Als er sie hochhob und zum Bett trug, klagte sie nicht. Sie war immer noch schmerzlich dünn und leicht wie eine Feder, doch sie fühlte sich so gesund und lebendig an, wie schon lange Zeit nicht mehr. Sie lächelte, als er sie auf das Bett legte, und hob ihre Hüften an, um ihm zu helfen, sie auszuziehen. Diesmal geschah es wieder auf eine sinnliche und eben nicht auf die funktionale, klinische Weise, mit der er sie fürs Bett vorbereitete, seitdem sie die Fähigkeit verloren hatte, sich selbst ohne größere Probleme zu entkleiden.
Dann lag er neben ihr – nackt, aufgeregt, doch vorsichtig. War es richtig von ihnen, dies jetzt zu tun? Sollten sie nicht warten, damit Jane wieder zu Kräften kam? Sie streckte die Hand aus und zog ihn für einen weiteren Kuss an sich. Sie würden nicht mehr länger warten.
Jane weckte ihn in den frühen Morgenstunden. Ihr Körper war starr vor Schmerz. Sie litt so entsetzliche Qualen, dass sie noch nicht einmal aufschreien konnte. Es ging gerade erst auf fünf Uhr in der Früh zu. Sie hatten nur einige Stunden geschlafen, doch Ian sprang sofort aus dem Bett, wählte die Notrufnummer der Ambulanz und gab Jane eine Morphiumspritze. Es folgte die automatische Reaktion ihres Körpers. Als wären die Geschehnisse des vorausgegangenen Tages und der Nacht nichts weiter als ein Traum gewesen. Dies war das Leben, wie sie es kannten: Jane wurde von trostlosen Qualen heimgesucht, und Ian versuchte verzweifelt, ihr zu helfen, obwohl er wusste, dass es keinen Zweck hatte.
Er zog ihr locker sitzende Kleidungsstücke an und gab sein Bestes, um ihr Trost zuzusprechen, während er ihren Körper anhob. Sie fühlte sich wieder gebrechlich an. Gebrochen. Zerstört. Was war passiert? Er hatte eine wirkliche Veränderung in ihr gespürt, und mit Sicherheit war das nicht bloß ein Wunschdenken gewesen. Sie hatten sich geliebt, Herrgott noch mal! Hatte er ihr dies angetan? Hatte er es schlimmer gemacht?
Während sie darauf warteten, dass der Rettungswagen endlich kam, hielt Ian ihre Hand in seiner ganz fest und flüsterte immer und immer wieder den einen Satz: »Es tut mir so leid.«
Ob es ihm wegen ihrer Qualen leidtat, ob es ihm leidtat, dass sich nichts so verändert hatte, wie sie es angenommen hatten, oder ob es ihm leidtat wegen seiner eigenen zerstörten Hoffnungen und Träume – er vermochte es nicht zu sagen. Er hatte einfach das Gefühl, dass es ihm schrecklich leidtat.
Ian ließ Janes Hand nur kurz los, als man sie in den Rettungswagen hineinhob. Er schnappte sich ihre Taschen, die nach den zahllosen Übernachtungen im Krankenhaus immer noch gepackt waren und für diesen Zweck bereitstanden, und stieg zu Jane hinten ins Auto. Er nahm all seine Kraft zusammen, als der Wagen mit einem Ruck losfuhr und das gedämpfte Geräusch der Sirenen über ihm einsetzte.
Sobald sie unterwegs waren, setzte er sich wieder an Janes Seite. Die Sanitäter konnten nichts für sie tun – abgesehen davon, sie rasch ins Krankenhaus zu bringen.
»Es tut mir so leid, Janey«, sagte er erneut.
»Schsch«, erwiderte sie.
Aus ihrem Augenwinkel quoll eine Träne und rann ihre Schläfe herab. Behutsam wischte er sie fort. Während all der Zeit, in der sie krank gewesen war, während all der Behandlungen und der Demütigungen, die damit einhergegangen waren, hatte er sie niemals weinen sehen. Er wusste, dass sie Tränen vergossen haben musste, doch er hatte es nicht gesehen. Sie hatte es ihn nie sehen lassen.
Diese einzelne Träne brach ihm das Herz. Denn ihm war irgendwie klar, dass sie nicht weinte, weil sie Schmerzen litt oder weil sie wusste, dass sie nun starb. Sie weinte, weil Gott sie im Stich gelassen hatte. Sie selbst hatte sich ihm von ganzem Herzen hingegeben, und er hatte sie verlassen. Ihr Glaube zählte nichts angesichts dieser Krebserkrankung. Sie würde trotzdem sterben. Und es war diese Erkenntnis, die schließlich ihren Geist gebrochen hatte.
»Ich liebe dich so sehr«, flüsterte Ian, der seinen Mund ganz nah an ihrem Ohr hielt. Der gewohnte Geruch ihrer Krankheit war zurück, verweilte auf ihrer Haut, stahl Jane ihm weg.
Ihre Lippen öffneten sich, als würde sie etwas antworten, doch sie tat es nicht. Ein langer, langsamer Atemzug rasselte zwischen ihren Zähnen. Sie würde heute sterben, und es gab nichts, was er – und auch nicht Gott – dagegen tun konnte.
Seit Monaten hatte Ian sich auf diesen Augenblick vorbereitet: spätestens seit die Ärzte sich mit ihnen zusammen hingesetzt und ihnen erzählt hatten, dass es nichts mehr gab, was sie tun konnten. Und jetzt war der Zeitpunkt da. Ian verspürte den Wunsch, sich in Jane hineinzuzwängen. Mit ihr zu gehen. Sie ganz nah an sich festzuhalten und ihr jedes bisschen Leben zu geben, das noch durch seinen Körper strömte. Er hatte sich selbst versprochen, dass er stark sein würde. Er hatte ihr geschworen, dass alles mit ihm in Ordnung sein würde. Doch im Moment traf keines von beidem zu.
Ein erbitterter, brennender Zorn verzehrte ihn. Nicht, weil er Jane verlor. Auch nicht, weil der Krebs willkürlich menschliches Leben zerstörte. Sondern weil diese Leute Jane das Einzige genommen hatten, was ihr so lieb und teuer gewesen war: ihren Glauben. Sie hatte wahrhaftig angenommen, sie wäre geheilt worden; sie beide hatten es gedacht. Und es waren diese Betrüger gewesen, die Jane es hatten glauben lassen. Als er ihre Hand umklammert hielt, seinen Kopf an ihre Brust legte und dem grauenvoll schwachen Atem lauschte, der sich in ihren zerstörten Körper hineinkämpfte und wieder herausmühte, schwor er, dass er diese Leute für ihren Schwindel büßen lassen würde – selbst wenn es das Letzte sein sollte, was er in seinem Leben täte.
1. Dezember
Alex Ripley war früher nie auf den Gedanken gekommen, dass ihre Wohnung einen abweisenden Eindruck machen könnte. Doch seit sie nach ihrem letzten Fall heimgekehrt war, hatte sie eine höchst merkwürdige Empfindung. Irgendwie fühlte sich die Wohnung nicht mehr wie ein Zuhause an. Sie war leer und kalt. Eine schonungslose Erinnerung daran, dass Alex immer noch allein war: dass sie nach wie vor auf Nachrichten – egal, welche – von ihrem Ehemann John wartete, der noch immer nach einem Militäreinsatz in Afghanistan vermisst wurde.
Seit mehr als einer Woche war sie inzwischen zurück und hatte immer noch nicht die Energie aufgebracht, selbst mit den einfachsten Dingen voranzukommen. Sie hasste es ohnedies, Lebensmittel einzukaufen, aber das ging nur so lange gut, wie sie von dem leben konnte, was sich in den Schränken befand. Neben den häuslichen Alltagsaufgaben gab es außerdem noch andere Arbeiten, die sie eigentlich in Angriff nehmen müsste; so sollte sie Anrufe erwidern und ein Buch promoten. Und trotzdem konnte sie nicht die Motivation aufbringen, irgendetwas davon zu machen. Ob es an ihrer Erschöpfung, ihrer Lethargie oder an den langwierigen Komplikationen ihres Martyriums im Lake District lag, wusste sie selbst nicht.
Der quälende Nachhall des seltsamen Falls im Cuckoo Wood, den sie gerade erst abgeschlossen hatte, störte immer noch ihren Schlaf. Vielleicht hatte die Tatsache, dass sie dem eigenen Tod so nahe gekommen war, ein allzu grelles Scheinwerferlicht auf ihre gegenwärtige Lebenssituation geworfen. Was, wenn sie dort gestorben wäre? Sie hätte dann niemals herausgefunden, was John passiert war.
So viel Glück sie auch gehabt hatte, dem Beinahe-Tod durch Ertrinken entkommen zu sein – die verbliebenen Schädigungen ihrer Lunge bereiteten ihr Probleme beim Atmen, insbesondere nachts. Möglicherweise hätte sie auf die Ärzte hören und ein wenig länger im Krankenhaus bleiben sollen. Alex hatte jedoch darauf beharrt, dass sie sich zu Hause schneller erholen würde. Aber seitdem sie zurückgekehrt war, hatte sie sich hier nicht wohlgefühlt. Als fehlte irgendetwas. Und genau das war natürlich der Fall. Doch nicht irgendetwas, sondern jemand fehlte.
Dennoch war es nicht hilfreich für ihren Geisteszustand, auf dem Sofa zu liegen und ein Foto von John fest an ihre Brust zu drücken. Aber sie konnte das Bild einfach nicht weglegen. Sie war sich so sicher gewesen, ihn dort im Lake District gesehen zu haben; und die seltsame Vision von ihm suchte sie immer noch heim. Die ganze Sache hatte sie sich zwar nur eingebildet, doch John hatte sich so real angefühlt. Ihr war dadurch ein Funke Hoffnung gegeben worden, dass er immer noch lebte.
Der ganze Fall hatte sie beunruhigt, und zwar mehr als vieles andere. Emma Drysdale, eine alte Freundin, die als Kriminaltechnikerin im Lake District arbeitete, hatte sie herbeigerufen, damit sie half zu verstehen, warum eine Serie von Selbstmorden unter Teenagern in einem tief religiösen, altmodischen Dorf mit einer Reihe von Engelssichtungen in Verbindung gebracht worden war. Innerhalb einer Woche nach ihrer Ankunft in dem kleinen abgelegenen Ort Kirkdale hatte Alex eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht: Die dortige Gemeinschaft war so in ihrem Glauben und ihren vergangenen Geheimnissen verfangen und fürchtete sich so sehr vor einer vermeintlich ansteckenden Sünde, dass die Menschen sich geweigert hatten, eine simple Wahrheit zu sehen. Die Augen einer Außenstehenden waren nötig gewesen, um diese Leute dazu zu bringen, die Wahrheit zu erkennen; und als Alex dies tat, war sie beinahe gestorben. Vielleicht war es Zeit für eine Veränderung.
Ihr Telefon läutete erneut; es klang alarmierend und schrill in dem stillen Zimmer. Alex nahm nicht ab, sodass es klingelte, bis der Anrufbeantworter ansprang. Dann lauschte sie dem Ansagetext: Es war Johns Stimme, die dem Anrufer mitteilte, dass keiner von ihnen beiden zu Hause war. Das traf freilich nur auf einen zu. Alex wusste, dass sie den Text verändern sollte, doch sie war noch nicht dazu imstande gewesen, Johns Stimme zu löschen. Sie brachte es nicht über sich. Das war Aberglaube … vielleicht.
Der Anrufer legte auf, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Sie war von Anrufen von Journalisten überschwemmt worden, die wegen ihres neuen Buches anfragten, das in der Woche vor ihrer Reise zum Lake District erschienen war. Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor. Das Buch war der krönende Abschluss ihrer zwei Jahre lang währenden Untersuchungen zu verschiedenen Standpunkten über Wunder- und Geistheilungen. Wie üblich hatte ihre skeptische Einstellung auch diesmal eine Menge Leute verärgert. Nach den bisherigen Buchbesprechungen und der Anzahl von Nachrichten auf ihrem Anrufbeantworter zu urteilen – deren Sprecher immer noch auf einen Rückruf warteten –, sorgte dieses Werk für ebenso viel Wirbel wie ihre vorhergehenden. Ihr Ruf als sachliche Entlarverin von vermeintlichen Wundern war intakt, wie die inzwischen gewohnten Hass-Ergüsse und Beschimpfungen in den sozialen Medien belegten.
Der Anrufbeantworter hatte sich kaum zurückgeschaltet, als ihr Handy läutete. Jemand war ganz versessen darauf, mit ihr zu sprechen. Sie stemmte sich mit einem Ellbogen hoch und schaute zum Handy auf dem Couchtisch vor ihr. Das Display zeigte an, dass Neil Wilcox anrief.
Sie griff rasch nach dem Mobiltelefon. Neil hatte mit ihrem Ehemann John beim Militär gedient. Er war einer der wenigen aus Johns Schwadron gewesen, der sie besucht hatte, nachdem die Einheit ohne ihren Captain nach Hause gekommen war. Er und seine Frau hatten mit ihnen zusammen an so vielen Abendessen und Grillpartys teilgenommen, dass man Neil einen Freund nennen konnte, obgleich sie ihn nur ein paar Mal gesehen hatte, seit John vermisst wurde. Alex wusste, dass Neil sich selbst die Schuld gab. Sie wusste ebenfalls, dass er zu den wenigen gehörte, die davon überzeugt waren, dass man John lebend gefangen genommen hatte.
»Neil, ich bin am Apparat«, meldete sie sich.
»Alex«, sagte Neil, in dessen Stimme Erleichterung und eine gewisse Dringlichkeit mitschwangen. »Gott sei Dank! Ich hab’s gerade mit deiner Festnetznummer versucht …«
»Ich habe Anrufe überprüft«, behauptete sie. »Was ist los?«
Nervös stand sie auf und ging ein paar Schritte. Sie konnte bereits dieses bekannte Flattern in ihrem Bauch spüren: Die Angst – die stets mit einem Anruf von einem von Johns Kameraden einherging –, dies würde der Augenblick sein, in dem sie mitgeteilt bekam, dass er für immer gegangen war. Man hatte ihr schon früh den Rat gegeben, sich auf das Schlimmste vorzubereiten; und obwohl sie schwören würde, dass sie erwartete, von seinem Tod zu hören, konnte sie nicht abstreiten, dass sie sich immer noch an die Hoffnung klammerte, er würde lebendig nach Hause kommen.
»Wir haben eine Mitteilung bekommen«, antwortete er zögernd, als spürte er ihre Angst. »Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass sie von John stammt, doch es scheint zunehmend wahrscheinlich zu sein.«
Alex fühlte, wie ihre Beine nachgaben; mit dem Rücken glitt sie an der Wand herab, bis sie auf dem kalten Fliesenboden saß. Das Plastik ihres Mobiltelefons knackte, da sie es immer fester mit der Hand umklammerte, und ihr Magen schlug Purzelbäume. Sie hatte schon einmal einen ähnlichen Anruf erhalten; es hatte sich jedoch herausgestellt, dass es falscher Alarm gewesen war. Also sah sie sich vor, sich sofort Hoffnungen zu machen. Doch gerade Neil Wilcox wusste, was sie durchgemacht hatte. Und so war sie sicher, dass er sie nicht angerufen hätte, wenn die Leute, denen die Information zugekommen war, diese nicht für glaubwürdig erachteten.
»Wir haben uns gefragt, ob du nicht auch irgendwas gehört hast? Während der letzten paar Wochen?«
Sie war seine Frau. Natürlich würde er versuchen, sie anzurufen, falls er dies konnte. Doch John war ein Mann des Militärs. Wenn seine Möglichkeiten zur Nachrichtenübermittlung begrenzt waren, würde er Prioritäten setzen und als Erstes den Leuten eine Botschaft zukommen lassen, die ihn am wahrscheinlichsten retten konnten.