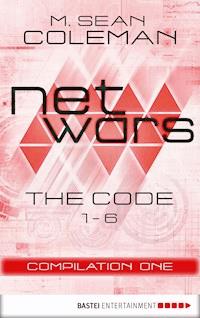4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: netwars - Sammelband Staffel
- Sprache: Deutsch
Netwars 2: Totzeit - Endlich als Sammelband erhältlich!
Anlagefonds. Sparkonten. Die Börse. All das kann mit einem einzigen Cyberangriff zum Einsturz gebracht werden.
In "Totzeit", der zweiten Staffel von netwars, kehrt Hacker Scott Mitchell zurück. Sein Sieg über die Hackergruppe Black Flag war nur ein kleiner Rückschlag für die gnadenlosen Cyberverbrecher.
Eine neue Malware zwingt den internationalen Finanzmarkt in die Knie, sodass sich die National Cyber Crime Unit (NCCU) in London mit dem FBI in New York zusammenschließen muss.
Unterdessen wurden mehrere Elite-Trader unter seltsamen Umständen - von Herzinfarkten bis hin zu schrägen Sexspielen - tot aufgefunden.
Gibt es eine Verbindung zwischen diesen Todesfällen?
Nach dem sensationellen Erfolg des Transemdia-Projekts "netwars: der Code" geht es endlich weiter!
Für Leser von Dave Eggers "Der Circle", Marc Elsbergs "Blackout" und "Zero", Daniel Suarez' "Darknet", für Fans von Filmen wie "Der Staatsfeind Nr. 1" und alle, die Spionage und High-tech Thriller lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Folge 1 – GEFAHR
Folge 2 – VERDACHT
Folge 3 – OPFER
Folge 4 – AUFGEFLOGEN
Folge 5 – SHOWDOWN
Folge 6 – ENDGAME
Über das Buch
Anlagefonds. Sparkonten. Die Börse. All das kann mit einem einzigen Cyberangriff zum Einsturz gebracht werden.
In »Totzeit«, der zweiten Staffel von netwars, kehrt Hacker Scott Mitchell zurück. Sein Sieg über die Hackergruppe Black Flag war nur ein kleiner Rückschlag für die gnadenlosen Cyberverbrecher.
Eine neue Malware zwingt den internationalen Finanzmarkt in die Knie, sodass sich die National Cyber Crime Unit (NCCU) in London mit dem FBI in New York zusammenschließen muss.
Unterdessen wurden mehrere Elite-Trader unter seltsamen Umständen – von Herzinfarkten bis hin zu schrägen Sexspielen – tot aufgefunden.
Gibt es eine Verbindung zwischen diesen Todesfällen?
Über den Autor
M. Sean Coleman begann als Scriptwriter für Douglas Adams’ Hitchhikers Guide to the Galaxy Online. Für seine Beiträge für MSN, O2, Sony Pictures, Fox, die BBC und Channel 4 wurde er mehrmals mit Preisen ausgezeichnet. Er lebt in London.
Totzeit
M. Sean Coleman
SAMMELBAND
Aus dem Englischen von Kerstin Fricke
beTHRILLED
Digitale Originalausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln, und filmtank GmbH, Hamburg
Übersetzung: Kerstin Fricke
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus
Projektmanagement: Lori Herber, Nils Neumeier
Covergestaltung: © Julia Jonas, Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von thinkstock/Andrew Ostrovsky; shutterstock/ agsandrew
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-0915-7
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Totzeit
M. Sean Coleman
Folge 1 – GEFAHR
1.
Es war seiner Meinung nach sehr viel einfacher, einen arroganten Mann zu töten.
Das lag nicht unbedingt daran, dass Shylock etwas gegen ein gesundes Selbstbewusstsein hatte. Es war nur so, dass man bedeutend leichter an einen arroganten Menschen herankam, ohne bemerkt zu werden, da diese Typen mehr Aufsehen machten und schlicht und einfach auffälliger waren.
Diese Leute waren so sehr daran gewöhnt, von jedem beachtet zu werden und stets im Mittelpunkt zu stehen, dass sie Shylock erst bemerkten, wenn es zu spät war. Selbst wenn ihnen auffiel, dass er sie beobachtete, kam ihnen nie in den Sinn, er könne die Absicht haben, sie umzubringen. Irgendwie versüßte ihm ihre Arroganz die Tat sogar. Shylock genoss den Ausdruck auf ihren Gesichtern, wenn sie mit einem Mal begriffen, dass sie ihre ehrgeizigen Pläne niemals verwirklichen würden, weil sie sterben mussten, und dass sie letzten Endes nur als Opfer und nicht als die Erfolgsmenschen, für die sie sich immer gehalten hatten, in Erinnerung bleiben würden.
Shylock saß schweigend am Ende der überfüllten Bar und beobachtete sein nächstes Opfer, während sein Hass anwuchs. Nat Marley war ein beliebter junger Typ und wie immer von einer lärmenden Gruppe seiner Kollegen umgeben. Sie kamen regelmäßig jeden Donnerstag her, nahmen teure Drinks und sorgten dafür, dass jeder andere in der Bar auch ja mitbekam, wie furchtbar wichtig sie waren.
Diese großkotzigen Angeber. Shylock hasste diese Bankertypen. Alles an ihnen strahlte Überheblichkeit, Aufgeblasenheit und eine offenkundige Missachtung für alles aus, was keine fetten Gewinne und persönlichen Ruhm versprach. Aber wer war er, dass er über sie richtete? Früher war er einer von ihnen gewesen, und was war er jetzt? Ein angeheuerter Killer wie er hatte keine moralische Überlegenheit. Wenn Shylock ehrlich war, störte ihn das alles auch nicht besonders, da es hier um etwas weitaus Persönlicheres ging. Außerdem war er Nat Marley ziemlich lange gefolgt und wusste, dass der Typ keinesfalls der Schlimmste aus dieser Gruppe war. Gut, er war arrogant und ehrgeizig, aber das war Shylock auch. Das Problem war, dass Nat Marley zu einer ernsthaften Gefahr geworden war, daher hatte man Shylock auf ihn angesetzt. Wäre Marley genauso bestechlich und betrügerisch gewesen wie Shylocks bisherige Opfer, hätte er vermutlich weiterleben dürfen.
Shylock wusste, dass er vorzeitig und ohne das Wissen seines Partners zuschlug. Aber ihm war auch klar, dass für seinen aktuellen Partner jeder eine begrenzte Zeit lang nützlich war, und wenn diese Zeit verstrichen war, wurde es zu gefährlich, sich noch länger mit ihm abzugeben. Der Trick war, weiterhin gebraucht zu werden. Das hatte Nat Marley nicht geschafft, deshalb war seine Zeit jetzt abgelaufen.
Shylock hatte auf die harte Tour lernen müssen, dass er diesen Teil seines Jobs nicht persönlicher nehmen durfte, als es notwendig war. Natürlich konnte man nicht bestreiten, dass das Töten eines anderen Menschen etwas sehr Persönliches war, aber er sah es trotzdem anders. Zumindest in diesem Fall. Er hatte diesen Kampf nicht angefangen, aber er würde ihn auf jeden Fall beenden. Anfangs hatte er nicht vorgehabt, so weit zu gehen, aber er bedauerte es auch nicht, zu was für einem Menschen er geworden war. Ein Mord ließ sich nun mal nicht schönreden. Da war es besser, alle Gefühle, die er diesbezüglich hatte, einfach abzuschotten und sich auf das zu konzentrieren, was vor einem lag. Rache war für ihn jetzt nur ein Job, wie das Backen von Brot oder das Verpacken von Fleisch – man tat es einfach, man tat es immer wieder, und man musste konzentriert sein, um den Job richtig zu machen und die Regeln zu befolgen. Aber es war nur ein Job.
Shylock blickte auf die Uhr. Genau 20.30 Uhr.
Wenn er seine Hausaufgaben richtig gemacht hatte – wovon er ausging –, würde Nat Marley sich gleich entschuldigen, seine Kollegen in der Bar verlassen und zu einem wichtigen Treffen gehen, von dem er niemandem erzählen durfte: einer Verabredung mit einem Vertreter von einem der größten Konkurrenten seines Unternehmens, der ihm anscheinend eine Stelle anbieten wollte, die ein großer Sprung auf der Karriereleiter wäre.
Der gute Marley muss sich im Moment richtig toll fühlen, dachte Shylock, als er beobachtete, wie der junge Mann den Kopf in den Nacken warf und laut über den Kommentar eines seiner Kollegen lachte. Er hätte großspurig behaupten können, dass dieses nächtliche Treffen schicksalhaft wäre, dabei würde Marley sterben, und nicht etwa, weil es sein Schicksal war, sondern weil er Shylocks Pläne ernsthaft gefährdete.
Augenblicke später sah Shylock, wie der junge Mann auf die Uhr schaute, rasch seinen Drink hinunterkippte und aufstand. Er musste sich die üblichen spöttischen Bemerkungen seiner Kollegen anhören, da es in dieser Gruppe als Zeichen von Schwäche angesehen wurde, früh zu gehen. Aber Marley ließen ihre Kommentare ungerührt. Das kollegiale Geplänkel prallte von ihm ab.
»Warum sollte ich diesen wundervollen Abend mit euch Losern verbringen?«, lautete sein letzter Spruch, bevor er sich seine lächerlich teure Jacke über die Schulter warf, einen letzten Kurzen vom Tablett auf dem Tisch trank und sich auf den Weg machte, wobei er seinen Kollegen über die Schulter hinweg den Mittelfinger zeigte, während die Blicke der meisten anderen Anwesenden in der Bar auf ihm hafteten.
Er machte es fast schon zu einfach.
Shylock schaute seinem Opfer hinterher und lächelte innerlich. Obwohl er sich ins Gedächtnis rufen musste, dass es nur ein Job war, genoss er diesen Teil der Arbeit mehr als alle anderen. Diese letzten Augenblicke der Jagd waren die faszinierendsten. Das eigentliche Töten hatte er beim letzten Mal nicht mehr wirklich genossen, und ein Großteil der Vorbereitungen hatte ihn gelangweilt, doch diese letzten Sekunden der Jagd waren nahezu berauschend. Aber die Erkenntnis, dass er etwas wusste, das das Leben seiner Opfer im wahrsten Sinne des Wortes verändern würde, war unglaublich aufregend.
Er schob einen Zwanzigpfundschein unter sein leeres Glas und stand auf. Schon jetzt konnte er die Signale in seinem Kopf hören: Die Jagd war fast zu Ende, die Hunde kamen näher. Ein unheilvolles Lächeln umspielte seine Lippen, als er Marley aus der Bar hinaus in die kühle Nachtluft folgte.
Die Stadt war kalt und dunkel, und es fiel dichter Nieselregen. Shylocks Atem bildete weiße Wölkchen vor seinem Gesicht, und er zog den Reißverschluss seiner Lederjacke hoch. Wie erwartet rief Nat Marley sich direkt vor der Bar ein Taxi. Shylock zog sein Handy aus der Tasche, während er seine Zielperson dabei beobachtete, wie sie dem Fahrer die Adresse nannte, und nutzte eine seiner selbstgeschriebenen Apps, um das GPS-Signal des davonfahrenden Wagens in Echtzeit zu verfolgen. Auch wenn er wusste, wohin Nat Marley fuhr, konnte er den Weg des Mannes auf diese Weise nachverfolgen.
Er setzte den Helm auf, stieg auf sein Motorrad und ließ den Motor an. Als er an einer Ampel neben dem Taxi hielt, warf er einen letzten Blick auf Marley, dann fuhr er weiter.
Es gab noch eine Menge zu tun.
Nat Marley gab dem Taxifahrer kein Trinkgeld und bedankte sich auch nicht bei ihm, das war einfach nicht sein Stil. Der Mann hatte nur seinen Job gemacht, dafür musste man ihm nicht danken. Nat gab nur Trinkgeld, wenn man etwas Außergewöhnliches für ihn getan hatte oder wenn er ein hübsches junges Ding beeindrucken wollte, das er angebaggert hatte. Andere Leute bezeichneten ihn oft als Geizhals, da er immer auf sein Wechselgeld wartete, obwohl er mit seinem Kontostand einen kleinen Staat hätte unterstützen können, aber ihm ging es ums Prinzip: Gib nie etwas kostenlos.
Er schlug die Tür des Taxis zu und stand vor dem hohen Glasgebäude, das er bestens kannte, da er in den letzten fünf Jahren jeden Tag daran vorbeigegangen war. Eisenberg, Katz & Frey war ein Unternehmen, bei dem er schon seit seinem Abschluss an der Uni arbeiten wollte, und jetzt sah es ganz so aus, als würde er endlich die Gelegenheit bekommen. Er hatte schon davon gehört, dass die Topfirmen ihren Konkurrenten die besten Mitarbeiter abwarben, und meist bekam man noch einen guten Anreiz dazu, die Seiten zu wechseln. Doch den brauchte er eigentlich gar nicht, da es ihm schon reichte, überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Hier würde er sein wahres Vermögen machen, davon war er überzeugt, und er würde den Stress des letzten Jahres endlich hinter sich lassen können.
Vor fast einem Jahr hatte er sich dummerweise auf gewisse außerplanmäßige Aktivitäten eingelassen, die auf den ersten Blick nach einem guten Deal ausgesehen hatten. Eine Gruppe Individuen, die ähnlich dachten wie er selbst, war an ihn herangetreten. Diese Leute versuchten, ihre Ressourcen zu bündeln, um ein Programm zu erstellen, das sie alle reicher machen würde, als sie es sich vorstellen konnten. Sie nannten sich die »Water Boys« und hielten sich für die Besten der Besten. Man hatte Marley gut bezahlt, aber nach und nach war ihm klar geworden, dass die Water Boys auf eine größere Sache hinarbeiteten, als ihm ursprünglich bewusst gewesen war, und ein solches Risiko wollte er nicht eingehen. Er wusste, dass die Sicherheitsbestimmungen in ihrem Arbeitsfeld relativ lasch gehandhabt wurden, war aber nicht bereit, zu einem Aktivisten zu werden, um dies zu beweisen. Als Marley begriff, dass die Leute, denen er sich angeschlossen hatte, tatsächlich vorhatten, die Aktienmärkte zum Einsturz zu bringen, hatte er versucht, aus der Sache auszusteigen. Danach war er bedroht worden. Er hatte den Leuten ein letztes Codefragment gegeben, aber absichtlich eine Hintertür eingebaut, die er nutzen konnte, falls sie es je verwendeten. Danach war Marley davon ausgegangen, dass seine Beteiligung an der Sache abgeschlossen war, und hatte sich darangemacht, das Gegenmittel zu programmieren. Wenn die Water Boys den Markt angriffen, würde es Nat Marley sein, der sie aufhielt. Er würde zu einer Legende werden.
Das heutige Treffen sollte den Beginn dieser Reise darstellen.
Marley war zwar jung, galt in seiner Firma aber jetzt schon als einer der begabtesten Mitarbeiter, und das wusste er nur zu gut. Er hatte seinen Abschluss als Bester seines Jahrgangs gemacht, der ohnehin schon aus einer Elite von Mathegenies bestand. Nach einem kurzen Ausflug an die Wall Street war er von Flintlock and Staines angeworben und zurück nach London geholt worden. Seitdem arbeitete er bei diesem Handelsunternehmen, das zu den wenigen gehörte, die die Londoner Börse beherrschten.
Normalerweise haben die Menschen, wenn sie an die Börse denken, das Bild von Testosteron-getriebenen Männern in teuren Designeranzügen und Hemden aus der Savile Row vor Augen, die Anweisungen in mehrere Telefone blafften, während sie die fluktuierenden Marktpreise beobachteten, die auf dem durchlaufenden Ticker unterhalb großer Monitor erschienen und wieder verschwanden. Aber dieses Bild ist ebenso veraltet wie die Filme, die es erschaffen haben. Aber da die Alternative zu komplex ist, als dass wir sie begreifen könnten, klammern wir uns weiterhin an dieser überholten Vorstellung fest, weil sie Sinn ergibt, denn auf diese Weise erweckt es den Eindruck, als würden Menschen hinter den Erfolgen und Fehlschlägen an den Aktienmärkten stehen, sodass alles irgendwie normal wirkt. In Wahrheit sind die Wertpapierhändler längst nicht mehr da, zumindest nicht auf diese Weise; der Großteil der Abschlüsse wird im Innern schwarzer Kästen getätigt, die in gut bewachten Gebäuden stehen, wobei so gut wie kein Mensch mehr begreift, was dort eigentlich vor sich geht.
Nach dem Börsencrash am 19. Oktober 1987, der als Schwarzer Montag bekannt wurde, veränderte sich die globale Finanzindustrie dramatisch. Der Prozess begann langsam, beschleunigte sich jedoch in den folgenden Jahren, als die Broker – die lauten, selbstsicheren Typen in ihren teuren Anzügen – nach und nach durch Computer ersetzt wurden. Heutzutage leben wir in einer Welt, in der die Maschinen den Aktienhandel übernommen haben. Es sind dieselben Rechner, die unsere Nachrichtenartikel und sogar unsere Twitter-Feeds lesen und binnen Milli- oder sogar Nanosekunden darauf reagieren, schneller als ein Mensch blinzeln kann. Ein gefälschter Tweet von einem gehackten Associate-Press-Twitter-Account, der behauptete, Präsident Obama wäre bei einer Explosion im Weißen Haus verletzt worden, ließ den Aktienmarkt fast augenblicklich ins Bodenlose stürzen und verringerte den Marktwert um beinahe zweihundert Milliarden Dollar. Sobald der Tweet als gefälscht bestätigt worden war, ging es mit den Märkten fast ebenso schnell wieder aufwärts, wie sie eingebrochen waren. Die Computer hatten den milliardenschweren Fehler begangen, Twitter zu glauben, und so schnell reagiert, wie sie es gemäß ihrer Programmierung tun sollten. Diese sogenannten »Flash Crashes« gehören heutzutage zum Aktienmarkt.
In seinem ersten Monat im neuen Job hatte Nat das volle, schockierende Ausmaß eines »Flash Crashs« zu spüren bekommen. Es war ein ungemein aufregendes Erlebnis für ihn gewesen. Der 6. Mai 2010 hatte ganz normal für ihn begonnen, mit der einzigen Ausnahme, dass in Großbritannien an diesem Tag gewählt wurde, worauf die europäischen und US-Märkte immer ziemlich nervös reagierten. Nat hatte sich darauf gefreut, verfolgen zu können, wie sich die Geschehnisse auf den Markt auswirkten, war allerdings nicht auf das vorbereitet, was ihn an diesem Tag tatsächlich erwartete. Die Welt wartete nicht nur gespannt auf das Ergebnis der Wahlen in Großbritannien, sie wurde außerdem dadurch in Aufruhr versetzt, dass die Griechen auf die Straßen gingen, um gegen die Sparmaßnahmen ihrer Regierung zu protestieren.
Als Nat zur Arbeit kam, war die Stimmung des Marktes bereits gedämpft, und jedes Mal, wenn Athen in einer Nachrichtenmeldung erwähnt wurde, sank der Dow Jones um ein paar Punkte, als würden sie wie Funken bei einem Lagerfeuer davonstieben. Es nicht zu fassen. Ohne jede Vorwarnung hatte in einem ansonsten verlässlichen Markt ein Flimmern eingesetzt, war dann zu einem Stottern und schließlich zu einem Ruck geworden, der sich auf die anderen Aktienmärkte ausbreitete und augenblicklich dafür sorgte, dass sämtliche Kurse in den Keller fielen. Innerhalb von Sekunden verlor der Dow Jones einhundert Punkte, und ehe die Börsenmakler darauf reagieren konnten, war er um weitere hundert Punkte abgesackt. Und noch einmal um hundert.
Verzweifelt versuchten die Broker, ihre Einlagen zu retten, und widerriefen Bestellungen, um den Schaden möglichst gering zu halten. Verschreckt kamen sie zusammen und sahen mit an, wie die Preise unaufhaltsam weiter fielen. Sekunden später, als der Dow Jones an diesem Tag um sechshundert Punkte gesunken war, erklärten sie die Lehman Brothers, die US-amerikanische Investmentbank, für zahlungsunfähig. Sämtliche Börsenmakler einschließlich Nat waren kreidebleich, fassungslos, sprachlos – es war, als würde man in einen Abgrund sehen. Selbst der 11. September hatte keine derartige Reaktion hervorgerufen, was darauf schließen ließ, dass etwas Gigantisches passiert war. Aber was? Weder in den Nachrichten noch online konnte man etwas darüber lesen. Warum griff niemand ein und stoppte diesen Irrsinn?
In diesem Moment wurde Nat klar, dass es niemanden gab, der etwas dagegen unternehmen konnte. In den USA war es bereits 14.47 Uhr, und die Schutzschalter, die den Handel nach ungewöhnlichen Preisveränderungen unterbrechen sollten, waren nur bis 14.30 Uhr aktiv. Jetzt waren die Broker auf sich selbst gestellt. Der Dow Jones raste auf einen Verlust von eintausend Punkten zu, was ungefähr einer Billion Dollar entsprach, und riss alles, was ihm in die Quere kam, mit in den Abgrund.
Dann veränderte sich der Markt völlig unerwartet ein weiteres Mal, und die Kurse stiegen wieder, fast so schnell, wie sie gefallen waren. Der Verlust sank auf sechshundert, dann auf dreihundert Punkte. Broker auf der ganzen Welt atmeten erleichtert auf. Der Crash, der dramatischste in der Geschichte des Aktienhandels, hatte sich innerhalb von zehn Minuten ereignet. Es waren die schrecklichsten und aufregendsten zehn Minuten in Nat Marleys leben gewesen. Er war Zeuge der Macht des Hochfrequenzhandels und der damit verbundenen Algorithmen geworden.
Nun wusste er, wo sein Platz war. Er hatte einen Einblick in eine Aktienwelt bekommen, die sich nur wenige Außenstehende vorstellen konnten: eine globale Matrix aus komplizierten Algorithmen, die durch miteinander verbundene, im wahrsten Sinne des Wortes gigantische Nervenzentren verliefen und anscheinend allmächtige, rasend schnell agierende, von der neuesten künstlichen Intelligenz gesteuerte Handelsroboter miteinander verbanden. Nat war fasziniert.
Fünf Jahre später war Nats Traum, zu den Alpha-Männern dieser Welt zu gehören, in greifbare Nähe gerückt, und er besaß den Respekt seiner Kollegen und seiner Bosse. Er war ein Datenzauberer und so geübt darin, Muster im Markt zu entdecken und vorherzusagen, dass er an die Spitze seiner Firma aufgestiegen war und in streng geheime quantitative Derivatenoperationen eingebunden wurde. Er war ein »Quant«, ein Mathematiker, der quantitative Techniken einsetzte, um Märkte vorherzusagen, aber er war besser als die meisten anderen. Irgendetwas an seiner Detailversessenheit oder seiner Fähigkeit, winzige Änderungen wahrzunehmen, hatte zur Folge, dass er genauer, schneller und weitaus besser war als seine Kollegen. Die Software, die er geschrieben hatte – und bei der er überlegte, ob er sie seiner jetzigen Firma zur Verfügung stellen sollte –, würde ihn auf die nächste Stufe der Karriereleiter katapultieren. Er war sich fast sicher, dass seine Kontaktpersonen irgendwann angreifen würden, aber dann wäre er auf sie vorbereitet. Wenn das Programm bei seinem Unternehmen lief, war es geschützt. Das machte Nat zum wichtigsten Aktivposten auf dem Markt.
Und jetzt war er hier, stand vor der Londoner Zentrale des von ihm erträumten Arbeitgebers und hatte ein geheimes Treffen mit dem Mann vor sich, der ihm einen Platz an der Spitze sichern konnte. Nat war wie aufgedreht.
Er griff in die Tasche und zog die Mitarbeiter-Magnetkarte hervor, die er zusammen mit der Einladung für den heutigen Abend per Post erhalten hatte. Er hatte die in der Nachricht aufgeführten Anweisungen genau befolgt und keinem seiner Freunde oder Kollegen verraten, dass man ihn abwerben wollte. Aber er freute sich diebisch ihre dummen Gesichter, wenn er ihnen enthüllte, dass er bald bei Eisenberg, Katz & Frey arbeiten würde.
Seitdem Nat die Einladung erhalten hatte, grübelte er immer wieder darüber nach, wie sie auf ihn aufmerksam geworden sein mochten. Hatte ihn jemand empfohlen? Er hatte nicht die leiseste Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Auch wenn er in seinem Job außergewöhnlich gut war – was er sehr genau wusste –, arbeitete er nicht gerade in einem Bereich, in dem anonyme Empfehlungen ausgesprochen wurden. Aber irgendwie war er aufgefallen, und jetzt lag es an ihm, bei diesem Treffen zu zeigen, was in ihm steckte.
Nat schlenderte über den breiten Weg westlich um das Gebäude herum zum Seiteneingang, wie es ihm aufgetragen worden war, und drückte die Magnetkarte an das Lesegerät. Das Kontrolllämpchen wechselte von Rot nach Grün, und Nat stieß die Tür mit dem Fuß auf. Die Lampen im Korridor wurden durch einen Bewegungssensor aktiviert und flammten in dem Moment auf, als er das Gebäude betrat. Das Ganze kam ihm sehr geheim und verstohlen vor; schließlich drang er spätabends in die Zentrale eines Konkurrenzunternehmens ein, um an einem geheimen Treffen teilzunehmen, bei dem sein Seitenwechsel besprochen wurde. Er fühlte sich wie ein Spion und stellte fest, dass er dieses Gefühl genoss.
Hinter ihm fiel die Tür hörbar ins Schloss. Nat stieg die Treppe hinauf in den ersten Stock, bog in den Flur ab und befolgte weiterhin die Anweisungen, die der Einladung und der unbeschrifteten Magnetkarte beigelegen hatten. Er ging langsam, ließ sich Zeit. Diesen Luxus konnte er sich leisten, da er den Pub absichtlich früher verlassen hatte. Sei Vater hatte ihn gelehrt, dass die Höflichkeit es gebot, immer pünktlich zu sein; seit er erwachsen war, hatte Nat sich angewöhnt, immer genau zur vereinbarten Zeit zu erscheinen. Nicht früher und nicht später. Jetzt blieben ihm noch fünf Minuten, um in den zwanzigsten Stock zu gelangen.
Im ersten Stock schlüpfte er in die Herrentoilette, die sich in der Nähe des Lifts befand, mit dem er nach oben fahren würde. Zuvor wollte er sich aber noch vergewissern, dass er gut aussah. Er beugte sich über das Waschbecken und betrachtete sein Spiegelbild. Ihm war klar, dass er ein attraktiver Mann war, und im Moment sah er besonders gut aus. Er hatte im vergangenen Jahr ein wenig zugelegt, da er mehr Zeit im Fitnessstudio und weniger in der Bar verbrachte, sodass sein weißes Hemd eng an seiner Brust und seinem Bizeps anlag.
Nachdem er die Hände kurz unter den Wasserhahn gehalten hatte, strich er sich damit übers Haar, um es zu glätten. Dann zog er seine Jacke wieder an und wischte ein paar Mal über die Schultern. Ja, er sah gut aus. Er war der perfekte Mann. Er würde es schaffen. Heute war sein Tag.
Er grinste sein Spiegelbild an, während er seine Hände unter den Handtrockner hielt. Jemand hatte einen Motorradhelm neben den Waschbecken liegen gelassen. Es kam ihm seltsam vor, dass man so etwas vergessen konnte. Außerdem hatte die Einladung durchklingen lassen, dass sich um diese Uhrzeit niemand mehr im Gebäude aufhalten würde. Die Finanzsoftwareindustrie war ziemlich klein, und Nat wollte auf gar keinen Fall jemandem begegnen, den er kannte, bevor er bereit war, die große Neuigkeit zu verkünden. Da er in den Kabinen jedoch niemanden entdecken konnte, zuckte er mit den Achseln und verließ die Herrentoilette, bevor möglicherweise der Besitzer des Motorradhelms zurückkam.
Im Fahrstuhl auf dem Weg in den zwanzigsten Stock ging er die möglichen Antworten auf die Fragen, die man ihm stellen würde, noch einmal durch. Er hatte keine Ahnung, was ihn erwartete: War es ein Vorstellungsgespräch oder nur noch eine reine Formsache? Egal, er hatte so oder so die Absicht, alles richtig zu machen. Er war bereit.
Er musste an seine Eltern denken und daran, wie stolz sie auf ihn sein würden, wenn sie die gute Nachricht erfuhren. Sie wussten nicht genau, was er eigentlich tat, nur dass er sehr gut in seinem Job war und bereits sehr viel Geld verdient hatte. Er hatte ihnen ein schönes großes Haus auf dem Land gekauft, hatte beiden einen neuen Wagen und ein gut gefülltes Konto geschenkt. Seiner älteren Schwester hatte er eine Wohnung in der Innenstadt gekauft, für die sie sich bis heute nicht bei ihm bedankt hatte. Sie hatte offenbar keine Ahnung, was für ein Glück sie hatte, dass er ihr Bruder war.
Sobald man ihn hier zum Partner gemacht hatte, würde es keinem von ihnen jemals wieder an irgendetwas fehlen. Seine Familie war das Einzige, was Nat wichtig war, abgesehen von seiner eigenen Person, versteht sich. Er sah sie nicht besonders oft, sorgte aber dafür, dass es ihnen an nichts mangelte.
Das Ping! des Fahrstuhls im zwanzigsten Stock riss ihn aus seinen Gedanken. Er warf sich in die Brust und wartete, dass die Türen sich öffneten. Die gesamte Etage lag im Dunkeln, nur das Licht aus der Fahrstuhlkabine fiel auf den Boden. Nat war sich nicht sicher, was er erwartet hatte, aber es kam ihm doch unheimlich vor, dass sich hier oben niemand aufzuhalten schien. Als er aus dem Fahrstuhl blickte, wurde er immer unruhiger. Hatte er sich die falsche Zeit gemerkt? Das falsche Stockwerk? Hatte er etwas durcheinandergebracht? Erst als er die Kabine verließ, bemerkte er ein einsames Licht, das in einem der Eckbüros brannte. Er atmete erleichtert auf und ging darauf zu. Durch seine Bewegung wurden die Deckenlampen aktiviert, und er blinzelte, als das sanfte fluoreszierende Licht auf ihn hinunterstrahlte.
Der zwanzigste Stock war so spektakulär, wie es ihm berichtet worden war: ein riesiger Raum, stilvoll ausgestattet und nach allen Seiten offen, mit Arbeitsbereichen, in denen überteuerte Schreibtische hinter Designertrennwänden standen. Metall, Holz und Glas – der moderne Stil stand für kultivierte Professionalität. Durch die deckenhohen Wände konnte man auf einen großen Teil Londons schauen. Das neonfarbene Leuchten der Stadt fing sich in den bunt schillernden Regentropfen auf den riesigen Fensterflächen. Nat lächelte, als er zum Eckbüro ging. Es gefiel ihm hier jetzt schon.
Doch das Büro war leer. Ein Laptop stand aufgeklappt auf dem Schreibtisch im Licht einer schicken Lampe. Der Schreibtischstuhl war zurückgeschoben worden, als wäre der Benutzer des Laptops nur kurz aufgestanden. Das Namensschild an der Tür bestätigte Nat, dass er am richtigen Ort war: Colm Monroe hatte ihm die Einladung zu diesem Treffen geschickt. Der CEO von Eisenberg, Katz & Frey war in der Branche dafür bekannt, dass er ab einem bestimmten Level an jeden seiner Angestellten persönlich auswählte.
Nat war ein wenig überrascht gewesen, die Einladung zu diesem Treffen zu erhalten, doch die damit verbundene Geheimhaltung wunderte ihn kein bisschen. Profis in Nats Position kannten viele Informationen über ihren Arbeitgeber, und wenn man dabei gesehen wurde, wie man mit der Konkurrenz sprach, konnte einem das schnell als Verrat an der Firmenpolitik ausgelegt werden. Nat war gespannt darauf, was Monroe ihm erzählen würde, aber er wollte seine Karriere nicht wegen eines solchen Treffens aufs Spiel setzen. Letzten Endes hatte er diesem Unternehmen doch deutlich mehr zu bieten, als er zu erwarten hatte.
Er betrat das Büro und schaute sich um. Es sah genauso aus wie die Eckbüros, die man immer in Filmen zu sehen bekam: elegant und aufgeräumt, ohne überquellende Posteingangskörbe, leere Kaffeetassen oder vertrocknete Topfpflanzen. Ein einzelner Bilderrahmen auf dem Schreibtisch gab einen Hinweis auf das Privatleben des Bürobesitzers, ansonsten aber strahlte es sachliche, beinahe kühle Professionalität aus. Das gefiel Nat, da er sich selbst eines Tages in einem solchen Büro sah.
Zögernd blieb er im Türrahmen stehen. Sollte er ungebeten eintreten? Oder war es klüger, noch mal kurz zu verschwinden und zurückzukommen, wenn Monroe wieder an seinem Schreibtisch saß?
Nein, sagte er sich dann. Das muss eine Art Test sein. Er war pünktlich hergekommen; da der Mann nicht in seinem Büro war, konnte das nur ein kleines Spielchen sein, mit dem man herausfinden wollte, wie er darauf reagierte. Er beschloss, einfach einzutreten und zu warten, als wäre alles ganz normal. Doch bevor er das Büro betreten konnte, hörte er eine Bewegung hinter sich.
»Da sind Sie ja.«
Nat drehte sich um und stand einem kleinen, breitschultrigen Mann gegenüber, der dicht hinter ihm stand. Er lächelte, aber es war kein besonders warmherziges Lächeln. Eigentlich sah er eher unheilvoll aus, fand Nat, der sich den großen Colm Monroe ganz anders vorgestellt hatte. Sein Gegenüber hatte zwar einen rasierten Schädel und dunkle Augenbrauen und entsprach somit den Bildern, die Nat im Internet gesehen hatte, aber er hatte Monroe größer eingeschätzt. Sein furchterregender Ruf schien einfach besser zu einem größeren Mann zu passen.
»Haben Sie etwa daran gezweifelt?« Nat versuchte, die Frage freundlich und entspannt klingen zu lassen, als wäre er ein Mann, der dazugehört, auch wenn sein Herz heftig in seiner Brust pochte. Monroe blieb einen Moment zu lange so stehen und ging nicht um Nat herum, sodass dieser schließlich einen unbeholfenen Schritt zur Seite machen musste, als würde er Monroe in sein eigenes Büro einladen. Monroe streckte die Hand aus und erwiderte Nats Händedruck fest, wobei er seinen Zeigefinger auf Nats Handgelenk legte – ein alter Trick, mit dem man den anderen daran hinderte, kräftig zuzupacken. Nat drückte Monroes Hand dennoch fest, da ein schwacher Händedruck auf einen Mann wie Monroe armselig gewirkt hätte. Er spürte, wie der Fingernagel des Mannes über sein Handgelenk kratzte, als er ihn losließ und an ihm vorbeiging, wobei er immer noch grinste.
»So«, meinte Monroe und setzte sich hinter seinen Schreibtisch. »Sie glauben also, dass Sie bei Eisenberg, Katz & Frey eine Chance haben?«
Nat bemerkte, dass Monroe einen leicht amerikanischen Akzent zu haben schien. Sprach er mit Absicht so, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen? Oder verwechselte er, Nat, Monroes berühmten schottischen Akzent mit dem eines Yankees? Er saß Monroe bereits gegenüber, bevor er antwortete, und war entschlossen, alles richtig zu machen.
»Sie scheinen jedenfalls davon auszugehen, sonst wäre ich jetzt nicht hier«, erwiderte er.
War das zu frech für den Gesprächsbeginn? Gute Frage. Aber jetzt konnte er es nicht mehr rückgängig machen.
»Gutes Argument«, erwiderte Monroe.
Seine Stimme war nasaler, als Nat erwartet hatte. Er hatte sich Aufzeichnungen von Monroes legendären Präsentationen angeschaut; da hatte der Mann nicht so weinerlich geklungen.
»Also gut«, fuhr Monroe fort. »Dann erzählen Sie mir mal ein bisschen was über Flintlock and Staines.«
»Was möchten Sie wissen?«
»Es zählt zu den besten Unternehmen Londons. Die Gesamteinnahmen gehen in die Milliarden. Diese Leute stellen nur die besten fünf Prozent sämtlicher infrage kommender Kandidaten ein, und Sie sitzen hier bei deren größter Konkurrenz. Warum wollen Sie unbedingt von dort weg?«
Nat hatte sich auf diese Frage vorbereitet. Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber war in dieser Branche oberstes Gebot.
»Es ist ein fantastisches Unternehmen, und ich bin dort immer sehr glücklich gewesen. Aber ich bin darüber hinausgewachsen, und offen gesagt können sie Eisenberg, Katz & Frey nicht das Wasser reichen«, erklärte Nat. »Außerdem gehöre ich zu den besten zwei Prozent. Der Gruppe, aus der Sie Ihre Angestellten auswählen. Deshalb gehöre ich hierher.«
Monroe zog eine Augenbraue hoch. Nat versuchte, den Gesichtsausdruck des Mannes zu deuten. Er hatte sich gut vorbereitet und wusste, dass Monroe Selbstsicherheit und innere Ruhe mochte. Er war dafür bekannt, dass er die kleinste Schwäche eines Menschen finden und ausnutzen konnte, um junge Heuchler in der Luft zu zerreißen. Wenn er jemanden mochte, war der Betreffende drin, aber wenn er jemanden ablehnte, war die Tür zu und würde sich nie wieder öffnen.
»Entspannen Sie sich, Junge«, beruhigte ihn Monroe. »Sie sind nicht hier, um mich zu überzeugen. Sie sind hier, weil Sie eine letzte Chance bekommen.« Monroe zog ein Paar Latexhandschuhe aus der Tasche und streifte sie über. Das kam Nat zwar seltsam vor, aber er hatte davon gehört, dass es Leute gab, denen es nicht behagte, irgendwelche Oberflächen zu berühren. Wahrscheinlich war das eine weitere von Monroes Macken.
Als er die Handschuhe angezogen hatte, drehte Monroe den Laptop um, damit Nat den Bildschirm sehen konnte.
»Hier«, sagte Monroe.
Nat schaute auf den Monitor und runzelte die Stirn. Da war nichts zu sehen, nur eine Eingabeaufforderung mit blinkendem weißem Cursor, der auf Befehle wartete.
»Sie wissen doch noch, wie Sie auf Ihren eigenen Server zugreifen, oder?« Monroe starrte Nat über den Monitor hinweg an.
»Natürlich, aber was …«
Er hatte mit einem beinharten Vorstellungsgespräch gerechnet, aber jetzt war er völlig verblüfft und wusste nicht, was von ihm erwartet wurde. Monroe seufzte und schaute ihn an, wobei er offenbar auf eine Erkenntnis wartete, die sich einfach nicht einstellen wollte.
»Für ein Genie sind Sie nicht besonders clever, was?«, sagte er schließlich kalt. »Das ist Ihre letzte Chance, mein Junge. Übergeben Sie mir den Code.«
Nat stand plötzlich der Schweiß auf der Stirn. Was lief hier ab? Warum verhielt sich Monroe so? Gehörte er etwa zu den Water Boys? War er Shylock? Er konnte mit der Gruppe doch unmöglich etwas zu tun haben.
»Sie haben sich dummerweise in eine sehr unangenehme Lage gebracht, Nathaniel«, stellte Monroe fest. »Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich im Moment nicht besonders gut fühlen.«
Da hatte er verdammt recht. Nat atmete schwer, war nervös, unruhig, verängstigt.
»Was geht hier vor?«, wollte er mit zittriger Stimme wissen. Er spürte, wie sein Herz flatterte.
Was geschieht mit mir?
»Ihnen wurde ein sehr schnell wirkendes Gift injiziert«, antwortete Monroe. »Ich bin im Besitz des Gegenmittels, aber Sie müssen mitspielen, wenn Sie es haben wollen.«
»Keine Chance«, entgegnete Nat entschlossen.
Monroe grinste nur.
»Das kratzt mich nicht weiter«, sagte er. »Aber denken Sie daran, wie es aussehen wird, wenn man Sie hier in Ihrer eigenen Pisse findet, im Büro eines Konkurrenzunternehmens, dessen Server infiltriert wurde. Möchten Sie, dass ein solch jämmerlicher Eindruck von Ihnen bleibt?« Monroe wischte beiläufig mit einem sauberen Taschentuch über die Tischplatte und säuberte sie auf diese Weise.
»Das können Sie nicht machen!«, stieß Nat hervor. Es ging ihm immer schlechter. Seine Lippen wollten nicht mehr auf die Befehle seines Hirns reagieren, und ihm fiel das Schlucken schwer. Er versuchte, sich seine Verzweiflung nicht anmerken zu lassen, obwohl es ihm die Kehle zuschnürte. Ihm war heiß, und er schwitzte. Panik erfasste ihn.
»Es ist bereits passiert, Kumpel«, sagte Monroe. »Jetzt liegt es an Ihnen. Wollen Sie, dass es aufhört?«
Nat beugte sich vor. Um ihn her drehte sich alles. Er holte tief Luft und versuchte, sich zu beruhigen, aber das war unmöglich. Er hatte das Gefühl, die Kontrolle über seinen Körper zu verlieren.
»Sie müssen mir nur den Code aushändigen, dann sorge ich dafür, dass es aufhört«, versicherte ihm Monroe.
»Okay …«, sagte Nat, dessen Zunge immer dicker zu werden schien, sodass er das Wort nicht mehr richtig aussprechen konnte. Er beugte sich zum Laptop vor, aber sein Körper fühlte sich träge an und schien ein Eigenleben zu entwickeln. Monroe schob den Laptop näher an Nat heran. Der versuchte, auf seinen eigenen Remote-Server zu gelangen, aber seine Finger wollten ihm nicht mehr gehorchen. Schließlich aber gelang es ihm doch, die Zahlen einzugeben und die Return-Taste zu drücken. Das Stammverzeichnis seines privaten Webservers wurde angezeigt und verlangte die Eingabe eines Benutzernamens und eines Passworts.
Nat sah Monroe an. Der Mann wirkte kalt, leidenschaftslos und irgendwie … dumm. Nat wusste, dass Colm Monroe alles andere als ein Dummkopf war, aber in diesem Augenblick sah er so aus.
Er blickte Nat an und wartete darauf, dass er den Code ausgehändigt bekam.
Seltsam.
Nats Körper fühlte sich fremd an, als würde er nicht mehr zu ihm gehören. Doch sein Gehirn arbeitete fieberhaft. Dieser Mann war nicht Colm Monroe! Man hatte ihn hereingelegt. Er war hier der Dumme. Er hatte Mist gebaut. Trotzig beschloss er, dass er lieber sterben würde, als ihnen den Code zu geben.
Nat musste seine ganze Kraft aufbringen, um den Laptop von sich wegzuschieben. Es war als große Geste gedacht gewesen, aber das Gerät bewegte sich keine drei Zentimeter.
»Nein«, sagte er. Es klang eher wie »Nnn.« Seine Zunge lag dick und schwer in seinem Mund. Sein Herz schlug rasend schnell, und es ging ihm mit jeder Sekunde schlechter. Er war kurzatmig, und seine Haut fühlte sich klamm an. Er zerrte mit den Fingern an seinem Kragen und versuchte, ihn zu lockern, aber das machte die Sache auch nicht besser. Die Welt schien ihn zerquetschen zu wollen, und er drohte diesen Kampf verlieren. Er spürte, dass ihm sein Hemd unter der Jacke auf der Haut klebte, und es kam ihm vor, als wollte der Kragen ihn erwürgen.
Er musste hier raus, er musste sofort hier weg! Zitternd stand er auf und merkte, dass seine Beine nachzugeben drohten.
Monroe hielt ihn nicht auf, als Nat versuchte, das Büro zu verlassen. Nat wusste, warum der Mann sich gar nicht erst die Mühe machte. Er, Nat, würde es nicht schaffen. Er war gerade mal auf Armeslänge an die Tür herangekommen, als seine Beine nachgaben. Obwohl er sich umdrehte und auf eines der Sofas hinter sich zusteuerte, ging er auf die Knie, bevor er es erreichte. Inzwischen rang er nach Luft und zerrte an seiner Krawatte, um sie loszuwerden.
Der Mann, der nicht Colm Monroe war, machte keine Anstalten, Nat zu helfen. Stattdessen musterte er ihn über den Bildschirm des Laptops hinweg mit einem missbilligenden Ausdruck.
»O Gott«, stieß Nat hervor und schnappte nach Luft, aber es kam keine mehr. Er legte sich hin, hoffte, dass er auf diese Weise Erleichterung fand. Er würgte, erstickte.
Du liegst im Sterben.
Diese Erkenntnis traf ihn mit voller Wucht. Er starb, und es gab nichts, was er dagegen tun konnte. Seine Gedanken rasten, aber sein Körper hatte längst aufgegeben. Der Schmerz, der durch ihn hindurchtoste, als es zu Ende ging, war schlimmer als alles, was er je erlebt hatte, aber er bekam keinen Laut mehr aus seiner zugeschnürten Kehle. Er hatte Todesangst und konnte keinen Muskel bewegen, konnte sich nicht wehren, konnte nichts tun, rein gar nicht. Nichts und niemand konnte ihm mehr helfen.
Das Letzte, was Nat auf Erden sah, war der Mann, der vorgab, Colm Monroe zu sein. Er stand auf, wandte sich ab und blickte aus dem Fenster, als wollte er den Todeskampf seines Opfers nicht mit ansehen.
Dann ergab Nat sich der Dunkelheit.
Letzten Endes war es viel leichter gewesen, Nat Marley umzubringen, als er erwartet hatte, und es war definitiv reibungsloser abgelaufen als bei dem Kerl davor. Shylock war enttäuscht, dass er den Jungen nicht dazu gebracht hatte, den Zugang zu seinem Server freizugeben, da seinem Boss dieses Geschenk gern gemacht hätte, um sich dafür zu entschuldigen, dass er so viele ihrer Schlüsselfiguren in derart kurzer Zeit ausgeschaltet hatte. Er musste die Water Boys auflösen und konnte es sich nicht leisten, Leute am Leben zu lassen, die irgendwas ausplaudern konnten. Sein Partner würde es verstehen, aber es wäre sehr viel einfacher gewesen, hätte Shylock ihm klipp und klar beweisen können, dass Nat Marley zu einer Bedrohung geworden war.
Wenigstens hatte er die IP-Adresse des Servers. Shylock wusste, dass er sich die Informationen damit auch so beschaffen konnte, wenn er etwas Zeit dafür fand, daher schrieb er sich die Zahlen auf und schloss dann den Browser, den er nicht mehr brauchte.
Seine Haut kribbelte unter der dünnen Latexschicht der Maske, mit der er sich als Colm Monroe verkleidet hatte. Er hatte Nat Marley ins Büro locken und in Sicherheit wiegen müssen, damit er ihm nahe genug kommen konnte. Da der Mann jetzt ausgeschaltet war, musste er alles so arrangieren, dass es eindeutig aussah, bevor er nach Hause gehen und sich waschen konnte.
Den Laptop musste er hierlassen, um die Illusion zu erschaffen, dass Marley irgendwie mit dem Konkurrenzunternehmen in Verbindung gestanden hatte. Obwohl er Marley zum Schweigen bringen wollte, hatte er einige Zeit und Mühe in die Planung des Mordes gesteckt. Indem er Marley hierher gelockt hatte, wollte er den jungen Mann außerdem diskreditieren. Marleys Ruf sollte im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen; wenn Shylock seinen Job richtig machte, würde es hier keine anderen Spuren geben, und die Todesursache wäre ein Rätsel. Es war immer hilfreich, die Behörden auf die falsche Spur zu locken, während man seinen nächsten Zug plante. Und wenn man den Goldjungen der Konkurrenzfirma mit einem Laptop voller Firmengeheimnisse tot im Büro des Firmenchefs fand, war das eine sehr gute Ablenkung. Auf lange Sicht wäre auch sein Partner froh darüber – schließlich dachte Shylock voraus.
Shylock trug den Laptop zu Colm Monroes Schreibtisch und schloss ihn direkt an Monroes Desktopcomputer an. Dann holte er ein Blatt Papier aus der Tasche und legte es neben die Tastatur. Es war voller handgeschriebener Anweisungen: sein Spickzettel. Er fuhr Monroes Rechner hoch und gab die Zugangsdaten ein, die er von seinem Supportteam erhalten hatte. Sobald die Benutzeroberfläche angezeigt wurde, öffnete er die Ordner, die er suchte. Dabei sah er immer wieder auf seinen Zettel, um sich zu vergewissern, dass er alles richtig machte. Er wusste, dass er nur diese eine Chance hatte, um alles zu bekommen, was er brauchte, und er konnte es sich nicht leisten, irgendetwas zu vergessen. Außerdem liebte er Listen, da sie ihm Selbstsicherheit gaben. Also arbeitete er sich durch die Unterpunkte und kopierte Dateien auf den Laptop. Shylock machte sich gar erst nicht die Mühe, die Dateien zu öffnen oder gar zu lesen; dafür würde er später noch genug Zeit haben.
Während die beiden Computer miteinander kommunizierten, beschäftigte Shylock sich damit, die physikalischen Beweise herzurichten. Dieser Teil seiner Arbeit behagte ihm deutlich weniger, aber er würde ihn trotzdem so schnell und effizient wie immer erledigen. Er ging zu Nat Marleys noch immer warmer Leiche, beugte sich über ihn und musterte den Toten. Marley war ein großer Mann, aber wenigstens schlank. Shylock schätzte, dass er ihn problemlos vom Boden heben konnte. Er wollte ihn auf keinen Fall schleifen, da er dabei Spuren hinterlassen würde.
Also schob er die Unterarme unter Nats Achseln und brachte ihn in eine sitzende Position. Nat sackte auf groteske Weise nach vorn zusammen. Shylock achtete darauf, dass er nicht zu weit vornüberkippte, da er nicht wollte, dass der Bursche sich post mortem verletzte. Dann zog er Nats Leiche auf das weiche Leder und ging um das Sofa herum, um die Szene in Augenschein zu nehmen.
Nat lag irgendwie seltsam da, deshalb bewegte Shylock ihn vorsichtig, bis er eine natürlichere Liegeposition eingenommen hatte. Sehr gut! Jetzt sah es aus, als hätte Marley sich zurückgelehnt, um sich im Fernsehen ein Fußballspiel anzusehen, und wäre eingeschlafen. Viel besser.
Shylock ging zurück zu den Computern auf dem Schreibtisch. Sie hatten ihre Arbeit ebenfalls erledigt. Gut. Jetzt konnte er alles so stehen lassen. Er wischte noch einmal die Vorder- und Rückseite des Laptops mit dem Taschentuch ab und ließ nur die Tasten aus. Er hatte ja mit Handschuhen darauf getippt und wusste, dass sie sauber waren. Danach wischte er alles auf dem Schreibtisch ab, sogar die Dinge, die er gar nicht berührt hatte. Er war stolz darauf, dass er äußerst vorsichtig war und niemals Beweise hinterließ – und sein Job basierte darauf, dass er in der Lage war, überall ungesehen hinein- und wieder herauszukommen.
Er machte einen Schritt nach hinten, sah sich um und nahm alles in sich auf. Er hatte es nicht eilig. Tatsächlich genoss er sogar den Frieden in diesen Augenblicken, der nach dem Tod, aber vor dessen Entdeckung herrschte. Das war die perfekte Zeit. Dabei wurde ihm bewusst, dass er diesen Mord mehr genoss als den letzten. Vielleicht lag es daran, dass Marley den Tod verdient hatte. Oder er wurde einfach nur besser in dem, was er tat.
Er nahm das Wasserglas und drückte den Rand an Nats Unterlippe. Dann legte er Nats Hand darum, sodass sich die Fingerabdrücke gleichmäßig darauf befanden, und stellte das Glas dann auf einen Untersetzer vor die Leiche auf den Tisch. Er wollte, dass alles genau richtig aussah, wenn man Marley fand. Es musste natürlich wirken. Shylock wusste, dass das Gift, das er benutzt hatte, in Nats Körper nicht nachzuweisen war, und sein Plan war, dass die Polizei von einer natürlichen Todesursache ausging und nicht weiter nachforschte. Dennoch durfte es keine Hinweise darauf geben, dass er, Shylock, sich heute hier aufgehalten hatte. Nichts durfte ihn mit Marleys Tod in Verbindung bringen.
Er zog einen USB-Stick aus der Tasche und schloss ihn an Colm Monroes Desktopcomputer an. Dann klickte er auf das Symbol und installierte das einzige Programm, das sich auf dem Laufwerk befand. Es waren einige kleine, simple Codezeilen, die dem digitalen Aufräumteam Zugriff auf das Netzwerk verschaffen würden, damit es alle Beweise auf seine Anwesenheit hier verschwinden lassen konnte. Shylock vertraute diesen Leuten; sie hatten ihn noch nie im Stich gelassen.
Überwachungskameras, Zugangscodes, Protokolle über geöffnete Türen und aktivierte Sensoren … sein Team konnte alles aus der Ferne steuern. Solange es hier keine physikalischen Beweise gab, war er genauso unmöglich aufzuspüren wie das Gift, das Nat Marley getötet hatte.
Shylock schaute auf die Uhr. Er hatte noch zehn Minuten. Gut. Rasch holte er eine kleine Digitalkamera aus seiner Aktentasche und fotografierte das Glas, den Computer, Nats Leiche und schließlich die gesamte Szene von der Bürotür aus. Dann steckte er die Kamera wieder in seine Aktentasche, verschloss sie und wischte noch einmal alles ab. Zu guter Letzt richtete er Nats Krawatte und lächelte.
Seine Arbeit hier war erledigt. Es wurde Zeit, den nächsten Job in Angriff zu nehmen.
2.
Scott Mitchell hatte sich noch immer nicht an sein neues Alter Ego gewöhnt. Der Name »Phoenix« sollte seinen Aufstieg aus der Asche symbolisieren, aber er musste sich eingestehen, dass dieser Name nicht sonderlich passend war. Er kam ihm zu hochgestochen, zu feinsinnig vor, um zu seinem Selbstbild zu passen. Außerdem war »Strider« schon seit so langer Zeit sein Alter Ego, dass er dessen Ableben aufrichtig betrauerte. Strider war mächtig, sogar gefährlich gewesen und trat ebenso wie sein Namensgeber aus dem Herrn der Ringe entschlossen für eine gute Sache ein. Er war die perfekte Persönlichkeit gewesen für die Art von Arbeit, die Scott Mitchell im Schutz des Dark Web ausführte. In vieler Hinsicht hatte er sich als Strider wohler gefühlt, als er sich als der schlichte, langweilige Scott Mitchell je fühlen würde. Aber Strider hatte sterben müssen, damit Mitchell gerettet werden konnte. Jetzt musste Mitchell sich daran gewöhnen, ohne ihn zu leben.
Mit Strider hatte er sich sicher gefühlt, und er hatte seine üblichen Routinen gehabt. Tagsüber war er Scott Mitchell, der unauffällige Programmierkünstler und ehemalige kriminelle Hacker, der zur guten Seite übergewechselt war und jetzt für die NCCU als Berater arbeitete, die Cyber Crime Unit der National Crime Agency in London, die sich dem Kampf gegen Computerkriminalität verschrieben hatte. Es war die perfekte Tarnung für seine anderen Aktivitäten als Strider gewesen. Als Strider hatte er den »Code« erfunden und perfektioniert – eine Reihe von Regeln und Richtlinien, nach denen er lebte und arbeitete und an die sich seiner Meinung nach auch andere Menschen halten sollten. Wenn er bei seiner Arbeit für die NCCU herausfand, dass jemand gegen den Code verstoßen hatte und drauf und dran war, trotz seiner Verbrechen ungestraft davonzukommen, überließ er Strider das Feld, der für seine Art der Gerechtigkeit sorgte.
Unter Zuhilfenahme all der Werkzeuge, die ihm in seinem Arsenal zur Verfügung standen, brachte Strider dann geduldig alles über die Zielperson in Erfahrung, was es zu wissen gab. Er hackte ihr Handy, ihren Computer, ihr Haus, ihren Wagen, um dann zu beobachten, zu lernen und zu warten. Wenn der Staub sich gelegt hatte und der Betreffende schon glaubte, er wäre davongekommen, beobachtete Strider ihn weiter; er hörte erst damit auf, wenn er gefunden hatte, was er suchte. Und irgendwann fand er immer die Beweise sowie die Mittel und Wege, seine Zielperson zu beseitigen. Und jedes Mal sorgte er dafür, dass ihr Tod wie ein Unfall aussah.
Dummerweise war die Sache beim letzten Mal, als Strider zugeschlagen hatte, schiefgelaufen, und damit war auch er selbst am Ende gewesen. Er hatte damals versucht, einem Online-Pädophilenring, der sich »Teddybärs Picknicknetzwerk« nannte, das Handwerk zu legen und einige der aktiveren Mitglieder auszuschalten, dabei jedoch einen weiteren unheilvollen Plan vereitelt, bei dem es um Menschen- und Organhandel gegangen war. Als Strider erkannt hatte, dass sein eigener Mentor diesen Handel kontrollierte, war es längst zu spät gewesen, um sich noch zurückzuziehen. Gut, er hatte Mist gebaut, aber er hatte auch herausgefunden, dass sein Mentor ihn nicht nur verraten, sondern auch seinen Mord in Auftrag gegeben hatte. Ausgerechnet der Mann, der ihm die wunderbaren Möglichkeiten, die ihm ein Leben als Strider bieten konnte, überhaupt erst aufgezeigt hatte!
Striders ganze Welt war auf den Kopf gestellt worden. Es waren Veränderungen gewesen, denen er nicht nur seinen kostbaren Code, sondern auch sein ganzes Leben und sein Verständnis von allem, was zuvor gewesen war, anpassen musste. Und um selbst aus der Sache herauszukommen, hatte er eine Grenze überschreiten müssen: Er war gezwungen gewesen, das Leben Unschuldiger zu opfern, und er hatte sehr dicht davorgestanden, aufzufliegen.
»Phoenix« war insgesamt vorsichtiger als Strider, aber er war auch ein dunklerer Charakter. Der Code hatte sich verändert und enthielt nun einige graue Bereiche, die sich mit dem Selbsterhalt und mit Rache beschäftigten, und er wusste, dass er klüger sein musste, das Netz beim Beobachten des Ziels weiter aufspannen und sich mehr Zeit lassen musste, um nicht enttarnt zu werden. Phoenix handelte nicht so schnell und ging noch verstohlener und vorsichtiger zu Werke als sein Vorgänger. Mitchell hatte sich noch nicht an diese Stimme der Vernunft gewöhnt, die ihm riet, noch ein wenig zu warten. Er war sich auch nicht sicher, ob sie ihm wirklich gefiel. Beim letzten Mal hätte er um ein Haar das Leben verloren und wäre beinahe erwischt worden – was in vieler Hinsicht das schlimmere Schicksal gewesen wäre.
Nun saß er in der hintersten Ecke des Cafés und beobachtete sein Ziel, wobei er das Fenster als Spiegel benutzte. In diesem kleinen Café am Broadway an der 49. Straße herrschte eine freundliche, lebhafte Atmosphäre. Er war noch nie zuvor hier gewesen und hatte sich deshalb gefreut, als seine Zielperson wie erwartet in dieses Café gegangen war. An einem solchen Ort konnte man eine Stunde lang bei einem Kaffee sitzen, ohne dass jemand sich darüber aufregte.
In den sechs Monaten, die er dieser Zielperson über drei Kontinente und durch sechs Länder gefolgt war, hielten sie sich erst zum zweiten Mal im gleichen Raum auf. Man nannte es »direkten Zugang«, wenn ein Hacker vor Ort war, um den Hack durchzuführen. Er hatte so etwas immer schon ungern getan, weil man dabei viel zu anfällig war; jetzt, als Phoenix, der weitaus vorsichtiger agierte, fühlte er sich noch viel unwohler dabei. Allerdings hatte es auch etwas Reizvolles, insbesondere bei dieser Zielperson. Es war aufregend, seinem alten Erzfeind so nahe zu sein. Offenbar steckte immer noch einiges vom alten Strider in ihm. Außerdem wollte er heute nur zusehen und warten – er hatte keinen Hack geplant.
Bei dem Mann, den er da im Auge behielt, handelte es sich seiner Meinung nach um seinen ehemaligen Mentor, den »Salesman«. Er hatte sich als einer der mächtigsten Strippenzieher im Dark Web erwiesen, der auch darüber hinaus eine Menge Einfluss hatte. Es gab keine bedeutsame Branche oder Firma, in der er nicht eine gewisse Kontrolle ausübte: Der Salesman beschränkte sich nicht auf eine Online-Persönlichkeit oder einen Geschäftszweig, sondern beackerte ein viel weiteres Feld, wie Phoenix herausgefunden hatte.
Jedenfalls war Strider ihm in die Quere gekommen und hatte aus diesem Grund sterben müssen – jedenfalls dem Anschein nach. Für Scott Mitchell, den einstigen Strider und nunmehrigen Phoenix, war es vor allem wichtig, dass der Salesman glaubte, der Mann, der beim Schusswechsel mit dem von ihm angeheuerten Attentäter gestorben war, wäre tatsächlich Strider.
Soweit es den Salesman betraf, war diese kleine Episode abgeschlossen. Deshalb wusste er auch nicht, dass der Killer, den er mit erschaffen hatte, sich in diesem Augenblick hier aufhielt und es auf ihn abgesehen hatte, wenngleich er jetzt unter einem anderen Namen operierte. Phoenix fand es verwunderlich, dass der Salesman trotz seiner Macht so schlecht geschützt war. Er gehörte zu den wichtigsten Bossen innerhalb des organisierten Verbrechens in Europa, wenn nicht gar weltweit; dennoch saß er hier allein und anonym in einem kleinen lauten Café in Manhattan und benutzte das Gratis-WLAN. Doch hinter genau dieser Anonymität verbarg sich auch Phoenix. Online kannte man sie, doch in Fleisch und Blut waren sie so gut wie unsichtbar. Das galt sogar für einen so großen und mächtigen Verbrecher wie den Salesman.
Nach der letzten Wirtschaftskrise hatte das organisierte Verbrechen im Dark Web eine neue Heimat gefunden, einem Ort, an dem die Anonymität fast garantiert war und wo man Drogen, Waffen, Sex, sogar den Tod kaufen kann. Mithilfe von Tor oder I2P, anonymisierenden Netzwerken mit Tausenden von Peer-to-Peer-Zugängen, die den Aufenthaltsort und die Identität des Benutzers verschleierten, findet man, was immer das Herz begehrt, von Kokain bis zu Kreditkarten, von Pornografie bis hin zu Poppers. Es ist einfach, man muss dafür nicht aus dem Haus gehen, und wenn man sich nicht zu dumm anstellt oder verdammtes Pech hat, wird man auch nicht erwischt. Jede Facette menschlicher Verderbtheit ist dort in den subkutanen Datenschichten vertreten, die unterhalb des mit einem Browser aufrufbaren, teilbaren World Wide Webs existiert, das wir alle kennen und lieben. Natürlich geht es im Dark Web nicht nur um illegale Dinge, da diese Welt vor allem dazu gedacht ist, die Redefreiheit und völlige Anonymität zu gewährleisten, doch aus genau diesem Grund stellt sie auch die perfekte neue Heimat für das organisierte Verbrechen dar. Hier gibt es keine zwielichtigen Gestalten in Kapuzenpullis, die Jugendlichen an der Straßenecke Drogen verkaufen, keine Prostituierten, die immer wieder verhaftet werden, die Betriebskosten sind geringer, der Markt ist größer, und man wird nicht so leicht zur Verantwortung gezogen – im wahrsten Sinne des Wortes ein Idyll.
Was jedoch nicht heißt, dass es im Dark Web keine Polizei gibt. Zu Scott Mitchells Job bei der NCCU gehörte, jene aufzuspüren, die im Dark Web das Gesetz brachen – allerdings waren sie sehr viel schwerer zu finden, und man konnte ihnen ihre Schuld kaum nachweisen.
Phoenix konzentrierte sich darauf, die richtige Zeit und die passende Methode zu finden, um den Salesman zu vernichten, und er wusste, dass er dabei geduldig sein musste. Aber bloß weil er jetzt zu Phoenix geworden war, bedeutete das noch lange nicht, dass Striders Werk nicht beendet wurde. Er hatte eine seiner anderen, unwichtigeren, entbehrlichen Identitäten genutzt, um die letzten Überreste von Teddybärs Picknicknetzwerk aufzuspüren und zu eliminieren. Dabei hatte er darauf geachtet, keine von Striders Methoden einzusetzen, da der Salesman nicht merken durfte, dass er noch im Geschäft war. Diese letzten Angriffe mussten daher direkter vonstattengehen: Kneipenschlägereien, ein Überfall, ein Hausbrand. Er hatte alles in der realen Welt angesiedelt und es sogar genossen. Es gab ihm das Gefühl, einen Abschluss zu finden, da alle diese Leute irgendwie zu Striders Tod beigetragen hatten. Sie trugen die Schuld daran. Er brauchte den Code nicht, um das zu wissen.
Heute würde er den Letzten von ihnen beseitigen, dann war es endlich vorbei.
Er musterte den Salesman, der an einem Tisch am Fenster saß, allein und isoliert, während er wie wild auf die Tasten seines Laptops einhämmerte. Letzten Endes waren es die bemerkenswerte Isolation und die große Macht gewesen, die Phoenix auf seine mögliche Identität in der realen Welt gebracht hatten. Er war sich fast sicher, dass er den richtigen Mann vor sich hatte, doch selbst ein Funken Ungewissheit war ihm in diesem Fall schon zu viel. Phoenix musste seine Beweise doppelt und dreifach überprüfen, da er nur eine Chance zum Zuschlagen bekommen würde.
Er hatte in letzter Zeit sehr hart daran gearbeitet, die letzten Reste von Teddybärs Picknicknetzwerk auszuschalten, sodass der Salesman vorübergehend an die zweite Stelle getreten war. Er stellte ein langfristigeres Ziel dar. Der Salesman war ein komplizierter, verzwickter Charakter – man konnte ihm nicht nahekommen und durfte keine Fehler machen. Er hatte zu viele Verbindungen, und sein Tod würde sich an zu vielen Stellen bemerkbar machen, sowohl in der Unterwelt als auch in der Öffentlichkeit.
Das war auch einer der Gründe, die Phoenix daran hinderten, einfach an seinen Tisch zu gehen und den Mann an Ort und Stelle abzustechen. Der Untergang des Salesman musste perfekt und anonym sein; zugleich sollte er begreifen, dass er den Krieg verloren und dass Strider gewonnen hatte. Vielleicht konnte Strider danach wieder zum Leben erwachen. Bei diesem Gedanken musste Phoenix lächeln.
Er trank seinen Kaffee aus, ließ den Salesman dabei aber nicht aus den Augen. Phoenix hatte ihn sich imposanter vorgestellt; er war überrascht, dass der Mann so klein war. Aber er sah gut aus, hatte dunkle Haare und trug einen teuren Anzug, der eine gewisse Art von »Leg dich ja nicht mit mir an«-Macht ausstrahlte. Während er den Salesman beobachtete, überkam Phoenix das heftige Verlangen, sich ihm vorzustellen. Natürlich nicht richtig, aber er hätte gern irgendeinen flüchtigen Kontakt hergestellt, einen Moment gehabt, den er mitnehmen konnte, um in den dunklen Nächten darüber nachzudenken. Aber er durfte nicht all das aufs Spiel setzen, was er bereits erreicht hatte. Sein großer Plan war, nicht nur den Salesman zu vernichten, sondern auch dessen gesamtes Imperium. Das musste genau geplant werden. Phoenix war bewusst, wie riskant es war, hier zu sitzen, aber er hatte nicht widerstehen können. Das alles war Teil der Jagd, und er liebte es, seine Opfer zu hetzen.
Er rief die Kellnerin zu sich und bezahlte seinen Kaffee. Dann beglich er auch die Rechnung des Salesman. Die Kellnerin runzelte die Stirn, nahm das Geld jedoch entgegen. Auf dem Weg nach draußen ging Phoenix direkt am Tisch des Salesman vorbei, aber sein ehemaliger Mentor sah nicht einmal auf. Phoenix wusste, dass er durchdrehen würde, wenn er erfuhr, dass ein Fremder seinen Kaffee bezahlt hatte. Dann nämlich würde er wissen, dass er beobachtet worden war. Das war clever und gleichzeitig bedrohlich.
Allmählich begann Mitchell, diese Seite an Phoenix zu genießen.
Rebecca MacDonald streckte die Arme nach oben aus und dehnte ihre verspannten Muskeln. Sie hatte viel zu lange am Schreibtisch gesessen. Wieder mal. Eigentlich konnte sie sich nicht einmal mehr daran erinnern, wann sie das letzte Mal zu einer vernünftigen Uhrzeit Feierabend gemacht hatte. Wahrscheinlich in ihrer ersten Arbeitswoche bei der NCCU, für die sie jetzt seit über sechs Monaten arbeitete. Es gefiel Rebecca, ständig herausgefordert zu werden, aber es war eine völlig andere Art Arbeit als auf dem privaten Sektor, aus dem sie gekommen war. Einerseits verdiente sie nur etwa halb so viel wie bei PrinceSec, dem Privatunternehmen, das Sicherheitssoftware herstellte und das sie an die NCCU abgestellt hatte, um den Mord an ihrem ehemaligen Chef aufzuklären. Andererseits arbeitete sie deutlich länger, und die Deadlines waren kürzer. Außerdem bekam sie eine viel dunklere, bedrohlichere Seite der Menschheit zu sehen. Aber aus irgendeinem Grund war sie hier glücklicher.
Nachdem sie zur NCCU gewechselt war, musste sie sich mit Kriminellen, Terroristen und Aktivisten aller möglichen Lager auseinandersetzen. Darunter waren vom Staat finanzierte sogenannte Cyberkrieger, die nationale Kraftwerke infiltrierten, Hackergangs, die es auf Geldautomaten abgesehen hatten, bis hin zu heimtückischen Idioten, die die Feeds von Babyfonen anzapften, um den ahnungslosen Eltern einen Schreck einzujagen.
Rebecca war sich nicht sicher, ob sie tatsächlich an vorderster Front des angeblichen Cyberkriegs stand, aber sie kannte die Kräfte, die dieses Land bedrohten, jetzt weitaus besser als zuvor. Es stimmte, dass gewisse Elitehacker raffinierte, schwer aufzuspürende Methoden fanden, um Regierungen, Unternehmen oder Banken lahmzulegen, doch innerhalb der NCCU und ähnlicher Einrichtungen in den USA und in Europa war man der Meinung, dass letzten Endes die Guten siegen würden.
Rebecca hatte keine Probleme gehabt, sich in das NCCU-Team zu integrieren. Sie hatte beim vorherigen Fall bereits eng mit diesen Leuten zusammengearbeitet – ein Fall, der mit dem Tod ihres ehemaligen Chefs bei einem Flugzeugabsturz begonnen und damit geendet hatte, dass ein Menschenhändlerring, der im ganzen Land operierte, aufgedeckt und zerschlagen wurde. Die NCCA hatte aufgrund aufgeflogener Korruptionsfälle selbst personelle Einbußen hinnehmen müssen, aber Rebecca hatte bewiesen, dass sie bereit war, für diesen Job ihr Leben zu riskieren – und das, obwohl sie noch nicht einmal richtig dazugehörte. Ihr neuer Chef, der stets mürrische, kompromisslose Abteilungsleiter Oscar Franklin, hatte sie speziell für sein Team angefordert, da man den Menschenhändlern dank Rebeccas Arbeit das Handwerk legen konnte. Sie hingegen war der Meinung, dass es vor allem ihrem Freund und Verbündeten Scott Mitchell zu verdanken war, der die meiste Arbeit gemacht hatte.
Aber es war sein letzter Fall für die NCCU gewesen; er hatte direkt nach dessen Abschluss wieder sein Leben als Freischaffender aufgenommen. Das war aber auch das Einzige, was Rebecca an ihrer neuen Situation bedauerte: dass sie nicht die Gelegenheit bekommen hatte, mit Mitchell bei der NCCU richtig zusammenzuarbeiten. Zumal sie wusste, dass ihm der Fall, an dem sie gerade saß, gefallen hätte.
Nach Mitchells Ausscheiden aus der NCCU hatte Rebecca versucht, mit ihm in Verbindung zu bleiben, indem sie sich hin und wieder per Online-Chat austauschten, aber Rebecca hatte häufig das Gefühl, dass sie mehr in diese Beziehung hineininterpretierte, als vorhanden war. Sie beide hatten gemeinsam ein dramatisches, lebensbedrohliches Ereignis durchgestanden und beide überlebt, während andere gestorben waren. Rebecca hatte gehofft, dass dadurch eine engere Verbindung zwischen ihnen entstehen würde, aber Mitchell war Einzelgänger, und wenn sie ehrlich zu sich selbst war, musste sie sich eingestehen, dass sie absolut nichts über sein Privatleben wusste. Sie hatten nur ein paar Mal miteinander gesprochen, nachdem er ihr das Leben gerettet hatte; dabei hatte sie jedes Mal den Eindruck gehabt, dass bei diesen Unterhaltungen irgendetwas fehlte. Aber ihr war auch klar, dass sie in dem aktuellen Fall vermutlich viel weiter wären, würde Mitchell noch immer hier arbeiten.