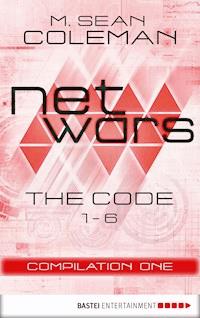3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Alex Ripley
- Sprache: Deutsch
Visionen. Alte Sünden. Angst und Rache: Eine Welle von Teenager-Selbstmorden erschüttert Kirkdale im Norden Englands. Gleichzeitig machen in dem kleinen Städtchen Gerüchte die Runde, die Teenager hätten vor ihrem Tod einen Engel gesehen. Die Polizei ist ratlos und bittet Dr. Alex Ripley um Hilfe. Die Expertin für Übersinnliches beginnt zu ermitteln und kommt einer jahrzehntelangen Tragödie auf die Spur - und schon bald schlägt ihr der geballte Hass der gesamten Stadt entgegen. Doch Ripley wird nicht eher ruhen, bis sie die ganze Wahrheit aufgedeckt hat ...
"Der Ruf der toten Mädchen" ist der Auftakt zu einer neuen Reihe um die faszinierende Ermittlerin Dr. Alex Ripley.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Samantha Jaynes war die Erste, die starb. Rosie Trimble war die Nächste.
Eine Welle von Teenager-Selbstmorden erschüttert Kirkdale, eine ländliche Gemeinde im englischen Lake District. In den Tagen vor ihrem Tod sprachen beide Mädchen davon, einen Engel gesehen zu haben. Die Polizei ist ratlos und bittet Dr. Alex Ripley um Hilfe, deren Spezialgebiet die Erklärung übersinnlicher Erscheinungen ist. Ripley soll herausfinden, was hinter den Engelssichtungen steckt und was sie mit dem Tod der Mädchen zu tun hatten. Haben sie halluziniert? Oder sind sie wirklich einem himmlischen Phänomen begegnet?
Visionen. Alte Sünden. Angst, Rache und Verdacht: Ripley deckt eine jahrzehntelange Tragödie auf, und je tiefer sie gräbt, desto mehr Feindseligkeit schlägt ihr von den geradezu fanatisch frommen Bewohnern Kirkdales entgegen. Sie alle sind so tief in die Geheimnisse dieses Ortes verstrickt, dass nur noch wenige wissen, wem sie noch vertrauen können. Abgesehen von Gott selbst.
Gibt es hier einen göttlichen Einfluss oder eine weitaus unheimlichere Kraft? Ripley wird, wie die toten Mädchen, nicht ruhen, bis die Wahrheit raus ist.
»Der Ruf der toten Mädchen« ist der Auftakt zu einer neuen Reihe um die faszinierende Dr. Alex Ripley.
Über den Autor
M. Sean Coleman begann seine schriftstellerische Laufbahn als Scriptwriter für »Hitchhikers Guide to the Galaxy (Per Anhalter durch die Galaxis) Online“(h2g2.com). Seitdem hat er Shows für MSN, O2, Sony Pictures International, Fox, die BBC und Channel 4 geschrieben und produziert, für die er mehrfach mit Preisen ausgezeichnet wurde. Er wohnt in London und schreibt Romane, Graphic Novels und Drehbücher.
M. SEAN COLEMAN
DER RUF DER TOTEN MÄDCHEN
Ein Alex-Ripley-Thriller
Aus dem Englischen von Kerstin Fricke
beTHRILLED
Deutsche Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by M. Sean Coleman
Titel der britischen Originalausgabe: »The Cuckoo Wood«
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Arno Hoven
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © shutterstock: kasha_malasha | andreiuc88
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-5389-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.
Offenbarung 21,8
KAPITEL 1
Am Vorabend des Mittsommertages – 20. Juni
Die Mädchen standen einfach nur am steinigen Ufer und sahen zu, wie sie ertrank. Sie waren nicht ihre Freundinnen – nicht wirklich. Das war ihr jetzt klar geworden. Der orangefarbene Schein des flackernden Lagerfeuers spiegelte sich auf der Oberfläche des Wassers wider, das direkt um sie herum in wildem Aufruhr war. Eine schwarze Rauchwolke stieg gen Himmel empor. Sie hätten nicht in den Cuckoo Wood kommen sollen. Nun bereute sie es, den anderen vom Engel erzählt zu haben. Sie hatten ihr nicht glauben wollen. Aber warum war er nicht erschienen?
Sie schlug verzweifelt mit den Armen um sich und versuchte, sich durch das Wasser zurück ans Ufer zu bewegen, aber es klappte nicht. Wenn sie doch nur nicht so erschöpft wäre! Es war dumm gewesen, etwas zu trinken. Sie hatte gewusst, dass sie das nicht tun sollte, und dennoch mehrmals einen Schluck genommen. Nun schien der ungewohnte Alkohol sie nach unten zu ziehen, und das Wasser schloss sich um sie, als würden Hände nach ihren Armen und Beinen greifen und sie in die Tiefe zerren. Auf einmal war sie davon überzeugt, dass sie in dieser Nacht sterben würde – hier in dem kalten, dunklen See.
Erneut ging sie unter, schluckte Wasser, das in ihre Luftröhre drang, und bekam keine Luft mehr. Hustend und spuckend kam ihr Kopf wieder an die Oberfläche. Sie versuchte, Sauerstoff in ihre schmerzende Lunge zu bekommen, doch es half nichts; sie konnte einfach nicht mehr atmen. Der See hatte bereits gewonnen.
Während die Welt ihr mehr und mehr entglitt, sah sie, wie er aus dem Wald kam und hinter den anderen Mädchen das Ufer betrat. Der Kirkdale-Engel. Er war also doch gekommen. Aber es war zu spät. Jedenfalls zu spät, um ihr zu helfen. Sie bedauerte es, jemals mit alldem angefangen zu haben. Sie wünschte sich, niemals von dem Engel erfahren zu haben – und dass sie jemandem sagen könnte, was sie wusste. Doch es war zu spät.
Samantha Jaynes hörte auf, um sich zu schlagen, und ließ sich vom Wasser nach unten ziehen. In diesen letzten, flüchtigen Sekunden, bevor sie das Bewusstsein verlor, glaubte sie, eine Hand zu spüren, die die ihre ergriff und sanft und beruhigend drückte. Alles würde wieder gut werden. Sie war nicht allein. Ihr Engel war bei ihr.
KAPITEL 2
29. Oktober
Das lange Gras war taufeucht und haftete kalt und klamm an ihren nackten Füßen, wo es ihre Haut betäubte, auf der die Brennnesseln Quaddeln und die Dornen Risse hinterlassen hatten. Eisiger Schlamm quoll bei jedem Schritt zwischen ihren Zehen hervor, als wollte die Erde sie an sich ziehen und sie leiten. Auch er befand sich heute Abend im Wald; man hatte ihn gesehen. Vielleicht würden sie ihn dieses Mal erwischen.
Der Vollmond schickte silberne Lichtstrahlen durch das im Herbst dünner werdende Blätterdach der Bäume, wann immer er zwischen den schweren dunklen Wolken hervorlugte. Rosie schob einen Ast beiseite und ließ ihn hinter sich zurückschnellen, als sie weiter in das trübe Zwielicht hineinrannte. Die Büsche schienen näher an sie heranzurücken, ihr den Weg zu versperren und die Lichter vom Dorf am Hang des Hügels zu verschlucken.
Spitze Dornen bohrten sich in ihre Haut und hinterließen winzige scharlachrote Punkte auf ihren weißen Armen. Sie spürte die Kratzer nicht. Und sie spürte die Kälte nicht. Sie merkte auch nicht, dass ihre Zähne klapperten oder dass ihr kurzes Baumwollkleid feucht und zerrissen an ihrem Körper klebte. Für sie gab es nichts außer der Stimme in ihrem Inneren, die wie ein tiefer Bass durch sie hindurchdröhnte, ihre Organe erschütterte, im Gleichtakt mit ihrem Herzen ertönte und sie ganz erfüllte. Die von ihr Besitz ergriff. Sie lief schneller. Ihr Herzschlag beschleunigte sich, ihre Atmung wurde abgehackter. Sie war ganz in der Nähe.
Beim Überqueren des flachen Bachs rutschte sie aus und landete mit den Knien auf den Steinen. Ihre Finger kratzten über das schlammige Ufer, und sie brach sich die ordentlich manikürten Fingernägel ab. Dann wischte sie sich mit den Händen durch das Gesicht, über den Hals und die Brust, verteilte den Matsch auf ihrer Haut und beschmutzte ihr Kleid. Dabei lachte sie wild, denn sie war jetzt ein Teil der Erde.
Grelles Licht blitzte vor ihr auf und glänzte heller als der Mond zwischen den Bäumen. Der Engel. Zeigte er ihr den Weg? Hoch oben am Himmel grollte der Donner, der im Wald widerhallte und ihn beben ließ. Regen prasselte rings um sie herum auf den Boden. Herbstlich verfärbte Blätter tanzten, wirbelten herum und glänzten silbern im Mondlicht. Es war jetzt nicht mehr weit. Aber sie musste sich beeilen. Sie durfte nicht noch mehr hinter die anderen zurückfallen.
Rasch kletterte sie die glitschige Uferböschung hinauf, rannte durch das Unterholz und stolperte über Wurzeln. Sie folgte dem Licht, das ihr voraustanzte, wurde angezogen von dem Rufen und dem Lachen ihrer Freundinnen. Endlich kam sie atemlos und zitternd am Waldrand an und trat auf die Lichtung hinaus. Sie hatte es geschafft! Aber das Licht war verschwunden, und der Donner ließ bereits nach. Kam sie etwa zu spät? Sie war so müde.
Zaghaft ging sie weiter und schloss sich den anderen auf der Lichtung an, die lachend und kreischend ums Feuer tanzten. Die weiße Haut ihrer Freundinnen schimmerte im blassen Licht, als sie die Kleider ablegten und neben den Flammen auf den Boden warfen. Der Feuerschein loderte hell und schmerzhaft in ihren Augen.
Sie fing an zu singen, erst ganz leise, und das alte Lied ging ihr wie Honig über die Zunge. Schon bald hörte sie, wie die anderen mit einfielen, wie sie mit hohen, süßen Stimmen zusammen mit ihr den Ruf anstimmten. Sie riefen den Engel, so wie Sam es ihnen gezeigt hatte. Sie würden Vergebung finden.
Erneut überkam sie die Erschöpfung. Sie geriet ins Stolpern und fiel auf die Knie. Nur ein bisschen sitzen; das war alles, was sie brauchte. Während es vor ihren Augen immer dunkler wurde, sah sie, dass Caitlin ebenfalls stürzte und unsanft auf dem nackten Hintern landete wie eine Marionette, deren Fäden durchgeschnitten worden waren. Caitlin ließ sich lachend auf den Rücken fallen, lag anschließend mit ausgebreiteten Armen auf dem Boden und starrte in den Himmel. Das ist eine gute Idee, dachte Rosie. Sich hinlegen und auf den Engel warten. Er würde kommen. Sie schloss die Augen, und sämtliche Geräusche verstummten.
Irgendwo in der Dunkelheit rief die Engelsstimme ihren Namen, ganz tief und leise – kaum lauter als ein Flüstern. Dann waren Hände unter ihrem Rücken und hoben sie hoch. Sie schlug die Augen auf, weil sie sehen wollte, wer da war. Aber am Rand ihres Blickfelds war alles dunkel, und sie erkannte nichts außer einem Flügel aus Federn – so weiß, so wunderschön –, der sie in eine warme Umarmung hüllte und sie forttrug. Ihr war vergeben worden.
Rings um sie herum war ein Klagelied zu vernehmen, das zwischen den Bäumen hallte. Es schwoll immer wieder an, um dann leiser zu werden, und erinnerte sie an etwas, aber ihr wollte nicht einfallen, an was. Der Gesang schien von überall und zugleich von nirgendwo her zu kommen. Aus der Nähe und aus der Ferne. Vielleicht war es ein Engelschor. Mit der Brise, die das Lied zu ihr herübertrug, drangen auch andere Stimmen an ihr Ohr, die ihren Namen riefen und aus weiter Ferne kamen.
Etwas Vergleichbares hatte sie noch nie zuvor gehört: ein Lied, das gleichzeitig unglaubliche Schönheit und quälenden Schmerz vermittelte. Es wirbelte um sie herum, packte sie, dröhnte in ihren Ohren. Ein tiefer, animalischer Teil von ihr wollte auf die Stimmen zulaufen, aber das konnte sie nicht, denn sie schwebte.
Ihre Füße und Hände waren kalt. Sie froren förmlich ein. Eine Eiseskälte kroch über ihre Haut, ihren Rücken, ihren Bauch, sodass sie schließlich aufkeuchte und zusammenzuckte. Und dann begriff sie, dass sie im See trieb. Ein schweres Gewicht drückte auf ihre Schultern: die drückendste aller liebevollen Umarmungen. Trotz der Eiseskälte fühlte sie sich endlich sicher, geliebt, ganz – größer sogar als sonst. Dies war ihre Zeit.
Das Wasser schloss sich um sie, drang ihr in Nase und Mund, füllte ihre Lunge. Ihre Stimme stieg in ihrer Kehle auf und wollte in den klagenden Chor mit einfallen, begierig darauf, Teil von etwas Wichtigem zu sein. Aber ihr Lied wurde rasch vom See ertränkt. Mit einem Mal machte sich Panik in ihr breit, als ihr Körper sich an das Leben zu klammern versuchte. Doch es war zu spät.
Während ihr Lebenslicht sie verließ und sie allein im kalten schwarzen Wasser trieb, hörte Rosie die Stimme ihrer Mutter unter den anderen, die ihren Namen riefen und sie im Wald suchten, während die heulenden Sirenen der Streifen- und Krankenwagen durch die Luft hallten. Es war zu spät, um zurückzugehen. Zu spät, um zuzugeben, was sie getan hatte. Was sie alle getan hatten. Es war einfach zu spät.
Da waren kein ewiges Licht, keine warme Umarmung und auch kein Engel, der ihr beim Aufstieg die Hand hielt. Keine ihrer Freundinnen war zurückgeblieben, um sie auf ihrem Weg zu begleiten. Der Engel war fort, ihre Freundinnen waren verschwunden. Nur noch die Dunkelheit war Rosie geblieben. Und dann – nichts.
KAPITEL 3
PC Daniel Cotter rannte durch das dichte Unterholz, so schnell ihn seine Beine trugen. Der Police Constable sprang über heruntergefallene Äste und brach sich einfach durch die Zweige hindurch einen Weg. Dornenbüsche rissen an seiner Hose und kratzten ihn im Gesicht. Aber er achtete nicht darauf. Er hatte einen Schrei gehört. Und er hätte schwören können, dass er aus Richtung des Brathigg Tarn gekommen war. Während er auf den kleinen See zurannte, spitzte er die Ohren, um trotz des Regens, der auf das Blätterdach des Waldes laut herniederprasselte, mögliche weitere Schreie hören zu können.
Dabei ärgerte er sich darüber, dass Rosies Eltern das Verschwinden ihrer Tochter nicht sofort gemeldet, sondern sich erst selbst auf die Suche gemacht hatten. Er wusste, dass sie das Verhalten ihrer Tochter lieber unter den Tisch gekehrt hätten. Dennoch machte es ihn wütend, dass für sie der Ruf der Familie offenbar wichtiger gewesen war als die Sicherheit des eigenen Kindes. Nun konnte er nur noch hoffen, dass sie das Mädchen rechtzeitig finden würden.
Sein bester Freund Luke – Rosies Bruder – hatte den Vorfall schließlich gemeldet. Cotter wusste, dass Luke seinen Eltern niemals vergeben würde, wenn seiner Schwester etwas zugestoßen sein sollte. Obwohl Luke fast zehn Jahre älter war als Rosie, hatte er sich stets leidenschaftlich bemüht, sie vor allen Widrigkeiten zu beschützen, und sie auch häufig vor den übertriebenen religiösen Ansichten ihrer Eltern bewahrt. Er wäre am Boden zerstört, sollte sich Rosie etwas angetan haben.
Der Himmel wurde bereits ein wenig heller, obwohl der Tag erst in einigen Stunden anbrach. Cotter hoffte, dass Rosie Trimble dann noch leben würde und sehen könnte, wie die Sonne aufging. Andere Stimmen riefen rings um ihn herum ebenfalls ihren Namen: »Rosie! Rosie?« Es klang wie ein unheimliches, sich ständig wiederholendes Echo.
Das ganze Dorf beteiligte sich an der Suche, auch Rosies Eltern, obwohl Cotter ihnen geraten hatte, lieber zu Hause zu bleiben. Wenn er an den entsetzlichen Zustand dachte, in dem sie das letzte Mädchen gefunden hatte, wollte er auf keinen Fall, dass jemand aus Rosies Familie oder Freundeskreis sie als Erster fand. Er hoffte sehr, dass er sich irrte und sie sich einfach mit einem Jungen fortgeschlichen hatte. Allerdings hatte Luke ihm bereits berichtet, dass sie sich in letzter Zeit extrem verändert hatte. Bitte mach, dass ihr nichts passiert ist, flehte er innerlich.
Er überquerte den Bach mit einem gewaltigen Satz, rutschte aus und stolperte auf der anderen Seite die flache, schlammige Uferböschung hinauf, wobei er die Finger zu Hilfe nahm und sie in die weiche Erde krallte, um rascher nach oben zu gelangen. Nachdem er die Lichtung überquert hatte, rannte er zwischen den Bäumen hindurch zum Seeufer. Dort blieb er heftig keuchend stehen. Ihm drehte sich der Magen um.
»Rosie! Rosie? Rosie …« Das Stakkato der Stimmen hallte um ihn herum durch die Luft.
Da! Dort war sie. Sie trieb mit dem Gesicht nach unten im Wasser, nicht weit vom Ufer entfernt, und war splitterfasernackt. Ihr dunkles Haar hatte sich auf dem Wasser ausgebreitet, und ihre Arme schwankten leicht, als wären sie Seegras.
»Rosie!«, brüllte Cotter und rannte in den See, aber sie rührte sich nicht. »Großer Gott, nein! Rosie!«
Er stand hüfttief im Wasser, als er sie erreichte, und die Kälte raubte ihm den Atem und ließ ihn aufkeuchen. Sofort packte er ihren Arm, zog sie an sich und schleppte sie rückwärtsgehend in Richtung Ufer.
»Komm schon, Rosie!«, schrie er verzweifelt. »Jetzt bist du in Sicherheit, Mädchen. Komm schon! Alles wird wieder gut!«
Er schob die Hände unter ihre Achseln, griff fest zu und zerrte Rosie ans Ufer. Da er ihr volles Gewicht tragen musste, geriet er ins Stolpern und fiel hin.
»Hilfe!«, rief er. »Hier drüben! Ich habe sie gefunden. Helft mir bitte!«
Er legte sie auf den Rücken und begann mit den Wiederbelebungsmaßnahmen; rhythmisch drückte er ihr auf den Brustkorb und hielt immer nur kurz für die Mund-zu-Mund-Beatmung inne. Ihre Lippen waren blau angelaufen, und ihre Haut fühlte sich eiskalt an.
»Komm schon, Rosie!«, flüsterte er verzweifelt. »Bleib bei mir!« Schritte kamen über die Steine hinter ihm näher, und als er über die Schulter blickte, sah er einen Rettungssanitäter am Ufer entlang auf sie beide zulaufen.
»Hilfe!«, schrie Cotter erneut und drückte panisch auf Rosies Brust.
Er hörte erst mit seinen Bemühungen auf, als sich der Sanitäter neben ihn kniete und ihm eine Hand auf die Schulter legte.
»Ich übernehme jetzt«, erklärte der Mann, und Cotter hielt inne, bewegte sich jedoch nicht.
Der Sanitäter überprüfte eine gefühlte Ewigkeit ihren Puls, bevor er sich zu Cotter umdrehte.
»Sie ist tot, Dan«, sagte er leise.
Tief in seinem Inneren wusste PC Daniel Cotter, dass der Mann recht hatte. Dennoch brauchte er einen Moment, bis er die Hände von Rosies Brust nehmen und es sich eingestehen konnte. Er sank auf seinen Knien nach hinten: erschöpft, durchgefroren, besiegt. Rosie Trimble war tot. Das zweite Mädchen aus dem Dorf hatte innerhalb von etwas mehr als vier Monaten in diesem See Selbstmord begangen.
KAPITEL 4
Dr. Alex Ripley stellte ihr klingelndes Handy rasch auf »Stumm« und ließ es wieder in ihrer Handtasche verschwinden. Sie kannte die Nummer nicht und hatte jetzt keine Zeit, um mit Reportern zu sprechen, die sofort irgendeinen druckreifen Kommentar von ihr hören wollten.
»Entschuldigung«, sagte sie zu dem Visagisten, der sich erneut über sie beugte.
»Kein Problem, meine Liebe«, erwiderte er. »Besser, so was passiert hier als live auf Sendung.«
»Das stimmt.« Sie lächelte ihn an. »Ich lasse es lieber bei Ihnen, wenn Sie nichts dagegen haben.«
Sie war eh schon nervös genug, weil sie im nationalen Fernsehen auftreten würde, und hatte keine Lust, sich zu blamieren, indem sie vergaß, ihr Handy auszuschalten. Zwar war dies bei Weitem nicht ihr erster Liveauftritt, aber sie bekam trotzdem noch jedes Mal Lampenfieber.
Als renommierte Skeptikerin, die darauf spezialisiert war, vermeintliche Wunder, übernatürliche oder sogar göttliche Erscheinungen von einem wissenschaftlichen und vernünftigen Standpunkt aus zu untersuchen, wurde Alex häufig hinzugezogen, wenn sich sensationssüchtige Medien mit Glaubensfragen beschäftigten und man dabei noch eine rationale Stimme benötigte.
Sie sollte gleich an einer Talkshow teilnehmen, die jeden Sonntagvormittag gesendet wurde, und »Wunderheilungen« war das Thema der heutigen Diskussionsrunde. Freiwillig hätte sie sich eine solche Sendung niemals angesehen. Sie konnte diese absichtlich polarisierenden Shows nicht leiden, bei denen sich das Publikum mit wütend herausgeschrienen Meinungen einmischte und die Gastredner nur eingeladen wurden, um der Menge die schlimmsten Reaktionen zu entlocken. Nichts als Sensationsgeilheit! Aber sie musste Werbung für ihr Buch machen, in dem es zufälligerweise um Wunderheilungen ging, und daher freute sie sich auf die Gelegenheit, bei einer Livesendung einige Mythen und Missverständnisse scharf zu kritisieren.
Sie wusste, dass sie sich bei einer Diskussion über dieses Thema behaupten konnte, ungeachtet dessen, was man ihr so alles an den Kopf warf. Ihre Bücher gingen immer einigen Menschen gegen den Strich, und das würde bei diesem auch nicht anders sein. Die Menschen wurden oft wütend, wenn man das, woran sie glaubten, infrage stellte, und genau das war schließlich Dr. Alex Ripleys Spezialität. Sie konnte diese Diskussionsrunde durchaus als eine Art Zielgruppenforschung betrachten.
Der Talkmaster hatte sie bei ihrer Ankunft begrüßt und ihr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie sich nicht zurückhalten musste. Im Privatleben war er ein intelligenter Mann, doch vor der Kamera mutierte er zu einem dieser Moderatoren, die ihre Gäste gern aufstachelten. Er machte dreiste, dramatische Aussagen, verstand Antworten absichtlich falsch und provozierte bei jeder sich bietenden Gelegenheit heftige Auseinandersetzungen. Das machte gutes Fernsehen schließlich aus.
Außerdem hatte er ihr vergnügt mitgeteilt, dass es sich bei einem der anderen Gäste an diesem Morgen um Reverend Bobby Swales handelte – einen der zahlreichen selbst ernannten Heiler, für die sie schon in den ersten Kapiteln ihres Buches deutliche Worte gefunden hatte. Das Wiedersehen mit ihm bereitete ihr jedoch kein Kopfzerbrechen, da es für ihn höchstwahrscheinlich unangenehmer sein würde als für sie.
Schließlich wusste er, dass sie ihn durchschaut hatte. Und sie war überzeugt davon, dass sie ihn in einer Debatte in die Tasche stecken würde. Zwar war er zugegebenermaßen gut darin, die Bibel so auszulegen, wie er es gerade brauchen konnte, und er vermochte sich auf eine charismatische Weise in Szene zu setzen, aber es war ihm nicht einen Moment lang gelungen, Alex zu täuschen. Ihrer Meinung nach war er ein zynischer, egoistischer Mann, der die Schwachen und Verzweifelten ausnutzte und ihnen falsche Hoffnung schenkte, um sich die Taschen zu füllen.
An sich hatte Alex nichts gegen den Glauben oder die Religion, auch nichts gegen Menschen, die bestimmte Ansichten vertraten. Es war eher das Gegenteil der Fall: Sie träumte davon, etwas zu finden, das ihre große Sehnsucht stillen konnte, an eine höhere Macht zu glauben. Alex konnte es allerdings nicht leiden, wenn man sich hinter der Religion versteckte, um grausame, gemeine, egoistische oder, und das waren die schlimmsten, dumme Taten zu rechtfertigen. Wenn jemand andere im Namen irgendeines Gottes betrog, machte es sich Alex zu ihrer Mission, diese Person, ungeachtet ihrer Position oder ihres Rufes, öffentlich bloßzustellen.
Sie wurde häufig als professioneller Advocatus Diaboli eingesetzt, um vermeintliche Wunder mithilfe von Logik und Wissenschaft zu widerlegen. Im Laufe der Jahre war sie von Gruppierungen beider Seiten um Unterstützung gebeten worden, und sie gehörte zu den wenigen Experten auf diesem Fachgebiet, die dafür anerkannt waren, dass sie keine anderen Ziele verfolgten, als die Wahrheit ans Licht zu bringen. Falls Dr. Alex Ripley, so wurde gemunkelt, jemals etwas als Wunder bezeichnen sollte, dann hatte man tatsächlich eines. Was das anbelangte, war sie jedoch bislang auf nichts gestoßen, das sie wirklich überzeugt hätte. Dies lag freilich nicht daran, dass sie sich zu wenig bemüht hatte, nach so etwas zu suchen.
Bisher waren drei Bücher über verschiedene Aspekte von Wundern aus ihrer Feder erschienen, und jedes hatte für genug Kontroversen gesorgt, um sie in den entsprechenden Kreisen ziemlich bekannt zu machen. Sämtliche Nachforschungen von ihr hatten zu demselben Resultat geführt: Das angebliche Wunder war gar keines. Sie hatte es noch jedes Mal geschafft, eine rationale Erklärung für die Heilungen, die weinenden Statuen, die göttlichen Erscheinungen, die Stigmata, die Visionen und sogar für die mysteriösen Stimmen zu finden.
Dabei war es jedoch nicht bei allen Fällen so, dass jemand diese vermeintlichen Wunder absichtlich und zu betrügerischen Zwecken arrangiert hatte. Vielmehr waren manche Menschen ob ihres unerschütterlichen Glaubens schlichtweg blind für die Wahrheit. Allerdings gab es hin und wieder auch Vorkommnisse, für die sich weder eine rationale Erklärung noch Beweise für ein göttliches Eingreifen finden ließen.
Letzten Endes gab es eben nicht nur Schwarz oder Weiß. Und auch wenn sie ihre Ergebnisse noch so vorsichtig formulierte, wusste Alex, dass sie entweder jemanden der Lüge oder zumindest der Naivität beschuldigte. Sie hatte schnell gelernt, mit dem unausweichlichen Zorn und der Kritik zu leben, die mit ihrer Tätigkeit einhergingen.
Verwirrte oder enttäuschte Gläubige hatten sie in all der Zeit der Profitgier, der Heuchelei, der Teufelsanbetung oder des mangelnden Glaubens bezichtigt, weil es ihr immer wieder gelang, eine Erklärung für gewisse Phänomene zu finden. Die meisten Anschuldigungen prallten einfach von ihr ab, aber manchmal überkam sie das Gefühl, der einzige klar denkende und rationale Mensch in einer Welt voller irregeleiteter Fanatiker zu sein.
In letzter Zeit arbeitete sie nur noch an komplexeren Fällen oder an solchen, für die sich die Öffentlichkeit interessierte. Unabhängig von allen anderen Faktoren schienen alle Vorkommnisse auf derselben Grundlage zu beruhen: Die Leute wollten unbedingt daran glauben. Ihnen gefiel die Vorstellung, dass sie auserwählt worden waren, eine besondere Gabe zu erhalten, oder wenigstens letztendlich den Beweis dafür bekommen hatten, dass das Leben nicht nur aus dem Hier und Jetzt bestand.
Ihr letztes Werk war ebenfalls ein Enthüllungsbuch. Sie hatte insgesamt zwei Jahre für die Nachforschungen und das Schreiben gebraucht und sich im Laufe dieser Recherchen einige Feinde gemacht, von jenen an der Spitze der katholischen Kirche bis hinunter zu den verärgerten Scharlatanen, die begriffen hatten, dass ihr Goldesel gerade öffentlich geschlachtet worden war. Reverend Bobby Swales fiel in die letzte Kategorie, was vermutlich auch erklärte, warum man ihn in die heutige Sendung eingeladen hatte. Er brachte zweifellos einige seiner getreuen Anhänger mit, die seine wilden Behauptungen unterstützen sollten.
Dabei hatte Alex ursprünglich gar nicht über Wunderheilungen schreiben wollen. Eigentlich war dies ein Thema, dem sie lieber aus dem Weg ging, weil bei dieser Art von Phänomen so viele nicht genau bestimmbare Faktoren vorlagen. Im Grunde genommen ließ sich keine eindeutige Aussage darüber treffen, was genau geschehen war und ob ein Wunder stattgefunden hatte. Aber sobald sie begonnen hatte, an der Oberfläche zu kratzen, war sie auf immer mehr Fälle von Menschen gestoßen, die tatsächlich glaubten, von Gott geheilt worden zu sein.
Während ihrer Nachforschungen war sie mit dem Vatikan wegen der Wunderheilungen, die Papst Johannes Paul II. zugeschrieben wurden, in Konflikt gekommen, was zu einem andauernden Streit über die Vorgaben für eine Heiligsprechung geführt hatte. Ferner liefen Verleumdungsklagen von drei Heilern gegen sie, allerdings ging sie davon aus, zwei dieser Prozesse auf jeden Fall zu gewinnen.
Man hatte ihr ins Gesicht geschlagen, sodass jetzt eine kleine Narbe über ihrem rechten Auge prangte, nachdem ein besonders verärgerter Heiler nicht hatte an sich halten können – was durchaus nicht einer gewissen Ironie entbehrte. Sie hatte Morddrohungen erhalten, Bestechungsversuche zurückgewiesen, und ihr war sogar eine wöchentliche Fernsehsendung angeboten worden; und das alles noch vor Erscheinen ihres Buches.
»Sie können jetzt ins Studio, Dr. Ripley!«, rief ein junger Regieassistent durch die Tür.
Der Visagist strich ihr noch einmal mit der Puderquaste über die Wange und nickte.
»Alles gut.« Er strahlte sie an. »Machen Sie sie fertig!«
Alex folgte dem Assistenten durch den Flur und in das ausladende Studio. Hier wurden hektisch die letzten Vorbereitungen getroffen. Menschen mit Kopfhörern liefen herum und sahen entweder beschäftigt aus oder waren es tatsächlich; Produzenten erteilten mit grimmiger Miene Anweisungen; und die letzten Zuschauer wurden auf ihre Plätze gescheucht.
Das rote Licht ging an, und es wurde still. Alex hörte, wie der Talkmaster den Text vom Teleprompter ablas.
»Heute Morgen werden wir uns über Wunderheilungen unterhalten. Dazu haben wir uns die ›Wunder-Detektivin‹ höchstpersönlich eingeladen: Dr. Alex Ripley. In ihrem neuesten Buch ›Eine Frage des Glaubens‹ greift sie jeden – von TV-Predigern bis hin zum Vatikan selbst – für etwas an, das sie, wie sie uns gleich erzählen wird, als ›falsche Behauptungen von göttlichen Heilungen‹ bezeichnet. Dr. Ripley wird sich mit Reverend Bobby Swales auseinandersetzen, dessen ›Heilungsspektakel‹ rund um die Welt Tausende von Zuschauern anziehen. Außerdem werden wir uns mit Menschen unterhalten, die behaupten, mithilfe eines Wunders geheilt worden zu sein, und einen Witwer kennenlernen, der sagt, dass seine Frau durch eine betrügerische Wunderheilung getötet wurde. All diese spannenden Themen werden wir hier vor dem Live-Publikum im Studio und natürlich vor Ihnen zu Hause behandeln. Gleich nach der Werbung geht es weiter mit ›Die rechtschaffene Wahrheit‹ – bleiben Sie also dran!«
Alex hatte sich an den Spitznamen »Wunder-Detektivin« gewöhnt, auch wenn sie sich noch immer darüber ärgerte. Er gab nicht präzise wieder, was sie tat, und stellte zudem eine Verspottung ihrer Arbeit dar. Aber durch ihn hatte sie eine bekannte Identität erhalten, die den Menschen im Gedächtnis blieb, und immerhin ließ dieser vieldeutige Ausdruck ein wenig ahnen, was sie tat. Der Spitzname war zuerst in einem heftigen Verriss ihres ersten Buchs aufgetaucht und dort als Beleidigung gemeint gewesen. Doch seitdem hatten andere diesen Begriff aufgenommen, um sie kurz und prägnant vorzustellen. Inzwischen haftete er schon viele Jahre an ihr.
Das rote Licht ging aus, und rings um sie herum setzte erneut hektische Aktivität ein. Der Assistent führte sie am Arm durch das Studio zu ihrem Sitz. Sie bemerkte, dass sie alle im Halbkreis saßen und man Reverend Swales den Platz ihr direkt gegenüber zugewiesen hatte. Er hockte dort wie eine plumpe, kleine Kröte und hatte seine zumeist unruhigen Hände im Schoß gefaltet. Als er Alex sah, verzog er unwillkürlich die Lippen, was sie mit einem möglichst gütigen Lächeln erwiderte. Das versprach, eine lustige Sendung zu werden.
KAPITEL 5
Emma Drysdale stand in der Nähe des Ufers, direkt neben dem Waldrand. Sie trug ihren weißen Schutzanzug und hatte ihre Ausrüstungstasche in der Hand. Den Tatort nahm sie aus der Ferne in Augenschein, um sich ein Gesamtbild zu machen, bevor sie zu den anderen Kriminaltechnikern ging. Selbst aus dieser Entfernung konnte sie Rosie Trimble erkennen, die rücklings auf den Steinen lag, die Arme dicht an den Seiten. Es hatte gerade wieder angefangen zu nieseln, und hin und wieder störte ein etwas größerer Tropfen die ruhige Wasseroberfläche des Sees. Sie hatten nach dem letzten Guss eine kurze Pause vom Regen gehabt, doch es würde nicht lange dauern, bis der Himmel erneut seine Schleusen öffnete.
Ihr Assistent Matt trat näher an die Leiche heran und fotografierte jedes Detail aus mehreren Perspektiven und Winkeln. Sie würden die Tote ohnehin nicht anrühren dürfen, solange der Gerichtsmediziner nicht eingetroffen war, und Emma nutzte solche Augenblicke stets, um das Gesamtbild genauer zu betrachten.
Ein paar Rettungssanitäter standen in der Nähe, unterhielten sich und warfen der Leiche hin und wieder einen Blick zu. Zwei uniformierte Kontaktbeamte von der Polizei halfen dabei, die Dorfbewohner, die bei der Suche mitgeholfen hatten, auf Distanz zu halten. Schon jetzt war bei vielen die Sorge um das Mädchen in Voyeurismus umgeschlagen, und die meisten versuchten, sich die Leiche genauer anzuschauen, oder begafften Rosies von der Trauer übermannte Familie.
Emmas Blick fiel auf eine Frau, von der sie annahm, dass es sich um Rosies Mutter handelte: Am Rand der Gruppe von Angehörigen lag die Frau zusammengekauert auf den Knien und weinte laut – das gequälte, animalisch klingende Jammern einer Mutter, die gerade die schlimmstmögliche Nachricht erhalten hatte. Hinter ihr hielten sich ein Mann und ein jüngeres Mädchen im Teenageralter verstört in den Armen. Wahrscheinlich Rosies Vater und Schwester.
Die Kriminaltechnikerin beobachtete, wie der gebrochene Mann erfolglos versuchte, seine Familie wegzuführen, wobei er nach kurzer Zeit von einer jüngeren Version von sich selbst unterstützt wurde. Das musste sein Sohn sein. Rosies älterer Bruder war bereits Mitte zwanzig. Er zog seine Angehörigen in einer unbeholfenen Umarmung an sich und wollte sie trösten. Eine weitere Familie, die für immer zerstört worden war.
Nicht weit von Rosies Leiche entfernt saß PC Daniel Cotter in sich zusammengesunken auf einer Bank, eingehüllt in eine Wärmefolie, und wurde von einem weiteren Rettungssanitäter versorgt. Emma kannte den jungen Dan Cotter, seitdem er direkt nach der Schule dank irgendeines beschleunigten Ausbildungsverfahrens bei der Polizei angefangen hatte. Ursprünglich war es sein Wunsch gewesen, als Kriminaltechniker zu arbeiten, doch es hatte sich herausgestellt, dass er nicht die Nerven für diese Art von Tätigkeit besaß. Auch heute, sechs Jahre später, sah er für einen Polizisten noch immer unfassbar jung aus. Trotz seines scharfen Verstandes und guten Auges war er hier auf dem Land geblieben. Er verstand dieses seltsame kleine Dorf und wusste, dass die Leute lieber einen der Ihren als Ortspolizisten hatten.
In den vergangenen gut vier Monaten hatte Emma öfter mit Cotter zu tun gehabt als während seiner ganzen vorherigen Polizeilaufbahn. Kirkdale war normalerweise ein ruhiges Fleckchen, und dennoch standen sie nun wieder an dem Ort, wo am Tag der letzten Sommersonnenwende ein anderes junges Mädchen tot aufgefunden worden war. Es war ein wunderschöner, sonniger Morgen gewesen. Ungewöhnlich warm für Juni, das wusste sie noch ganz genau. Ganz im Gegensatz zu der dichten grauen Wolkendecke und den Regenschauern, mit denen sie es heute zu tun hatten.
Aufgrund der drastischen Budgetkürzungen bei den nationalen Polizeikräften war Daniel Cotter ein Schicksal beschieden, das eine traurige Rückkehr in alte Zeiten darstellte: ein ortsansässiger Constable, geboren und aufgewachsen in demselben Dorf, in dem er nun Polizist war, und mit begrenzter Unterstützung aus dem restlichen Distrikt. Während Emma ihn jetzt betrachtete – diesen jungen Mann, der in seinen Job hineingewachsen war –, wurde ihr bewusst, dass er einer der wenigen an vorderster Front tätigen Police Constables war, die sie tatsächlich mochte. Er arbeitete hart, hielt sich strikt an die Vorschriften und war ein intuitiver Polizist – eine Seltenheit in einem derart ländlichen Bezirk. Wenn er sich nur von Kirkdale lösen könnte, stünde ihm vermutlich eine vielversprechende Karriere als Kriminalbeamter bevor. Aber Emma vermutete, dass er nie von hier wegziehen würde. Kirkdale war anscheinend ein Ort, den man nicht so einfach verließ.
Obwohl er nie weggegangen war, hatte es Cotter irgendwie geschafft, nicht so engstirnig zu werden wie der Großteil der anderen Gemeindemitglieder. Beim ersten Fall war Cotter mit Emma einer Meinung gewesen, dass es sich bei Samantha Jaynes’ Selbstmord in erster Linie um ein auf tragische Weise verlorenes junges Leben handelte und nicht etwa um eine Ablehnung Gottes, wie viele andere im Dorf zu denken schienen.
Als Emma ihn jetzt neben dem leblosen Körper eines weiteren jungen Mädchens sitzen sah, konnte sie sich gut vorstellen, wie schockiert und frustriert er sein musste, weil so etwas erneut geschehen war. Die Aufmerksamkeit, die der nunmehr zweite Fall mit sich bringen würde, wollte niemand von ihnen.
»Tja, so langsam entwickelt sich eine Art Muster, nicht wahr?«
Emma zuckte zusammen, als sie die Stimme vernahm. Als sie sich umdrehte, stand sie Jim Forde gegenüber, dem Gerichtsmediziner. Sie hatte ihn überhaupt nicht kommen hören.
»Herrgott noch mal, Jim! Warum müssen Sie sich immer so an mich anschleichen?«
»Ich bin eben leichtfüßig.« Er lächelte schmallippig, als er wie immer denselben Witz machte.
»Leicht« war nun wirklich kein Attribut, das auf Jim Forde zutraf. Wie es einem derart beleibten Mann gelingen konnte, sich so leise zu bewegen, war ihr ein Rätsel, aber es gelang ihm erschreckend oft, sich an sie heranzuschleichen, worüber er sich stets köstlich amüsierte. Doch das war auch schon das Einzige im Umgang zwischen ihnen beiden, das einen Anflug von Humor aufwies; ansonsten verhielten sie sich durch und durch professionell.
»Noch ein Mädchen im Teenageralter, wie ich gehört habe«, sagte er.
»Rosie Trimble«, berichtete Emma. »Wurde heute in den frühen Morgenstunden als vermisst gemeldet. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass sie schon viel länger verschwunden war und man sie zuletzt gestern Vormittag gesehen hatte. Sie wurde nach langer Suche im Wasser gefunden, und zwar von Constable Cotter, der dort drüben sitzt.«
»Wie tragisch!«, merkte Forde an. Emma war sich nicht sicher, ob er damit Rosie oder Cotter meinte, aber sie stimmte ihm zu, und zwar mit Blick auf beide.
»Dann schauen wir mal, womit wir es zu tun haben, damit wir sie aus dem Regen und von diesen Gaffern wegbekommen«, meinte er, ging weiter und machte dabei den Eindruck, als hätte er die Schaulustigen am liebsten wütend angefaucht.
Emma folgte ihm über die nassen Kieselsteine und hielt automatisch nach Fußspuren Ausschau, doch ihr wurde schnell bewusst, wie sinnlos das war. Sie hatten es erneut mit dem Selbstmord eines Teenagers zu tun, und am steinigen Ufer waren schon jede Menge Menschen herumgelaufen. Was wollte sie denn hier noch finden?
»Wie geht es Ihnen?«, fragte sie PC Cotter und hockte sich neben ihn, während sich Forde daranmachte, Rosies Leiche zu untersuchen. Cotters Miene wirkte grimmig. Das feuchte Haar klebte ihm an der Stirn, und die Lippen waren blau angelaufen. Er zitterte noch immer, trotz der Wärmedecke und des Plastikbechers mit dampfendem Tee, den er mit bebenden Händen umklammerte. Emma wusste, dass es ebenso am Schock wie an der Kälte lag.
Cotter zuckte nur mit den Achseln und starrte Rosies Leiche an, wobei er langsam blinzelte, als ob er versuchen wollte, die schreckliche Realität auf diese Weise verschwinden zu lassen. Es war immer hart, derjenige zu sein, der eine Leiche entdeckte. Und wenn man das Opfer persönlich kannte, was hier zweifellos der Fall war, musste es sogar noch schlimmer sein.
Das größte Problem bei einem Selbstmord stellten die Fragen dar, die er zurückließ und die keiner zu beantworten vermochte. Verhaltensweisen, die man hätte bemerken können. Stimmungsschwankungen, die einem entgangen waren. Ein Mensch brachte sich normalerweise nicht aus einer Laune heraus um, nicht einmal ein Teenager. Wie war Rosie also an diesen Punkt gelangt, ohne dass ihre Familie oder ihre Freunde etwas mitbekommen hatten?
Emma dachte zurück an Samantha Jaynes, an das Mädchen, das sich im Sommer das Leben genommen hatte. Ihr Selbstmord schien alle schockiert zu haben. Vor allem, da sie sich am Abend vor dem Sommerjahrmarkt umgebracht hatte – also zu einer Zeit, in der das ganze Dorf in guter Stimmung und Feierlaune war. Alle hatten ihr erzählt, Samantha wäre ein ruhiges, normales Mädchen gewesen. Emma hatte den Abscheu fast schon spüren können, den die Leute ob dieser sogenannten Sünde empfanden.
Nun hatten sie es mit zwei Selbstmorden von Teenagern zu tun: am selben Ort, auf dieselbe Weise und im Abstand von nur wenigen Monaten. Das konnte doch kein Zufall sein. Würden die Leute jetzt auch wieder von einer Sünde sprechen?
»Sie sollten ins Krankenhaus fahren und sich durchchecken lassen«, schlug sie Cotter vor. »Wenn Sie sich unterkühlen, ist auch niemandem geholfen.«
Er zuckte wieder mit den Achseln und nickte. Aber es war offensichtlich, dass er sich nicht vom Fleck bewegen würde. Emma sah, wie er zusammenzuckte, als sich Forde direkt neben Rosies Leiche hinkniete und die Untersuchung fortsetzte. Sie veränderte absichtlich ihre Position, um Cotter weitgehend die Sicht zu versperren.
»Es ist nicht Ihre Schuld, Dan«, sagte sie und versuchte ihn dazu zu bringen, sie anstelle der Leiche anzusehen. Gleichzeitig war ihr jedoch bewusst, dass sie mit Plattitüden seine Stimmungslage auch nicht verändern konnte. Als er sich endlich zu ihr umdrehte, sah sie den Schmerz in seinen Augen. Er versuchte gar nicht erst, sich die große Träne wegzuwischen, die ihm über die Wange rann und rasch vom Regen weggewaschen wurde. Mit einem sehr tiefen Seufzer, bei dem er erschauderte, wandte Cotter den Blick von Emma ab, schaute auf den See hinaus, schniefte bedrückt und versuchte sich zusammenzureißen.
»Sie waren als Erster am Tatort?«
Sie glaubte, es könnte ihm helfen, wenn er sich einen Augenblick lang auf den Job konzentrierte.
»Ja«, antwortete er – so leise, als hätte er Angst, jemanden zu stören.
»Und sie trieb im Wasser, als Sie sie gefunden haben?«
Er nickte und blickte weiter auf den See hinaus.
»Ich habe sie schreien gehört, da bin ich mir ganz sicher«, sagte er und runzelte die Stirn. »Als ich von Gibbs’ Farm durch den Wald gerannt bin. Ich habe einen Schrei gehört und bin geradewegs zwischen den Bäumen hierhergelaufen. Es kann nicht länger als zehn Minuten gedauert haben. Aber ich war trotzdem zu spät hier, um sie davon abzuhalten. Ich habe sie aus dem Wasser gezogen, bis zu der Stelle, wo sie jetzt liegt, und versucht, sie wiederzubeleben. Das war vermutlich falsch, oder?«
Er sah sie flehentlich an.
»Sie haben getan, was Sie konnten, Dan«, versicherte sie ihm. »Nichts davon ist Ihre Schuld.«
»Aber ich habe sie gekannt, verstehen Sie?« Seine Stimme brach erneut. »Sie ist die jüngere Schwester meines besten Freundes. Wir haben immer auf sie aufgepasst, als sie noch klein war. An ihrem ersten Schultag sind wir mit ihr zum Schulhaus gegangen und danach auch fast jeden Tag bis zu unserem Abschluss. Manchmal haben wir das sogar später noch gemacht.«
Emma sah zu den Angehörigen hinüber, vor allem zu Rosies Bruder, Cotters Freund, der mit all seiner Kraft versuchte, die ganze Familie zusammenzuhalten.
»Das ergibt doch alles keinen Sinn«, fuhr Cotter fort. »Nicht bei Rosie. Sie ist kein Mädchen, das so etwas tun würde.«
Er blickte wieder auf den See hinaus, als würde er sich von dort Antworten erhoffen. Emma wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie tätschelte sein Knie, merkte dann, dass dies doch ziemlich unpassend war, und stand auf. In solchen Dingen war sie wirklich nicht besonders gut.
»Wir werden die Wahrheit schon herausbekommen, Dan«, erklärte sie mit fester Stimme. »Aber wenn Sie uns jetzt helfen wollen, dann lassen Sie sich wenigstens von den Sanitätern durchchecken. Und wärmen Sie sich wieder auf. Wir müssen den Leuten noch sehr viele Fragen stellen, und es wäre hilfreich, wenn wir dabei jemanden an unserer Seite hätten, der Rosies Familie und Freunde kennt. In Ordnung?«
Cotter schniefte noch einmal, aber sie konnte erkennen, dass er sich zusammenriss. Sie nickte dem Rettungssanitäter zu, der in der Nähe wartete. Daraufhin trat der Mann zu ihnen, half Cotter beim Aufstehen und führte ihn weg. Der junge Polizist ließ es ohne Widerrede mit sich geschehen. Sobald er außer Hörweite war, wandte Emma sich erneut Jim Forde zu.
»Womit haben wir es zu tun?«, erkundigte sie sich.
»Die Todesursache ist Ertrinken – wie bei dem anderen Mädchen«, antwortete er, während er seine Untersuchung der Leiche fortsetzte. »Es könnte sich recht gut um Selbstmord handeln, aber das kann ich selbstverständlich erst mit Sicherheit feststellen, wenn ich sie auf meinem Tisch liegen habe. Auf den ersten Blick sind keine Anzeichen für einen Kampf zu erkennen, obwohl sie mit lauter kleinen Schnittwunden und Kratzern bedeckt ist, als wäre sie durch eine Dornenhecke geschleift worden.«
Emma sah sich Rosie zum ersten Mal genauer an: ein hübsches Mädchen mit elfenhaften Zügen, blasser Haut und einer niedlichen Nase. Außerdem war sie nackt, genau wie Samantha Jaynes, als man sie damals gefunden hatte. Emma hätte Rosies Leiche gern zugedeckt, um sie vor all den neugierigen Blicken zu schützen.
Sie beugte sich vor und nahm die Kratzer auf Rosies Armen und Beinen sowie ihre abgebrochenen, schmutzigen Fingernägel in Augenschein. Für eine Achtzehnjährige sah Rosie sehr jung aus, aber der Tod ließ viele Menschen kleiner und zerbrechlicher erscheinen.
»Wie ist sie in diesen Zustand geraten?«, fragte Emma laut.
»Das herauszufinden ist Ihre Aufgabe«, entgegnete Forde.
Emma hob die Arme und Beine des Mädchens an und suchte nach weiteren Spuren.
»Keine Hautblutungen an den Hand- oder Fußgelenken, die vermuten ließen, sie wäre gefesselt, fortgezerrt oder mit Gewalt zu etwas genötigt worden«, stellte sie fest. »Was in aller Welt treibt jemanden dazu, barfuß durch den Wald zu rennen?«
»Da muss ich auf meinen letzten Kommentar verweisen«, meinte Forde trocken. Er beteiligte sich nie an irgendwelchen Spekulationen.
»Können Sie schon etwas zum Todeszeitpunkt sagen?«, wollte Emma wissen.
»Hm.« Forde überlegte. »Das ist aufgrund der Wassertemperatur schwer festzustellen; aber wenn ich alle Faktoren in Betracht ziehe, würde ich schätzen, dass sie heute Morgen zwischen vier und sechs gestorben ist. Ich habe keine Ahnung, was sie hier draußen getrieben hat, vermute jedoch, dass sie nicht allein gewesen ist. Die Feuerstelle dort ist noch warm.« Er deutete mit dem Kinn in Richtung Wald.
Emma sah auf die Uhr. Es war neun. Rosie war schon seit Stunden tot. So lange, dass sie längst nicht mehr hier auf diesen kalten Steinen liegen sollte. Auf einmal verspürte Emma das Bedürfnis, das Mädchen an einen stillen, friedlichen Ort zu bringen, wo sie ihr in Ruhe »zuhören« konnten. Als hätte er Emmas Gedanken gelesen, stand Forde auf, drückte den Rücken durch und nickte.
»Ich bin hier vorerst fertig«, sagte er. »Sie finden mich dann später in meinem Büro.«
Während er auf dem steinigen Ufer davonmarschierte, wurde der Regen wieder heftiger. Na super, dachte Emma und kniete sich wieder neben der Leiche auf die Steine.
»So, Rosie, meine Liebe«, murmelte sie und blies sich Regentropfen von der Oberlippe. »Was hast du mir zu erzählen?«
Emma wusste bereits, dass Rosie zuletzt von ihren Eltern gesehen worden war, als sie am gestrigen Morgen das Haus verlassen hatte, um zur Schule zu gehen. Angeblich hatte sie da völlig normal gewirkt. Ihre Absicht war es gewesen, bei ihrer Freundin Caitlin Rogers zu übernachten, die ebenfalls im Dorf wohnte, und dann sollte sie mit ihr in aller Frühe nach Hause zurückkommen, damit sie am Morgen gemeinsam frühstücken konnten. Offenbar nahm das Samstagsfrühstück bei den Trimbles eine wichtige Rolle ein.
Als Rosie nicht aufgetaucht war, hatten ihre Eltern bei Caitlin zu Hause angerufen und dort Erstaunliches erfahren. Deren Eltern hatten nämlich geglaubt, die Mädchen wären nachts im Haus der Trimbles gewesen. Anscheinend war Caitlin sehr früh am Morgen heimgekommen und hatte behauptet, ihr gehe es nicht gut, sie habe nicht schlafen können und sich nach ihrem eigenen Bett gesehnt. Sie wollte nicht sagen, wo die beiden tatsächlich gewesen waren, und fühlte sich augenscheinlich nicht besonders.
Es war notwendig, Caitlin ausführlich zu befragen, aber Emma bezweifelte, dass ihre Eltern das so bald zulassen würden. Wenn sie bedachte, wie die Gemeinde auf den Tod des letzten Mädchens reagiert hatte, konnte sie vermutlich von Glück reden, wenn sie überhaupt irgendwann einmal ein Wort mit Caitlin wechseln durfte.
Emma öffnete ihren Koffer, nahm ein Paar Latexhandschuhe heraus, streifte sie über und machte sich an die Arbeit. Ganz langsam ging sie um die Leiche herum und suchte nach allem, was ein Hinweis sein könnte.
Vorsichtig untersuchte sie jede Schnitt- und Kratzwunde, jeden blauen Fleck, jede Hautabschürfung, jeden Schmutzfleck, die alle später genau dokumentiert werden würden. Die feinen Kratzer der Dornenbüsche waren auf Rosies blasser Haut deutlich zu erkennen. Sie hatte außerdem Prellungen an den Schienbeinen, Schürfwunden an den Knien und Quaddeln an den Stellen, an denen sie mit Brennnesseln in Kontakt gekommen war.
Rosie hatte es offensichtlich eilig gehabt, zum See zu kommen, und den Schmerz entweder nicht bemerkt oder einfach ignoriert. Das war noch ein Aspekt, auf den Emma sich keinen Reim machen konnte: Selbstmörder rannten üblicherweise nicht zu der Stelle, wo sie sterben wollten. Vor allem nicht, wenn sie vorhatten, sich zu ertränken, denn das war im Allgemeinen ein sehr ruhiger und absichtlich gewählter Tod.
Dennoch waren sie nun hier und blickten auf die Leiche eines weiteren Mädchens, das sich im selben See ertränkt hatte wie das erste; und dies ließ bei Emma alle Alarmsirenen schrillen. Bei Samantha waren weder Kampfspuren zu erkennen gewesen noch solche Kratzer und Flecken, wie sie Rosie hatte. Anfangs hatte Emma argumentiert, ihr Tod könnte ein Unfall gewesen sein, und Cotter war ursprünglich derselben Ansicht gewesen. Doch die Gemeinde, und allen voran Samanthas Vater, war sich darin einig gewesen, dass es sich um einen klaren Selbstmord handeln musste. Der hiesige Sergeant Steve Walcott hatte dann Emma stark unter Druck gesetzt, damit sie die Ermittlungen abschloss, ihren Bericht schrieb und es anderen überließ, die ganze Angelegenheit unter den Teppich zu kehren. Mit einiger Mühe hatte Cotter sie letzten Endes davon überzeugt, dass es so am besten wäre.
Aber dieses Mal würde sie nicht so schnell nachgeben. Doch würden die Leute hier die Übereinstimmungen bei beiden Todesfällen ignorieren oder endlich begreifen, dass sie mit ihren Töchtern über das reden mussten, was hier vor sich ging?
Was auch immer die Mädchen dazu antrieb, sich das Leben zu nehmen, falls das denn tatsächlich der Fall war – irgendein zugrunde liegendes Motiv musste es dafür geben. Dessen war sich Emma sicher. Schließlich war es immer so. Alkohol, Drogen, Jungen, Stress, Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Doch es schien in Kirkdale unangebracht zu sein, selbst typische Routinefragen nach solchen möglichen Ursachen zu stellen, da die Gemeinde so streng religiös war. Selbstmord wurde als ultimative Ablehnung der Liebe Gottes und schlimmste Sünde angesehen, und die Einwohner hier schienen darüber nicht hinwegzukommen.
Daher hatten sich die Nachbarn und Freunde von Samanthas trauernder Familie abgewandt, weil sie mit dieser Sünde nicht in Berührung kommen wollten. Somit wurde das Leid der Familie noch vermehrt: Sie hatte in einer verhängnisvollen Nacht nicht nur ihre Tochter, sondern auch ihre Freunde und ihren Gott verloren. Dennoch waren nicht einmal ihre Eltern gewillt gewesen, das allgemeine Urteil infrage zu stellen. Emma hatte jedoch das Gefühl gehabt, dass Samanthas Mutter Zweifel gekommen waren. Aber sie hatte auch mit angesehen, wie die arme Frau bei den Befragungen von ihrem Mann eingeschüchtert worden war.
Daher hatte schließlich auf dem Totenschein gestanden: Tod durch Ertrinken. Vermutlicher Selbstmord. Grundlage hierfür waren Aussagen von Angehörigen und Freunden gewesen, gemäß denen Samantha sich in letzter Zeit zurückgezogen habe. Irgendwie anders gewesen sei. Emma hatte nie den Eindruck gehabt, dass dies der Wahrheit entsprach.
Nun vermutete sie, dass man dasselbe über Rosie sagen würde: ein braves, frommes Mädchen, das sich plötzlich aus egoistischen Gründen von Gott abgewandt hatte. Sie fragte sich, ob man Rosies Familie ebenfalls ächten würde. Wo sollte das enden? Würden noch mehr Mädchen sterben? Hatten die Teenager hier eine Art Selbstmordpakt geschlossen?
Vor fast einem Jahrzehnt hatte es in Schottland einen solchen Fall gegeben, bei dem mehrere Teenager über ein soziales Netzwerk einen Selbstmordpakt geschlossen hatten. Innerhalb eines Jahres nahmen sich dreizehn von ihnen das Leben. Die Polizei ging davon aus, dass die Teenager das kollektive Mitleid gesehen hatten, das nach dem ersten Todesfall online bekundet worden war, und es auch für sich selbst haben wollten – sie hatten sich nach der vermeintlichen Unsterblichkeit durch eine digitale Gedenkstätte gesehnt. So anfällig für lebenszerstörende Vorstellungen konnte der Verstand eines Teenagers sein.
Es musste einen Grund dafür geben, dass diese ansonsten glücklichen Mädchen in Kirkdale sich auf derart zielgerichtete und beschwerliche Weise das Leben genommen hatten. Emma fragte sich, ob Sergeant Walcott damit einverstanden sein würde, dass sie eine tiefgreifendere Ermittlung einleitete, bezweifelte es jedoch. Die Menschen in Kirkdale waren nicht nur nicht bereit, über die Selbstmorde der Mädchen zu reden, sie wollten erst recht nicht, dass Fremde diese Schande genauer in Augenschein nahmen. Möglicherweise konnte sie mithilfe des jungen PC Cotter ja mehr erreichen. Er hatte Rosie immerhin persönlich gekannt und bereits gesagt, dass sie nicht der Typ Mensch gewesen war, der zu Selbstmord neigte.
Als Emma bemerkte, dass es auf der anderen Seite der Lichtung unruhig wurde, kehrten ihre Gedanken in die Gegenwart zurück. Ein großer, schlaksiger Teenager war aus dem Wald getreten und wie ein Hase, der auf einmal von Autoscheinwerfern angestrahlt wurde, in seinen Bewegungen erstarrt. Der Junge war wie alle anderen vom Regen durchnässt. Ein stämmiger uniformierter Polizist versuchte, ihn zum Weitergehen zu zwingen, indem er ihn von hinten anstieß. Sergeant Walcott. Emma erkannte ihn sofort wieder und seufzte innerlich. Was jetzt? Doch der Junge rührte sich weiterhin nicht von der Stelle – bis Walcott ihn schließlich am Arm packte und mit sich zerrte.
»Nein, Dad«, protestierte der Junge und versuchte, sich dem Griff seines Vaters zu entziehen.