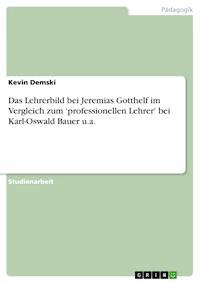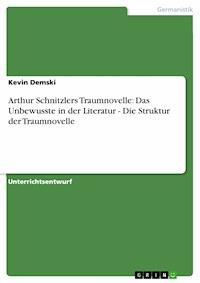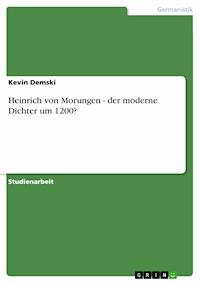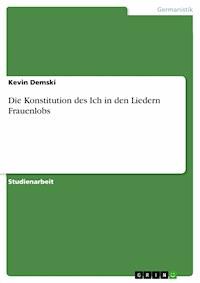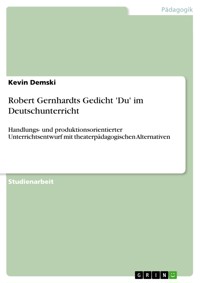Das 'serapiontische' Prinzip E.T.A. Hoffmanns in drei Erzählungen aus den 'Serapionsbrüdern' E-Book
Kevin Demski
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: sehr gut (1,00), Freie Universität Berlin (Institut für Deutsche und Niederländische Philologie), Sprache: Deutsch, Abstract: Theodor, Ottmar und Cyprian waren darin einig, daß ohne alle weitere Abrede sich die literarische Tendenz von selbst bei ihren Zusammenkünften eingefunden haben würde und gaben sich das Wort der Regel des Einsiedlers Serapion, wie sie Lothar sehr richtig angegeben, nachzuleben, wie es nur in ihren Kräften stehe […]. (S. 70) So heißt es an exponierter Stelle in E.T.A. Hoffmanns Erzählzyklus „Die Serapionsbrüder“, nachdem Cyprian von seinem „Einsiedler Serapion“ sowie Theodor vom „Rat Krespel“ berichtet haben und Lothar den Serapionsbrüdern schließlich folgenden Vorschlag unterbreitet: „sprechen wir von dem Serapionischen Prinzip!“ (Ebd.). Was unter diesem Prinzip eigentlich und genau zu verstehen ist, darüber wird in der Hoffmann-Forschung viel und anhaltend diskutiert. Einig ist man sich jedenfalls darin, dass es für E.T.A. Hoffmanns Auffassung vom Wesen und von den Aufgaben der Dichtung von zentraler Bedeutung ist. Mit dem obigen Zitat aus dem Erzählzyklus ist auf die Schwierigkeiten, die für die Forschung aus der Befassung mit dem „serapiontischen“ Prinzip von jeher erwachsen, bereits hingewiesen: Hoffmann selbst verfasst keine eigene Poetik, vielmehr transportiert er sie über die Erzählungen und Unterhaltungen der fiktiven Serapionsbrüder. Schon deshalb erscheint es mir hinsichtlich eines möglichst soliden theoretischen Fundamentes unabdingbar, die poetologischen Äußerungen der Freunde stets rückbezüglich der beiden oben genannten poetologischen Erzählungen (auf deren Grundlage die Serapionsbrüder jenes „serapiontische“ Prinzip entwickeln) zu betrachten. Die sich mit dem Erzählprinzip beschäftigende Forschung nimmt nun zwar gelegentlich noch etwas ausführlicher den „Einsiedler Serapion“ in den Blick, „Rat Krespel“ wird daneben jedoch zumeist kaum bedacht. Offenbar ist hierin auch ein Grund etwa für die Position Peter von Matts zu sehen, der das „serapiontische“ Prinzip als ein Bekenntnis zur „absolute[n] Autonomie der produktiven Einbildungskraft“ missversteht. Jochen Schmidt folgt ihm darin weitgehend. In der Nachfolge von Wolfgang Preisendanz betont Wulf Segebrecht dagegen die Distanz, die zwischen „serapionischem“ und „serapiontischem“ Erzählen liegt. Für Segebrecht evoziert das „serapiontische“ Prinzip fernerhin notwendig die Frage, wie „erlebte Wirklichkeit“ Dichtungscharakter gewinnen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlegung in „gemütlicher“ Runde: Ein Versuch über das „serapiontische“ Prinzip
2.1 Der analytische Blick auf die Erzählungen „Der Einsiedler Serapion“ und „Rat Krespel“ oder Zur Entwicklung eines Erzählprinzips
2.1.1 „Der Einsiedler Serapion“. Ein auf die innere Schau beschränkter Poet
2.1.2 „Rat Krespel“. Von der Duplizität des Daseins und dem Geheimnis der Kunst
2.1.3 Das Fundament oder Die Vorbedingungen „serapiontischen“ Erzählens: Vom wirklichen Schauen, von der Duplizität des Daseins und vom ordnenden Verstand
2.2 Niemals schlechtes Machwerk: Poetologische Merkmale „serapiontischen“ Erzählens
2.2.1 Durch feine Fäden fest zusammengehalten. Zur Integration in der „serapiontischen“ Erzählung
2.2.2 Lebendigkeit oder Über das „Ins-Leben-Treten“
2.2.3 Mystifikation: Was der historische Besen für den geneigten Leser übrig lässt
2.2.4 Das Prädikat „serapiontisch“ – Zur komplexen Poetik der Serapionsbrüder
2.3 Exkurs: Ironie und Humor – Dualismus und Duplizität
3 Zur Umsetzung des „serapiontischen“ Prinzips in drei ausgewählten Erzählungen aus den „Serapionsbrüdern“
3.1 „Doge und Dogaresse“
3.1.1 Text und Bild – Die Erzählung eines Gemäldes
3.1.2 Das „redende Gespenst aus der Vorzeit“
3.1.3 Annunziata, Antonio und der Doge – Ikonographie und Karikatur
3.1.4 Zu Margaretha… diesem „seltsamen Bettelweib“
3.1.5 Über das „eigensinnig tolle Ding“
3.1.6 Kolbes Gemälde „tritt ins Leben“
3.1.7 Vom retardierenden Moment zur Katastrophe
3.1.8 Die Auflösung der Perspektive – Verlust des Zentrums?
3.1.9 Eine „serapiontische“ Bild-Interpretation
3.2 „Das fremde Kind“
3.2.1 „Es war einmal“…
3.2.2 Der „große hagere Mann“ aus der Stadt
3.2.3 Thaddäus von Brakel: „Lasse die Kinder nur gewähren“
3.2.4 Herrmann und Adelgunde als „kleine Roboter des Wissens“
3.2.5 Wider das steife Zeremoniell von Onkel und Tante. Felix und Christlieb
3.2.6 Pepasilio – Gnomenkönig Pepser – Magister Tinte. Wenn ein „serapiontischer“ Hofmeister „ins Leben tritt“…
3.2.7 Über das „seltsame Wunderkind“
3.2.8 Dramaturgie und Uneindeutigkeit
3.2.9 Der Wald als „fester Kern“
3.3 „Der Zusammenhang der Dinge“
3.3.1 „medias in res“ – Zwei Freunde und zwei Thesen
3.3.2 Der „wahre Ausbund von Bildung“ mit seinem „kurzen Gesicht“
3.3.3 Von den „Torheiten“ der Gesellschaft
3.3.4 Euchar – Edgar
3.3.5 Emanuela und der Talisman – Euchars „Angelegenheit“
3.3.6 Über die Präsidentin
3.3.7 Ein doppelter „Zusammenhang der Dinge“
3.3.8 Literatur und Wirklichkeit – wen man so Edgar nennt…
3.3.9 Der „über uns, in uns waltende höhere Geist“
4 Schluss
5 Literaturverzeichnis
5.1 Primärliteratur
5.2 Sekundärliteratur
6 Erklärung
1 Einleitung
Theodor, Ottmar und Cyprian waren darin einig, daß ohne alle weitere Abrede sich die literarische Tendenz von selbst bei ihren Zusammenkünften eingefunden haben würde und gaben sich das Wort der Regel des Einsiedlers Serapion, wie sie Lothar sehr richtig angegeben, nachzuleben, wie es nur in ihren Kräften stehe […]. (S. 70)[1]
So heißt es an exponierter Stelle in E.T.A. Hoffmanns Erzählzyklus „Die Serapionsbrüder“, nachdem Cyprian von seinem „Einsiedler Serapion“ sowie Theodor vom „Rat Krespel“ berichtet haben und Lothar den Serapionsbrüdern schließlich folgenden Vorschlag unterbreitet: „sprechen wir von dem Serapionischen Prinzip!“ (Ebd.).[2] Was unter diesem Prinzip eigentlich und genau zu verstehen ist, darüber wird in der Hoffmann-Forschung viel und anhaltend diskutiert. Einig ist man sich jedenfalls darin, dass es für E.T.A. Hoffmanns Auffassung vom Wesen und von den Aufgaben der Dichtung von zentraler Bedeutung ist.[3]
Mit dem obigen Zitat aus dem Erzählzyklus ist auf die Schwierigkeiten, die für die Forschung aus der Befassung mit dem „serapiontischen“ Prinzip von jeher erwachsen, bereits hingewiesen: Hoffmann selbst verfasst keine eigene Poetik, vielmehr transportiert er sie über die Erzählungen und Unterhaltungen der fiktiven Serapionsbrüder.[4] Schon deshalb erscheint es mir hinsichtlich eines möglichst soliden theoretischen Fundamentes unabdingbar, die poetologischen Äußerungen der Freunde stets rückbezüglich der beiden oben genannten poetologischen Erzählungen (auf deren Grundlage die Serapionsbrüder jenes „serapiontische“ Prinzip entwickeln) zu betrachten. Die sich mit dem Erzählprinzip beschäftigende Forschung nimmt nun zwar gelegentlich noch etwas ausführlicher den „Einsiedler Serapion“ in den Blick,[5] „Rat Krespel“ wird daneben jedoch zumeist kaum bedacht.[6]
Offenbar ist hierin auch ein Grund etwa für die Position Peter von Matts zu sehen, der das „serapiontische“ Prinzip als ein Bekenntnis zur „absolute[n] Autonomie der produktiven Einbildungskraft“ missversteht.[7] Jochen Schmidt folgt ihm darin weitgehend.[8]
In der Nachfolge von Wolfgang Preisendanz[9] betont Wulf Segebrecht dagegen die Distanz, die zwischen „serapionischem“[10] und „serapiontischem“ Erzählen liegt.[11] Für Segebrecht evoziert das „serapiontische“ Prinzip fernerhin notwendig die Frage, wie „erlebte Wirklichkeit“ Dichtungscharakter gewinnen kann.[12] Gewissermaßen von der anderen Seite her stellt Walther Müller-Seidel fest, im „serapiontischen“ Prinzip gehe es „[u]m die angemessene ‚Übersetzung’ eines Inneren ins Äußere, eines Geistigen ins Wirkliche und eines seelenhaften Seins in die körperliche Welt“.[13] Mit Uwe Japp lässt sich schließlich konstatieren: „Die Außenwelt firmiert […] als Ausgangs- und Zielpunkt des serapiontischen Erzählens.“[14]
Dabei ist spätestens seit Klaus Deterding – in Weiterentwicklung der Erkenntnisse von Preisendanz und Segebrecht – rücksichtlich der grundlegenden Weltauffassung „serapiontischer“ Erzähler nicht nur von einem „Dualismus“ zwischen Außen- und Innenwelt, sondern zugleich von der „Duplizität des Daseins“ zu sprechen.[15]
Das „serapiontische“ Prinzip wurde auch interpretiert als „therapeutisches System“,[16] resp. die Runde der Serapionsbrüder als „therapeutische[r] Zirkel“.[17] Ebenfalls ist nicht darauf verzichtet worden, es, unter Einbezug der gesellschaftlich-politischen Situation in Berlin nach 1815, zu einem „Prinzip der Ausweglosigkeit“ zu erklären.[18] Johannes Wiele schließlich nimmt sich in erster Linie der historisch-politischen Dimension „serapiontischen“ Erzählens an.[19]
Indessen wird der Übereinkunft der Serapionsbrüder, „sich durchaus niemals mit schlechtem Machwerk zu quälen“ (S. 70; Hervorhebung von mir), in aller Regel doch nur recht wenig Beachtung zuteil. Ilse Winter hat zwar vor einiger Zeit eine poetologische Analyse des „serapiontischen“ Prinzips unternommen,[20] meines Erachtens dabei jedoch zuwenig die Verschlungenheit der im Wesentlichen durchaus brauchbaren von ihr abstrahierten poetologischen Merkmale gesehen. Womöglich ist dieses Manko nicht zuletzt auch der Tatsache geschuldet, dass sie auf Untersuchungen der poetologischen Erzählungen „Der Einsiedler Serapion“ und „Rat Krespel“ gänzlich verzichtet. So verkennt sie beispielsweise wiederholt die Bedeutung des mystifizierenden Moments einer „serapiontischen“ Erzählung. Häufig bleiben die Analysen der Texte, die Winter zur Illustration der herausgearbeiteten Merkmale auswählt, zu oberflächlich und verlassen sich zu sehr auf die Kritik aus der Runde der Serapionsbrüder.
Darüber hinaus nimmt sich Lothar Pikulik der poetologischen Reflexionen der Serapionsbrüder an und befindet über das „serapiontische“ Prinzip, dass „es sich nicht nur um ein Prinzip, sondern um einen ganzen Komplex von Prinzipien oder ein Prinzip mit mehreren verschiedenen Aspekten“ handele,[21] von denen er einige genauer untersucht. Für eine differenzierte Textanalyse erweist sich seine Systematik allerdings als wenig brauchbar, weil sie innerhalb der einzelnen Aspekte nicht hinreichend konkret ist.
Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, den Missständen der Forschung in zweifacher Hinsicht Rechnung zu tragen:
Einerseits ist zunächst eine möglichst stabile Untersuchungsbasis zu schaffen. Das heißt, es sind auf der Grundlage von Analysen der poetologischen Erzählungen „Der Einsiedler Serapion“ und „Rat Krespel“[22] die Unterhaltungen der Serapionsbrüder im Hinblick auf deren poetologische Äußerungen genauer Betrachtungen zu unterziehen,[23] sodass hieraus schließlich die Entwicklung einer differenzierten Poetik möglich ist. Das „serapiontische“ Prinzip wird sich dabei als komplexe Poetik erweisen.
Andererseits ist die Umsetzung des „serapiontischen“ Prinzips in drei weniger bekannten Erzählungen aus den „Serapionsbrüdern“ eingehend zu untersuchen. Es wird sich zeigen, dass zumindest Lothars Märchen „Das fremde Kind“ und Sylvesters Erzählung „Der Zusammenhang der Dinge“ bisher in der Forschung, jedenfalls auf poetologischer Ebene, nicht hinreichend gewürdigt wurden.
2 Theoretische Grundlegung in „gemütlicher“ Runde: Ein Versuch über das „serapiontische“ Prinzip
2.1 Der analytische Blick auf die Erzählungen „Der Einsiedler Serapion“ und „Rat Krespel“ oder Zur Entwicklung eines Erzählprinzips
Die Verschlingung von Realität und Fantasie[24] zieht sich als konstantes Grundthema durch Hoffmanns dichterisches Werk. In den „Serapionsbrüdern“ bezeichnet er diese beiden Bereiche als Außenwelt und Innenwelt.
Bereits am ersten Serapions-Abend wird das Verhältnis, in dem die beiden Welten zueinander stehen, von Lothar verdeutlicht:
Es gibt eine innere Welt, und die geistige Kraft, sie in voller Klarheit, in dem vollendetsten Glanze des regesten Lebens zu schauen, aber es ist unser irrdisches [sic.] Erbteil, daß eben die Außenwelt in der wir eingeschachtet, als der Hebel wirkt, der jene Kraft in Bewegung setzt. (S. 68)
Und als die Serapionsbrüder fernerhin am fünften Abend im Anschluss an Lothars Märchen „Die Brautwahl“ in eine Diskussion über die Gattung Märchen geraten, unterstützt Theodor den Erzähler Lothar in dessen „Hange das Märchenhafte in die Gegenwart, in das wirkliche Leben zu versetzen“ (S. 720) wie folgt:
Sonst war es üblich, ja Regel, alles was nur Märchen hieß, ins Morgenland zu verlegen und dabei die Märchen der Dschehezerade zum Muster zu nehmen. Die Sitten des Morgenlandes nur eben berührend, schuf man sich eine Welt, die haltlos in den Lüften schwebte und vor unsern Augen verschwamm. Deshalb gerieten aber jene Märchen meistens frostig, gleichgültig und vermochten nicht den innern Geist zu entzünden und die Fantasie aufzuregen. Ich meine, daß die Basis der Himmelsleiter, auf der man hinaufsteigen will in höhere Regionen, befestigt sein müsse im Leben, so daß jeder nachzusteigen vermag. Befindet er sich dann immer höher und höher hinaufgeklettert, in einem fantastischen Zauberreich, so wird er glauben, dies Reich gehöre auch noch in sein Leben hinein, und sei eigentlich der wunderbar herrlichste Teil desselben. (S. 720f.)
An dieser Stelle sei zunächst lediglich ein „wunderliches“[25] Ineinander von Außen- und Innenwelt konstatiert. Es wird bereits an der Einführung des Einsiedlers „Serapion“ innerhalb der gleichnamigen Erzählung Cyprians erkennbar.
2.1.1 „Der Einsiedler Serapion“. Ein auf die innere Schau beschränkter Poet
Der Erzähler begegnete einem
Mann in brauner Einsiedlerkutte, einen breiten Strohhut auf dem Kopf, mit langem schwarzem verwildertem Bart, der dicht an einer Bergschlucht auf einem Felsstück saß und die Hände gefaltet gedankenvoll in die Ferne schaute. (S. 24)
– Cyprians Bekanntschaft erscheint auf der einen Seite durchaus wie von dieser Welt, andererseits erfahren das Auditorium[26] und der geneigte Leser aber zugleich, dass „[d]ie ganze Erscheinung […] etwas fremdartiges, seltsames (hatte)“ (ebd.), wodurch den Erzähler ein Gefühl des Unheimlichen überkommt: „ich fühlte leise Schauer mich durchgleiten“ (ebd.) und er erklärt, dass „[…] man sich ([s]olchen Gefühls) auch wohl kaum erwehren (kann), wenn das, was man nur auf Bildern sah oder nur aus Büchern kannte, plötzlich ins wirkliche Leben tritt“ (ebd.; Hervorhebung von mir); ja schließlich befindet Cyprian:
Da saß nun der Anachoret aus der alten Zeit des Christentums in Salvator Rosa’s wildem Gebürge lebendig mir vor Augen. (Ebd.; Hervorhebung von mir)
Sehr richtig konstatiert Pikulik im Hinblick auf diese Textpassage, dass es scheine, „als sei eine Fiktion real geworden“.[27] Die „Lebendigkeit“ der Darstellung ist – wie sich noch zeigen wird – ein wesentliches Charakteristikum „serapiontischen“ Erzählens. Sie wird erzeugt durch eine „feurige Fantasie“ (S. 25), die offenbar auch dem Einsiedler zueigen ist. So berichtet Cyprian von dessen Erzählkunst:
Alle Gestalten traten mit einer plastischen Ründung, mit einem glühenden Leben hervor, daß man fortgerissen, bestrickt von magischer Gewalt wie im Traum daran glauben mußte, daß Serapion alles selbst wirklich von seinem Berge erschaut. (S. 34)
Die Erzählung vermittelt in ihrer Exposition also die zentrale Problematik des Folgenden: Es geht um die Auseinandersetzung zwischen Fantasie und Wirklichkeit, zugespitzt formuliert: um eine Konfrontation von Wahnsinn und Vernunft.
Infolge des Eindrucks, den die erste Begegnung mit dem Einsiedler auf Cyprian macht, versucht Letzterer sich zunächst auf die nüchterne Faktizität zu besinnen, dass „ein ambulierender Mönch wohl eben nichts ungewöhnliches in diesen Gegenden sei“ (S. 24). Dennoch gelingt es ihm nicht, die surreal anmutende Erscheinung vollends der Realität zuzuschlagen: vielmehr stiftet die Antwort des Mönchs auf Cyprians Frage nach dem Weg aus dem Wald, um nach B*** zurückzukehren, erneut Verwirrung beim Erzähler, der sich schließlich seiner Sinne nicht mehr mächtig fühlt: „Mir war als läg’ ich im Traum“ (ebd.). Nicht wenig tragen hierzu die Einsamkeit, Dichte und Unwegsamkeit des Waldes, in dem die Begegnung sich ereignet, bei.[28] Dies deutet sich an, wenn Cyprian aus der schaurigen Umgebung herausfindet und sich zur äußeren Befreiung die auch innerlich befreiende, weil den Spuk auflösende, Erklärung gesellt, dass er es schlichtweg mit einem Wahnsinnigen zu tun gehabt habe: Zunächst berichtet ein Bauer, der dem Erzähler wieder auf den rechten Weg hilft: „Die Leute sagen, er [der Einsiedler; K.D.] sei nicht recht richtig im Kopfe“ (S. 25) und in der Stadt B*** wird Cyprian von Doktor S**[29] fachlich kompetent genauer über den Einsiedler informiert (vgl. S. 25f.).[30]
Allerdings kann von wirklicher Aufklärung des Falles infolge der ärztlichen Diagnose keine Rede sein; es ergeben sich vielmehr neue Rätsel. Immerhin wird mitgeteilt, dass der wahnsinnige Einsiedler „aus glänzender Familie“ stammt und „[…] sonst einer der geistreichsten vielseitig ausgebildetsten Köpfe (war) die es in M– gab“ (S. 25), weshalb es „[…] nicht fehlen (konnt’), daß man ihn […] in ein bedeutendes diplomatisches Geschäft zog, dem er mit Treue und Eifer vorstand“ (ebd.). In der Konsequenz fragt sich dann jedoch, wie der Einsiedler, gerade als er zu einem „wichtigen Gesandtschaftsposten“ bestimmt worden ist, verschwinden und sich für den „Priester Serapion“ (ebd.) halten konnte. Die Erzählung weiß hier lediglich anzubieten, dass dies „auf unbegreifliche Weise“ (ebd.) geschehen ist – und auch hierdurch ist auf ein bedeutendes Kennzeichen „serapiontischen“ Erzählens bereits hingewiesen.[31]
Auch die Verfassung, die der Einsiedler mit seinem Wahn angenommen hat, bleibt rätselhaft. Denn abgesehen davon, dass er sich für jenen Serapion hält, „der unter dem Kaiser Dezius in die Thebaische Wüste floh und in Alexandrien den Märtyrer-Tod litt […], schien sein Geist gar nicht zerrüttet“ (S. 26).
Vielmehr ist er imstande, „die geistreichsten Gespräche zu führen, ja nicht selten traten Spuren jenes scharfen Humors, ja wohl einer Gemütlichkeit hervor, die sonst seine Unterhaltung belebten“ (ebd.). Ferner „baute sich [der Einsiedler] eine […] Hütte, er verfertigte sich Tisch und Stuhl, er flocht sich Binsenmatten zum Lager […] [und] er legte ein kleines Gärtlein an“ (ebd.). Hoffmann war jene Art des partiellen Wahnsinns, welcher auf der Besessenheit durch eine „fixe Idee“ (S. 27) beruht, jedoch den Großteil der Geisteskräfte in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt, aus einer seiner psychiatrischen Quellen[32] bekannt.[33]
So kann der wahnsinnige Einsiedler dann auch „mit den Waffen der Vernunft“ (S. 30; Hervorhebung von mir) auf Cyprians Heilungsversuch reagieren. In einwandfreier Logik argumentiert er folgendermaßen:
[1. Fall:] Bin ich nun wirklich wahnsinnig, so kann nur ein Verrückter wähnen, daß er im Stande sein werde mir die fixe Idee, die der Wahnsinn erzeugt hat, auszureden. Wäre dies möglich so gäb’ es bald keinen Wahnsinnigen mehr auf der ganzen Erde, denn der Mensch könnte gebieten über die geistige Kraft die [aber eben] nicht sein Eigentum sondern nur anvertrautes Gut der höhern Macht ist, die darüber waltet. [2. Fall:] Bin ich aber nicht wahnsinnig und wirklich der Märtyrer Serapion, so ist es wieder ein törigtes Unternehmen mir das ausreden und mich erst zu der fixe Idee treiben zu wollen, daß ich der Graf P** aus M– und zu Großem berufen sei. (Ebd.; Hervorhebung von mir)[34]
Hiermit wird nun die Verschlingung von Wahn und Vernunft ganz deutlich vorgeführt. An späterer Stelle in den „Serapionsbrüdern“, am siebenten Serapions-Abend, wird darüber hinaus – und zwar von Cyprian[35] – bemerkt,
daß einiger Wahnsinn, einige Narrheit so tief in der menschlichen Natur bedingt ist, daß man diese gar nicht besser erkennen kann als durch sorgfältiges Studium der Wahnsinnigen und Narren, die wir gar nicht in den Tollhäusern aufsuchen dürfen, sondern die uns täglich in den Weg laufen, ja am besten durch das Studium unseres eigenen Ichs, indem jener Niederschlag aus dem chemischen Prozeß des Lebens genugsam vorhanden. (S. 920)
Wiederum rücksichtlich seiner logischen Argumentation, verweist der Einsiedler ferner auf die Relativität und Subjektivität von „Zeit […] wie Zahl“ (S. 31), bringt seinen Kontrahenten Cyprian damit in Beweisnot und setzt ihn schlussendlich matt:
Auf, rief ich [der Erzähler resp. Cyprian; K.D.], kommen Sie mit mir, in zwei Stunden sind wir in B*** und das was ich behauptet, ist bewiesen.
Armer verblendeter Tor, sprach Serapion, welch ein Raum trennt uns von B***! – Aber gesetzten Falls ich folgte Ihnen, wirklich nach einer Stadt die Sie B*** nennen, würden Sie mich davon überzeugen können, daß wir wirklich nur zwei Stunden wandelten, daß der Ort, wo wir hingelangten wirklich B*** sei? – Wenn ich nun behauptete daß eben Sie von einem heillosen Wahnsinn befangen die Thebaische Wüste für ein Wäldchen und das ferne, ferne Alexandrien für die süddeutsche Stadt B*** hielten was würden Sie sagen können? (Ebd.)
Dem Einsiedler Serapion wird darüber hinaus die Rolle des planvoll und überlegt verfahrenden Poeten zuerkannt: „Serapion erzählte jetzt eine Novelle, angelegt, durchgeführt, wie sie nur der geistreichste […] Dichter anlegen, durchführen kann“ (S. 34). Cyprian findet es „bewunderungswürdig, mit welchem Scharfsinn, mit welchem durchdringenden Verstande [s]ein Anachoret über das Leben in allen seinen Gestaltungen sprach“ (S. 35). Erneut ist dies als Vorverweis auf ein drittes wichtiges Element „serapiontischen“ Erzählens zu sehen.
Als poetologisch besonders bedeutend stellt sich im weiteren Verlauf die grundsätzliche erkenntnistheoretische Position des Einsiedlers heraus, wenn er im Gespräch mit Cyprian erörtert:
Ist es nicht der Geist allein, der das was sich um uns begibt in Raum und Zeit, zu erfassen vermag? – Ja was hört was sieht, was fühlt in uns? – vielleicht die toten Maschinen die wir Auge – Ohr – Hand etc. nennen und nicht der Geist? – Gestaltet sich nun etwa der Geist seine in Raum und Zeit bedingte Welt im Innern auf eigene Hand und überläßt jene Funktionen einem andern uns inwohnenden Prinzip? – Wie ungereimt! (S. 33f.; Hervorhebungen von mir)
Und er schließt: „Ist es nun also der Geist allein, der die Begebenheit vor uns erfaßt, so hat sich das auch wirklich begeben was er dafür anerkennt“ (ebd.). Der Einsiedler behauptet damit einen Automatismus zwischen der Außenwelt und dem Geist in der Innenwelt; und zwar in der Art, dass alles, was der Geist wahrnimmt,[36] sich tatsächlich dementsprechend in der Außenwelt begeben haben muss. Umgekehrt müssen hiernach auch innere Offenbarungen ihr Pendant in der Außenwelt haben.[37]
Dem Einsiedler ist es in seinem Wahnsinn offenbar gelungen, die Duplizität von Außen- und Innenwelt zu ignorieren.[38] Die Serapionsbrüder stehen jedoch einer derartigen Flucht in den Wahnsinn keineswegs kritiklos gegenüber,[39] worauf sie genauer allerdings erst nach dem Vortrag einer weiteren Erzählung, der Geschichte vom Rat Krespel, zu sprechen kommen.
2.1.2 „Rat Krespel“. Von der Duplizität des Daseins und dem Geheimnis der Kunst
Theodor führt mit dem Rat Krespel einen kunstaffinen „gelehrte[n] und gewandte[n] Jurist[en]“ (S. 39)[40] vor, der – nach Stefan Ringel – „[…] unter dem Dualismus zwischen den Erscheinungen in seinem Innern und den Gegebenheiten der Außenwelt (leidet)“.[41] Hiermit charakterisiert Ringel die Situation meines Erachtens jedoch nicht hinreichend genau. Das Problem liegt dabei in der undifferenzierten Verwendung der Begriffe „Dualismus“ und „Duplizität“, wie sie in der Hoffmann-Forschung immer wieder zu bemerken ist.[42] Klaus Deterding plädiert zu Recht wiederholt für den differenzierten Begriffsgebrauch.[43]
In Annäherung an die Handlungsmotivation des Rates sei zunächst nun die aufschlussreiche Schilderung seines Hausbaus genauer besehen. Krespel entwickelt die Idee des Ganzen in seinem Geist und verzichtet dabei auf jeglichen „Bauriß“ (S. 40), einen vorweisbaren äußeren Plan gibt es nicht. Freilich ist der Baumeister hierüber verwundert und erachtet das Vorhaben als „unsinnigen Bau“ (S. 41) – schließlich bleibt ihm (wie allen anderen) Krespels innere Konzeption verborgen. So wird der Erwartungshorizont der Handwerker und Zuschauer kontinuierlich durchbrochen; beispielsweise, wenn „wieder ein neues Fenster entstand, da wo man es gar nicht vermutet hatte“ (ebd.). Gleichwohl sprechen die sorgfältige Vorbereitung der Baumaterialien sowie die äußerste Präzision der Anweisungen des Rates allemal gegen ein bloß willkürliches Unternehmen.
Wenig später
stand ein völlig eingerichtetes Haus da, welches von der Außenseite den tollsten Anblick gewährte […], dessen innere Einrichtung aber eine ganz eigene Wohlbehaglichkeit erregte. (S. 42; Hervorhebungen von mir)
Dieser Kontrast von äußerer und innerer Erscheinung ist bestimmend für die Erzählung insgesamt: denn Krespel nimmt nun (was angesichts der gelungenen Konstruktion des Hauses nur konsequent erscheint) an, dass „im Innern einer materiellen Repräsentation das gesuchte schöpferische Geheimnis […] verborgen sei“.[44] Jene Annahme stellt sich im weiteren Verlauf der Erzählung als Voraussetzung für Krespels Handeln heraus.
Zunächst ist nun allerdings ein Blick auf seine Tochter Antonie unabdingbar, die dem Rat als endliche Verkörperung des Unendlichen erscheint und damit wiederum eine Einheit verkörpert, die seinem Wesen fremd ist und nach der er sich sehnt. Antonie ist
das einzige Wesen auf der weiten Welt, das nie gekannte Lust in ihm entzündet, das allein ihn mit dem Leben versöhnte […]. (S. 61)[45]