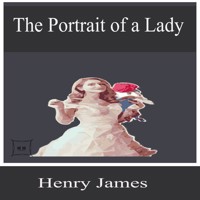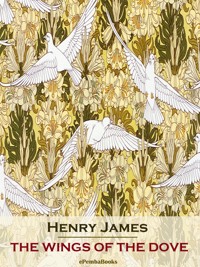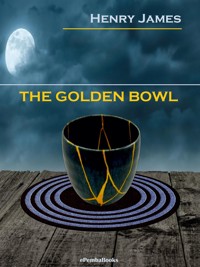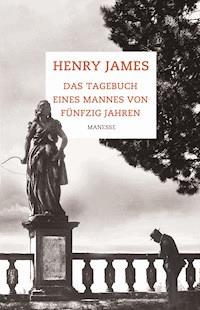
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten über Selbsttäuschung und versäumte Liebe, geheimnisvolle Entsprechungen und Reisen zwischen Alter und Neuer Welt: Die sechs Erzählungen dieses Bandes präsentieren Henry James als begnadeten Ironiker, eleganten Stilisten und scharfen Analytiker. Erstmals ins Deutsche übertragen, bestätigen sie seinen Ruf als Liebling aller Literatur-Connaisseure.
Florenz ist Schauplatz der titelgebenden Erzählung, deren Held – Angehöriger der britischen Armee – auf den Spuren einer verflossenen Leidenschaft wandelt. Während er seine eigene Vergangenheit Revue passieren lässt, wird er unversehens zum Berater eines jungen Paares, dessen Geschichte verblüffende, ja beinahe unglaubliche Ähnlichkeit mit dem Erinnerten aufweist ... James’ distanziert-intellektuelle Erzählweise ermöglicht mühelos den Brückenschlag in die Gegenwart. Überrascht stellt man fest: Seine Helden sind mit ihren seelischen Nöten, ihrer meist vergeblichen Liebes- und Glückssuche unsere Zeitgenossen. Dieser Band hebt mit «Die entscheidende Bedingung», «Louisa Pallant», «Der Beldonald-Holbein», «Die Eindrücke einer Cousine» und «Der spezielle Fall» fünf weitere Schätze aus Henry James’ reichem Werk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
HENRY JAMES
Das Tagebuch eines Mannes von fünfzig Jahren
Erzählungen
Aus dem Englischen übersetzt von Friedhelm Rathjen
Nachwort von Maike Albath
MANESSE VERLAGZÜRICH
LOUISA PALLANT
I
Man behaupte nie, bis ins Letzte über ein menschliches Herz Bescheid zu wissen. Mir enthüllte sich einmal auf eine Weise, die mich erschreckte und berührte, etwas über eine Person, mit der ich seit Jahren bekannt war (nun, so glaubte ich jedenfalls), deren Charakter zu schätzen ich, weiß der Himmel, gute Gründe hatte und betreffs welcher, wie ich mir selbst schmeichelte, ich nichts mehr hinzulernen konnte.
Es geschah auf der Terrasse des Kursaals von Homburg, vor beinahe zehn Jahren, eines entzückenden Abends gegen Ende Juli. Ich war an jenem Tag mit unklaren Absichten von Frankfurt aus dort angereist und war vornehmlich damit beschäftigt, auf einen jungen Neffen zu warten, den einzigen Sohn meiner Schwester, der meiner Obhut von einer sehr liebevollen Mutter für den Sommer anvertraut worden war (von mir wurde erwartet, ihm Europa zu zeigen – natürlich nur das Allerbeste daran) und der von Paris aus kommend im Begriff war, sich mir zuzugesellen. Das vortreffliche Orchester gab Musik zum Besten, die nicht übermäßig schwer zugänglich war, und erfüllt war die Luft zudem von Gemurmel in diversen Sprachen, dem Rauch vieler Zigarren, dem Knirschen schlendernder Schuhe auf den Kieswegen der Gärten und dem heftigen Geklirr von Biergläsern. Wohl hundert Leute spazierten umher, wieder andere saßen in Trauben an kleinen Tischen und viele auf Bänken und Stuhlreihen und sahen den übrigen zu, als hätten sie für das Privileg bezahlt und seien nun einigermaßen enttäuscht. Ich war unter diesen Letzteren; ich saß für mich allein, rauchte meine Zigarre und dachte an nichts Bestimmtes, während Familien und Paare ein ums andere Mal an mir vorbeigingen.
Ich kann mich kaum erinnern, wie lange ich da gesessen hatte, als ich eines Wiedererkennens gewahr wurde, das meinem Sinnieren ein Ende setzte. Mir selbst wiederfuhr es, und der Gegenstand des Wiedererkennens war eine Dame, die, ohne meine Aufmerksamkeit bemerkt zu haben, mit einem jungen Mädchen an der Seite auf und ab spazierte. Ich hatte sie seit zehn Jahren nicht gesehen, und was mir als Erstes auffiel, war nicht etwa der Umstand, dass es sich um Mrs. Henry Pallant handelte, sondern dass das in ihrer Begleitung befindliche Mädchen bemerkenswert hübsch war – oder vielmehr als Allererstes, dass alle, die ihr begegneten, sich nach ihr umdrehten. Dies veranlasste auch mich, die junge Dame in Augenschein zu nehmen, und ihr bezauberndes Antlitz lenkte meine Aufmerksamkeit eine gewisse Zeit lang von demjenigen ihrer Begleiterin ab. Letztere trug zudem, obwohl es Abend war, einen dünnen leichten Schleier, unter dem ihre Gesichtszüge verschwammen. Das Paar war immerzu in Bewegung, gemächlich, doch obwohl sie still und schicklich waren, und gut angezogen obendrein, schienen sie keine Freunde zu haben. Jedermann beäugte sie, doch niemand sprach sie an; sie schienen sogar miteinander nur sehr wenig zu reden. Überdies nahmen sie die Aufmerksamkeit, die sie erregten, mit äußerster Gelassenheit und auf eine Weise hin, als wäre ihnen das alles äußerst vertraut. Ich fürchte, mich überkam der Impuls, stillschweigend davon auszugehen, dass sie nicht ganz honorig waren und dass die ältere Dame, wenn sie’s doch gewesen wären, sicherlich die jüngere ein bisschen besser von den aufdringlichen Blicken der Öffentlichkeit abgeschirmt und sich weniger geschämt hätte, ihr eigenes Gesicht preiszugeben. Vielleicht hatte ich solcherlei Fragen in jenem Moment einfach zu sehr im Hinterkopf – im Zusammenhang mit meiner mir bevorstehenden Rolle als Mentor meines Neffen. Wenn ich ihm von Europa nur das Allerbeste zeigen sollte, musste ich einige Umsicht walten lassen betreffs der Leute – insbesondere der Damen –, die er kennenlernen, und der Beziehungen, die er zu ihnen aufnehmen sollte. Ich vermutete, dass er mit dem Leben noch sehr wenig vertraut war, und dachte mit einiger Unruhe an meine Verantwortung. War ich wirklich uneingeschränkt erleichtert und beschwichtigt, als ich erkannte, dass ich einfach nur Louisa Pallant vor mir hatte und dass es sich bei dem Mädchen um ihre Tochter Linda handelte, die ich als Kind erlebt hatte – nunmehr zu einer richtigen Schönheit herangereift?
Diese Frage ist knifflig, und als Beweis meiner Unsicherheit mag der Umstand dienen, dass ich es unterließ, die Damen sogleich anzusprechen. Ich beobachtete sie ein Weilchen – ich fragte mich, was sie wohl treiben mochten. Nichts weiter Schlimmes sicherlich; aber es drängte mich, zu sehen, ob sie wirklich gänzlich isoliert waren. Homburg ist als Sommerfrische bei den Engländern sehr beliebt – die Londoner Saison schwappt um den ersten August herum dort hinüber –, und ich hatte die Vorstellung, in einer solchen Gesellschaft müsse Louisa wohl naturgemäß die einen oder anderen Leute kennen. Mein Eindruck war der, dass sie das Englische «kultivierte», dass sie viel Zeit in London verbracht hatte und sehr wahrscheinlich darüber nachdachte, sich dort dauerhaft anzusiedeln. In dieser Annahme wurde ich durch den Anblick von Lindas Schönheit noch bestärkt, denn ich wusste, es gibt kein Land, in dem eine hübsche Person mehr geschätzt wird. Man sieht also, ich ließ mir Zeit, und ich muss zugeben, als ich mit meiner Zigarre fertig war, dachte ich, damit sei nun auch diese Episode beendet. Tatsächlich gab es keine guten Gründe, warum ich Mrs. Pallant überstürzt in die Arme hätte fallen sollen. Sie hatte mich nicht gut behandelt, und das hatten wir nie richtig aus der Welt geschafft. Irgendwie hatte nicht einmal der Umstand, dass ich (nach dem ersten Schmerz) ganz froh war, sie verloren zu haben, die Dinge zwischen uns wieder völlig ins Lot bringen können; ebenso wenig hatte es, was ihre Seite betraf, die Scham über ihr herzloses Verhalten schmälern können, dass sich der arme Pallant am Ende doch als keine so gute Partie erwiesen hatte. Ich hatte ihr vergeben; es war da nicht mehr als lediglich das Gefühl, noch einmal glücklich davongekommen zu sein, weil es mir versagt geblieben war, ein Mädchen zu heiraten, das imstande war, das einmal gegebene Wort zurückzunehmen und einem Kerl das Herz zu brechen, und das alles bloßer Fleischtöpfe wegen – oder vielmehr der vagen Aussicht auf Fleischtöpfe wegen, wie sich bedauernswerterweise herausstellte; zudem waren wir einander in der Zwischenzeit schon begegnet, angelegentlich meines früheren Aufenthalts in Europa; wir hatten einander in die Augen gesehen, wir hatten so getan, als seien wir beste Freunde, und hatten so unerschüttert von der Schlechtigkeit der Welt gesprochen, als wären wir die einzig Gerechten, die einzig Reinen. Ich wusste da schon, was sie herumerzählt hatte – dass ich sie mit meiner wahnsinnigen Eifersucht in die Flucht geschlagen hätte, bevor sie auch nur einen Gedanken an Henry Pallant verschwendet habe, bevor sie sich überhaupt je mit ihm getroffen habe. Dies war damals keine Grundlage für einen echten Neubeginn und konnte es auch heute nicht sein, insbesondere wenn man dann noch berücksichtigt, dass sie bestens wusste, was ich über sie dachte. Es ist meine Überzeugung, dass es einer Freundschaft meistens nicht zum Vorteil gereicht, wenn mein Freund meine wahre Meinung kennt, denn er kennt sie hauptsächlich dann, wenn es eine ungünstige ist, und dies gilt insbesondere dann, wenn (falls ich das so schief ausdrücken darf) er eine Frau ist. Ich hatte das Schicksal von Mrs. Pallant nicht weiter verfolgt; die Jahre gingen dahin, meine Jahre in meinem eigenen Land, während sie ihr Leben, von dem ich vage annahm, nach dem Tod ihres Mannes müsse es ein schwieriges sein – praktisch von Bankrott gezeichnet –, in fremden Ländern zubrachte. Von Zeit zu Zeit hörte ich das eine oder andere über sie; immer, dass sie sich irgendwo «eingerichtet» habe, allerdings stets an einem anderen Ort. Sie ließ sich von einem Land ins andere treiben, und hatte sie sich schon anfangs hart gegeben, so konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie durch ihren Kampf mit der Gesellschaft, wie man es nennen mochte, die Dinge aufgeweicht hatte. Immer, wenn ich hörte, dass eine Frau «fürchterlich weltgewandt» genannt wurde, musste ich unwillkürlich an das Objekt meiner frühen Leidenschaft denken. Ich stellte mir vor, sie müsse Schulden haben, und als ich mich nunmehr entschloss, mich ihr in Erinnerung zu bringen, da rechnete ich durchaus damit, sie könnte mich bitten, ihr Geld zu leihen. Mehr als alles andere hatte ich nun, zu so später Stunde, Mitleid mit ihr, weswegen dieser Gedanke mich nicht abschrecken konnte.
Sie tat hinterher so, als hätte sie mich gar nicht bemerkt – gab sich sehr überrascht und wollte wissen, wo ich denn so plötzlich hergekommen sei; aber ich glaube, aus den Augenwinkeln hatte sie mich schon beobachtet und abgewartet, um zu sehen, was ich tun würde. Am Ende war sie mit ihrem Mädchen in derselben Stuhlreihe wie ich zu sitzen gekommen, und als nach einem Weilchen der Platz neben ihr frei wurde, ging ich und stellte mich vor sie hin. Sie schaute einen Moment lang zu mir auf und starrte mich an, als hätte sie keinerlei Ahnung, wer ich war oder was ich wollte; dann brach es, während sie lächelte und mir ihre Hände hinstreckte, aus ihr heraus: «Ach, mein lieber alter Freund – was für eine Freude!» Wenn sie abgewartet hatte, um zu sehen, was ich tun würde, und dann ihr eigenes Verhalten danach zu richten, dann setzte sie dieses Verhalten jedenfalls mit äußerster Anmut um. Sie gab sich herzlich, freundlich, ungekünstelt, interessiert, und tatsächlich bin ich mir sicher, dass sie sich sehr freute, mich zu sehen. Ich kann aber auch gleich erwähnen, dass sie weder in jenem Moment noch später irgendein Anzeichen dafür an den Tag legte, sich Geld leihen zu wollen. Sie hatte nicht allzu viel – so viel erfuhr ich –, aber bis auf Weiteres schien sie in der Lage, ihre Ausgaben zu bestreiten. Ich nahm mir den freien Stuhl, und wir unterhielten uns eine Stunde lang. Nach einer Weile bat sie mich, auf ihrer anderen Seite Platz zu nehmen, neben ihrer Tochter, die mich als einen ihrer ältesten Freunde kennen – und lieben – lernen sollte. «Das reicht weit, weit, weit zurück, nicht wahr?», sagte Mrs. Pallant. «Und natürlich erinnert sie sich noch aus Kindertagen an Sie.» Linda lächelte ganz süß und unbestimmt, und ich konnte sehen, dass sie sich ganz und gar nicht an mich erinnerte. Als ihre Mutter andeutete, sie hätten häufig über mich gesprochen, sprang sie keineswegs darauf an, wiewohl sie über die Maßen nett dreinschaute. Nett dreinzuschauen war eine ihrer Stärken; sie war sogar noch hübscher, als ihre Mutter es gewesen war. Sie war eine solche kleine Dame, dass ich mich schämte, sie, was ihre Schicklichkeit betraf, falsch eingeschätzt zu haben, wenn auch nur andeutungsweise und einen Moment lang. Ihre äußere Erscheinung schien zu besagen, wenn sie keine Bekanntschaften hatte, dann nur, weil sie keine wollte – weil es hier niemanden gab, der ihr anziehend vorkam; sie hatte nicht die geringsten Probleme, sich ihre Freunde selbst auszusuchen. Linda Pallant sah, so jung sie auch war, und frisch und fein und reizend und sanftmütig und hinreichend schüchtern, irgendwie über alles erhaben aus – als sei der Staub der gewöhnlichen Welt niemals dazu vorgesehen gewesen, auf sie herabzusinken. Sie war schlichter als ihre Mutter und ging als junge Frau ganz offensichtlich keinerlei Beschäftigung nach – abgesehen davon, dass sie darin geübt war, einem mit ihrem strahlenden, reinen, intelligenten Lächeln ihr Interesse zu bekunden. Ein Mädchen, das einem auf so entzückende Weise ihre Zähne zeigte, konnte niemals als herzlos gelten.
Während ich so zwischen den beiden saß, spürte ich, dass sie von mir Besitz ergriffen hatten und dass mein Aufenthalt in Homburg nun, ob ich wollte oder nicht, eng mit dem ihren verflochten war. Wir erzählten einander sehr viele Neuigkeiten und brachten ein uneingeschränktes Interesse an dem zum Ausdruck, was dem jeweils anderen seit unserer letzten Begegnung alles widerfahren war. Ich weiß nicht, was Mrs. Pallant für sich behielt, aber ich jedenfalls war überaus offenherzig. Immerhin gab sie mir so viel preis, dass ihr Leben weitgehend so aussah, wie ich angenommen hatte, nur dass die Worte, in welchen sie es beschrieb, nicht so grob waren wie die meiner Gedanken. Sie räumte ein, dass sie sich hatten treiben lassen und dass sie sich immer noch treiben ließen. Ihr Bericht geriet recht ausschweifend und war von einer Qualität, die man umgangssprachlich als ziemlich durchwachsen bezeichnen würde, was, wie mir schien, auch Linda bemerkte, während sie dasaß, ohne ihrer Mutter zu Hilfe zu kommen, und die Passanten in einer Weise betrachtete, die keinerlei Bewusstsein für deren Interesse erkennen ließ. Das eine oder andere Mal gab Mrs. Pallant mir das Gefühl, sie einem Kreuzverhör zu unterziehen, was ich freilich keineswegs wollte. Ich kam zu dem Schluss, wenn das Mädchen niemals ein Wörtchen einwarf, dann wohl, weil sie vollkommen auf die Fähigkeit ihrer Mutter vertraute, sich verständlich zu machen. Mir wurde der Eindruck vermittelt, ohne dass ich recht wusste wie, dass dieses wechselseitige Vertrauen zwischen den beiden Damen sehr weit reichte; dass der Einklang ihres Denkens, ihr System des geradezu hellseherischen Bescheidwissens übereinander, ganz bemerkenswert war und dass sie wohl selten zu dem umständlichen und in manchen Fällen gefährlichen Hilfsmittel greifen mussten, ihre Gedanken in Worte zu fassen. Ich nehme an, diese Überlegung stellte ich nicht sofort an – sie war nicht allein Ergebnis jener ersten Begegnung. Ich befand mich in den nächsten paar Tagen unablässig in ihrer Gesellschaft, und meine Eindrücke hatten Zeit, sich herauszukristallisieren.
Ich weiß aber noch, dass schon bei dieser ersten Begegnung Archies Name gefallen ist. Sie verknüpfte ihren eigenen Aufenthalt in Homburg nicht mit irgendeinem beflissenen oder auftrumpfenden Beweggrund – sagte nicht, sie sei hier, weil sie immer herkomme oder weil irgendeine große ärztliche Kapazität sie angewiesen habe, das Wasser zu sich zu nehmen; sie gab ganz offen zu, der Grund ihres Besuchs sei schlichtweg der, dass ihr partout kein anderes Ziel eingefallen sei. Sie schien aber anzunehmen, dass meine Entscheidung auf edleren Beweggründen beruhte und sogar erklärungsbedürftig sei, wo diese Örtlichkeit doch recht frivol und modern sei – nichts von jenem altertümlichen Charme an sich habe, den ich immer so geschätzt hatte. «Wissen Sie nicht mehr – ach, ist das lange her –, dass Sie sich immer geweigert haben, sich in Europa irgendetwas anzuschauen, was nicht mindestens tausend Jahre alt war? Nun, ich nehme an, mit fortschreitendem Lebensalter halten wir das nicht mehr für gar so einen großen Vorzug.» Und als ich ihr erzählte, ich sei nach Homburg gekommen, weil ich hier ebenso gut wie anderswo auf meinen Neffen warten könne, rief sie aus: «Ihr Neffe – was für ein Neffe? Der muss aber spät auf der Bildfläche erschienen sein.» Ich antwortete, es handele sich um einen jungen Bengel namens Archer Pringle und er gehöre in der Tat zur heutigen Generation; er werde in einigen Monaten volljährig und sei zum ersten Mal in Europa. Die letzten Nachrichten hätte ich von ihm aus Paris erhalten, und ich rechnete tagtäglich damit, von ihm zu hören. Sein Vater sei tot, und wiewohl ich ein selbstsüchtiger Junggeselle und kaum darin bewandert sei, mich um Kinder zu kümmern, setze seine Mutter doch beträchtliche Hoffnungen darauf, dass ich ihn davor bewahrte, zu viel zu rauchen oder von einem Alpengipfel zu stürzen.
Mrs. Pallant erriet sogleich, dass es sich bei seiner Mutter um meine Schwester Charlotte handelte, von der sie sprach, als kennte sie sie gut, wiewohl ich wusste, dass sie sie nur ein- oder zweimal gesehen hatte. Dann, urplötzlich fiel ihr wieder ein, welchen Pringle Charlotte geheiratet hatte; sie erinnerte sich lückenlos an die Familie, wie sie in den alten New Yorker Tagen gewesen war – «diese abstoßend reiche Sippe». Sie sagte, es sei doch sehr nett, dass der Junge solchermaßen einmal heraus und in meine Obhut komme; worauf ich antwortete, sehr nett sei es vor allem für ihn. Sie erklärte, sie meine, für mich – ich hätte Kinder haben sollen; ich hätte so eine erzieherische Ader und hätte sie bestimmt prächtig großgezogen. Sie konnte eine Anspielung dieser Art machen – auf alles, was hätte sein können und nicht eingetreten war –, ohne dass der leichteste Anflug von Schuldgefühlen in ihrem Auge schimmerte; und ich sah schon voraus, dass ich ihr, bevor ich diesen Ort wieder verließ, anvertraut haben würde: Wiewohl ich sie verabscheute und heilfroh war, dass wir uns entzweit hatten, habe mir unsere seinerzeitige Beziehung doch nicht genug Herzenskraft gelassen, um eine andere Frau zu heiraten. Wenn ich heute ein verschwatzter alter Junggeselle war, dann war niemand anderes daran schuld als sie. Sie fragte mich, was ich mit meinem Neffen vorhatte, und ich sagte, die Frage sei wohl eher, wozu er mit mir bereit sein werde. Sie wollte wissen, ob er ein netter junger Mann sei, Brüder und Schwestern habe und irgendeinen bestimmten Beruf. Ich erzählte ihr, ich hätte ihn wahrhaftig nicht viel zu Gesicht bekommen; meines Wissens sei er einen Meter achtzig groß und ganz gut gebaut. Er war der einzige Sohn, aber zu Hause gab’s noch eine kleine Schwester, ein zartes, anfälliges Kind, das aller mütterlichen Sorge bedürftig sei.
«Das macht Ihre Verantwortung in Sachen des Jungen also sozusagen noch größer, oder?», sagte Mrs. Pallant.
«Größer? Ich weiß nicht recht, was Sie meinen.»
«Na, wenn das Leben des Mädchens auf wackligen Füßen steht, könnte er von einem Augenblick auf den nächsten alles sein, was der Mutter bleibt. Sodass er, wenn er in Ihren Händen …»
«Oh, ich denke, ich werde es schon hinkriegen, dass er überlebt, falls Sie das meinen», erwiderte ich.
«Nun, wir werden ihn nicht umbringen, was, Linda?», fuhr Mrs. Pallant mit einem Lachen fort.
«Ich weiß nicht – vielleicht doch!», sagte das Mädchen lächelnd.
II
Ich sprach am nächsten Tag in ihrem Quartier vor, dessen bescheidenem Standard durch hundert hübsche weibliche Kunstgriffe auf die Sprünge geholfen wurde – durch Blumen und Fotos und mitgebrachten Nippes und ein gemietetes Klavier und Stoffreste aus altem Brokat, die über Ecksofas drapiert worden waren. Ich lud sie auswärts ein; ich traf mich im Kursaal wieder mit ihnen; ich richtete es so ein, dass wir nach Homburger Manier an derselben table d’hôte1 miteinander speisten; und über einige Tage hinweg wurde dieser wiederbelebte altbekannte Verkehr fortgeführt, eine Vertraulichkeit zumindest imitierend, wenn auch vielleicht nicht recht erreichend. Mir gefiel das, denn meine Begleiterinnen ließen mir die Zeit nicht lang werden, und die Umstände unseres tagtäglichen Lebens waren wohltuend – das Gefühl von Sommer, Schatten, Musik und Freizeit inmitten der deutschen Gärten und Wälder, in denen wir spazieren gingen, herumsaßen und plauderten; hinzu kam noch das Gefühl einer gewissen ungezwungenen Geselligkeit, weil wir inmitten von Menschen, die kennenzulernen durchaus keinen unwiderstehlichen Reiz für uns darstellte, recht gut unter uns bleiben konnten. Wir verkehrten miteinander als alte Freunde, die in Bezug auf einander immer noch überraschende Entdeckungen zu machen hatten. Ein jeder war mit dem Wesen des anderen vertraut, aber nicht mit den Erlebnissen; sodass, als Mrs. Pallant mir berichtete, worauf sie es so viele Jahre lang (wie ich es nannte)«abgesehen» gehabt hatte, mein früheres Wissen diese spannende Seite um hundert interpretierende Fußnoten ergänzte (als würde ich als Herausgeber eines Autors fungieren, dessen Text Schwierigkeiten bereitete). Es war für mich nichts Neues, dass ich sie nicht recht wertschätzen konnte, aber es war auf gewisse Weise erfrischend, feststellen zu dürfen, dass dies in Homburg auch gar nicht notwendig war und dass es mir trotzdem gelang, sie zu mögen. Es kam mir vor, als habe sie sich auf höchst seltsame Weise gleichzeitig gebessert und verschlechtert, als wären in ihrem Wesen beide Prozesse gemeinsam fortgeschritten. Sie war ramponiert, vom Lauf der Welt versehrt und in geistiger Hinsicht verdorben; eine gewisse Frische, die sie besessen hatte, hatte sich abgenutzt (das galt selbst für die Lebhaftigkeit ihres früheren Verlangens, immer das zu tun, was für sie selbst am besten war), und dafür war sie von einer gewissen Fadheit überzogen. Andererseits legte sie teilweise Skepsis an den Tag, und das war durchaus von Vorteil, denn dadurch hatte sich jener Feuereifer abgekühlt, der seinerzeit in seinem Auftreten so unglückliche Folgen für mich hatte. Sie war müde und gleichgültig geworden, und wenn sie mir so vorkam, als habe sie vom Bösen auf der Welt mehr zu sehen bekommen als vom Guten, so war das von Vorteil; der Zynismus, der sich in ihrem Wesen ausgebildet hatte, besaß mit anderen Worten eine sanftere Oberfläche als die eine oder andere ihrer früheren Ambitionen. Und dann musste ich auch anerkennen, dass die Hingabe, die sie ihrer Tochter zuteilwerden ließ, etwas Religiöses hatte; sie hatte für Linda das absolut Bestmögliche getan.
Linda war erstaunlich – Linda war interessant; ich habe Mädchen erlebt, die ich mehr mochte (so reizend sie auch war), aber ich habe nie eins erlebt, das mich dann, wenn wir zusammen waren (dieser Eindruck verlor sich irgendwie, wenn sie außer Sichtweite war), mehr beschäftigt hätte. Am besten kann ich die Art von Aufmerksamkeit, die sie erregte, wohl beschreiben, indem ich sage, sie kam einem vor allem wie ein zum Abschluss gelangtes Produkt vor – ebenso wie das bei einer Pflanze oder einer Frucht der Fall ist, einer wachsbleichen Orchidee oder einem vollkommenen Pfirsich. Mehr als jedes andere Mädchen, das ich je erlebt habe, war sie das Resultat eines Prozesses der Berechnung; eines Prozesses geduldigster Erziehung; eines Drucks, der ausgeübt worden war, um sie zum Punkt höchster Vollendung zu treiben. Dieser Punkt höchster Vollendung war der Stern am Himmel ihrer Mutter gewesen (er hing so bestimmt und endgültig hoch droben über ihr) und auch die Quelle des einzigen Lichts – in Ermangelung eines besseren –, das der bedauernswerten Dame auf ihrem Pfad voranleuchtete. Er stand ihr bei anstelle jeder anderen Religion. Das allermeiste und das Allerbeste – das war, was zu erreichen das Mädchen angeleitet worden war; ich meine natürlich (denn es war kein wirkliches Wunder erwirkt worden) das meiste und Beste, das ihr erreichbar war. Sie war so hübsch, so anmutig, so intelligent, so wohlerzogen, so kenntnisreich, so gut gekleidet, wie es ihr möglich war; ihre Fertigkeiten in der Musik, im Gesang, im Deutschen, im Französischen, im Englischen, im Schreiten, im Sprechen, im Schauen, im Betragen und überhaupt alles an ihrer Person und ihren Bewegungen, von den Locken und Schattierungen ihrer Haare bis zur Art und Weise, den anderen zu zeigen, dass ihre Fingernägel rosig waren, wenn sie die Hand hob, waren auf einem derart hohen Niveau, dass man all das unwillkürlich als eine Art Standard akzeptierte. Ich sah sie als eine Art Modell an, und doch war es auch Merkmal ihrer Perfektion, dass sie nichts von der Steifheit eines Musters an sich hatte. Wenn sie anhaltende Aufmerksamkeit heischte, dann nur, weil man gespannt war, wo und wann sie patzen würde; doch sie patzte nie, weder bei ihrer französischen Betonung noch in ihrer rôle2 als gebildeter Engel.
Nachdem Archie dazugekommen war, waren die Damen ihm sichtlich ein großartiger Freudenquell, und alle Welt weiß ja, dass eine vierköpfige Gesellschaft günstiger ist als eine dreiköpfige. Mit der ihm ganz eigenen Gemütsruhe ließ mein Neffe mich eine Woche lang warten; doch diese Gemütsruhe war auch ein Eckpfeiler des Erfolgs unserer persönlichen Beziehungen – solange ich nicht die Geduld verlor, heißt das. Meistenteils verlor ich sie nicht, weil die Art und Weise, in der mein junger Mann die diversesten Formen glücklicher Fügungen ohne alle Überraschtheit wie selbstverständlich hinnahm, mehr als alles andere den Effekt hatten, mich zu amüsieren. Die letzten drei oder vier Jahre hatte ich ihn so gut wie gar nicht gesehen. Ich hatte keine Ahnung, wie seine bevorstehende Mündigkeit ihn verändert haben mochte (er sah nicht im mindesten so aus, als würde er demnächst in die Vollen gehen können), und ich achtete mit einer Besorgtheit auf ihn, die am Ende in der Regel zum Lachen war. Er war ein großer junger Mann von frischem Aussehen, mit einem aufrichtigen runden Gesicht und einer Liebe zu Zigaretten, Pferden und Schiffen, die noch nicht auf dem Altar intellektuellerer Interessensgebiete geopfert worden war. Er war erfrischend natürlich für unser überzivilisiertes Zeitalter, und ich kam ziemlich schnell zu dem Schluss, die Formel für seinen Charakter sei ein gewisser vereinfachender Gleichmut. Später hatte ich Zeit, über die Grenze nachzusinnen, die Gleichmut von Dummheit und Vereinfachung von Tod abhebt. Archie war nicht intelligent – diese Theorie zu verfechten war unmöglich, wiewohl Mrs. Pallant es ein-, zweimal versuchte; aber andererseits schien mir, dass sein Mangel an Scharfsinn eine gute Abwehrwaffe war. Es war nicht die Art Vernageltheit, die einen irgendwo baden gehen lässt, sondern die Art, die einen von etwas abhält. Womit ich nicht gesagt haben will, dass er an kurzsichtigen Verdächtigungen litt, sondern ganz im Gegenteil, dass es nie der Fantasie bedürfen würde, ihn zu retten, weil dieselbe ihn auch nie in Gefahr bringen würde. Er war, kurz gesagt, ein gut gebauter, reinlicher, muskulöser junger Amerikaner, dessen extreme Gutmütigkeit ihn als arrogant durchgehen ließ. Wenn er den Eindruck erweckte, er sei mit sich zufrieden, so rührte dies nur daher, dass er mit dem Leben zufrieden war (was er auch durchaus sein durfte angesichts des Geldes, das in Kürze das seinige sein würde), und sein herzlich gesundes, unabhängiges Wesen trug unabdingbar dazu bei. Ich muss unbedingt noch hinzufügen, dass er entgegenkommend war – wofür ich dankbar war. Seine eigenen Vorlieben waren aktiver Natur, aber er bestand nicht darauf, dass ich sie übernahm, und um meiner Gesellschaft willen brachte er beachtliche Opfer. Wenn ich sage «um meiner Gesellschaft willen», so darf ich natürlich nicht vergessen, dass meine Gesellschaft und diejenige von Mrs. Pallant und Linda nunmehr weitgehend identisch waren. Er fand sich dazu bereit, stundenlang unter den Bäumen zu sitzen und zu rauchen oder, die Schritte seiner langen Beine dem Tempo seiner drei Gefährten anpassend, durch die nächstgelegenen Wälder des reizenden kleinen Höhenzugs des Taunus zu jenen Wirtschaften3 zu schlendern, wo man unter einem Rankgitter Kaffee trinken konnte.
Mrs. Pallant zeigte beträchtliches Interesse für ihn; sie sprach sehr viel von ihm und betrachtete ihn als prächtiges Exemplar eines jungen Gentleman seiner Zeit und seines Landes. Sie fragte mich sogar nach der Größenordnung der «Zahl», auf die sich sein Vermögen wohl tatsächlich belaufen mochte, und brachte nagendste Neidgefühle zum Ausdruck, als ich meine Schätzung preisgab. Während wir uns unterhielten, konnte Archie seinerseits gar nicht mehr davon ablassen, mit Linda zu konversieren, und um die Wahrheit zu sagen, ließ er auch nicht die geringste Neigung zu anderweitigen Verrichtungen erkennen. Sie schlenderten davon, während ihre Altvorderen ruhten; zwei- oder dreimal, des Abends, wenn der Ballsaal im Kurgebäude4 hell erleuchtet war und Tanzmusik gespielt wurde, wirbelten sie über das glatte Parkett, einen Walzer tanzend, der bei mir Erinnerungen weckte. Ob sich bei Mrs. Pallant der nämliche Effekt einstellte, weiß ich nicht, denn sie äußerte sich nicht. Wir beide erlebten bei gewissen Gelegenheiten unsere Momente, beinahe schon halbe Stunden, ungenierten Schweigens, während unsere jungen Begleiter sich vergnügten. Wenn aber zu anderen Zeiten ihre Erkundigungen und Kommentare betreffs meines naiven Verwandten zahlreich waren, so hätte dies auch gut als höfliche Entgeltung jener Bewunderung durchgehen können, die ich häufig für Linda zum Ausdruck brachte – eine Bewunderung, auf welche sie, wie ich bemerkte, kaum direkt zu reagieren pflegte. Mich verblüffte etwas Anormales an der Art und Weise, wie sie meine Bemerkungen über ihre Tochter aufnahm – sie hatten so arg wenig von dem üblichen mütterlichen Getue zur Folge. Ihre Distanziertheit, ihr Gestus, sich keinerlei törichten Illusionen hinzugeben und nicht von Vorurteilen blenden zu lassen, schienen mir zuweilen zur Affektiertheit zu verkommen. Entweder antwortete sie mit einem unbestimmten, leicht ungeduldigen Seufzen und wechselte das Thema, oder aber sie sagte zuvor noch: «O ja, ja, sie ist ein höchst prächtiges Geschöpf. Muss sie auch sein: Weiß Gott, was ich alles für sie getan habe!»
Der Leser wird bemerkt haben, dass ich den Dingen gern auf den Grund gehe, um sie mir erklären zu können, und im vorliegenden Falle war meine Theorie die, dass sie von dem Mädchen enttäuscht war. Worin bestand ihre spezielle Enttäuschung? Da sie sich das Mädchen wohl kaum noch hübscher oder ansprechender hätte wünschen können, war die einzige Erklärung, dass Linda ihre Gaben nicht mit entsprechendem Erfolg eingesetzt hatte. Hatte sie erwartet, sie werde sich einen Prinzen einfangen, gleich am Tag nachdem sie mit der Schule fertig war? Immerhin war für derlei noch reichlich Zeit, schließlich war Linda erst zweiundzwanzig. Es kam mir nicht in den Sinn, mich zu fragen, ob der mangelnde mütterliche Enthusiasmus vielleicht daher rühren mochte, dass die junge Dame sich in ihrem Wesen womöglich nicht so famos entwickelt hatte, wie zu hoffen war, weil Linda mir erstens vollkommen unschuldig vorkam und ich zweitens nicht dafür bezahlt wurde, wie die Franzosen sagen, dass ich glaubte, Louisa Pallant würde sich sonderlich darum scheren. Die letzte Hypothese, zu der ich Zuflucht hätte nehmen können, war diejenige einer privaten Verzweiflung über Symptome der Unmoral. Was Lindas Wesen betraf, hatte ich das tägliche Schauspiel ihres Betragens meinem Neffen gegenüber direkt vor der Nase. Dieses war so reizend, wie es nur sein konnte, ohne die kleinste Andeutung eines Verlangens, ihm etwas vorzumachen. Sie ging so vertraut mit ihm um wie eine Cousine, allerdings eine entfernte – eine Cousine, die dazu erzogen worden war, gewisse Unterschiede zu machen. Sie war so sehr viel klüger als Archie, dass sie unwillkürlich über ihn lachen musste, aber sie lachte doch nicht so sehr, dass es eintönig wurde, zweifellos aus dem Bewusstsein heraus, dass die Intelligenz einer Frau sich von der Dummheit eines Mannes dann am glänzendsten abhebt, wenn sie so tut, als halte sie diese Dummheit für Weisheit. Linda Pallant war zudem kein Plappermaul; wie sie um den Wert von vielerlei Dingen wusste, so wusste sie auch um den Wert von Pausen. Es gab reichlich viele in den Gesprächen dieser jungen Menschen; zumal meines Neffen Reden, von seinem Denken ganz zu schweigen, durchaus nicht ohne Erholungsphasen auskam, sodass ich mich bisweilen fragte, wie es nur angehen mochte, dass ihr Verkehr die Tonlage jener Freundschaft hielt, deren Merkmale nicht zu übersehen waren.
Ganz augenscheinlich war es ein Zeichen der Freundschaft, wenn Archie dicht an ihrer Seite saß – dicht genug, um leise flüstern zu können, falls ihm leise Flüsterworte auf die Lippen kamen – und sie mit interessierten Augen und in dem freien Bemühen betrachtete, sich nicht allzu deutlich Liebkind zu machen. Sie war immer mit irgendetwas beschäftigt – knüpfte eine Blume in einem Stück Wandteppich zu Ende, durchtrennte die Seiten einer Zeitschrift, nähte einen Knopf an ihren Handschuh (sie trug einen kleinen Handarbeitsbeutel in der Tasche und hatte die niedlichsten Angewohnheiten) oder werkelte mit ihrem Stift in einem Skizzenbuch, das sie sich auf die Knie gelegt hatte. Wenn wir drinnen waren, im Hause ihrer Mutter, konnte sie immer auf das Klavier zurückgreifen, das sie natürlich perfekt beherrschte. Diese nebenher ausgeführten Verrichtungen setzten sie in den Stand, solch emsige Inaugenscheinnahmen mit Fassung zu tragen (am Ende tadelte ich Archie doch dafür – ich sagte ihm, er starre das arme Mädel zu viel an), und ein weiteres Ventil fand sie darin, dass sie überall in der Gegend herumlächelte. Wenn die Augen meines jungen Mannes sie anfunkelten, wandten sich diejenigen von Miss Pallant strahlend den Bäumen und den Wolken und anderen sie umgebenden Dingen zu, ihre Mutter und mich eingeschlossen. Manchmal brach sie in ein plötzliches verlegenes, glückliches, sinnloses Lachen aus. Wenn sie ein Stück von uns fortschlenderte, warf sie uns einen Blick in einer Weise zu, die besagte, das sei nicht für lang – und im Geiste sei sie immer noch bei uns. Wenn ich mich an ihr freute, so hatte das seinen guten Grund: Es war schon ein paar Tage her, dass irgendein hübsches Mädchen sich die Mühe gemacht hatte, so viel Notiz von mir zu nehmen. Manchmal, wenn sie weit genug weg waren, um uns nicht zu stören, las sie Mr. Archie ein bisschen vor. Ich weiß nicht, woher sie ihre Bücher hatte – ich versorgte sie nie mit welchen, und er ganz gewiss auch nicht. Er war kein Leser, und ich wage zu behaupten, er muss dabei eingeschlafen sein.
III
Ich erinnere mich noch gut an das erste Mal – es war nach zehn Tagen von alldem –, dass Mrs. Pallant mir gegenüber bemerkte: «Mein lieber Freund, Sie verblüffen mich wirklich! Sie benehmen sich vor aller Welt so, als wären Sie absolut bereit, gewisse Konsequenzen zu akzeptieren.» Sie nickte in Richtung unserer jungen Gefährten, aber ich verlangte ihr dennoch die Mühe ab, zu sagen, welche Konsequenzen sie meine. «Welche Konsequenzen?», wiederholte sie. «Na, die Konsequenzen, die sich ergaben, als Sie und ich zum ersten Mal miteinander bekannt wurden.»
Ich zögerte einen Moment, und dann sagte ich, während ich ihr in die Augen schaute: «Meinen Sie, dass sie ihn sitzen lassen wird?»
«Das ist nicht nett von Ihnen, das ist nicht großmütig von Ihnen», entgegnete sie und errötete unwillkürlich. «Ich will Sie nur warnen.»
«Sie meinen, mein Junge könne sich in sie verlieben?»
«Gewiss doch. Es sieht sogar so aus, als wäre der Schaden womöglich schon angerichtet.»
«Dann kommt Ihre Warnung zu spät», sagte ich und lächelte. «Aber warum sprechen Sie von Schaden?»
«Denken Sie denn gar nicht an Ihre Verantwortung?», fragte sie. «Ist es das, wofür seine Mutter ihn zu Ihnen herübergeschickt hat – dass Sie ihm eine Frau besorgen, ihn seinen Kopf gleich am Tag nach seiner Ankunft in eine Schlinge stecken lassen?»
«Der Himmel bewahre, dass ich dergleichen tue! Ich weiß zudem, dass seine Mutter keine frühe Heirat wünscht. Sie findet, das sei ein Fehler, und in diesem Alter treffe ein Mann niemals wirklich eine Wahl. Eine Wahl treffe er erst, wenn er schon eine Weile gelebt habe – wenn er sich umgeschaut und Vergleiche angestellt habe.»
«Und was finden Sie selbst?»
«Ich würde sagen, dass ich der Meinung bin, schon die Liebe als solche sei, ganz gleich, wie jung man ist, eine Wahl für sich. Aber wenn ich so spät am Tage als Junggeselle herumlaufe, dann stehe ich womöglich zu mir selbst in zu krassem Widerspruch.»
«Nun denn, Sie sind einfach zu primitiv. Sie sollten diesen Ort morgen verlassen.»
«Damit ich nicht mit anschauen muss, wie Archie baden geht?»
«Sie sollten ihn auf der Stelle herausfischen und ihn mitnehmen.»
«Glauben Sie, dass er schon sehr drinhängt?», wollte ich wissen.
«Wäre ich seine Mutter, ich weiß wohl, was ich dann glauben würde. Ich kann mich an ihre Stelle versetzen – ich bin ja nicht beschränkt –, ich weiß nur zu gut, was sie von einer solchen Frage halten würde.»
«Und trotzdem wissen Sie nicht, dass man das in Amerika nicht für wichtig nimmt – was eine Mutter davon hält?»
Mrs. Pallant schwieg einen Moment, als würde ich sie teils verwirren und teils verärgern. «Nun, wir sind nicht in Amerika; wir sind nun mal hier.»
«Nein; meine bedauernswerte Schwester hängt voll und ganz an New York.»
«Ich wäre fast imstande, ihr zu schreiben, sie solle sich losmachen», sagte Mrs. Pallant.
«Sie warnen mich ja wirklich», rief ich aus, «aber ich weiß kaum, wovor. Mir scheint, meine Verantwortung würde erst dann einsetzen, wenn es den Anschein hätte, Ihre Tochter selbst wäre in Gefahr.»
«Oh, darum müssen Sie sich nicht sorgen; um die kümmere ich mich selbst.»
«Wenn Sie meinen, dass sie schon in Gefahr ist, werde ich gleich morgen mit ihm von hier verschwinden», fuhr ich fort.
«Das wäre das Beste, was Sie tun können.»
«Ich weiß nicht. Es täte mir sehr leid, mich von einem falschen Alarm aufscheuchen zu lassen. Ich fühle mich sehr wohl hier; mir gefallen der Ort und das Leben hier und Ihre Gesellschaft. Außerdem will es mir nicht so scheinen, als ob da – von ihrer Seite – überhaupt etwas wäre.»
Sie schaute mich mit einem Ausdruck an, den ich noch nie auf ihrem Gesicht gesehen hatte, und falls ich sie verblüfft haben sollte, vergalt sie es mir mit gleicher Münze. «Sie gehen mir wirklich sehr auf die Nerven; Sie verdienen gar nicht, was ich für Sie tun würde.»
Was sie für mich tun würde, enthüllte sie mir an jenem Tage nicht, aber wir kamen später auf das Thema zurück. Ich sagte ihr, ich begriffe wirklich nicht, warum wir annehmen sollten, ein Mädchen wie Linda – famos genug, um sich eine allerbeste Partie zu angeln – könne meinem Neffen in die Arme sinken. Dürfe ich wohl fragen, ob ihre Mutter ihr eine Beichte abgenommen habe – ob sie ihr Geheimnis ausgeplaudert habe? Mrs. Pallant antwortete, dass sie einander solche Dinge nicht erst zu erzählen brauchten – sie hätten nicht umsonst zwanzig Jahre auf so vertrautem Fuße miteinander verlebt. Worauf ich erwiderte, ich hätte mir dergleichen schon gedacht, aber vielleicht gäbe es in einem ganz speziellen Sonderfall wie dem jetzigen ja eine Ausnahme. Wenn Linda nichts hatte erkennen lassen, so sei das ein Zeichen dafür, dass der Fall für sie kein spezieller sei; und ich erwähnte, dass Archie mir gegenüber nicht einmal von der jungen Dame gesprochen habe, abgesehen davon, dass er nach der ersten Begegnung mit ihr ganz nebenbei und eher gönnerhaft angemerkt habe, sie sei noch ein richtiges kleines Pflänzchen. (Das kleine Pflänzchen war beinahe drei Jahre älter als er selbst.) Ansonsten hatte er sie überhaupt nicht erwähnt und war auch auf keine meiner Erwähnungen eingegangen. Mrs. Pallant ließ mich noch einmal wissen (worauf ich schon vorbereitet war), ich sei einfach zu primitiv, und dann sagte sie: «Wir brauchen die Angelegenheit nicht weiter zu vertiefen, wenn Sie nicht wollen, aber zufälligerweise weiß ich – wie ich an dieses Wissen gelangt bin, ist unwichtig –, dass meine Tochter in dem Augenblick, in dem Mr. Pringle ihr einen Antrag machen würde, ihn sogleich mit Haut und Haaren verschlingen würde. Das ist doch gewiss ein Detail, das es wert ist, Ihnen gegenüber erwähnt zu werden.»
«Sehr schön. Ich werde ihn aushorchen. Ich werde der Sache gleich heute Abend auf den Grund gehen.»
«Aber nein, tun Sie das nicht; Sie werden alles verderben!», murmelte sie in einem eigentümlich entmutigenden Tonfall. «Entfernen Sie ihn von hier – das ist die einzige Möglichkeit.»
Der Gedanke, ihn von hier zu entfernen, gefiel mir ganz und gar nicht; das kam mir zu überzogen vor, unnötig brutal, selbst wenn ich ihm dafür irgendeinen fadenscheinigen Vorwand präsentierte; und außerdem hatte ich, wie ich Mrs. Pallant schon gesagt hatte, wirklich nicht den Wunsch, meinen Aufenthalt hier abzubrechen. Ich hielt es nicht für Teil der Abmachung mit meiner Schwester, dass ich mit meinen Gepflogenheiten eines in die Jahre gekommenen Mannes nun auf wilder Flucht durch Europa hetzen sollte. Drum sagte ich: «Wäre Ihnen der Junge denn wirklich so unrecht als Schwiegersohn? Immerhin ist er ein guter Bengel und ein Gentleman.»
«Mein lieber Freund, Sie sind zu oberflächlich – zu leichtfertig», entgegnete Mrs. Pallant mit beträchtlicher Bitterkeit.
Es schwang darin eine Spur verächtlicher Geringschätzung mit, die mich reizte, weswegen ich ausrief: «Schon möglich; aber ich finde es komisch, dass gerade Sie mir eine Lektion in Beständigkeit erteilen wollen.»
Darauf kam von ihr keine Widerrede; aber schließlich sagte sie ruhig: «Ich glaube, Linda und ich ziehen wohl besser weiter. Wir sind hier schon einen Monat – das ist genug.»
«Ach je, dann wird’s hier wohl langweilig werden!», entfuhr es mir; und den restlichen Abend lang, bis wir uns verabschiedeten (unser Gespräch hatte nach dem Abendessen stattgefunden, im Kursaal5), blieb sie beinahe stumm und gab sich kleinlaut und verletzt. Dies war mir auch kein rechter Trost, wiewohl es das hätte sein dürfen, denn es war wirklich absurd, dass ausgerechnet Louisa Pallant es unternehmen sollte, mich ins Unrecht zu setzen. Wenn es jemals eine Frau gegeben hat, die selbst im Unrecht war …! Archie und ich geleiteten die Damen normalerweise an ihre Tür zurück – sie logierten in einer Straße minderer Quartiere, ein gewisses Stück entfernt von den Kurhotels – und verabschiedeten uns dann spät zur Nacht auf den groben Pflastersteinen in dem kleinen, schlafenden deutschen Städtchen, unter dessen verschlossenen Fenstern, die die Vorstellung muffiger Innenräume heraufbeschworen, unsere englischen Abschiedsworte heiter klangen. Bei dieser Gelegenheit hingegen waren sie nicht heiter, denn die Probleme, die sich zwischen mir und Mrs. Pallant aufgetan hatte, schienen sich durch einen mysteriösen Gleichklang der Empfindungen auf das junge Paar zu übertragen. Auch die beiden hingen schweren Gedanken nach und blieben recht schweigsam.
Als ich mit meinem Neffen zu unserem Hotel zurückging, schob ich meine Hand unter seinen Arm und fragte ihn ohne viele Umschweife, ob er sich in ernstlichen Liebesgefahren befinde.
«Ich weiß nicht, ich weiß nicht … wirklich, Onkel, ich weiß es nicht!» – dies war schon alles, was ich dem Jungen an Auskunft entlocken konnte, dem nicht einmal der kleinste Hang zur Selbsterforschung zu eigen war. Vielleicht wusste er es wirklich nicht, aber noch bevor wir beim Gasthof ankamen (wir tauschten noch einige Worte mehr über das Thema aus), hatte ich schon den Eindruck, er wisse es doch. Sein Kopf war nicht so eingerichtet, dass er allzu viele Dinge gleichzeitig aufnehmen konnte, aber Linda Pallant machte derzeit ganz gewiss den Hauptgegenstand darin aus. Sie durchdrang sein Bewusstsein, sie erregte seine Neugier, sie spielte auf eine Weise, die noch unbestimmt und unausgesprochen war, in seine Zukunft hinein. Ich konnte erkennen, dass sie der erste nachhaltig positive Eindruck seines Lebens war. Ich verriet ihm freilich nicht, wie viel sich mir offenbarte, und ich schlief nicht sonderlich gut, weil ich darüber nachdenken musste, dass es schließlich nicht meine Aufgabe gewesen war, ihm nachhaltig positive Eindrücke zu vermitteln. Ihm eine Frau zu verschaffen war das Letzte, was seine Mutter von mir erwartet und was ich selbst von mir erwartet hatte. Zudem entsprach es durchaus auch meiner Meinung, dass er selbst noch zu jung war, die Qualität von Ehefrauen zu beurteilen. Mrs. Pallant hatte recht, und ich hatte mich ganz seltsam oberflächlich geriert, indem ich sie und ihre schöne Tochter als «Freudenquell» betrachtet hatte. Es gab andere Freudenquellen, und eine davon bestand ganz entschieden darin, weiterzureisen. Was wusste ich schließlich von dem Mädchen, außer dass ich heilfroh war, der Eheschließung mit ihrer Mutter entgangen zu sein? Jene Mutter, schon richtig, war eine ganz einzigartige Person, und es war seltsam, dass sich ihr Gewissen bereits vor meinem eigenen geregt hatte und dass sie sich um meinen Neffen größere Sorgen machte als ich selbst. Frauen waren unergründlich, und es war nichts Neues für mich, dass man nie wusste, woran man mit ihnen war. Da ich in diesem Bericht bisher nicht gezögert habe, die nervöse Seite meiner eigenen Natur preiszugeben, will ich auch freimütig einräumen, dass ich mich sogar fragte, ob Mrs. Pallants Besorgtheit nicht vielleicht ein verborgener Kunstgriff war. War das womöglich gar ein Plan, den sie ausgeheckt hatte, um sich meines jungen Mannes ganz sicher sein zu können – auch wenn ich diese Logik nicht recht durchschaute? Wenn sie ihn, was in Anbetracht seines erheblichen Vermögens durchaus möglich war, als ausgesprochen gute Partie ansah, mochte sie dann dieses kleine Schauspiel nicht gemeinsam mit dem Mädchen in ihrer beider persönlichem Interesse inszeniert haben?
Jedenfalls wurde mir angesichts dieser Möglichkeit umso glücklicher zumute bei dem Gedanken, mit dem Jungen weiterzuziehen und andere Städte zu besuchen. Ganz ohne Zweifel gab es viele, die seiner Beachtung weit würdiger waren als Homburg. Im Verlauf des Vormittags (es war nach unserem zweiten Frühstück) spazierte ich zu Mrs. Pallant hinüber, um ihr mitzuteilen, dass mich diese Einsicht mit voller Wucht getroffen hatte; und während ich ausschritt, verspürte ich wiederum, wie unwahrscheinlich die Rolle doch war, die meine eigenen Befürchtungen und diejenigen der Mutter, falls diese echt waren, Linda zuwiesen. Falls sie ein solches Mädchen war, wie diese Befürchtungen unterstellten, so würde sie sich doch gewiss ein lohnenderes Jagdziel suchen. Mit Blick auf lohnende Jagdziele, das hatte Mrs. Pallant mir gegenüber ganz offen eingeräumt, war sie großzogen worden, und eine solche Ausbildung (und erst recht ein solcher Lehrgegenstand) rechtfertigten die Hoffnung auf einen noch höheren Ertrag. Ein junger Amerikaner, der ihr außer Taschengeld nichts zu bieten hatte, war ein recht bescheidener Preis, und wenn sie darauf aus war, aus gesellschaftlichem Ehrgeiz zu heiraten (in ihrem Gesicht und ihrem Tonfall war nichts von der entsprechenden Härte zu finden, aber das ist es nie), dann musste ihr Ziel mindestens ein englischer Herzog sein. In Mrs. Pallants Unterkunft empfing man mich mit der Mitteilung, sie habe Homburg mit ihrer Tochter vor einer halben Stunde verlassen. Die gute Frau, die den beiden aufgewartet hatte, gab an, von ihren Absichten weiter nichts zu wissen, als dass sie nach Frankfurt abgereist seien, wo sie, wie sie glaubte, aber nicht zu bleiben beabsichtigten. Sie wollten offensichtlich noch weiterreisen. So plötzlich? O ja, überaus plötzlich. Sie müssten die Nacht damit zugebracht haben, zu packen, schließlich hätten sie so viele Sachen und so hübsche dazu; und ihr bedauernswertes Dienstmädchen habe am Morgen kaum Zeit gehabt, ihren Kaffee auszutrinken. Aber offensichtlich seien es ja Damen, die gewohnt seien, zu kommen und zu gehen. Das sei auch gar nicht nicht weiter schlimm: Mit solchen Zimmern wie den ihrigen leide sie nie Mangel; um drei Uhr treffe schon eine neue Familie ein.
IV
Angesichts dieses Schachzugs konnte ich nur noch verblüfft dreinschauen, und ich gebe zu, ich war darüber ziemlich wütend. Mein einziger Trost war, dass Archie, als ich es ihm erzählte, ein ebenso verständnisloses Gesicht machte wie ich und dass der Streich ihm mehr zu Herzen ging, denn ich war ja nicht in Louisa verliebt. Wir stimmten darin überein, dass hier eine Erklärung recht und billig war, und wir taten so, als erwarteten wir gleich am nächsten Tag eine solche in Gestalt eines Briefes, der über die bloße Erklärung hinaus auch so etwas wie eine Entschuldigung enthielt. Wenn ich sage, «wir» hätten so getan, so meine ich damit, dass ich so tat, denn mein Verdacht, er wisse (durch eine Absprache mit Linda), was mit unseren Freundinnen sei, hielt nur einen Augenblick an. War sein Groll geringer als der meinige, so war seine Überraschung doch ebenso groß. Ich war bereit gewesen, zu türmen, aber nun war ich ein wenig beleidigt über die Leichtigkeit, mit der Mrs. Pallant, wie sich erwiesen hatte, auf unsere Gesellschaft verzichten konnte. Archie war nicht wütend, weil er erstens gutmütig war und sich zweitens offensichtlich gar nicht darüber im Klaren war, dass er ermutigt worden war, hatte er doch, wie ich glaube, gar keinen nennenswerten Begriff davon, was eine Ermutigung ausmachte. Er war ganz frisch aus jenem wunderbaren Lande gekommen, in dem sich unter der naiven Jugend kaum einmal die Frage nach den «Absichten» stellt. Er war sich seiner eigenen nur sehr undeutlich bewusst und hätte nicht einzuschätzen vermocht, ob er provoziert oder sitzen gelassen worden war. Ich hatte nicht den Wunsch, ihn zu verstimmen, aber als wir nach Ablauf von drei weiteren Tagen immer noch ohne Nachricht von unseren vorherigen Gefährtinnen waren, merkte ich an, die Sache sei doch recht einfach; es sei klar, dass sie sich vor uns verbergen wollten; sie hielten uns für gefährlich; sie hätten die Absicht, Verwicklungen zu vermeiden. Sie hätten unsere Fürsorge als zu aufdringlich empfunden und wollten keine falschen Hoffnungen wecken. Er schien diese Erklärung zu schlucken und ging sogar so weit (zumindest folgerte ich das daraus, dass er mir keine Fragen stellte), zu glauben, die Angelegenheit könne heikel für mich sein. Der arme Junge war in jeder Hinsicht recht verwirrt, und ich lächelte über die bildliche Vorstellung in seinem Kopf, wie Mrs. Pallant vor den aufdringlichen Nachstellungen seines Onkels floh.
Wir beschlossen, Homburg zu verlassen, aber wenn wir ihrer Spur nicht folgten, so nicht einfach nur, weil wir keine Ahnung hatten, wo sie war. Das hätte ich mit ein wenig Mühe wohl herausfinden können, aber mich schreckte die Überlegung ab, dass dies genau ihrem eigenen Denken entsprach. Sie war unehrlich, und ihre Abreise war eine Provokation – ich fürchte, genau diese törichte Überzeugung war’s, aus der heraus ich zusammen mit Archie einen eigenständigen kleinen Reiseplan aufstellte. Ich redete mir sogar ein, ich würde recht bald in Erfahrung bringen, wo sie waren, und unsere Geduld – selbst diejenige meines jungen Mannes – würde sich als ausdauernder als die ihrige erweisen. Deswegen entfuhr mir ein kleiner privater Triumphschrei, als er mir drei Wochen später (wie waren gerade in Interlaken) erzählte, er habe eine Nachricht von Miss Pallant erhalten. Erzählt hat er es mir unter dem Vorwand der Frage, ob es eigentlich irgendwelche besonderen Gründe dafür gebe, dass wir unsere geplante Weiterreise zu den italienischen Seen noch weiter hinauszögerten; seien unsere Befürchtungen hinsichtlich des heißen Wetters, das zudem im Sommer unseren heimischen Temperaturen entsprach, nicht mittlerweile hinfällig, wo es nun schon Mitte September war? Ich antwortete, wir würden am nächsten Tag aufbrechen, wenn er wolle, und dann, offenbar damit zufrieden, dass man die Dinge mit mir so problemlos regeln konnte, enthüllte er sein kleines Geheimnis. Er zeigte mir den Brief, ein anmutiges, normales Schriftstück – mit einigen wenigen dahinfließenden Federstrichen war ein einziges Blatt Briefpapier gefüllt –, das die junge Dame keineswegs kompromittierte. Wenn es auch beinahe der Entschuldigung gleichkam, die ich erwartete (einmal abgesehen davon, dass eine solche von der Mutter hätte kommen sollen), war es doch anscheinend nicht im Geringsten eine Einladung. Es wurde lediglich nebenbei erwähnt (diese Erwähnung erfolgte hauptsächlich in der Datumsangabe), dass sie sich am Lago Maggiore befanden, in Baveno6; hauptsächlich aber bestand der Brief aus dem Ausdruck des Bedauerns, dass sie uns in Homburg ganz ohne Nachricht hatten verlassen müssen. Linda erwähnte nicht, mit welcher Art Notwendigkeit sie konfrontiert gewesen waren; sie äußerte lediglich die Hoffnung, wir hätten nicht zu schlecht von ihnen gedacht und akzeptierten «diese paar eilig hingeworfenen Worte» als Ersatz für die entfallene Verabschiedung. Ebenfalls hoffte sie, dass wir unsere Zeit auf interessante Weise zubrachten und ebensolches Wetter hatten, wie es südlich der Alpen vorherrschte; und sie verblieb aufrichtig und hochachtungsvoll und mit den freundlichsten Grüßen auch an mich.
ENDE DER LESEPROBE
Copyright © 2013/2015 by Manesse Verlag, Zürich
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln,
ISBN 978-3-641-16255-9
www.manesse.ch