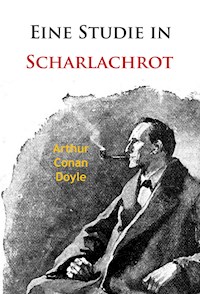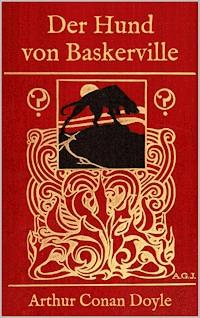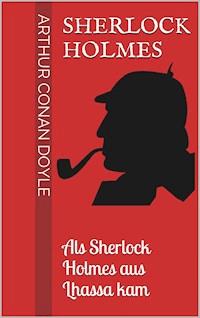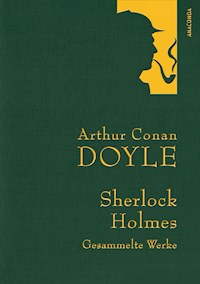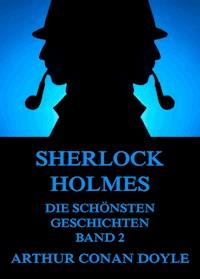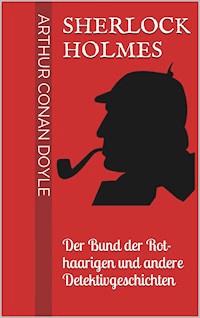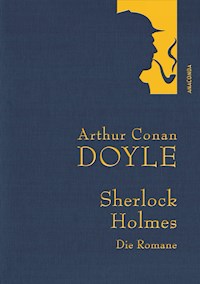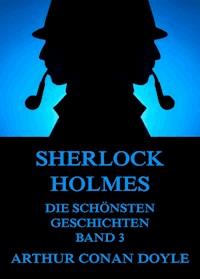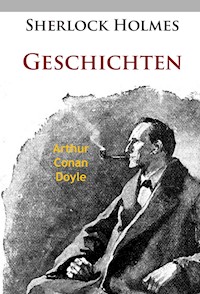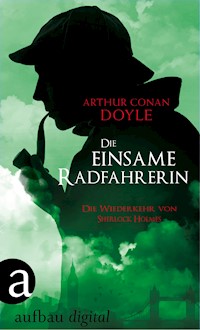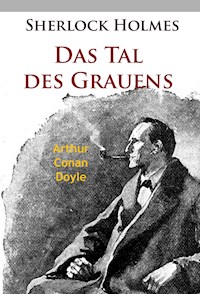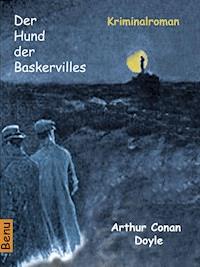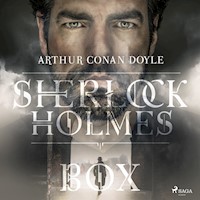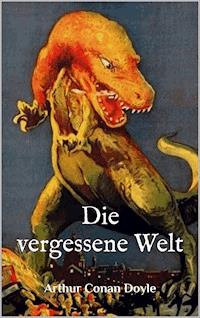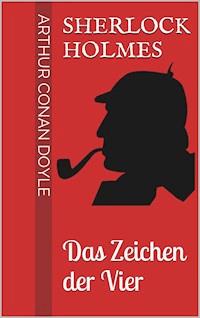8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Reclam Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
Der vielleicht seltsamste und skurrilste der Sherlock-Holmes-Romane mit einer der ersten Verfolgungsjagden in der Geschichte des Kriminalromans Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von Sherlock Holmes, dem wohl berühmtesten Detektiv aller Zeiten! Eine der ersten wirklich großen Verfolgungsjagden in der Kriminalliteratur und Höhepunkt einer jeden Verfilmung: Auf der Themse versuchen Holmes und Dr. Watson einen Holzbeinigen und eine Pygmäe, die sie mit einem Blasrohr beschießt, einzuholen und zu stellen. Sie ist die Hauptverdächtige am Mord des Vaters von Mary Morstan, der einen gewaltigen Schatz gefunden haben soll. Die temporeiche Geschichte macht diesen zweiten Roman der Sherlock-Holmes-Reihe in der neuen Übersetzung zu einem himmlischen Lesevergnügen. Spannung pur! – Mit einer kompakten Biographie des Autors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Doyle Arthur Conan
Das Tal der Angst
Ein Sherlock-Holmes-RomanMit sieben Abbildungen von Arthur I. Keller
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAM TASCHENBUCH Nr. 962472
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung:© Gutentag-Hamburg
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM ist eine eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962472-3
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020753-6
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Vignette
»Was hat das zu ...
Die Tragödie von Birlstone
Die Warnung
Mr. Sherlock Holmes’ Abhandlungen
Die Tragödie von Birlstone
Dunkelheit
Die Personen des Dramas
Ein heraufdämmerndes Licht
Die Lösung
Die Scowrers
Der Mann
Der Meister
Loge 341, Vermissa
Das Tal der Angst
Die dunkelste Stunde
Gefahr
Das Einfangen von Birdy Edwards
Epilog
Zu dieser Ausgabe
Anmerkung des Übersetzers
Anmerkungen
Nachwort
Zeittafel
Vignette
»Was hat das zu bedeuten, Mr. Holmes? Menschenskinder, das ist ja Hexerei! Woher, um alles in der Welt, haben Sie diese Namen?«
Teil I
Die Tragödie von Birlstone
Kapitel I
Die Warnung
»ALSO, ich wäre geneigt, zu denken –«, sagte ich.
»Das würde ich auch tunlichst empfehlen«, bemerkte Sherlock Holmes ungehalten.
Ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass ich zu den duldsamsten Sterblichen überhaupt gehöre, aber ich muss zugeben, dass ich mich über diese hämische Unterbrechung ärgerte. »Also wirklich, Holmes«, sagte ich in strengem Ton, »Sie sind bisweilen richtig anstrengend.«
Er war zu sehr von seinen eigenen Gedanken vereinnahmt, um mir eine direkte Antwort auf meinen Vorwurf geben zu können. Das Kinn hatte er auf eine Hand gestützt, vor sich das unberührte Frühstück, und starrte auf das Blatt Papier, das er soeben aus dem Umschlag gezogen hatte. Dann griff er nach dem Umschlag, hielt ihn gegen das Licht und betrachtete sehr aufmerksam sowohl die Außenseiten als auch die Lasche.
»Das ist Porlocks Handschrift«, sagte er nachdenklich. »Es gibt kaum einen Zweifel daran, dass es Porlocks Handschrift ist, obwohl ich sie bisher nur zweimal gesehen habe. Das griechische ›e‹ mit dem eigenartigen Schnörkel darüber ist unverkennbar. Aber wenn der Brief tatsächlich von Porlock stammt, dann muss es etwas von äußerster Wichtigkeit sein.«
Er sprach eher mit sich selbst als mit mir, aber mein Verdruss schwand bei dem Interesse, das seine Worte in mir weckten.
»Wer ist denn dieser Porlock?«, fragte ich.
»Porlock ist ein Pseudonym, Watson, ein reines Erkennungszeichen, aber dahinter verbirgt sich eine verschlagene und schwer fassbare Persönlichkeit. In einem früheren Schreiben hat er mir unverblümt mitgeteilt, der Name sei nicht sein eigener, und mich herausgefordert, ihn unter den wimmelnden Millionen dieser großen Stadt ausfindig zu machen. Porlock ist wichtig, aber nicht seiner selbst wegen, sondern wegen des bedeutsamen Mannes, mit dem er in Verbindung steht. Malen Sie sich den Pilotfisch mit dem Hai aus, den Schakal mit dem Löwen – irgendetwas, das unbedeutend ist, in Begleitung von etwas, das furchterregend ist. Nicht nur furchterregend, Watson, sondern unheimlich – in höchstem Maße unheimlich. Deshalb ist er auch in mein Blickfeld geraten. Ich habe in Ihrem Beisein doch schon von Professor Moriarty gesprochen?«
»Von dem berühmten gelehrten Verbrecher, unter Gaunern so berühmt wie –«
»Ich erröte, Watson«, murmelte Holmes in missbilligendem Ton.
»›Wie er in der Öffentlichkeit unbekannt ist‹, wollte ich eigentlich sagen.«
»Touché – wahrlich ein Treffer!«, rief Holmes. »Sie entwickeln eine gewisse überraschende Art von trockenem Humor, Watson, gegen die ich mich erst noch zu wappnen lernen muss. Aber wenn Sie Moriarty einen Verbrecher nennen, sprechen Sie aus Sicht des Gesetzes eine Verleumdung aus – und darin liegt ja gerade das Glorreiche und Sonderbare. Der größte Intrigant aller Zeiten, der Organisator jeder nur denkbaren Teufelei, das maßgebende Hirn der Unterwelt – ein Hirn, das das Schicksal ganzer Nationen bestimmen oder zugrunde richten könnte – das ist dieser Mann. Aber er ist derart über jeglichen Verdacht erhaben, derart gefeit gegen jegliche Kritik und derart bewundernswürdig für seine Machenschaften und seine eigene Zurückhaltung, dass er Sie für eben jene Worte, die Sie gerade geäußert haben, vor Gericht schleppen könnte und mit Ihrer Jahresrente als Entschädigung für seine gekränkte Ehre davonkäme. Ist er nicht der gefeierte Verfasser von Die Dynamik eines Asteroiden – eines Werkes, das sich derartig in die höchsten Sphären der reinen Mathematik begibt, dass es heißt, es gebe in der wissenschaftlichen Presse niemanden, der imstande wäre, es zu beurteilen? Ist das ein Mann, den man verleumdet? Der schmutzige Reden führende Arzt und der in falschen Verdacht geratene Professor – so sähen Ihre jeweiligen Rollen aus. Das ist Genialität, Watson. Aber sofern ich von geringeren Leuten verschont werde, wird unser Tag sicher kommen.«
»Auf dass ich das noch erleben darf!«, rief ich voller Andacht. »Aber Sie haben gerade von diesem Porlock erzählt.«
»Ah, ja – der sogenannte Porlock ist ein Glied in der Kette, ein Stück weit entfernt von seinem großen Ankerpunkt. Ganz unter uns, Porlock ist nicht gerade ein stabiles Glied. Soweit ich das bislang überprüfen konnte, ist er der einzige Schwachpunkt in der Kette.«
»Aber keine Kette ist stärker als ihr schwächstes Glied.«
»Richtig, mein lieber Watson. Daher rührt die außerordentliche Bedeutsamkeit von Porlock. Geleitet von einem rudimentären Verlangen nach Recht und ermutigt durch den klugen Anreiz einer gelegentlichen Zehn-Pfund-Note, die ihn auf Umwegen erreicht, hat er mir ein- oder zweimal Vorabinformationen geliefert, die von Wert waren – von jenem höchsten Wert, der Verbrechen voraussieht und verhindert, anstatt sie zu rächen. Wenn wir den Code hätten, daran besteht kein Zweifel, dann würden wir feststellen, dass diese Mitteilung von jener Art ist, auf die ich eben hingewiesen habe.«
Erneut strich Holmes das Blatt Papier auf seinem unbenutzten Teller glatt. Ich stand auf, beugte mich über ihn und starrte auf die sonderbare Inschrift, die wie folgt lautete:
534 C2 13 127 36 31 4 17 21 41
DOUGLAS 109 293 5 37 BIRLSTONE
26 BIRLSTONE 9 47 171
»Was halten Sie davon, Holmes?«
»Das ist offensichtlich ein Versuch, eine geheime Information zu übermitteln.«
»Aber was nützt einem eine chiffrierte Botschaft ohne den Code?«
»In diesem Fall gar nichts.«
»Warum sagen Sie ›in diesem Fall‹?«
»Weil es viele Chiffrierungen gibt, die ich so leicht lese, wie ich die Apokryphen der Seufzerspalten deuten kann. Solche plumpen Tricks erheitern den Intellekt, ohne ihn zu ermüden. Aber das hier ist anders. Es handelt sich eindeutig um einen Verweis auf Wörter auf einer Seite in irgendeinem Buch. Solange man mich jedoch nicht wissen lässt, um welche Seite und um welches Buch es sich handelt, bin ich machtlos.«
»Aber warum ›Douglas‹ und ›Birlstone‹?«
»Weil das offensichtlich Wörter sind, die nicht auf der in Frage kommenden Seite auftauchen.«
»Warum hat er dann aber nicht auf das Buch verwiesen?«
»Der Ihnen eigene Scharfsinn, mein lieber Watson, jene angeborene Gerissenheit, die zur Erheiterung Ihrer Freunde beiträgt, würde Sie gewiss davon abhalten, die Chiffrierung und die Botschaft in ein und denselben Umschlag zu stecken. Sollte er in die falschen Hände geraten, wären Sie erledigt. So aber müsste schon beides schiefgehen, bevor etwas Schlimmes geschieht. Unsere zweite Postsendung ist überfällig, und ich wäre überrascht, wenn sie uns nicht entweder einen weiteren Brief bescherte, der eine Erklärung liefert, oder, was wahrscheinlicher ist, eben jenes Buch, auf das sich diese Ziffern beziehen.«
Holmes’ Vorhersage erfüllte sich binnen weniger Minuten mit dem Erscheinen von Billy, dem Hausburschen, und zwar mit genau dem Brief, auf den wir warteten.
»Dieselbe Handschrift«, bemerkte Holmes, als er den Umschlag öffnete, »und sogar unterschrieben«, fügte er mit frohlockender Stimme hinzu, als er den Brief auseinanderfaltete. »Na also, wir kommen voran, Watson.«
Doch seine Miene umwölkte sich, während er den Inhalt überflog.
»Du liebe Güte, das ist sehr enttäuschend! Ich fürchte, Watson, dass all unsere Erwartungen ins Leere laufen. Ich hoffe nur, dass dieser Porlock nicht zu Schaden kommt.
›SEHR GEEHRTER MR. HOLMES‹, schreibt er, ›ich möchte diese Angelegenheit nicht weiter verfolgen. Es ist zu gefährlich. Er misstraut mir. Ich spüre, dass er mir misstraut. Er suchte mich ganz unerwartet auf, kurz nachdem ich diesen Umschlag in der Absicht beschriftet hatte, Ihnen den Schlüssel für die Dechiffrierung zu schicken. Ich konnte ihn verbergen. Wenn er ihn gesehen hätte, wäre das schlimm für mich ausgegangen. Aber ich sehe Argwohn in seinen Augen. Bitte verbrennen Sie die chiffrierte Botschaft, die Ihnen nun nicht länger von Nutzen sein kann.
FRED PORLOCK‹«
Holmes saß einen Augenblick da, verdrehte diesen Brief zwischen den Fingern und runzelte die Stirn, während er ins Feuer starrte.
»Letzten Endes«, sprach er schließlich, »hat es vielleicht keine Bewandtnis. Vielleicht ist es nur sein schlechtes Gewissen. Da er weiß, dass er ein Verräter ist, hat er womöglich nur deshalb jene Anschuldigung in den Augen des anderen entdeckt.«
»Dieser andere ist, nehme ich an, Professor Moriarty?«
»Kein Geringerer. Wenn irgendeiner von denen von einem ›Er‹ spricht, weiß man, wen sie meinen. Es gibt einen allesbeherrschenden ›Er‹ für sie alle.«
»Doch was kann er tun?«
»Hm! Das ist die große Frage. Wenn man einen der erstklassigsten Köpfe Europas gegen sich aufgebracht hat und alle Mächte der Finsternis hinter diesem stehen, gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Wie dem auch sei, unser Freund Porlock ist offensichtlich wie von Sinnen vor Angst. Seien Sie so nett und vergleichen Sie die Schrift in der Nachricht mit der auf dem Umschlag, die, wie er uns mitteilt, vor jenem unheilvollen Besuch geschrieben wurde. Die eine ist klar und fest; die andere kaum lesbar.«
»Warum hat er das überhaupt geschrieben? Warum hat er es nicht einfach fallenlassen?«
»Weil er befürchtete, dass ich in diesem Fall Erkundigungen über ihn einziehen und ihn womöglich in Schwierigkeiten bringen würde.«
»Zweifellos«, sagte ich. »Natürlich ist es« – ich hatte die ursprüngliche chiffrierte Botschaft zur Hand genommen und beugte den Kopf über sie – »beinahe zum Verrücktwerden, wenn man bedenkt, dass sich ein bedeutendes Geheimnis hier auf diesem Bogen Papier verbergen könnte und dass es jenseits des menschlichen Vermögens liegt, es zu ergründen.«
Sherlock Holmes hatte sein unangetastetes Frühstück von sich geschoben und entzündete seine unappetitliche Pfeife, die Gefährtin seines tiefgründigsten Nachsinnens. »Das ist die Frage!«, sprach er, lehnte sich zurück und starrte zur Decke hinauf. »Vielleicht gibt es Aspekte, die Ihrem machiavellistischen Intellekt entgangen sind. Betrachten wir das Rätsel im Licht der reinen Vernunft. Der Mann stellt einen Bezug zu einem Buch her. Das ist unser Ausgangspunkt.«
»Ein ziemlich vager.«
»Dann wollen wir doch einmal sehen, ob wir weiter eingrenzen können. Nun, da ich meine Gedanken darauf richte, erscheint es mir weniger unergründlich. Welche Hinweise haben wir auf dieses Buch?«
»Keine.«
»Nun, nun, ganz so schlimm ist es wohl nicht. Die chiffrierte Botschaft beginnt mit einer großen 534, nicht wahr? Als Arbeitshypothese dürfen wir davon ausgehen, dass es sich bei 534 um eben jene Seite handelt, auf die sich die Verschlüsselung bezieht. Demzufolge ist unser Buch bereits zu einem dicken Buch geworden, was an sich schon einen Gewinn bedeutet. Welche anderen Hinweise haben wir, was die Beschaffenheit dieses dicken Buchs anbelangt? Das nächste Zeichen ist C2. Was fangen Sie damit an, Watson?«
»Das zweite Kapitel, zweifellos.«
»Wohl kaum, Watson. Ich bin mir sicher, Sie werden mir zustimmen, dass eine Zählung des Kapitels unbedeutend ist, wenn die Seite angegeben wird. Und wenn wir uns auf Seite 534 immer noch im zweiten Kapitel befinden, dürfte die Länge des ersten Kapitels wirklich unerträglich gewesen sein.«
»Eine Spalte!«, rief ich.
»Brillant, Watson. Sie sprühen heute Morgen vor Geist. Ich müsste mich sehr täuschen, wenn das keine Spalte ist. Nun, wie Sie sehen, schwebt uns allmählich ein großes Buch vor, das in zwei Spalten gedruckt wurde, die jeweils von beträchtlicher Länge sind, da eines der Wörter in dem Schriftstück mit 293 beziffert ist. Haben wir schon die Grenzen dessen erreicht, was der Verstand zu liefern vermag?«
»Ich fürchte, ja.«
»Sie tun sich gewiss selbst Unrecht. Eine weitere geistreiche Idee, mein lieber Watson. Noch so ein Geistesblitz. Hätte es sich um ein ungewöhnliches Buch gehandelt, so hätte er es mir zugeschickt. Doch stattdessen hatte er, ehe seine Pläne vereitelt wurden, beabsichtigt, mir den Schlüssel in diesem Umschlag zukommen zu lassen. So schreibt er es in der Nachricht. Das scheint darauf hinzudeuten, dass es sich um ein Buch handelt, von dem er glaubt, dass ich es ohne Schwierigkeiten selbst finden werde. Er hatte es, und er ging davon aus, dass ich es auch haben würde. Kurzum, Watson, es handelt sich um ein äußerst geläufiges Buch.«
»Was Sie sagen, klingt wirklich plausibel.«
»Wir haben also das Feld unserer Nachforschungen auf ein großes Buch eingegrenzt, das in zwei Spalten gedruckt und allgemein gebräuchlich ist.«
»Die Bibel!«, rief ich triumphierend.
»Gut, Watson, gut! Aber, wenn ich so sagen darf, nicht gut genug. Selbst wenn ich das als Kompliment für mich selbst gelten ließe, so könnte ich doch kaum ein Buch nennen, das einer von Moriartys Gehilfen mit geringerer Wahrscheinlichkeit zur Hand hätte. Außerdem liegen so viele Ausgaben der Heiligen Schrift vor, dass er kaum davon ausgehen könnte, dass zwei Ausgaben die gleiche Seitennummerierung aufweisen. In unserem Fall handelt es sich offensichtlich um ein Buch, das standardisiert ist. Er weiß ganz genau, dass seine Seite 534 exakt mit meiner Seite 534 übereinstimmt.«
»Aber das würde nur auf sehr wenige Bücher zutreffen.«
»Richtig. Und genau das ist unsere Rettung. Unsere Suche beschränkt sich auf standardisierte Bücher, bei denen man davon ausgehen kann, dass jeder sie besitzt.«
»Der Bradshaw!«
»Da zeigen sich Schwierigkeiten, Watson. Die Wortwahl im Bradshaw ist zwar ausdrucksvoll und knapp gehalten, aber begrenzt. Die Auswahl an Wörtern würde sich kaum für die Übermittlung allgemeiner Nachrichten eignen. Wir werden den Bradshaw ausschließen. Das Wörterbuch ist, so befürchte ich, aus dem gleichen Grund unzulässig. Was bleibt dann noch übrig?«
»Ein Almanach.«
»Ausgezeichnet, Watson! Ich müsste mich sehr irren, wenn Sie es nicht genau auf den Punkt gebracht hätten. Ein Almanach! Lassen Sie uns überdenken, was Whitaker’s Almanack zu bieten hat. Er ist allgemein gebräuchlich. Er weist die erforderliche Seitenzahl auf. Er ist zweispaltig aufgebaut. Obwohl sein Wortschatz anfangs eher zurückhaltend ist, wird er gegen Ende doch ziemlich geschwätzig, wenn ich mich recht entsinne.« Er griff nach dem Buch auf seinem Schreibtisch. »Hier haben wir Seite 534, Spalte zwei, ein umfangreicher Absatz, der sich, wie ich sehe, mit dem Handelswesen und den Rohstoffen von Britisch-Indien befasst. Notieren Sie die Wörter, Watson. Nummer 13 ist ›Mahratta‹. Kein, so fürchte ich, sonderlich verheißungsvoller Anfang. Nummer 127 lautet ›Regierung‹, was immerhin Sinn ergibt, auch wenn es mit Blick auf uns und Professor Moriarty eher bedeutungslos ist. Versuchen wir es noch einmal. Was tut die Regierung von Mahratta? Oje! Das nächste Wort ist ›Schweineborsten‹. Wir sind erledigt, mein guter Watson! Es ist zu Ende.«
Er hatte in scherzhaftem Ton gesprochen, doch verriet das Zucken seiner buschigen Brauen seine Enttäuschung und Verärgerung. Ich saß hilflos und unglücklich da und starrte ins Feuer. Das lange Schweigen wurde von einem jähen Ausruf von Holmes unterbrochen, der zu einem Schrank eilte, von dem er mit einem zweiten Buch mit gelbem Einband zurückkehrte.
»Das ist der Preis, den wir zahlen, Watson, weil wir zu sehr auf dem neuesten Stand sind«, rief er. »Wir sind unserer Zeit voraus und müssen dafür büßen. Da der siebte Januar ist, haben wir uns bereits mit dem neuen Almanach eingedeckt. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Porlock seine Botschaft dem alten Almanach entnommen hat. Zweifellos hätte er uns das mitgeteilt, wenn sein klärender Brief geschrieben worden wäre. Schauen wir einmal, was die Seite 534 für uns auf Lager hat. Nummer 13 lautet ›Dort‹, was vielversprechender klingt. Nummer 127 lautet ›ist‹ – ›Dort ist‹« – Holmes’ Augen leuchteten vor Aufregung, und seine dünnen, nervösen Finger zuckten, während er die Wörter aufzählte – »›Gefahr‹. Ha! Ha! Großartig! Schreiben Sie das auf, Watson. ›Dort ist Gefahr – kann – sehr – bald – passieren – ein gewisser‹. Dann haben wir den Namen ›Douglas‹ – ›reich – Land – jetzt – in – Birlstone – House – Birlstone – Überzeugung – ist – dringend‹. Na, also, Watson! Was halten Sie von der reinen Vernunft und ihren Früchten? Wenn der Gemüsehändler so etwas wie einen Lorbeerkranz hätte, dann würde ich Billy losschicken, ihn zu holen.«
Ich starrte noch auf die sonderbare Botschaft, die ich, während er sie entschlüsselte, auf einen Bogen Foolscap-Papier gekritzelt hatte.
»Was für eine seltsame, verwirrende Art und Weise, seine Absicht zum Ausdruck zu bringen!«, sagte ich.
»Im Gegenteil, er hat es bemerkenswert gut angestellt«, sagte Holmes. »Geht man eine einzelne Spalte nach Wörtern durch, mit denen man seine Absicht zum Ausdruck bringen möchte, kann man kaum erwarten, all das zu bekommen, was man benötigt. Sie müssen etwas der Intelligenz Ihres Adressaten überlassen. Der Sinn ist vollkommen klar. Irgendeine Teufelei ist gegen einen gewissen Douglas geplant, wer auch immer das sein mag, der, wie es hier steht, als Gutsherr seinen Wohnsitz auf dem Land hat. Er ist davon überzeugt – ›Überzeugung‹ traf es am ehesten, um zu ›überzeugt‹ zu gelangen –, dass es dringend ist. Da haben wir unser Ergebnis – und das war doch eine äußerst fachmännische Analyse!«
Holmes empfand die distanzierte Freude des wahren Künstlers an seinen besseren Werken, auch wenn er sich zutiefst grämte, sollten sie unter dem hohen Niveau bleiben, das er eigentlich immer zu erreichen anstrebte. Er lachte immer noch leise in sich hinein angesichts seines Erfolgs, als Billy schwungvoll die Tür öffnete und Inspektor MacDonald von Scotland Yard ins Zimmer geführt wurde.
Das trug sich in den Anfangstagen gegen Ende der Achtziger Jahre zu, als Alec MacDonald noch weit davon entfernt war, den landesweiten Ruhm zu erlangen, den er inzwischen errungen hat. Er war ein noch junges, aber verlässliches Mitglied der Kriminalpolizei und hatte sich in mehreren Fällen hervorgetan, die man ihm anvertraut hatte. Seine große, knochige Statur deutete auf außergewöhnliche Körperkraft hin, während sein massiger Schädel und die tiefliegenden, leuchtenden Augen nicht minder deutlich von der hohen Intelligenz zeugten, die unter den buschigen Augenbrauen hervorblitzte. Er war ein schweigsamer, gewissenhafter Mann mit mürrischem Wesen und einem starken Aberdeen-Akzent.
Bereits zweimal in seiner Karriere hatte Holmes ihm zu einem Erfolg verholfen, und die einzige Belohnung für ihn selbst bestand in der intellektuellen Freude an dem Rätsel. Aus diesem Grund hegte der Schotte tiefe Zuneigung und Respekt für seinen Amateurkollegen und bekundete beides durch die Freimütigkeit, mit der er Holmes bei jeder sich ergebenden Schwierigkeit konsultierte. Mittelmaß kennt nichts Höheres als sich selbst, Begabung jedoch erkennt sofort das Genie, und MacDonald besaß genügend Begabung für seinen Beruf, um erkennen zu können, dass es nichts mit Erniedrigung zu tun hatte, die Unterstützung desjenigen zu erbitten, der innerhalb Europas sowohl hinsichtlich seiner Fähigkeiten als auch seiner Erfahrung unerreicht war. Holmes neigte nicht dazu, Freundschaften zu schließen, aber er war nachsichtig gegenüber dem großen Schotten und lächelte, als er seiner ansichtig wurde.
»Sie sind schon zur Morgenstunde auf den Beinen, Mr. Mac«, sprach er. »Ich wünsche Ihnen Glück mit dem Gold. Ich befürchte, es bedeutet, dass Ihnen irgendein Unheil auf dem Fuße folgen wird.«
»Hätten Sie ›ich hoffe‹ anstatt ›ich befürchte‹ gesagt, wäre das, denke ich, wohl näher an der Wahrheit, Mr. Holmes«, antwortete der Inspektor mit einem wissenden Grinsen. »Nun, ein kleiner Schluck könnte die raue Morgenkälte vielleicht vertreiben. Nein, rauchen möchte ich nicht, ich danke Ihnen. Ich werde mich gleich wieder auf den Weg machen müssen, denn die frühen Stunden bei einem Fall sind die kostbaren, was niemand besser weiß als Sie. Aber – aber –«
Der Inspektor war abrupt stehengeblieben und starrte mit einem Ausdruck völliger Verwunderung auf ein Blatt Papier auf dem Tisch. Es war der Bogen, auf den ich die rätselhafte Botschaft gekritzelt hatte.
»Douglas!«, stammelte er. »Birlstone! Was hat das zu bedeuten, Mr. Holmes? Menschenskinder, das ist ja Hexerei! Woher, um alles in der Welt, haben Sie diese Namen?«
»Das ist eine kodierte Botschaft, Dr. Watson und ich haben heute die Gelegenheit gehabt, sie zu lösen. Aber warum – was stimmt mit diesen Namen nicht?«
Der Inspektor sah in fassungslosem Staunen von einem zum anderen. »Nun, ja«, sprach er, »Mr. Douglas aus Birlstone Manor ist letzte Nacht auf entsetzliche Weise ermordet worden!«
Kapitel II
Mr. Sherlock Holmes’ Abhandlungen
ES war einer jener dramatischen Momente, für die mein Freund lebte. Es wäre eine Übertreibung, zu sagen, dass ihn die verblüffende Mitteilung schockiert oder gar in Aufregung versetzt hätte. Seine einzigartige Veranlagung wies nicht den Hauch von Grausamkeit auf, doch war er zweifellos aufgrund langer Überreizung unempfindlich geworden. Dennoch, selbst wenn seine Gefühlsempfindungen abgestumpft waren, so war sein intellektuelles Auffassungsvermögen außerordentlich aktiv. Also gab es keine Spur des Entsetzens, die ich bei dieser knappen Verlautbarung für mich empfunden hatte, seine Miene verriet vielmehr die stille und interessierte Beherrschung des Chemikers, der beobachtet, wie sich die Kristalle in seiner übersättigten Lösung niederschlagen.
»Bemerkenswert!«, sagte er; »bemerkenswert!«
»Sie wirken nicht überrascht.«
»Interessiert, Mr. Mac, aber kaum überrascht. Warum sollte ich überrascht sein? Ich erhalte eine anonyme Mitteilung aus einer Ecke, die meines Wissens bedeutsam ist und die mich warnt, einer gewissen Person drohe Gefahr. Binnen einer Stunde erfahre ich, dass diese Gefahr tatsächlich Gestalt angenommen hat und dass die Person tot ist. Ich bin interessiert, aber, wie Sie merken, nicht überrascht.«
In wenigen knappen Sätzen erläuterte er dem Inspektor die Fakten im Zusammenhang mit dem Brief und der Chiffrierung. MacDonald saß da, das Kinn auf beide Hände gestützt, und seine dichten, strohblonden Augenbrauen zogen sich zu einem gelblichen Büschel zusammen.
»Ich will mich heute Morgen auf den Weg nach Birlstone machen«, sagte er. »Ich bin gekommen, um Sie zu fragen, ob Sie mich begleiten möchten – Sie und Ihr Freund hier. Aber nach allem, was Sie sagen, könnten wir in London vielleicht bessere Arbeit leisten.«
»Das glaube ich eher nicht«, meinte Holmes.
»Zum Teufel noch mal, Mr. Holmes!«, rief der Inspektor. »Die Zeitungen werden in ein, zwei Tagen voll sein mit dem Rätsel von Birlstone, aber wo ist das Rätselhafte, wenn es in London jemanden gibt, der das Verbrechen vorhergesagt hat, ehe es sich überhaupt ereignet hat? Wir brauchen diesen Mann bloß in die Finger zu kriegen, der Rest wird sich dann schon ergeben.«
»Zweifellos, Mr. Mac. Aber was schlagen Sie vor, wie Sie den sogenannten Porlock in die Finger kriegen wollen?«
MacDonald drehte den Brief um, den Holmes ihm gereicht hatte. »Aufgegeben in Camberwell – das hilft uns nicht groß weiter. Der Name ist, wie Sie sagen, ein Deckname. Damit lässt sich sicher nicht viel anfangen. Haben Sie nicht erwähnt, Sie hätten ihm Geld geschickt?«
»Zweimal.«
»Und wie?«
»Ins Postamt von Camberwell, in Scheinen.«
»Und Sie haben sich nie die Mühe gemacht, herauszufinden, wer das Geld abgeholt hat?«
»Nein.«
Der Inspektor sah überrascht und ein wenig erschrocken aus.
»Wieso nicht?«
»Weil ich immer Wort halte. Als er mir das erste Mal schrieb, hatte ich ihm versprochen, dass ich nicht versuchen würde, ihn aufzuspüren.«
»Sie glauben, dass jemand im Hintergrund steht?«
»Ich weiß, dass es sich so verhält.«
»Dieser Professor, den Sie mir gegenüber erwähnt haben?«
»Richtig!«
Inspektor MacDonald lächelte, und sein Augenlid zuckte, als er mir einen Blick zuwarf. »Ich möchte Ihnen nicht verheimlichen, Mr. Holmes, dass wir vom C. I. D. der Meinung sind, dass Sie hinsichtlich dieses Professors einen Vogel haben. Ich habe in dieser Angelegenheit selbst ein paar Nachforschungen angestellt. Er scheint ein sehr ehrbarer, gelehrter und begabter Mensch zu sein.«
»Ich bin erfreut, dass Sie wenigstens sein Talent erkannt haben.«
»Menschenskind, das muss man doch erkennen! Nachdem ich Ihre Ansicht gehört hatte, habe ich es zu meiner Sache gemacht, ihn aufzusuchen. Ich habe mit ihm über Sonnenfinsternisse geplaudert – wie wir im Gespräch darauf gekommen sind, weiß ich nicht mehr –, aber er hat eine Reflektorlaterne und einen Globus hervorgeholt und mir alles innerhalb von einer Minute klargemacht. Er hat mir ein Buch geliehen, aber ich gebe gern zu, dass es ein bisschen zu hoch für mich war, obwohl ich eine gute Erziehung in Aberdeen genossen habe. Er hätte einen guten Pfarrer abgegeben, mit seinem schmalen Gesicht und dem grauen Haar und der feierlichen Art zu sprechen. Als er mir beim Abschied dann eine Hand auf die Schulter gelegt hat, war das wie ein väterlicher Segen, ehe man in die kalte, grausame Welt auszieht.«
Holmes lachte leise und rieb sich die Hände. »Großartig!«, rief er aus; »großartig! Sagen Sie, Freund MacDonald; dieses erfreuliche und anrührende Gespräch hat sich, wie ich annehme, im Arbeitszimmer des Professors zugetragen?«
»Ja, so war es.«
»Ein schönes Zimmer, nicht wahr?«
»Sehr schön – wirklich stattlich, Mr. Holmes.«
»Sie haben vor seinem Schreibtisch gesessen?«
»Ganz genau.«
»Die Sonne schien Ihnen in die Augen, und sein Gesicht befand sich im Dunkeln?«
»Tja, es war Abend, aber ich erinnere mich, dass die Lampe auf mein Gesicht gerichtet war.«
»Natürlich. Ist Ihnen zufällig ein Gemälde über dem Kopf des Professors aufgefallen?«
»Mir entgeht nicht viel, Mr. Holmes. Vielleicht habe ich das von Ihnen gelernt. Ja, ich habe da ein Bild gesehen – eine junge Frau, den Kopf auf die Hände gestützt, und sie schaut einen von der Seite an.«
»Das Gemälde stammt von Jean-Baptiste Greuze.«
Der Inspektor bemühte sich, Interesse zu bekunden.
»Jean-Baptiste Greuze«, fuhr Holmes fort, legte die Fingerspitzen aneinander und lehnte sich in seinem Stuhl zurück, »war ein französischer Künstler, der zwischen 1750 und 1800 tätig war. Natürlich beziehe ich mich auf seine berufliche Laufbahn. Die moderne Kritik hat die hohe Meinung, die seine Zeitgenossen von ihm hatten, mehr als bestätigt.«
Die Augen des Inspektors verloren sich in der Ferne. »Sollten wir nicht vielleicht –«, sagte er.
»Wir sind schon dabei«, unterbrach Holmes ihn. »Alles, was ich jetzt sage, weist einen unmittelbaren und entscheidenden Bezug zu dem auf, was Sie als das Rätsel von Birlstone bezeichnet haben. Tatsächlich könnte man es in gewisser Hinsicht als dessen Dreh- und Angelpunkt bezeichnen.«
MacDonald lächelte matt und sah flehentlich zu mir. »Ihre Gedanken bewegen sich ein bisschen zu schnell für mich, Mr. Holmes. Sie lassen ein, zwei Glieder aus, und ich kann die Lücken nicht schließen. Was für ein Zusammenhang, um alles in der Welt, soll zwischen diesem verstorbenen, malenden Menschen und der Angelegenheit in Birlstone bestehen?«
»Jedwedes Wissen erweist sich für den Detektiv als nützlich«, bemerkte Holmes. »Selbst so ein trivialer Umstand, dass ein Gemälde von Greuze mit dem Titel ›La Jeune Fille à l’agneau‹ im Jahr 1865 nicht weniger als eine Million Zweihunderttausend Francs, mehr als 40 000 Pfund, auf der Portalis-Auktion erzielte, setzt in Ihrem Kopf womöglich einen Denkprozess in Gang.«
Es war offensichtlich, dass dem so war. Der Inspektor wirkte ernsthaft interessiert.
»Dürfte ich Sie daran erinnern«, fuhr Holmes fort, »dass das Gehalt des Professors aus mehreren vertrauenswürdigen Verzeichnissen ermittelt werden kann. Es beläuft sich auf siebenhundert im Jahr.«
»Wie war es ihm dann möglich, ein solches Gemälde käuflich –«
»Ganz genau! Wie war ihm das möglich?«
»Oh ja, das ist in der Tat bemerkenswert«, sagte der Inspektor nachdenklich. »Reden Sie nur weiter, Mr. Holmes. Das gefällt mir. Das ist sehr gut.«
Holmes lächelte. Aufrichtige Bewunderung wärmte ihm stets das Herz – der Wesenszug des wahren Künstlers. »Was ist mit Birlstone?«, fragte er.
»Wir haben noch Zeit«, meinte der Inspektor und schaute auf seine Uhr. »Ich habe eine Droschke vor der Tür, und bis zur Victoria Station brauchen wir keine zwanzig Minuten. Aber was dieses Gemälde betrifft – ich dachte, Sie hätten mir einmal erzählt, Mr. Holmes, Sie seien Professor Moriarty nie begegnet.«
»Stimmt, noch nie.«
»Woher wissen Sie dann über seine Räumlichkeiten Bescheid?«
»Ah, das ist wieder ganz etwas anderes. Ich bin dreimal in seiner Wohnung gewesen, zweimal habe ich unter verschiedenen Vorwänden auf ihn gewartet und bin dann wieder gegangen, ehe er kam. Einmal – nun ja, einem offiziellen Kriminalbeamten dürfte ich von diesem einen Mal eigentlich nicht erzählen. Es war bei dieser Gelegenheit, dass ich mir die Freiheit nahm, seine Unterlagen zu überfliegen – mit höchst unerwarteten Ergebnissen.«
»Haben Sie etwas Kompromittierendes gefunden?«
»Absolut nichts. Das war es, was mich so verblüfft hat. Aber jetzt kennen Sie ja die Sache mit dem Gemälde. Es zeigt, dass er ein sehr reicher Mann ist. Wie ist er zu dem Reichtum gekommen? Er ist unverheiratet. Sein jüngerer Bruder ist Bahnhofsvorsteher im Westen Englands. Sein Lehrstuhl wirft siebenhundert Pfund im Jahr ab. Und er besitzt einen Greuze.«
»Und?«
»Die Schlussfolgerung ist doch offensichtlich.«
»Sie meinen, dass er hohe Einkünfte erzielt und dass er sie auf unrechtmäßige Weise sich verdienen muss?«
»Genau. Natürlich habe ich noch andere Gründe, so zu denken – Dutzende von winzigen Fäden, die vage zur Mitte des Netzes führen, wo die giftige reglose Kreatur lauert. Ich erwähne den Greuze nur deshalb, da er die Angelegenheit in das Feld ihrer eigenen Beobachtungen rückt.«
»Nun, Mr. Holmes, ich gebe zu: Was Sie da sagen, ist interessant. Es ist mehr als nur interessant – es ist geradezu wunderbar. Aber lassen Sie es uns ein wenig deutlicher formulieren. Geht es um Fälschung, Falschmünzerei, Einbrüche – woher kommt das Geld?«
»Haben Sie je über Jonathan Wild gelesen?«
»Nun, der Name klingt vertraut. Jemand aus einem Roman, ist’s nicht so? Ich messe Ermittlern in Romanen nicht viel Bedeutung bei – Leute, die etwas machen, einen aber nie wissen lassen, wie sie es nun anstellen. Das ist alles bloß Eingebung, keine richtige Arbeit.«
»Jonathan Wild war kein Ermittler, und er stammt auch aus keinem Roman. Er war ein Verbrechergenie und lebte im letzten Jahrhundert – um 1750.«
»Dann nützt er mir nichts. Ich bin ein praktisch veranlagter Mensch.«
»Mr. Mac, was Sie in praktischer Hinsicht am besten in Ihrem Leben tun sollten, wäre, sich ein Vierteljahr einzuschließen und zwölf Stunden am Tag in den Annalen des Verbrechens zu lesen. Alles wiederholt sich zyklisch, sogar Professor Moriarty. Jonathan Wild war die verborgene Macht der Londoner Kriminellen, denen er seine Geistesschärfe und sein Organisationstalent gegen eine Beteiligung von fünfzehn Prozent verkaufte. Das alte Rad dreht sich immer noch, und dieselbe Speiche kommt wieder nach oben. Alles ist schon einmal dagewesen und wird sich erneut so abspielen. Ich erzähle Ihnen ein oder zwei Dinge über Moriarty, die Sie interessieren dürften.«
»Sie wecken tatsächlich mein Interesse.«
»Zufällig weiß ich, wer das erste Glied in seiner Kette ist – einer Kette mit diesem Napoleon-auf-Abwegen an einem Ende und hundert heruntergekommenen Schlägern am anderen Ende, allesamt Taschendiebe, Erpresser und Falschspieler, und zwischen diesen stoßen wir auf jede nur erdenkliche Art von Verbrechen. Sein Stabschef ist Colonel Sebastian Moran, so unnahbar und zurückhaltend und unerreichbar für das Gesetz wie er selbst. Was, glauben Sie, zahlt er ihm?«
»Das würde ich gerne erfahren.«
»Sechstausend im Jahr. Sie bezahlen für die besten Köpfe, wie Sie sehen – das amerikanische Geschäftsprinzip. Dieses Detail habe ich durch Zufall erfahren. Das ist mehr, als der Premierminister erhält. Jetzt haben Sie eine ungefähre Vorstellung von Moriartys Einkünften und von der Größenordnung, in der er tätig ist. Und noch ein Aspekt. Ich habe es mir kürzlich zur Aufgabe gemacht, einige von Moriartys Schecks nachzuverfolgen – gewöhnliche, unscheinbare Schecks, mit denen er seine Haushaltsrechnungen begleicht. Sie waren auf sechs unterschiedliche Banken ausgestellt. Was für einen Eindruck hinterlässt das bei Ihnen?«
»Mit Sicherheit sonderbar. Aber was schließen Sie daraus?«
»Dass er kein Gerede über seinen Reichtum haben will. Kein Einziger soll wissen, was er besitzt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er zwanzig Bankkonten hat – der Großteil seines Vermögens liegt vermutlich bei der Deutschen Bank oder der Crédit Lyonnais. Sollten Sie einmal ein oder zwei Jahre erübrigen können, empfehle ich Ihnen, sich mit Professor Moriarty zu beschäftigen.«
Inspector MacDonald zeigte sich im Verlauf des Gesprächs mehr und mehr beeindruckt. Er hatte sich im Nachdenken verloren. Jetzt aber brachte ihn sein praktischer schottischer Verstand schlagartig zum vorliegenden Fall zurück.
»Er kann noch etwas warten«, sprach er. »Sie haben uns mit Ihren interessanten Anekdoten vom Thema abgelenkt, Mr. Holmes. Was wirklich zählt, ist Ihre Bemerkung, dass es da einen Zusammenhang zwischen dem Professor und dem Verbrechen gibt. Das haben Sie der Warnung entnommen, die Sie von diesem Porlock erhalten haben. Können wir für unsere gegenwärtigen praktischen Bedürfnisse sonst noch etwas daraus ziehen?«
»Wir können uns ein Bild von den Motiven des Verbrechens machen. Es handelt sich, wie ich Ihrer anfänglichen Bemerkung entnehme, um einen unerklärlichen oder zumindest um einen nicht aufgeklärten Mord. Also, wenn wir davon ausgehen, dass der Ursprung des Verbrechens dort zu finden ist, wo wir ihn vermuten, könnte es zwei verschiedene Motive geben. Als Erstes kann ich Ihnen sagen, dass Moriarty mit eiserner Faust über seine Leute herrscht. Seine Disziplin ist unglaublich. In seinem Kodex gibt es nur eine Art von Bestrafung: den Tod. Wir können also davon ausgehen, dass dieser ermordete Mann – dieser Douglas, dessen bevorstehendes Schicksal einem der Untergebenen des Erzverbrechers bekannt gewesen ist – den Chef in irgendeiner Weise verraten hat. Seine Bestrafung folgte auf dem Fuß, und alle sollen davon erfahren, und sei es nur, um ihnen Todesangst einzujagen.«
»Nun, das wäre eine Möglichkeit, Mr. Holmes.«
»Die andere wäre, dass es von Moriarty in der üblichen Vorgehensweise organisiert wurde. Ist etwas gestohlen worden?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Falls ja, würde das natürlich der ersten Hypothese widersprechen und eher für die zweite sprechen. Moriarty wurde womöglich mit der Aussicht auf einen Teil der Beute beauftragt, das alles zu organisieren, oder man hat ihm so viel im Voraus gezahlt, damit er es durchzieht. Beides ist möglich. Aber was es auch sein mag oder falls es auch noch eine dritte Konstellation gibt, wir müssen die Lösung in Birlstone suchen. Ich kenne unseren Mann zu genau, um davon ausgehen zu können, dass er hier irgendetwas hinterlassen hätte, das uns zu ihm führen könnte.«
»Dann auf nach Birlstone!«, rief MacDonald und sprang von seinem Stuhl auf. »Donnerwetter! Es ist später, als ich dachte. Ich kann Ihnen fünf Minuten geben, um sich fertigzumachen, meine Herren, mehr aber nicht.«
»Genügend Zeit für uns beide«, sagte Holmes, während er aufsprang und sich beeilte, den Morgenrock gegen den Mantel zu tauschen. »Wenn wir unterwegs sind, Mr. Mac, möchte ich Sie bitten, mir freundlicherweise alles zu erzählen.«
»Alles zu erzählen« erwies sich als enttäuschend dürftig, und dennoch genügte es, um uns davon zu überzeugen, dass der vorliegende Fall durchaus die größte Aufmerksamkeit des Experten verdienen könnte. Seine Miene hellte sich auf, und er rieb sich die schmalen Hände, während er den spärlichen, aber erstaunlichen Einzelheiten lauschte. Hinter uns lagen etliche ereignislose Wochen, und hier bot sich endlich ein geeignetes Objekt für jene bemerkenswerten Fähigkeiten, die, wie alle speziellen Gaben, belastend für ihren Besitzer sein können, wenn sie nicht angewandt werden. Sein rasiermesserscharfer Verstand stumpfte ab und wurde rostig.
Sherlock Holmes’ Augen glitzerten, seine blassen Wangen nahmen einen wärmeren Farbton an, und sein ganzes wissbegieriges Gesicht leuchtete von innen heraus, wenn der Ruf nach Arbeit ihn erreichte. Er saß leicht vornübergebeugt in der Droschke und lauschte aufmerksam MacDonalds kurzer Darstellung des Rätsels, das uns in Sussex erwarten sollte. Der Inspektor wiederum war, wie er uns erläuterte, auf eine gekritzelte Nachricht angewiesen, die er in den frühen Morgenstunden mit dem Milchzug erhalten hatte. Der örtliche Beamte White Mason war ein Freund von ihm, und daher war MacDonald sehr viel früher von der Sache in Kenntnis gesetzt worden, als dies sonst bei Scotland Yard üblich ist, wenn Beamte aus der Provinz Unterstützung benötigen. Meist ist die Fährte schon längst kalt, wenn der Experte aus der Hauptstadt gebeten wird, sie zu verfolgen.
»SEHR GEEHRTER HERR INSPEKTOR MACDONALD«, stand in dem Schreiben, das er uns vorlas, – »die amtliche Aufforderung für die Inanspruchnahme Ihrer Dienste befindet sich in einem separaten Umschlag. Dies ist nur für Sie bestimmt. Telegraphieren Sie mir, welchen Zug Sie am Morgen nach Birlstone nehmen können, und ich hole Sie ab – oder lasse Sie abholen, wenn ich zu beschäftigt bin. Dieser Fall ist ein echter Kracher. Verschwenden Sie keinen Moment, sich auf den Weg zu machen. Wenn Sie Mr. Holmes mitbringen können, tun Sie das bitte, denn er wird etwas vorfinden, was ganz nach seinem Geschmack sein dürfte. Man könnte meinen, die ganze Sache wäre arrangiert worden, um einen dramatischen Effekt zu erzielen, gäbe es da nicht mittendrin einen Toten. Im Ernst! Das ist ein Kracher!«
»Ihr Freund scheint kein Dummkopf zu sein«, bemerkte Holmes.
»Nein, Sir, White Mason ist ein sehr rühriger Mann, soweit ich das beurteilen kann.«
»Und, haben Sie sonst noch etwas?«
»Nur, dass er uns alle Einzelheiten nennen wird, wenn wir ihn treffen.«
»Wie haben Sie dann von Mr. Douglas und dem Umstand erfahren, dass er auf entsetzliche Weise ermordet wurde?«
»Das fand sich in dem beigefügten offiziellen Bericht. Da stand nicht ›entsetzlich‹: Das ist kein geläufiger amtlicher Ausdruck. Der Bericht nannte den Namen John Douglas. Es wird erwähnt, dass er Verletzungen am Kopf hatte, vom Abfeuern einer Schrotflinte. Erwähnt wird auch, zu welcher Stunde Alarm geschlagen wurde, und zwar gestern Abend kurz vor Mitternacht. Dort stand außerdem, dass es sich bei dem Fall zweifelsfrei um Mord handele, es sei aber noch keine Verhaftung vorgenommen worden, und darüber hinaus handele es sich um einen Fall, der einige äußerst verwirrende und außergewöhnliche Merkmale aufweise. Das ist wirklich alles, was wir gegenwärtig haben, Mr. Holmes.«
»Dann belassen wir es mit Ihrem Einverständnis dabei, Mr. Mac. Die Versuchung, voreilige Theorien aufgrund unzureichender Fakten aufzustellen, ist der Fluch unseres Berufsstandes. Im Augenblick kann ich lediglich zwei Aspekte als gesichert ausmachen: ein großes Hirn in London und einen Toten in Sussex. Es ist die Kette zwischen diesen beiden Punkten, die wir nachverfolgen müssen.«
Kapitel III
Die Tragödie von Birlstone
NUN bitte ich für einen Augenblick um die Erlaubnis, meine eigene unbedeutende Person hintanzustellen und die Ereignisse, die sich zutrugen, ehe wir am Ort des Geschehens eintrafen, im Lichte der Erkenntnisse zu schildern, die uns erst später zuteilwurden. Nur auf diese Weise kann ich den Leser in die Lage versetzen, die betroffenen Personen und den seltsamen Schauplatz zu würdigen, an dem sich ihr Schicksal abspielte.
Das Dorf Birlstone ist eine kleine und sehr alte Ansammlung von Fachwerk-Cottages an der nördlichen Grenze der Grafschaft Sussex. Seit Jahrhunderten war es unverändert geblieben, doch haben im Lauf der letzten Jahre sein pittoreskes Erscheinungsbild und seine Lage eine Reihe gut situierter Bewohner angezogen, deren Villen aus den umliegenden Wäldern hervorlugen. Diese Waldgebiete gelten aus örtlicher Sicht als äußerste Ausläufer des großen Weald-Waldes, der sich verjüngt, bis er den nördlichen Kalksteinhöhenzug erreicht. Eine ganze Reihe Geschäfte sind entstanden, um den Bedürfnissen der wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden, so dass offenbar Aussicht besteht, dass Birlstone sich schon recht bald von einem alten Weiler zu einer modernen Stadt entwickeln könnte. Es bildet das Zentrum einer beträchtlichen Region dieses Landstrichs, da Tunbridge Wells, die nächstgelegene Ortschaft von Bedeutung, zehn bis zwölf Meilen ostwärts jenseits der Grenzen nach Kent liegt.
Etwa eine halbe Meile von der Ortschaft entfernt befindet sich in einem alten Park, der berühmt ist für seine gewaltigen Buchen, das alte Herrenhaus von Birlstone. Ein Teil dieses ehrwürdigen Gebäudes datiert zurück auf die Zeit des Ersten Kreuzzugs, als Hugo de Capus eine Feste in der Mitte jenes Besitztums errichtete, das ihm vom Roten König übertragen worden war. Diese wurde 1543 durch Feuer zerstört, und einige der rußgeschwärzten Grundsteine wurden verwendet, als zu der Zeit König James I. ein aus Backstein erbautes Landhaus auf den Ruinen der feudalen Burg entstand.
Das Herrenhaus mit seinen vielen Giebeln und den kleinen, rautenförmigen Fensterscheiben sah noch fast so aus, wie der Erbauer es zu Beginn des 17. Jahrhunderts hinterlassen hatte. Von den beiden Gräben, die einst den kriegerischen Vorläufer schützten, hatte man den äußeren austrocknen lassen, der inzwischen die bescheidene Funktion eines Küchengartens erfüllte. Der innere Graben existierte noch und zog sich vierzig Fuß breit, allerdings nur noch ein paar Fuß tief, um das gesamte Gebäude herum. Ein kleiner Bachlauf speiste ihn und verlief jenseits davon weiter, so dass die Wasserfläche zwar trübe, aber nie brackig-abgestanden oder ungesund war. Die Fenster im Erdgeschoss befanden sich einen Fuß oberhalb der Wasseroberfläche.