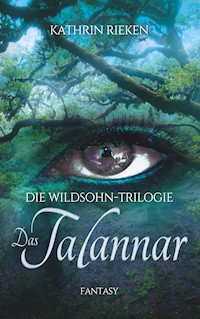
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Wildsohn-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ahacco lebt bereits seit Jahren im Dorf Ik´Ernu an der Westküste Ormands, der größten der »Wachsenden Inseln« Aerdenwelts. Niemand weiß, dass der junge Mann früher den Wildsöhnen angehörte, die sich dem Schutz des Waldes verschrieben haben und die wegen ihrer geheimnisvollen Kräfte gefürchtet sind. Eines Tages entsteht in der Nähe des Dorfes neues Land - und mit ihm ein schwarzer Berg. Dieser erweist sich als Hort der Schattenalben, dämonischer Wesen, die einen tiefen Hass gegen die Menschen hegen. Wie sich zeigt, ist Ahaccos Schicksal eng mit dem der Schattenalben verbunden ... »So fantastisch wie fantasievoll« (Augsburger Allgemeine)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 767
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autorin
Kathrin Rieken wurde 1996 in Augsburg geboren und begann mit acht Jahren Gedichte und Geschichten zu schreiben. 2008 gewann sie mit dem Gedicht »Ostfriesland bei Nacht« einen Preis bei einem Literaturwettbewerb des Arbeitskreises Ostfriesischer Autoren. Sie studiert derzeit im Master Physik und arbeitet an der Universität Augsburg. In ihrer Freizeit ist sie als Fitness-Trainerin im Turnverein und als Violinistin in der Mittelalterrockband »Sturmfänger« aktiv. Der Fantasy-Roman »Das Talannar« ist ihr erstes Buch und der erste Band der »Wildsohn«-Trilogie, an der sie seit ihrem 14. Lebensjahr schreibt. Der zweite Teil, »Die Totensuche«, erscheint in Kürze.
Lebt nicht im Wald, sondern mit ihm.
Aus dem Buch
»Lieder und Gedichte der Wildsöhne«
von B. Makaloro
Inhalt:
Aerdenwelt
Ik’Ernu
Ein Lied für Ahacco
Oblúvien
Das Atelier des Meisters
Nacht der Geschichten
Die Wachsende Insel
Am Rand der Klippen
Das Fest von Bärenbark
Wahrheit und Erinnerung
Im Schatten des Berges
Wechselnde Winde
Unter Verdacht
Diebstahl
Stimmen im Wind
Die letzte Prüfung
Der Xorroc
Am Fuß des Towroquartz
Jäger der Dämmerung
Daru’Chur
Das Tál An’Nar
Unerforschtes Gebiet
Hoher Besuch
Die Bibliothek von Sinnabol
Die Warnung
Im Hospital
Martha
Nächtliche Gäste
Die Ehrliche Eiche
Der Herzog von Ormand
Fremde
Ein alter Freund
Scherbenfest
Tod und Leben
Abschied von Ik’Ernu
Fort
Das Silberne Haus
Die Reise geht weiter
Der Tausendherzwald
Wildheim
Sturm
Entscheidungen
Die Sprache der Adler
Die Erscheinung
Die singenden Raiséllhornbäume
Blutmond
Schwert und Stab
Schlechte Nachrichten
Heilung
Fáinne
Rumiens Geheimnis
Auf feindlichem Gebiet
Der Schattendrache
Die letzte Etappe
Eisthal
Morven Domstein
Die Abtrünnigen
Anhang:
Karte von Ormand
Personenverzeichnis
Mehr von Kathrin Rieken
Aerdenwelt
»Warum sind wir Menschen eigentlich so verschieden?«, fragte der Schüler des großen Meisters Warwinther. »Es wäre auf dieser Welt doch alles viel einfacher, wenn sich die Menschen ähnlicher wären.«
Warwinther, der auch der Sternenfänger genannt wurde, lächelte über diese Frage. »Da magst du Recht haben. Aber sieh dir den Himmel an und zeig mir zwei Sterne, die gleich sind. Wir sind wie sie, mein Junge. Kein Licht leuchtet wie das andere.«
So kamen sie auf den Nachthimmel zu sprechen. Der alte Mann erklärte seinem Schüler, dass die Finsternis dort oben wahrscheinlich unendlich war – ebenso unendlich wie die Anzahl der kleinen Lichter, die Warwinther als erster Gelehrter Aerdenwelts ›Sterne‹ getauft hatte. Er war es auch gewesen, der erstmals die These geäußert hatte, dass das Licht und das Leben auf Aerdenwelt noch relativ junge Erscheinungen waren, wie er dem Jungen heute nicht zum ersten Mal darlegte. Er vermutete sogar, dass ihre Welt aus einer riesigen Explosion in der Sonne hervorgegangen war ...
»Aber Meister«, unterbrach der Schüler seine weitschweifigen Ausführungen, »das hieße ja, dass es auch uns Menschen noch gar nicht so lange gibt.«
»Nein, sowieso nicht«, erwiderte Warwinther geduldig. »Die ersten Lebewesen, die denken und sprechen konnten, waren die Dendramen. Sie beherrschten diese Welt viele Jahrtausende lang. Aus ihnen haben sich nach und nach wir Menschen entwickelt. Die Dendramen waren es, die unseren Planeten ›Aerdenwelt‹ tauften. Sie erfanden auch die Schrift und gaben jedem Kontinent, jeder Insel und jedem Lebewesen einen Namen. Wir benutzen diese alten Namen, die heute jedes Kind kennt, immer noch: die Länder Erinhas, der große Kontinent Galica, der Narshear-Ozean ... und nicht zu vergessen, die Kreskiden, unsere ›Wachsenden Inseln‹. Wusstest du, dass die Kreskiden früher so klein waren, dass sie auf den Karten nicht einmal verzeichnet waren? Bis man feststellte, dass sie im Laufe der Zeit immer größer wurden.«
»Wie kommt es, dass die Inseln wachsen, Meister?«
Warwinther wiegte bedächtig den Kopf. »Ich denke, dass der Grund für dieses Wunder tief unter der Erde liegt. Mein früherer Schüler Daemos, der heute in Eisthal lebt, ist sogar fest davon überzeugt.«
»Und was genau passiert da?«
»Daemos meint, es gäbe tief unter der Erde ein Feuer, und das sei so heiß, dass es das Gestein verformt und verflüssigt. In einer Wachstumsphase träte es an die Oberfläche. Die Gesteinsmassen würden dabei von irgendeiner geheimnisvollen Kraft nach oben gedrückt. Sie erkalten, werden fest, und wir sehen sie dann als das neu entstandene Land. Aber warum die Kreskiden die einzigen Landmassen auf ganz Aerdenwelt sind, die wachsen, weiß bisher keiner.«
Der Junge war sichtlich beeindruckt. »Die Kreskiden sind also aus flüssigem Gestein entstanden?«, fragte er.
»Ich denke ja. So wird es heute in den Schulen gelehrt. Aber es gibt auch Leute, die das nicht glauben. Die Wildsöhne zum Beispiel sind der Überzeugung, dass nicht die Berge, sondern der Wald der Anfang aller Dinge war. Darum verehren sie ihn so.«
»Das ist vielleicht der Grund, warum viele die Wildsöhne nicht leiden können«, mutmaßte sein Schüler.
Warwinther freute sich darüber, dass der Junge sich seine eigenen Gedanken machte. »Die Menschen neigen dazu, Dinge abzulehnen, die ihnen fremd sind«, meinte er.
»Und wer hat Recht? Was ist denn nun der Ursprung unserer Welt?«
»Das wird wohl immer eine Glaubensfrage bleiben.« Die Züge des alten Mannes verdunkelten sich für einen Augenblick. »Wie du weißt, glauben die Menschen an alles Mögliche. Viele sind zum Beispiel davon überzeugt, dass unsere Welt aus drei Reichen besteht. Das ›Obere Reich‹ ist demnach die Heimstatt übergeordneter Wesen mit magischen Kräften. Das ›Zweite Reich‹, auch ›Mittelwelt‹ genannt, ist das, in dem wir leben. Und im ›Unteren Reich‹ sind die Schatten und Dämonen eingesperrt. Von dort aus drängen sie an die Oberfläche, um unsere Welt zu erobern und uns ins Verderben zu stürzen ...«
Dann lächelte er den neugierigen Jungen wieder an und wechselte erneut das Thema. »Es waren übrigens wir Menschen, die als erste damit begannen, die Zeit in Epochen zu gliedern, in Jahre und in immer kleinere Abschnitte. Andere Völker übernahmen diese Idee. Aber leider unterteilt heute jedes Volk seine Zeit anders. Was Ordnung hätte schaffen können, artete in Verwirrung aus.«
»Sollte man sich nicht auf eine Einteilung einigen?«
»Ja, das wäre sicher gut«, meinte Warwinther. »Aber wie du weißt, herrscht noch immer viel Zwiespalt zwischen den Völkern. Jedes Volk hat nun einmal seine eigenen Geschichten, auf die es stolz ist und mit der es sich identifiziert.«
Der alte Mann wusste nur zu gut, wie wichtig die alten Überlieferungen für alle Völker waren, egal ob sie reale Begebenheiten enthielten oder ob es sich um Märchen handelte. So erzählte man sich zum Beispiel von großen Kriegen, zornigen Göttern und blutrünstigen Königen. Diese Geschichten dienten den Menschen vor allem als Warnung, damit sich die geschilderten Schrecken nicht wiederholten. Es gab aber auch Erzählungen über glorreiche Feldherren, die Länder erobert und geeint hatten, sowie über mutige Menschen, die anderen viel Gutes getan hatten. Joanuth der Jähzornige aus der Dritten Epoche war einer jener Helden, die durch ihre Taten sogar weltweiten Ruhm erlangt hatten. Menschen wie Joanuth waren der Grund, dass gerade junge Leute davon träumten, eines Tages ebenfalls Helden zu werden und in den Erzählungen anderer weiterzuleben.
»Übrigens wurden die Wildsöhne nicht immer angefeindet«, kam Warwinther auf ihr vorheriges Gesprächsthema zurück. »Kannst du dich an die Geschichte über die geheimnisvollen Waldwesen aus der Dritten Epoche erinnern?«
»Die Vaeren? Es heißt, sie wären irgendwann einfach verschwunden, weil die Menschen Jagd auf sie machten.«
»Richtig. Erst danach begannen die Leute, die Wildsöhne zu verfolgen. Die Menschen scheinen immer etwas zu brauchen, das sie eint – und nichts eignet sich dafür besser als die Furcht vor etwas Fremden und der Hass auf einen gemeinsamen Feind. Die Wildsöhne waren ein guter Ersatz für die Vaeren, hatten sie doch eine ganz ähnliche Lebensweise.«
»Was ist eigentlich aus den Vaeren geworden? Denkt Ihr, dass sie noch irgendwo am Leben sind?«
»Es heißt, sie hätten sich tief in den Wald zurückgezogen und lebten seitdem im Verborgenen.«
»Glaubt Ihr, dass das stimmt?«
»Wer weiß. Wenn nicht, wäre das ein großer Verlust für diese Welt.«
»Wisst Ihr denn, worin das Geheimnis der Vaeren bestand, Meister? Ihr wisst doch so vieles.«
Warwinther kicherte. »So, glaubst du das? Ich würde behaupten, mein größtes Wissen ist, dass ich nichts wirklich weiß.«
Der Junge blieb beharrlich. »Einer meiner früheren Lehrer hat gesagt, die Wildsöhne seien den Vaeren sehr ähnlich. Auch sie leben im Wald und verehren ihn. Auch sie haben etwas Geheimnisvolles an sich. Er meinte, sie würden über magische Kräfte verfügen.«
»Eine Kraft, vor der die Menschen heute nicht weniger Angst haben als unsere Vorväter«, sagte sein Meister. »Früher hat man sie den Vaeren angedichtet, später dann den Wildsöhnen. Sie ist einer der Gründe, weshalb die Waldbewohner so viel Hass erfahren haben. Die Wildsöhne wurden im Laufe der Jahre ja nicht nur verjagt und verfolgt. Einige hat man sogar schon gefoltert, um ihnen ihre Geheimnisse zu entreißen. Aber niemand hat je herausgefunden, ob sie tatsächlich irgendwelche magischen Kräfte besitzen.«
Warwinther schwieg eine Weile. Dann schaute er seinem Schüler unvermittelt tief in die Augen und sagte eindringlich: »Sprich vor anderen Leuten lieber nicht über die Wildsöhne. Denk immer daran: Die Furcht und die Gier der Menschen kennen keine Grenzen.«
Mit einer energischen Geste, die jede mögliche Äußerung des verwirrten Jungen im Keim erstickte, wandte er sich wieder seinen Büchern zu.
Ik’Ernu
Mit einem lauten Krachen brach der letzte große Ast entzwei. Ahacco wuchtete die beiden Teile auf den Stapel, den er im Verlauf des Vormittags in der Nähe des Zauns aufgeschichtet hatte.
Der vertraute Geruch nach frischem Holz und Harz stieg ihm in die Nase und erinnerte ihn daran, weshalb er sich bei Bernos Sägewerk beworben hatte: Er mochte die Arbeit mit den Bäumen. Wenn sie schon jemand von ihren Ästen befreien musste, damit sie zugesägt und zu Möbeln, Türen oder Fensterrahmen verarbeitet werden konnten, dann wollte Ahacco es tun. Er fühlte sich dabei wohl und erledigte die Aufgabe mit dem nötigen Respekt.
Seine Oberarme brannten von der Anstrengung, und in der Mittagshitze lief der Schweiß über seinen freien, sonnengebräunten Oberkörper. Ein letztes Mal schlug er mit der Axt auf das Holz ein, dann legte er sie beiseite. Für heute war die Arbeit getan.
Ahacco nahm sein Hemd und durchquerte den staubigen Hof.
Berno beschäftigte ein gutes Dutzend Leute. Damit war sein Sägewerk der größte Betrieb des Dorfes Ik’Ernu. Er besaß zwei Mühlräder, die sich von frühmorgens bis spätabends drehten und große Maschinen antrieben. Diese machten das Werk zu dem modernsten an der Ostküste von Ormand.
Ahacco grüßte die Männer, an denen er vorbeiging und die noch bis zum Abend mit dem Zersägen der Stämme beschäftigt sein würden. Die meisten von ihnen kannte er schon seit Jahren.
Er blieb vor Bernos kleinem Wohnhaus im Schatten der Werksmauer stehen und klopfte an die Tür.
Der untersetzte, glatzköpfige Mann öffnete und schaute hinaus. »Ah, Ahacco. Du bist schon fertig?«, fragte er mit seiner rauen, tiefen Stimme. »Keine Ahnung, wie du das machst, aber du bist immer zu schnell.«
Ahacco öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, aber da war Berno schon lachend in der Diele verschwunden. Kurz darauf trat er wieder vor die Tür und drückte Ahacco einen kleinen Lederbeutel in die Hand: sein Lohn für diesen Vormittag.
»Danke, Berno«, sagte Ahacco. »Kann ich dann gehen?«
»Im Moment sind genug Leute da. Geh ruhig und mach dir einen schönen Nachmittag.«
Ahacco bedankte sich und schlenderte zum Tor hinaus. Das Geld ließ er in seiner Hosentasche verschwinden.
Bernos Betrieb lag außerhalb des Dorfes. Während Ahacco einen schmalen Wiesenpfad in Richtung der Landstraße einschlug, die Ik’Ernu mit dem Nachbardorf verband, genoss er den warmen Südwind im Gesicht. Er brachte zumindest ein bisschen Kühlung und trocknete den Schweiß.
An der Straße angekommen, blieb er stehen. Von links kam eine Kutsche angerattert. Die Räder wirbelten Sand und Staub auf, und die Hufe der Pferde klapperten auf dem trockenen Untergrund. Ahacco wartete, bis das Gefährt näher gekommen war. Als es an ihm vorbeifuhr, schwang er sich hinten auf die Gepäckablage. Niemand störte sich daran.
Ahacco blieb sitzen, während die Kutsche die Wäscherei am Dorfrand passierte, und ließ die schmalen, hölzernen Terrassen und winzigen Balkone der Häuser an sich vorüberziehen, bis sie die große Kreuzung erreichten. Hier sprang er ab. Er zog sich das Hemd über und folgte der Straße, die nach links führte.
Im Hochsommer lag um diese Tageszeit eine bedrückende Stille über Ik’Ernu. Nur vereinzelt traf Ahacco auf Menschen, die ihre kühlen Häuser verlassen hatten, vermutlich um dringende Einkäufe zu erledigen oder um ihre Jüngsten von der Schule abzuholen. Vor dem Rathaus spielten ein paar Kinder, die schon schulfrei hatten. Und auf den heißen Pflastersteinen des Platzes lagen ein paar ältere Jungen und ließen sich die Sonne auf den nackten Bauch scheinen. Sie genossen den Tag, ohne an Hausaufgaben oder Prüfungen zu denken.
Ahacco steuerte die Dorfwirtschaft an; von der harten Arbeit hatte er Hunger bekommen.
Gerade schlenderte er am Rathaus vorbei, da kam auf der anderen Seite eine Gruppe Jugendlicher um die Ecke. Sie sahen ihn, winkten und schlenderten auf ihn zu. Der schwarzhaarige Junge, der vorneweg lief, hob grüßend die Hand. Alles, was er trug, waren eine dunkle, verschlissene Lederhose und löchrige Stiefel, die aussahen, als hätten sie schon zu viele Winter und Sommer erlebt.
Während die Gruppe den Platz überquerte, hielten die Kinder in ihren Spielen inne und sahen mit einer Mischung aus Bewunderung und Angst zu den Größeren hinüber. Die Erwachsenen, die ihren Weg kreuzten, musterten sie missbilligend und machten, dass sie schnell weiterkamen.
»Hallo, Ahacco«, sagte der Schwarzhaarige, als die Jugendlichen den jungen Mann erreichten. Seine blauen Augen blitzten schelmisch, und beim Grinsen entblößte er strahlend weiße Zähne.
»Hallo, Jungs«, erwiderte Ahacco lächelnd und blickte in die Runde. Es waren fünf Jugendliche. Drei von ihnen waren Geschwister, wie er wusste. Trigo war der älteste von ihnen, und die Zwillinge hießen Dahi und Marik.
»Wie geht es euch, Tongo?«, fragte er den Jungen mit der Lederhose. Dieser war so etwas wie der Anführer der Gruppe.
»Gut. Wir wollen gerade in die Hügel gehen, zum Jagen.«
»Willst du mitkommen?«, fragte Kada und trat neben Tongo. Sie war das einzige Mädchen, das die Bande in ihrer Mitte duldete. Mit ihrem kecken Grinsen, dem nach hinten gebundenen Haar und der zerfetzten, weiten Hose hätte man sie auf den ersten Blick leicht für einen Jungen halten können.
»Tut mir leid, Kada, heute nicht«, antwortete Ahacco.
Sie schürzte die Lippen. »Aber dann verpasst du was. Ein Trupp Fasanen hat sich in den Hügeln niedergelassen.«
»Die kommen schon wieder. Ein andermal, in Ordnung?«
Ahacco hob die Hand zum Gruß und setzte seinen Weg fort.
»Willst du heute Abend bei uns vorbeikommen?«, rief Tongo ihm hinterher. »Es gibt Fasan.«
Ahacco drehte sich um und streckte einen Daumen in die Luft. Damit signalisierte er den Jugendlichen, dass er ihre Einladung gerne annahm.
Er hatte lange keine Gelegenheit mehr gehabt, sich mit ihnen zu unterhalten. Dabei mochte er Tongo und Kada wirklich gerne. Natürlich war ihm bewusst, dass er als Einziger im Dorf näheren Kontakt zu den beiden pflegte. Alle anderen wollten nichts mit ihnen zu tun haben – was nicht nur daran lag, dass Tongo und Kada Straßenkinder waren.
Nein, Ahacco konnte sich noch gut daran erinnern, wie man die beiden einmal beim Hühnerstehlen erwischt hatte. Oder das andere Mal, als sie mit Kohle groß und deutlich ›Herr der Schweinereien‹ auf die Tür des Rathauses geschmiert hatten. Erst beim letzten Windwechsel war es Ahacco nur um Haaresbreite gelungen, die ganze Bande in seiner Hütte zu verstecken, bevor sie eine Meute wütender Bürger erwischen konnte, die sie der Brandstiftung beschuldigte. Er wusste bis heute nicht, ob wirklich Tongo für das Feuer verantwortlich gewesen war, das beinahe ein ganzes Haus erfasst hatte, oder ob es durch die Trockenheit in Brand geraten war, wie der Jugendliche behauptete.
Ahacco musste zugeben: Tongos Bande hatte viel Unsinn im Kopf. Aber er mochte sie. Und darum freute er sich auf den gemeinsamen Abend.
Gut gelaunt betrat er die Wirtschaft.
~ Ein Lied für Ahacco ~
Nahe der Stadt Eisthal fegt ein klirrend kalter Nordwind über die Ebene von Alunia. Tiefer Winter liegt über der Insel Ormand. Der Sturm soll in den nächsten Tagen noch stärker werden und vielleicht Schnee mit sich bringen.
Am Südrand der Ebene erlischt nach und nach eine Kette von Lichtern. Die Laternen, die man zum Schutz vor bösen Mächten ins Freie gehängt hat, gehören zu einer Wagenkolonne, die nun, mitten in der Nacht, in vollkommener Finsternis und Stille liegt. Zwischen den Gespannen und den abgeschirrten Pferden bewegt sich keine Menschenseele, denn alle haben sich zum Schlafen in ihre Zelte begeben.
Nur in einem einzigen Wagen, von draußen kaum zu sehen, flackert noch das Licht einer Öllampe. Durch die geschlossene Plane ist ein Flüstern zu vernehmen. Drinnen liegen eine Frau und ihr vierjähriger Sohn bäuchlings auf einer alten Strohmatratze. Die Frau hält ein Buch in den schlanken, weißen Händen. Sie ist jung und sehr schön. Ihr pechschwarzes Haar fällt lockig bis auf die Buchseiten hinab.
»Er ist groß und hell, aber nur in jeder zwölften Nacht zu sehen«, liest sie dem kleinen Jungen mit leiser Stimme vor. »Denn nur in Voll- und Neumondnächten erscheint er hoch am Himmel, entweder Seite an Seite mit dem Mond oder allein an seiner Stelle. Den Menschen ist er unter dem Namen ›Xarion‹ bekannt, das bedeutet ›Funken der Nacht‹. Man sagt ihm nach, dass er mit dunklen Mächten im Bund steht, weil er blutrot am Himmel steht und seine Farbe die der Dämonen ist. Viele fürchten ihn so sehr, dass sie in diesen Nächten nicht vor die Tür gehen. Aber nur die abergläubischsten unter den Menschen haben eine derartige Angst vor dem roten Stern.«
Die junge Frau wendet dem Jungen ihr hübsches Gesicht zu. »Was meinst du, warum der Stern so rot ist, Ahacco?«
Der Kleine sieht sie mit großen, fragenden Augen an. Seine Iris leuchtet grün im schwachen Licht der kleinen Flamme.
Da ihm nichts einfällt, erklärt die Mutter es ihm: »Also ich glaube, dass die Farbe von dem vielen Blut stammt, das wir Menschen auf der Erde vergießen und das niemand wahrhaben will. Insofern ist der Xarion eine Mahnung an uns. Solange es Krieg und Mord auf Aerdenwelt gibt, wird er uns jeden Windmond aufs Neue an unsere schlimmsten Taten erinnern.«
»Aber das heißt ja, dass der Xarion, wenn es irgendwann nur noch Frieden auf Ormand gibt, vom Himmel verschwinden wird?«, überlegt der Junge.
»Wer weiß? Leider wird es wohl keinen Frieden geben, solange es Menschen gibt«, antwortet die Frau traurig.
»Aber wenn der Krieg nicht aufhört, warum brauchen die Menschen dann eine Warnung? Wovor warnt uns der rote Stern denn?«
»Vor dem Tod, Ahacco. Man sagt, wenn ein Mensch den Xarion auf der linken Seite des Mondes sieht, steht ihm der Tod bevor.«
Ahacco starrt seine Mutter ungläubig an. »Ich habe noch nie darauf geachtet, wo er steht. Ich habe mich nur gefragt, warum es ihn gibt. Was, wenn der Stern schon einmal auf der linken Seite stand und ich es nicht gemerkt habe?«
»Das glaube ich nicht. Schließlich lebst du noch.« Die junge Frau lächelt nachdenklich. »Du wirst das alles noch verstehen«, sagt sie dann. »Irgendwann werden es alle verstehen.«
»Aber ich will es jetzt verstehen!«
Die Mutter streicht Ahacco übers Haar, das ebenso pechschwarz ist wie das ihre. »Du stehst noch am Anfang deines Lebensweges. Du kannst nie wissen, wohin dich eine fremde Straße führt. Nicht einmal ich kann sagen, was passieren wird.«
»Aber du siehst doch auch, was mit den Kranken passieren wird. Du weißt immer schon vorher, ob du sie retten kannst oder nicht«, wendet Ahacco ein.
»Ihren Weg kann ich sehen, weil er die Krankheit ist. Und diesen Weg kenne ich, denn er ist bei vielen Leuten derselbe. Darum weiß ich auch meistens, wo er endet«, erklärt die Mutter geduldig.
Als ihrem Sohn ein lautes Gähnen entschlüpft, klappt die Frau das Buch zu und wickelt es sorgfältig in ein Stück Stoff. Sie versteckt es unter dem Kissen, obwohl eine Kiste mit Büchern gleich neben der Matratze liegt.
»Vergiss nicht«, raunt Ahaccos Mutter ihrem Sohn ins Ohr, »erzähle deinem Vater nichts davon. Er liebt mich, aber nicht meine Gabe. Er hat kein Verständnis für das, was ich tue und woran ich glaube. Deshalb darf er auch niemals wissen, dass ich dir diese Geschichten erzähle oder dieses Buch besitze, sonst wird er wütend. Verstehst du mich?«
Aber Ahacco hat sich längst neben ihr zum Schlafen zusammengerollt. Seine Augen sind geschlossen und seine Lider zucken, als wäre er bereits am Träumen.
Mit einem sanften Lächeln auf den Lippen deckt die Frau ihren Sohn zu. Sie zieht ihm die Wolldecke bis zum Kinn hoch. Dann löscht sie mit einem angefeuchteten Finger den Docht der Öllampe. Sofort umhüllt die Finsternis Mutter und Sohn.
Dicht an den Jungen geschmiegt, will auch die Frau gerade einschlafen, da rührt sich Ahacco noch einmal.
»Ich will das Gedicht noch einmal hören«, murmelt er schläfrig.
»Welches? Das Rätsel?«
Als keine Antwort kommt, ruft sich die Mutter jenes alte Lied ins Gedächtnis, das sie von ihrer Mutter und Großmutter kennt, so wie diese es wiederum von ihren Vorfahren gelernt haben:
»Wir sind frei wie Stürme,
Wir fliegen hoch wie Winde,
Sind stark wie tausend Feuer,
Die in unsren Herzen brennen.
Wir frieren und wir fürchten nicht,
Wir sterben und wir leben nicht,
Und wenn wir dich berühren
Mit sanften, kalten Händen,
Dann schauderst du
Und weichst zurück,
Auch wenn du uns bloß spürst
Und doch nicht sehen kannst.«
Oblúvien
Er setzte sich an seinen Lieblingstisch, den einzigen, der zu dieser Zeit frei war, und bestellte das Mittagsmenü, das aus Eierkuchen, Gemüse und gebratenen Rindfleisch bestand.
Kurz nachdem er sein Getränk – einen Schoppen mit süßem Wein aus Briallenberg – bekommen hatte, näherten sich zwei junge blonde Frauen seinem Tisch. »Verzeihung«, sagte die eine zwitschernd. »Ob wir uns wohl zu Ihnen setzen dürfen?«
Ahacco rutschte bereitwillig zur Seite, damit sich die beiden einander gegenüber hinsetzen konnten. Er spürte ihre prüfenden Blicke. Sie wanderten von seinem Gesicht zu den Händen, über seine muskulösen Arme und Brust bis zu dem Punkt, wo die Tischplatte ihnen weitere Beobachtungen verwehrte.
Ahacco tat höflich so, als hätte er nichts bemerkt und verwöhnte seine von der Arbeit trockene Kehle mit einem kräftigen Schluck Wein.
Die größere der beiden Frauen warf ihr langes Haar zurück und sah ihm forschend in die Augen. »Sind Sie öfter hier? Können Sie uns etwas empfehlen?«, fragte sie, und klang dabei gar nicht so, als wäre sie wirklich am Essen interessiert.
»Gerne«, sagte Ahacco. »Bestellen Sie doch einfach das Tagesgericht. Das ist das erste auf der Speisekarte, also das ganz oben ...«
»Vielen Dank.«
Die jungen Frauen unterhielten sich eine Weile über Stoffe und Kleider, die sie in einem Dorfladen gesehen hatten, bis die Bedienung kam. Mit einem flüchtigen Blick auf Ahacco sagte die größere: »Bringen Sie uns bitte das Tagesgericht.«
Ahacco sah kurz auf. Er fand die kleinere der beiden mit ihren vielen Sommersprossen um die Nase hübscher. Allerdings war das schwer zu entscheiden, denn sie hatten alle zwei bemerkenswert schönes, langes Haar.
Nachdem die Kellnerin verschwunden war, wandte sich die Sommersprossige an ihn. »Wohnen Sie auch in Ik’Ernu? Ich glaube fast, Sie sind nicht von der Küste, oder?«, fragte sie neugierig.
»Nein, das stimmt.« Ahacco strich sich nervös das schwarze Haar aus der Stirn.
»Und wo kommen Sie her?«
»Ähm ... Um ehrlich zu sein ...«
Die Bedienung rettete ihn, indem sie seine Bestellung brachte. Ahacco nickte den beiden kurz zu und hoffte, dass sie ihn wenigstens beim Essen in Ruhe lassen würden.
Das taten sie. Kurz darauf kamen auch ihre Teller.
»Guten Appetit«, wünschte Ahacco.
»Sie haben ja gar nicht dasselbe wie wir«, bemerkte die große Blonde enttäuscht.
Ahacco unterdrückte ein Seufzen und sagte wahrheitsgemäß: »Wegen der Tomaten. Ich mag keine Tomaten.«
Die Frau nickte skeptisch, als glaubte sie ihm das mit den Tomaten nicht. »Dann guten Appetit«, wünschte sie ihm und ihrer Freundin.
Zu Ahaccos Verwunderung brachten die zwei es zustande, ihren Teller schneller zu leeren als er. Sie mussten sehr hungrig gewesen sein. Leider schienen sie anschließend erpicht darauf zu sein, das Gespräch mit ihm fortzusetzen.
»Wenn Sie nicht aus Ik’Ernu sind, woher kommen Sie dann?«, fragte die mit den Sommersprossen.
»Ich wohne hier seit drei Jahren«, antwortete Ahacco ausweichend und mit halb vollem Mund. Es kümmerte ihn nicht, was die beiden von seine Tischmanieren hielten.
»Ach so. Also, wir sind nicht von hier«, verkündete die Große, die ihm gegenüber saß.
Wen interessiert’s?, dachte Ahacco missmutig.
Nun streckte sie ihm auch noch ihre Hand entgegen. »Ich heiße Alea. Und das ist meine Schwester Meredith.«
»Ahacco«, murmelte er und schüttelte die ihm gereichten Hände. Er gab es auf, so zu tun, als würde er sich auf seine Mahlzeit konzentrieren, nur um nicht mit ihnen reden zu müssen. Vor den beiden gab es offensichtlich kein Entkommen. Also schluckte er schnell die letzten Bissen hinunter, schob seinen Teller weg und fragte: »Und Sie beide? Was machen Sie in Ik’Ernu?«
»Wir besuchen unseren Onkel. Eigentlich kommen wir aus Sar’Rubin.« Das war, wie Ahacco wusste, ein Dorf nördlich von Ik’Ernu.
»Wir bleiben nur einige Tage. Vielleicht ...«
Alea wechselte einen raschen Blick mit ihrer Schwester. Meredith – die Hübschere – schien irgendetwas zu verstehen, was Ahacco nicht verstand. Prompt fragte sie ihn: »Vielleicht haben Sie ja Lust, mit uns in den nächsten Tagen einmal einen Tee trinken zu gehen? Sie könnten uns auch ein bisschen die Gegend zeigen.«
»Da wird Ihnen jeder andere bestimmt mehr zeigen können als ich«, entgegnete er. »Ich kenne mich nicht so gut aus. Außerdem wohne ich ein Stück außerhalb des Dorfes.«
Er musterte die beiden genauer. Alea schätzte er auf über zwanzig. Meredith konnte kaum älter als achtzehn sein. Aber vielleicht sah sie mit ihren Sommersprossen und ihrer Stupsnase auch nur jünger aus, als sie tatsächlich war. Insgesamt machte sie einen aufgeweckteren Eindruck als ihre große Schwester.
»Erzählen Sie uns doch etwas über sich«, fuhr Alea fort. »Zum Beispiel wo Sie herkommen. Ihrer Haarfarbe nach sind Sie sicher aus dem Westen ...«
Ahacco nickte knapp.
»Und wo genau haben Sie da gewohnt?«
Es war dieses Wort, das sie benutzte, ›wohnen‹, das Ahacco irritierte. Hatte er jemals irgendwo wirklich gewohnt? »Das ist etwas kompliziert«, sagte er, womit er der Frage zum dritten Mal auszuweichen versuchte. »Ich war früher ziemlich viel unterwegs.«
»Und Ihr Geburtsort?«, insistierte Meredith. »Boralia? Tharet? In Tharet war ich schon mal. Da haben viele Leute schwarze Haare.«
»Nein. Ich ... ich wurde sozusagen unterwegs geboren, während meine Eltern umgezogen sind«, antwortete er vage. Das entsprach sogar fast der Wahrheit: Die Schaustellertruppe war schließlich immer von einem Ort zum nächsten gezogen.
»Und wo haben Sie bisher gelebt?«, bohrte Alea weiter.
»In Oblúvien«, sagte Ahacco, einer plötzlichen Eingebung folgend. Dann erhob er sich schnell. »Bitte entschuldigen Sie mich. Ich habe noch eine Verabredung.«
»Oh«, sagten beide Schwestern wie aus einem Mund. Alea machte Anstalten, ebenfalls aufzustehen. Doch Ahaccos abweisender Blick ließ sie sich sofort wieder hinsetzen.
Er lächelte Meredith kurz zu, denn sie war eindeutig die Erträglichere von beiden. Dann ging er zum Tresen, um sein Essen zu bezahlen.
»Man sieht sich«, zwitscherte Alea, als er wieder an ihrem Tisch vorbeikam.
Ahacco flüchtete zur Tür hinaus.
Draußen auf der Straße traf ihn die Hitze wie ein Schlag, und er war froh, dass er nicht mit Tongos Bande zum Jagen gegangen war.
Oblúvien, dachte er lächelnd. Er hoffte inständig, dass er die aufdringliche Blondine damit vor den Kopf gestoßen hatte. War es nicht eine gute Idee von ihm gewesen, die weiße Ruinenstadt zu nennen? Oblúvien, die Stadt des Vergessens: Keiner wusste genau, wo sie sich befand. Es gab das Gerücht, sie läge mitten im Wald, wo sie niemand finden konnte. Einst sollte sie der Schauplatz eines grausigen Gemetzels gewesen sein, und es hieß, die Toten wanderten immer noch zwischen den alten Steinen umher. ›Der Hort der bösen Dämonen‹, so nannten einige die geheimnisvolle Ruinenstadt. Daher machte für gewöhnlich auch niemand Scherze über Oblúvien.
Vielleicht kam diese Stadt dem Ort, an dem er tatsächlich gelebt hatte, bevor er nach Ik’Ernu gekommen war, sogar am nächsten. Denn auch Grauengrund, die Dornenwüste, war eine öde und verlassene Gegend, wie es sie auf ganz Ormand sicher kein zweites Mal gab.
Diese Dornenwüste war Ahaccos selbst gewähltes ›Exil‹ gewesen. Während der vielen Nächte auf dem kalten, harten Boden hatte er beinahe vergessen, wer er war; und während der einsamen Tage, mit Wurzeln und fleischigen Blättern als einzige Mahlzeit, hatte er sich irgendwann auch nicht mehr daran erinnern können, wie es gewesen war, glücklich zu sein – im Gegenteil: Manchmal, wenn der Wind nachts um seine Ohren gepfiffen hatte, war es ihm so vorgekommen, als würde er von bösen Geistern verfolgt und gequält.
Und nun? Wo stand er heute?, fragte er sich. War es ihm in Ik’-Ernu gelungen, die Geister der Vergangenheit zu vergessen? Wusste er, nachdem er schon drei Jahre lang hier wohnte, endlich was er wollte? Und hatte er gelernt, wieder zu glücklich zu sein?
So viele Fragen, dachte er bei sich, und ich habe nur so wenige Antworten.
Von einer plötzlichen Erschöpfung ergriffen, setzte er sich in den Schatten einer Hauswand und schloss die Augen.
~ Das Atelier des Meisters ~
Wieder einmal legt sich der Abend über das Lager der Schauspielertruppe. Vor wenigen Tagen ist der Winter hereingebrochen, und es ist das Ende eines grauen und ungemütlichen Tages. Der Wind hat gewechselt und wird im nächsten Windmond von Norden her wehen. Er bringt eisige Luft nach Ormand, und die Nächte sind schon jetzt so kalt wie ein Tag in den Nordländern Aerdenwelts.
Damit die Menschen in ihren Wagen nicht erfrieren, müssen einige von ihnen hinauf in die Stadt gehen. Mit dem Geld, das sie in den letzten Tagen verdient haben, sollten sie sich nicht nur Feuerholz und Lebensmittel, sondern auch ein paar warme Decken leisten können.
Ahaccos Mutter schickt ihren Sohn. Der Junge ist zwar erst sieben, doch er soll lernen, für andere mitanzupacken, zum Beispiel indem er beim Tragen hilft. Außerdem hat er den Auftrag, sich selbst und seinen Eltern ein oder sogar zwei Decken zu sichern.
Im Licht des Vollmonds laufen schließlich vier Männer und drei Kinder durch die dunkle Stadt. Sie suchen einen Laden, der noch geöffnet hat. Ihre langen, hellblauen Umhänge, Kennzeichen der Nomaden Ormands, bauschen sich im Wind wie Schiffssegel und erwecken den Anschein, als glitten ihre Besitzer durch die Straßen.
Hinter den Männern springen die Kinder einher, spielend und tobend wie junge Hunde. Sie bewegen sich weder so fließend und gewandt wie die Erwachsenen noch halten sie es für notwendig, sich wie diese in Schweigen zu hüllen.
»Ich hatte dich schon, Moris!«, ruft der eine so laut, dass seine Stimme noch drei Gassen weiter zu hören ist.
»Das war aber nur meinen Mantel. Das gilt nicht!«, entgegnet der andere. Er weicht dem Fänger erneut aus und stolpert dabei über einen Blechnapf, den jemand an eine Hauswand gelehnt hat.
Das Scheppern hallt die Straße hinauf. Die Männer zucken zusammen und drehen sich um. »Seid ihr verrückt?«, zischen sie den Kindern zu. »Ihr weckt noch die ganze Stadt auf. Dann jagen sie uns wieder fort!«
Schuldbewusst meidet Moris ihre zornigen Blicke. Aber kaum haben sich die Männer abgewandt, tollen er und die anderen aufs Neue herum, nur diesmal mit weniger Geschrei.
Schließlich bleiben die Erwachsenen vor einem beleuchteten Geschäft stehen. Im Schaufenster hängt ein Schild mit der Aufschrift »Stoffe, Decken, Mäntel. Für jede Tages- und Jahreszeit«.
»Wartet draußen. Aber verhaltet euch gefälligst ruhig!«, ermahnt einer der Männer die Jungen barsch. Dann verschwinden die vier Erwachsenen im Laden.
»Wir kriegen dich, Ahacco!«, ruft Moris, sobald die Tür zugefallen ist. Er und der andere versuchen, den kleinsten von ihnen zu erwischen. Doch flink wie ein Wiesel entkommt dieser ihnen immer wieder. Die Fänger stürzen sich lachend von zwei Seiten auf ihn. Haken schlagend weicht Ahacco aus und flüchtet sich in eine Seitengasse.
Er ist so von dem Spiel mitgerissen, dass er immer schneller wird und weiter läuft, während die anderen längst die Lust verloren haben, ihn zu verfolgen. Er merkt gar nicht, wie seine Fänger zurückbleiben, und lässt immer mehr Häuser und Straßen hinter sich. Es ist, als würde ihn etwas anziehen, dem er nicht widerstehen kann.
Ehe er sich versieht, kann Ahacco nur noch raten, aus welcher Richtung er gekommen ist. An diesem Punkt bleibt er endlich stehen. Sein schneller, heißer Atem bildet Wölkchen in der Kälte. Der Junge schaut sich um, wendet den Blick nach links und rechts. Er befindet sich in einer menschenleeren Straße, in einem der dunkleren Viertel der Stadt. Vor der Finsternis selbst hat er zwar keine Angst, wohl aber vor den Geschöpfen der Nacht, die hier auf ihn lauern könnten.
Zwei fette Ratten huschen kaum eine Schrittlänge vor ihm über das Pflaster. Schaudernd stolpert Ahacco rückwärts, bis er die nasse, kalte Wand eines Hauses im Rücken spürt.
Plötzlich fühlt er sich allein gelassen. Was hat ihn nur getrieben, so weit fortzulaufen?
Mit klopfendem Herzen biegt Ahacco um eine Ecke. Doch auch hier kommt ihm kein Gebäude bekannt vor.
Nun ist es sicher: Er hat sich verlaufen. Bei allen Dämonen des Unteren Reiches!, denkt Ahacco, halb verärgert, halb verängstigt. Er legt den Kopf in den Nacken und sieht über sich den Mond stehen. Die große, runde Scheibe strahlt hell und fahl. Aber nicht sie ist es, die seinen Blick an sich fesselt: Der Mond ist nicht allein. Heute Nacht hat er einen Gefährten.
Der Xarion, schießt es Ahacco durch den Kopf, der rote Stern! Auf einmal hat er das Gefühl, als ob eine eiserne Faust sein Herz umklammert. Denn der Xarion steht an diesem Abend auf der linken Seite des fahlen Mondes. Er erinnert sich daran, was das bedeutet: Tod!
Ahacco beginnt zu rennen. Die Fenster, an denen er vorbeikommt, sind schwarz und die Häuser verwaist. Das ganze Viertel scheint verlassen zu sein.
Wo ist bloß dieser Laden? Von Panik ergriffen, schlittert Ahacco um eine Ecke und gerät prompt in eine Sackgasse, in der sich der Unrat auf dem Boden häuft.
Ist da vorne nicht ein Licht? Nur ein paar Schritte weiter fallen tatsächlich Lichtstrahlen durch ein Fenster auf die Straße. Es ist ein sehr altes, halb verfallenes Haus, bei dem sich der Schimmel schon durch die Fensterrahmen frisst. Doch immerhin ist es beleuchtet – ein Zeichen für Leben.
Er stützt seine Unterarme auf das Fensterbrett und späht durch die dreckige Scheibe. Der Schmutz lässt ihn zwar nicht viel erkennen, dafür bemerkt Ahacco, dass das Fenster nur angelehnt ist. Die rostigen Angeln quietschen verräterisch, als er es aufstößt. Rasch schlüpft er hinein.
Er findet sich in einer Werkstatt wieder, die von ein paar Öllampen erhellt wird. Zu seiner Verwunderung stehen in den Ecken und Winkeln des Raumes große Statuen, Abbilder von Königen, Helden und Göttern, darunter viele, die Ahacco aus Büchern kennt. Ein riesiger Holztisch nimmt den größten Teil des Zimmers ein. Auf ihm liegen die seltsamsten Dinge, die der Junge je gesehen hat. Die merkwürdige Sammlung reicht von bunten Glasaugen und nackten Männer- und Frauenfiguren bis hin zu vollständigen menschlichen Gebissen. Wahllos im ganzen Raum verteilt stehen außerdem Schaukästen aus dunklem Holz, und an der gegenüberliegenden Wand lehnt ein komisches Gebilde aus Glasstäben, die bunte Kristallkugeln auf ihren Spitzen tragen.
Vielleicht ist das so etwas wie ein Musikinstrument? Handelt es sich hier gar um das Atelier eines Künstlers, der in der Einsamkeit Inspiration sucht?
Inmitten dieser eigenartigen Sammlung fühlt sich Ahacco wie ein Fremdkörper. Beklommen geht er den langen Tisch entlang, von dem kaum ein freies Stück Holz zu sehen ist, so über und über mit Werkzeugen bedeckt ist er. In der Mitte zwischen all den Geräten liegen, ihre Deckel wie in einer Ausstellung geöffnet, Dutzende kleiner, mit Samt ausgeschlagener Kästchen, die, wie Ahacco staunend erkennt, voller kostbarer Schmuckstücke sind: Ringe, Armbänder und Ketten. In einer Nische des Raumes entdeckt er sogar eine Feuerstelle mit Schmiedeutensilien.
Neugierig will er sich die vertrauten Geräte näher anzuschauen, da stößt er mit dem Fuß versehentlich gegen einen der Schaukästen. Ahacco kann ihn gerade noch festhalten, bevor er umkippt. Dabei schaut er hinein und erblickt hinter dem Glas mit Staunen noch mehr Reichtümer: Die Glaskästen in diesem Raum enthalten Sammlungen von Edelsteinen, Muscheln und Perlen, von Elfenbein-, Silber- oder Goldfigürchen.
Ahacco ist besonders von den Edelsteinen fasziniert. Sie sind in allen Farben des Regenbogens vertreten, grün, gelb, blau, rot, orange. Das Licht der Öllampen fängt sich in ihrem milchigen Innern und lässt sie geheimnisvoll schimmern. Einzelne Steine sind fast so groß wie Ahaccos Faust und sicher wertvoller als Gold.
In der Vitrine, die er gerade noch vor dem Stürzen bewahrt hat, liegt nur ein einziger Edelstein: ein gigantischer Rubin, der das spärliche Licht blutrot widerspiegelt. Ahacco schaudert, denn für einen Moment erinnert ihn der rote Schein an den Xarion draußen am Himmel.
Blödsinn, denkt er im nächsten Augenblick. Das ist doch nur Aberglaube! Es gibt keine Todeszeichen.
Dann entdeckt er etwas, das seine Neugierde noch mehr erregt als die Schmiedestelle: eine Vitrine aus dunklem Ebenholz, die sich in den Schatten einer Wandnische drückt, als wolle sie nicht gesehen werden.
Vorsichtig, um sich nicht noch einmal zu stoßen, nähert sich Ahacco dem Schaukasten. Er muss sich auf die Zehenspitzen stellen, um einen Blick hinein werfen zu können. Darin liegt, auf ein Stück blauen Stoff gebettet, eine einzelne Halskette. Sie wirkt antik und ist seltsamerweise nicht poliert. Insgesamt macht sie einen recht unscheinbaren Eindruck.
Die Schaustellertruppe ist im vergangenen Jahr vereinzelt auch in den Häusern reicher Gutsbesitzer aufgetreten, in denen die Damen ähnliche Colliers getragen haben. Allerdings sieht die Kette in der Vitrine anders aus als alle, die er bisher zu Gesicht bekommen hat. Diese hier besteht aus drei Strängen Weißgold, die umeinander gewunden sind und sich am Verschluss zu einer Spirale schlängeln. Zwischen den Strängen sitzen, dicht aneinander gereiht, viele kleine, blaue Steine. Obwohl das Gold nur matt glänzt, weil sich über die Jahre eine Staubschicht auf ihm abgesetzt hat, scheinen die Steine von der Zeit vollkommen unberührt zu sein. Sie sind so klar wie die sanften Wellen des Narshear-Ozeans und leuchten so mystisch wie der Abendhimmel an manchen Sommertagen.
Ahacco empfindet tiefe Bewunderung für den Künstler, der diese Kette angefertigt hat. Ein Sammler und Kunstliebhaber würde dafür bestimmt viel Geld bezahlen, so viel, dass man damit den gesamten Wagenzug ein Jahr lang versorgen könnte.
Er senkt den Blick und schüttelt den Kopf. Damit schüttelt er zugleich den Gedanken ab, der ihn gerade beschlichen hat.
Eben will er sich von der Vitrine entfernen, da entdeckt er ein kleines Schild unterhalb der Glasscheibe. Es sieht ebenso alt aus wie die Kette, und Ahacco kann die altmodischen Schriftzeichen nur mit Mühe entziffern: ›Kette von Tál A’Durh‹. Was hat das zu bedeuten? Ahacco mustert das Schmuckstück noch einmal.
»Ein hässliches altes Ding, nicht wahr?«, ertönt plötzlich eine Stimme hinter ihm.
Zu Tode erschrocken fährt der Junge herum. Hinter dem Arbeitstisch ist lautlos ein Mann aufgetaucht. Er steht über etwas gebeugt, das wie ein menschlicher Knochen aussieht, und scheint völlig in dessen Anblick vertieft zu sein.
Der Fremde schaut nicht einmal auf, als Ahacco hastig nach einer Erklärung sucht. »Ich ... es tut mir leid, Herr ... dass ich hier eingebrochen bin! Aber da war das Licht, und das Fenster stand offen, da habe ich gedacht ...«, stammelt er.
»Ein Licht und ein offenes Fenster sind keine Einladung, hier einzubrechen, mein Junge«, sagt der Mann.
»Ich weiß, Herr, aber es war so dunkel draußen. Und der Stern ...«
Ahacco verstummt. Was soll er sagen? Dass er durch das nächstbeste Fenster gestiegen ist, weil er sich vor einem roten Stern gefürchtet hat?
»Keine Sorge. Du hast dich nur verlaufen. Das ist in diesem Teil der Stadt keine Seltenheit.«
Der Mann nimmt seelenruhig eine Feile und glättet eine Kerbe im Knochen. Dann sagt er, noch immer ohne aufzusehen: »Du kannst gerne noch ein bisschen hierbleiben. Ich habe nichts dagegen, wenn du dich eine Weile aufwärmst. Mein Lieber, es ist so kalt da draußen, als hätten die Nordwindgeister persönlich ihren Atem über das Land gehaucht!«
Unsicher beobachtet Ahacco den Mann. Er hat die ganze Zeit über keinerlei Vorwurf oder Ärger aus dessen Stimme herausgehört, und das verwundert ihn.
Der Fremde beginnt nun, den Knochen mit einer hauchzarten Goldschicht zu versehen. Seine Handgriffe sind ruhig und flink, als würde er jeden Tag Gebeine vergolden. Sein Haar, das von einem breiten Stirnband gebändigt wird, weckt Ahaccos Aufmerksamkeit. Es ist nicht einfach schwarz wie sein eigenes sondern von dicken goldenen Strähnen durchzogen. Die Kleidung des Mannes dagegen wirkt völlig unauffällig. Er trägt ein schlichtes, helles Gewand aus grobem Stoff, unter dem alte braune Stiefel hervorschauen.
»Wer seid Ihr?«, traut sich Ahacco nach einer Weile zu fragen.
»Nenn mich einfach ›Meister‹.«
»Habt ... habt Ihr keinen Namen, Meister?«
»Sicher. Aber was sind schon Namen, mein Junge? Nichts als eine menschliche Bequemlichkeit, nicht wahr?«
Ahacco versteht nicht, was der Mann damit meint. Aber er traut sich auch nicht nachzufragen, denn wahrscheinlich würde er darauf eine nur noch verwirrendere Antwort bekommen. Stattdessen sagt er: »Ich finde diese Kette sehr schön. Habt Ihr sie geschmiedet, Meister?«
»Oh nein«, entgegnet der Mann sanft. »Ich sammle nur alte Dinge. Und manchmal repariere ich auch das, was die Leute mir bringen.«
Warum sieht er mich nie an?, fragt sich Ahacco. Denn der Fremde konzentriert sich nach wie vor allein auf seine Arbeit.
»Lass dich von mir nicht stören«, murmelt der Mann. »Du darfst dir ruhig alles ansehen. Nur die Halskette da neben dir, der solltest du lieber nicht zu nahe kommen. Wer weiß, wer sie über die Jahre hinweg schon alles in der Hand hatte.«
»In Ordnung«, entgegnet Ahacco verlegen. Er späht noch einmal verstohlen hinüber zu besagter Kette. Dann mustert er wieder den Meister, der immer noch ganz in die Arbeit an seinem Knochen vertieft ist. Trotz seiner einfachen Kleidung macht dieser Mann einen gelehrten Eindruck. Aber wie kommt es, dass er in einem so verfallen Haus lebt und sich offenbar keine besseren Gewänder leisten kann?
Wenn Ahacco ihm nur in die Augen sehen könnte! ›Aus den Augen der Menschen erfährst du oft mehr als aus ihren Worten‹, sagt seine Mutter immer.
Abermals dreht sich der Junge zu der Kette um. Irgendetwas zwingt ihn dazu, zu der Vitrine zu gehen und vorsichtig den gläsernen Deckel anzuheben.
Der Meister scheint ihn auch weiterhin nicht zu bemerken. Er hat dem Jungen den Rücken zugewandt und inspiziert nun einen Glasbehälter mit eingelegten Augäpfeln.
Ahacco nimmt mit einem raschen Griff die Halskette aus ihrem Stoffbett und lässt sie in seiner Tasche verschwinden. Das Diebesgut wiegt schwer darin, während er auf leisen Sohlen die Werkstatt durchquert und auf die Tür zusteuert.
»Ähm ... Meister?«, sagt er, als seine Hand schon auf der Türklinke liegt. Der Alte muss ihn doch wenigstens einmal ansehen!
»Ja?« Der Mann stützt seine Hände auf die Tischplatte, den Blick weiterhin starr auf die Augäpfel gerichtet.
»Danke, dass Ihr mir erlaubt habt, eine Weile hier zu bleiben. Ich ... ich glaube, ich mache mich jetzt besser auf den Heimweg.«
»Ja. Geh schon, bevor deine Familie sich Sorgen macht.«
Hat er denn gar nichts bemerkt? Ahacco öffnet mit schweißnassen Händen die Tür. Sie knarrt so laut, als wolle sie den kleinen Dieb verraten.
»Auf Wiedersehen, Meister.«
»Leb wohl, mein Junge«, sagt der Mann leise. »Und pass gut auf dich auf. Es ist sehr finster heute Nacht.« Beim seinen letzten Worten sieht er endlich auf und schaut Ahacco, der die Schwelle bereits überschritten hat, direkt in die Augen.
Der Junge schnappt unwillkürlich nach Luft. Die Augen des seltsamen Fremden sind so schwarz wie die Nacht! Doch zugleich sind sie von einem unheimlichen Glänzen erfüllt. Denn ähnlich wie die Strähnen in seinem Haar leuchten goldene Sprenkel in seiner dunklen Iris.
Diese Augen scheinen Ahacco regelrecht zu durchbohren. Als könnte der Meister in meiner Seele lesen, denkt er.
Wie von einem plötzlichen Windstoß erfasst, fällt krachend die Tür ins Schloss. Er findet sich allein auf der dunklen Straße wieder.
Oben am Himmel sind der Mond und der Xarion von einigen Wolken verschluckt worden. Nur einzelne weiße Sterne sind noch zu sehen. Beim Anblick des Nachthimmels muss Ahacco sofort wieder an die unheimlichen Augen des Meisters denken. Das Licht der Sterne schafft es, weder die Finsternis auf der Straße noch die Angst des Jungen zu vertreiben.
Ahacco schüttelt sich. Jetzt bläst auch noch der scharfe Nordwind die dunklen Gassen hinab und jagt ihm einen kalten Schauer über den Rücken.
Er wendet sich nach Westen. Im Westen der Stadt liegt das Lager, so viel weiß er noch. Wenn er immer geradeaus läuft, wird er die Häuser schon irgendwann hinter sich lassen.
Seine Finger fest um die Halskette in seiner Tasche geklammert, macht er sich auf den Weg.
Genau in diesem Moment bricht der Sturm los. Die eisigen Böen fahren ihm rau wie schwielige Hände über das Gesicht und reißen an seiner Jacke.
Wenigstens bleibt der Xarion den ganzen Heimweg über hinter den Wolken versteckt, denkt Ahacco.
Nacht der Geschichten
Am Abend machte sich Ahacco auf den Weg zum nordwestlichen Rand von Ik’Ernu. Er freute sich über Tongos Einladung, und bei dem Gedanken an gebratenen Fasan lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Natürlich ging es ihm mit diesem Besuch nicht nur um das Essen. Er verspürte auch ein gewisses Verantwortungsgefühl den Jugendlichen gegenüber und wollte ihnen helfen, wenn sie ihn denn ließen.
Außerdem hatte ihn das Gespräch mit den zwei Blondinen heute Mittag auf eine Frage gebracht: Was war eigentlich Tongos Geschichte? Wo kam er her, und was war ihm zugestoßen, dass er heute auf der Straße lebte? Ahacco wusste nur, dass er und Kada beide keine Familie in Ik’Ernu hatten. Aber das war auch schon alles.
Auf dem sandigen Hof saßen sieben Jugendliche vor einem Lagerfeuer. Kada schürte die Flammen, während Tongo und die anderen Jungen ein halbes Dutzend gerupfte Fasanen auf Holzspieße steckten. Ihre Jagd war also erfolgreich gewesen.
Die drei blonden Brüder – Dahi, Trigo und Marik – war auch da. Beim Näherkommen sah Ahacco, dass neben ihnen zwei weitere Jungen saßen, die ebenfalls wie Geschwister aussahen. An den Namen des größeren erinnerte er sich: Er hieß Jared. Aber dessen kleinen Bruder kannte er noch nicht. Vielleicht war er neu in Tongos Bande.
»’n Abend, Ahacco«, rief Tongo und winkte.
Der Platz, an dem sie ihr Feuer entfacht hatte, befand sich hinter dem Schlachthof von Ik’Ernu. Wie Ahacco gehört hatte, waren hier früher die Tiere angebunden worden. Heute benutzte den Hof niemand mehr. Der Dorfvorsteher machte sich auch nicht die Mühe, dem Platz eine neue Funktion zuzuweisen – zum Glück! Denn zusammen mit den Blechhütten, die sie zum Schutz vor Regen und Kälte errichtet hatten, bot er Tongo und den anderen seit Jahren einen sicheren Unterschlupf.
Ahacco ließ sich neben Tongo nieder. Sie saßen im Kreis um das Feuer herum, sodass er allen ins Gesicht schauen konnte.
Er musterte den ältesten der Jungen, Jared. Soweit Ahacco wusste, hatte er einen Vater, der sich nicht um ihn kümmerte und seine Freizeit lieber mit einer Flasche Wein als mit seinem Sohn verbrachte. Deshalb trieb sich der Junge zumeist mit den Straßenkindern herum. Ahacco fand, dass er sehr erwachsen aussah, was vielleicht daran lag, dass er meistens sehr ernst war. In seinen Augen stand ein ehrgeiziges Funkeln, das nicht unangenehm wirkte. Aber seine spitze Nase und dünnen Lippen verliehen seinem Gesicht einen leicht hinterlistigen Ausdruck.
Jared bemerkte seinen Blick. »Was ist?«, fragte er argwöhnisch.
»Gar nichts, entschuldige«, erwiderte Ahacco. »Kannst du mir vielleicht einen der Spieße reichen?«
»Hunger?«, grinste Tongo, während er eine Portion von Jared entgegennahm und an Ahacco weiterreichte. »Wir haben ziemlich viele Fasanen erwischt. Kada allein hat fast die Hälfte gefangen.« Ein stolzes Lächeln stahl sich auf Tongos Gesicht.
»Mit was habt ihr gejagt?«, wollte Ahacco wissen.
»Teils mit dem Messer, teils mit Jareds Steinschleuder.«
»Habe ich noch nie ausprobiert«, bemerkte Ahacco.
Tongo grinste wieder. »Alles besser als Pfeil und Bogen. Manchmal bleiben die Spitzen stecken und man beißt sich daran einen Zahn aus.«
Ahacco lachte. »Ist dir das schon mal passiert?«
»Ja, ist aber schon ein paar Jahre her. Ich war gerade erst fünf oder sechs Tage in Ik’Ernu und hatte noch nicht viel Erfahrung mit dem Jagen«, erzählte Tongo. »Deshalb habe ich mir ein paar Pfeile zusammengebastelt – keine sehr guten natürlich. Meine erste Beute war ein Hase, und ... naja. Es hat ziemlich wehgetan, als der Zahn abbrach.«
Er sperrte seinen Mund weit auf, um Ahacco die Lücke zu zeigen. »Seitdem jage ich nur noch mit dem Messer. Aber so eine Steinschleuder ist auch nicht schlecht.« Er zwinkerte Jared zu.
Der zuckte die Achseln und starrte ungerührt ins Feuer.
Ahacco prüfte mit dem Finger das Fleisch. Dann sagte er: »Ich habe eigentlich nie richtig Freude am Jagen gehabt. Es ist einfach keine saubere Arbeit. Wenn man bedenkt, wie sich das Tier fühlen muss, kurz bevor es stirbt ...«
Tongo stierte ihn verständnislos an. »Jetzt mach aber mal einen Punkt, Ahacco! Wovon sollen Kada und ich denn leben, wenn nicht vom Jagen? Die Dorfwirtschaft können wir uns nicht leisten. Ich habe meistens kaum genug Geld, um uns morgens ein Stück Brot zu kaufen! Ich weiß nicht einmal, wie sich das anfühlt, viel Geld in der Tasche zu haben.«
»Du könntest dir eine Arbeit suchen. Das musste ich auch, als ich hierher zog«, hielt Ahacco dagegen.
»Als ob die Leute einen wie mich einstellen würden! Nein, dazu habe ich einen viel zu schlechten Ruf im Dorf. Glaubst du, ich wüsste nicht, was die über Kada und mich sagen? Dass ich nicht mitbekommen hätte, wie die Mütter ihre Kinder vor uns verstecken? Allein die Blicke, die sie uns zuwerfen ... Diese Leute haben keine Ahnung, und trotzdem bilden sie sich ihre Meinung. Für die sind wir etwas Minderwertiges. Sie verachten uns.«
Ahacco verstand Tongo nur allzu gut. »Die haben Angst vor euch. Das steckt hinter ihrer Herablassung«, sagte er. »Wenn die Leute euch besser kennen würden, dann würden sie vielleicht auch anders reagieren.«
Tongo schnaubte verächtlich. »Das glaubst auch nur du. Wir gehören für die einfach nicht dazu. Wir sind anders als die.«
»Und wenn schon«, winkte Ahacco ab. »Ich habe gelernt, stolz darauf zu sein, dass ich nicht so bin wie die meisten anderen.«
»Du?«, fragte Kada zweifelnd und beugte sich vor. »Du weißt doch gar nicht, wie das ist, verachtet zu werden!«
Ahacco musste lächeln. »Doch, Kada. Das weiß ich leider ganz genau.«
»Aber die Männer im Dorf haben Respekt vor dir, und manche Frauen bewundern dich sogar!«, wandte sie ein.
»Meinst du? Nun, das glaube ich nicht. Zumindest habe ich das nie so wahrgenommen.« Ahacco sah in die Flammen. »Die machen sich doch auch nur ein Bild von mir und wissen gar nicht, wie ich wirklich bin.«
Kada drehte ihren Spieß um, damit das Fleisch gleichmäßig braun wurde. Dann fragte sie neugierig: »Und wie bist du wirklich?«
»Eine gute Frage«, stimmte Tongo ein. »Was soll das denn sein, das die nicht wissen? So was wie ein dunkles Geheimnis?«
Um nicht antworten zu müssen, nahm Ahacco vorsichtig einen Bissen von seinem Spieß und verbrannte sich trotzdem prompt den Mund. Das Fleisch war eindeutig zu heiß und auch noch nicht ganz durchgebraten.
»Jeder hat seine Geheimnisse«, sagte er ausweichend.
Verschwörerisch stieß Tongo ihn in die Seite. »Na komm schon, jetzt hast du uns neugierig gemacht!«
»Ja, was ist dein Geheimnis?«, wollte Kada wissen.
Aber Ahacco schüttelte den Kopf. Er würde den beiden gerne alles erzählen. Das Problem war nur, dass die anderen zuhörten. Er fand es zu riskant, wenn so viele Leute, die er kaum kannte, wüssten, dass er ... Nein. Es war besser, wenn er nichts sagte.
»Wir erzählen auch nichts weiter«, versicherte ihm Trigo.
»Ich rede nicht gerne über meine Vergangenheit«, erklärte Ahacco. »Aber ein Geheimnis kann ich euch verraten: Als ich noch ein Kind war, habe ich einmal etwas Ungesetzliches getan.«
»Du? Etwas Ungesetzliches?«, rief Kada lachend.
»Das will ich hören«, sagte Tongo.
Ahacco wusste nicht, ob ihre Bemerkungen ernst gemeint waren. Er hatte der Bande zwei-, dreimal dabei geholfen, einem Bauern in der Nähe ein Huhn zu stehlen. Damit zog vor allem Kada ihn immer gerne auf.
»Ich habe etwas Wertvolles gestohlen«, gab Ahacco zu. »Ich weiß nicht mehr genau, warum. Irgendetwas muss mich damals geritten haben.«
»Ja, das Gefühl kennen wir«, warf Tongo grinsend ein.
Die anderen lachten.
Nur Ahacco blieb ernst. Er wartete, bis das Gelächter verstummte, dann fuhr er fort: »Es war in einer Werkstatt. Ich hatte mich verlaufen. Der Mann, der dort wohnte, war sehr nett zu mir. Aber in seiner Werkstatt lagen viele kostbare Dinge herum ...«
»Und da hat es dich gepackt, stimmt’s?«, kicherte Kada.
»Nein, eigentlich nicht. Ich war nur von einer ganz bestimmten Halskette fasziniert, von nichts sonst. Es gab dort viele Schmuckstücke, die schöner waren als sie. Aber diese Kette hatte irgendetwas Besonderes an sich. Also habe ich sie mitgenommen.«
Ahacco sah in die Runde. Die Jungen schienen nicht allzu beeindruckt zu sein. Kein Wunder, hatten sie doch alle schon irgendwo irgendetwas mitgehen lassen. Sein Diebstahl war nicht einmal spektakulär gewesen. Schließlich hätte er noch weitaus kostbarere Dinge entwenden können.
»Und das sollen wir dir jetzt glauben?«, fragte Jared.
Ahacco sah ihn überrascht an. Bis jetzt hatte der Junge eisern geschwiegen. Er sprach auch sonst nicht sehr viel.
»Ich meine, wo ist der Beweis? Wo ist diese Halskette?«, wollte er wissen. Sein Tonfall war skeptisch.
»Ich habe sie gut versteckt. Ihr könnt ja mal bei mir vorbeikommen und sie euch ansehen, wenn ihr wollt«, gab Ahacco zur Antwort.
Tongo war sofort einverstanden. »Das machen wir. Ist es in Ordnung, wenn wir morgen Vormittag kommen?«
»Ja. Wenn ich nicht da bin, findet ihr mich bei Berno.«
Endlich war das Fleisch durchgebraten. Nachdem die Stücke ein wenig abgekühlt und gut gesalzen waren, schmeckte der Fasan erstaunlich gut, fand Ahacco.
Aber er musste trotzdem daran denken, dass diese Vögel, die sie gerade verspeisten, vor kurzem noch in der Erde gescharrt und nach Samen gepickt hatten. Ahacco fand es einfach nicht richtig, dass man Tiere tötete, ohne ihnen zumindest ein wenig Respekt entgegenzubringen.
Tongo war dieser Gedanke – aus verständlichen Gründen – fremd. ›Wenn ich Hunger habe, muss ich essen‹, war sein Argument gewesen, als sie zuletzt darüber gesprochen hatten. Ahacco wollte nicht schon wieder anfangen, mit ihm zu streiten.
Als alles aufgegessen war, fiel ihm wieder ein, dass er seinen jugendlichen Freund nach dessen Herkunft fragen wollte. »Du hast vorhin erwähnt, dass du noch nicht so lange hier bist«, wandte er sich an Tongo. »Aus welcher Ecke Ormands kommst du eigentlich?«
Tongo antwortete nicht sofort. Er schien sich über Ahaccos Interesse zu wundern.
Schließlich wischte er sich mit dem Handrücken das Fasanenfett vom Mund und erklärte: »Ich komme gar nicht aus Ormand, sondern von einer Inselgruppe südöstlich von hier: den ›Drei Grauen‹. Meine Eltern haben auf Eldri-Avo gelebt, bis ich zwölf war.«
»Von den Inseln habe ich schon gehört«, sagte Ahacco. »Die sollen unglaublich schön sein. Angeblich kann man dort nachts am Strand das Heulen der Meernixen hören.«
Tongo lachte. »Das ist ein Märchen! Das ist nur der Wind, der durch die Klippen fegt.«
»Und wie bist du nach Ik’Ernu gekommen?«
»Meine Eltern haben immer davon geträumt, auf Reisen zu gehen«, erklärte Tongo. »Doch als es so weit war, ist meine Mutter gestorben. Wir waren auf einem Schiff, das eigentlich an der Küste entlang Richtung Westen segeln sollte. Aber wir sind in einen Sturm geraten, und das Schiff ist gekentert. Meine Mutter hatte nie schwimmen gelernt.«
Kada sah Tongo mitfühlend an. »Das tut mir leid«, sagte sie und legte ihre Hand auf die seine.
»Ich habe gelernt, damit klarzukommen.«
»Und wie hast du den Schiffbruch überlebt?«, fragte Ahacco
»Ich war ein guter Schwimmer, der beste von Eldri-Avo. Außerdem waren wir nur zwei Meilen von der Küste Ormands entfernt, sonst wäre ich vermutlich auch ertrunken.«
»Und dein Vater?«, fragte der kleine Junge neben Jared.
Tongo seufzte. »Ich weiß bis heute nicht, ob er noch lebt. Aber eigentlich mache ich mir wegen ihm keine Sorgen, Nilo. Er konnte ebenfalls gut schwimmen.«
Nilo sah betreten zu Boden. Auch die anderen schwiegen.
Es war Tongo, der schließlich sagte: »Ich träume oft davon, eines Tages nach Eldri-Avo zurückzukehren.« Ein Lächeln erhellte seine Gesichtszüge, und seine Augen begannen wieder wie gewohnt zu blitzen. »Wisst ihr, Avo ist wirklich eine Trauminsel: weiße Strände, hohe Palmen, in deren Schatten sich die prächtigsten Vögel niederlassen, und dann die Sonnenuntergänge! Man sieht, wie die Sonne hinter der Nase des Festlands verschwindet, als würde sie einfach ins Nichts abtauchen. Das ist ein unbeschreiblicher Anblick.«
»Irgendwann wirst du das wiedersehen«, versicherte Kada ihm. »Vielleicht kannst du uns ja mitnehmen.«
»Natürlich kommst du mit – ihr alle!« Tongo sah begeistert in die Runde, als könnte er es kaum abwarten, dass sie aufbrachen. »Ahacco, du auch.«
Ahacco war es immer so vorgekommen, als wäre er schon überall gewesen: im Gebirge und im Wald, im Sumpf und in der Wüste. Auf eine der kleinen Nachbarinseln hatte er jedoch noch nie einen Fuß gesetzt.
»Ich würde mir Avo sehr gerne einmal ansehen«, sagte er.
»Abgemacht! Mag übrigens jemand einen Becher Wein? Frisch gekl ... äh ... gekauft.«
Ahacco bedachte Tongo mit einem vorwurfsvollen Blick, aber er musste dabei lächeln. »Was für eine Sorte?«, fragte er. Tatsächlich hatte er auf einmal richtig Lust auf einen guten Wein.
»Der beste, den es gibt«, antwortete Tongo stolz. Er stand auf und holte drei Flaschen und ein halbes Dutzend Becher aus einer der Hütten. Am Ende waren es aber nur Kada, Tongo, Ahacco und Jared, die sich von ihm einschenken ließen.
Der Wein war schwer und stark, was Ahacco heute Abend gerade recht kam.
»Am Regal im Laden stand ›Schwarzlandwein‹. Er wird nur um Eisthal herum hergestellt und nur von einigen wenigen Bauern. Der Herzog verachtet ihn angeblich und nennt ihn den ›Schwarzländer‹«, erklärte Kada. Als alle sie anstarrten, fügte sie hinzu: »Das habe ich irgendwo aufgeschnappt.«
»Beeindruckend«, sagte Ahacco und nahm einen großen Schluck. »Der Herzog weiß nicht, was ihm da entgeht!«
Etwas später verabschiedeten sich die drei blonden Brüder. Sie hatten zuhause erzählt, sie wären bei Freunden zum Essen eingeladen – was ja auch stimmte. Aber sie durften nicht zu spät zurückkommen, sonst würden ihre Eltern Verdacht schöpfen, mit wem sie sich herumtrieben.
»Verleugnet mich nur – und dass ihr mit mir befreundet seid!«, rief Tongo den Dreien im Scherz hinterher. »Aber dann bekommt ihr nächstes Mal auch keinen Fasan ab.«
Ahacco winkte mit seinem Becher.
Als kurz darauf auch Nilo aufstand, sagte Jared: »Kannst du Vater Bescheid geben, dass ich hier übernachte?«
Sein Bruder nickte. »Wahrscheinlich ist er längst eingeschlafen.«
»Bis morgen, Nilo!«, rief Kada dem Kleinen hinterher, als er sich auf den Weg nach Hause machte.
Zu viert blieben sie noch länger sitzen, tranken weiter und unterhielten sich. Auf Tongos bohrendes Nachfragen hin erzählte nun auch Kada ein wenig aus ihrer Kindheit, also aus der Zeit, bevor sie von zuhause weggelaufen und in Ik’Ernu gelandet war. Als Schülerin musste sie wohl eine begabte Nachwuchssportlerin gewesen sein. Aber was auch immer Tongo ihr entlocken konnte, blieb vage. Sie mochte es offenbar ebenfalls nicht, über ihre Vergangenheit zu sprechen.
Ahacco stellte fest, dass es ihm Spaß machte, sich mal wieder zu betrinken. Irgendwann – er wusste gar nicht, wie das passiert war – fand er sich Arm in Arm mit Kada wieder, das ›Lied vom Einsamen Elmerich‹ singend. Keiner von ihnen bekam den Text richtig zusammen, und sie verhaspelten sich ständig, was vor allem auf ihre häufigen Lachanfälle zurückzuführen war. Aber das war ihnen völlig egal. Hauptsache, sie hatten ihren Spaß. Tongo und Jared verfolgten die Vorstellung und jubelten, als die beiden die letzte Strophe des Liedes zwar schief, aber zweistimmig beendeten.
Schließlich war das Feuer heruntergebrannt. Nur noch einige kleine Flammen leckten an den Holzscheiten. Der roten Glut gelang es kaum noch, die Kühle der Nacht zu vertreiben. Tongo lag neben der Feuerstelle auf dem Boden, seinen fast leeren Becher in der Hand, und starrte in den Sternenhimmel hinauf. Er bemerkte gar nicht, dass er sich mit Wein bekleckerte. Jared dagegen saß aufrecht auf demselben Platz wie zuvor, trank und beobachtete Ahacco und Kada aus den Augenwinkeln.
Das Mädchen begann, Ahacco in die Seite zu pieken, bis er vor Lachen einen Mund voll Wein in die Glut prustete. Kleine Rauchwolken stiegen auf.





























